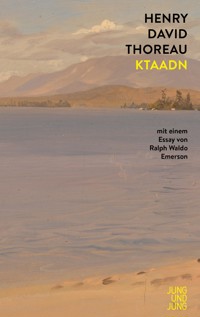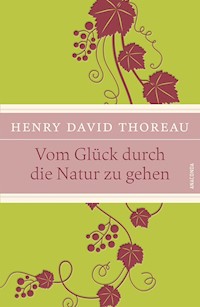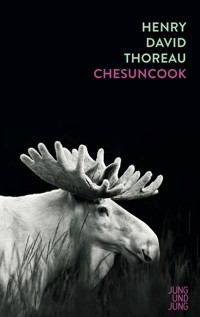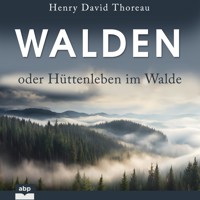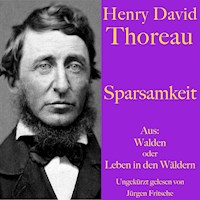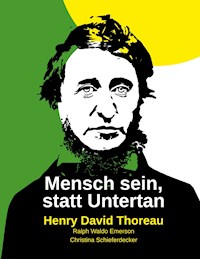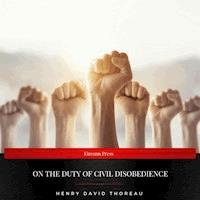0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sachbücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
In Walden beschreibt Thoreau sein Leben in einer Blockhütte, die er sich 1845 in den Wäldern von Concord (Massachusetts) am See Walden Pond auf einem Grundstück seines Freundes Ralph Waldo Emerson baute. Dort kehrte er mehr als zwei Jahre der der jungen Industriegesellschaft der USA den Rücken. Sein Ziel war es einen alternativen und ausgewogenen Lebensstil zu verwirklichen. Das 1854 veröffentlichte Werk ist kein Roman im eigentlichen Sinne, sondern eine Zusammenfassung und Überarbeitung seiner Tagebucheinträge. Die achtzehn Kapitel des Buches sind unterschiedlichen Aspekten menschlichen Daseins gewidmet und enthält Reflexionen über die Ökonomie, über die Einsamkeit, Betrachtungen über die Tiere des Waldes oder über die Lektüre klassischer literarischer Werke. Die Wirkung von Walden ist untrennbar mit der amerikanischen Geschichte verbunden. Thoreau wurde mit seinem Werk zu einem Prophet des zivilen Ungehorsams und des amerikanischen Anarchismus. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henry David Thoreau
Walden
Oder: Leben in den Wäldern
Henry David Thoreau
Walden
Oder: Leben in den Wäldern
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Jürgen Schulze, Wilhelm Nobbe EV: Eugen Diederichs, Jena, 1922 2. Auflage, ISBN 978-3-954186-28-0
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Sparsamkeit
Ergänzende Verse
Die Ansprüche der Armut
Wo ich lebte und wofür ich lebte
Lektüre
Töne
Einsamkeit
Besuch
Das Bohnenfeld
Das Dorf
Die Teiche
Baker Farm
Höhere Gesetze
Meine Nachbarn: die Tiere
Heizung
Frühere Bewohner und Besuch im Winter
Wintertiere
Der Teich im Winter
Frühling
Schluß
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Sachbücher bei Null Papier
Aufstand in der Wüste
Das Leben Jesu
Vom Kriege
Geschmacksverirrungen im Kunstgewerbe
Ansichten der Natur
Über den Umgang mit Menschen
Die Kunst Recht zu behalten
Walden
Römische Geschichte
Der Untergang des Abendlandes
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Buch
In Walden beschreibt Thoreau sein Leben in einer Blockhütte, die er sich 1845 in den Wäldern von Concord (Massachusetts) am See Walden Pond auf einem Grundstück seines Freundes Ralph Waldo Emerson baute. Dort kehrte er mehr als zwei Jahre der jungen Industriegesellschaft der USA den Rücken. Sein Ziel war es einen alternativen und ausgewogenen Lebensstil zu verwirklichen.
Ich zog in die Wälder, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, alle Wirkenskraft und Samen zu schauen und zu ergründen, ob ich nicht lernen könnte, was ich lehren sollte, um beim Sterben vor der Entdeckung bewahrt zu bleiben, daß ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das Leben, was kein Leben war. Das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung üben – höchstens im Notfall. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so herzhaft und spartanisch leben, daß alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen würde.
Das 1854 veröffentlichte Werk ist kein Roman im eigentlichen Sinne, sondern eine Zusammenfassung und Überarbeitung seiner Tagebucheinträge. Die achtzehn Kapitel des Buches sind unterschiedlichen Aspekten menschlichen Daseins gewidmet und enthält Reflexionen über die Ökonomie, über die Einsamkeit, Betrachtungen über die Tiere des Waldes oder über die Lektüre klassischer literarischer Werke.
Die Wirkung von Walden ist untrennbar mit der amerikanischen Geschichte verbunden. Thoreau wurde mit seinem Werk zu einem Prophet des zivilen Ungehorsams und des amerikanischen Anarchismus.
Autor
Die Pyramide aus Kieselsteinen, die an der Stelle sich erhebt, wo einst Henry Thoreaus Hütte am Waldenufer stand, wächst von Jahr zu Jahr. Sie ist gleichsam das Symbol, nicht nur der steigenden Anerkennung, die seine Landsleute und dankbare Menschen aus allen Ländern ihm zollen, sondern auch des Fortschrittes, den im materialistischen Amerika die Pflege ideeller Güter macht. Wer die Empfindlichkeit kennt, welche der Amerikaner jedem Tadel seines Landes und seiner »Kultur« entgegenbringt, und andrerseits liest, wie mutig und derb, wie treffend und klar Thoreau – von warmer Liebe zum Vaterlande beseelt – seinen Landsleuten die Wahrheit sagt, ihre Schwächen und Fehler, ihre Laster und Torheiten aufdeckt, der wird mit doppelter Genugtuung die zunehmende Wertschätzung dieses Denkers und Dichters verfolgen. Thoreau galt zu seinen Lebzeiten manchen als ein Narr und Faulenzer, den meisten als ein Sonderling. Nur wenigen – darunter befanden sich allerdings die Besten seiner Zeit: Emerson, Alcott, Channing – war er ein Phänomen, ein Dichter, ein Seher. Diesen wenigen erschien sein Leben nicht schon deshalb verfehlt, weil es weder nach Ruhm noch Geld geizte und in der Einsamkeit verfloß. Sie wußten, daß er wie kein zweiter vermochte, in dem heiligen Buch der Natur zu lesen, daß er aus seinem Körper einen Tempel für eine reine Seele schuf. Sie wußten oder ahnten, daß ein seltener Mensch, eine Individualität unter ihnen wandelte, die wohl ihresgleichen noch nie auf Erden hatte. Ihnen war es kein Menschenhasser, sondern ein Menschenbeglücker, kein Weltflüchtiger, sondern ein Weltbesieger, kein verworrener Träumer, sondern ein Philosoph, der seine Philosophie lebte.
Thoreau’s Großvater war französischer Abstammung und in St. Heliers auf der Insel Jersey geboren. Er wanderte, kaum dem Knabenalter entwachsen, 1773 nach Amerika aus, ließ sich in Boston nieder und heiratete 1781 Jane Burns, in deren Adern schottisches und Quäkerblut floß. Sie gebar ihm vier Kinder – einen Sohn und drei Töchter. Später zog die Familie nach Concord, wo John Thoreau im Alter von siebenundvierzig Jahren an Schwindsucht starb. Sein einziger Sohn, John Thoreau, der Vater Henrys, wurde 1787 in Boston geboren. Er setzte des Vaters kaufmännisches Geschäft fort, hatte aber so wenig Erfolg, daß er Bankerott machte, alles verlor und, um seinen Gläubigern möglichst gerecht zu werden, selbst seinen Ehering verkaufte. Er war mit einem temperamentvollen, klugen und witzigen Mädchen, mit Cynthia Dunbar, der Tochter des Advokaten Asa Dunbar aus Keene, vermählt. Sie war von hoher Gestalt, hatte angenehme Gesichtszüge, liebte Musik, sang mit gutem Können, besaß ein hervorragendes Gedächtnis und wußte über viele Gebiete lebendig und anregend zu plaudern. Ihre Gutmütigkeit war allgemein bekannt. Stets war sie bereit, den Armen zu helfen. In vielen äußeren und inneren Eigenschaften unterschied sie sich von ihrem Manne. Henrys Vater war von kleiner Figur, ernst und verschlossen, pflichttreu in jeder Hinsicht, fast ganz von seiner Arbeit in Anspruch genommen, doch ab und zu der Geselligkeit und munterem Geplauder nicht abgeneigt. In ihm steckte mehr Franzosen- wie Yankeeblut. Beiden Eltern gemeinsam war die Vorliebe für die Natur. Viele Jahre hindurch sah man sie in Fair Haven, am Walden und an anderen Plätzen in Wäldern und auf Hügeln umherstreifen, wo sie, wenn immer ihre Pflichten es erlaubten, botanisierten und mit verständnisvollen Augen die unendliche Mannigfaltigkeit der Natur beobachteten. Henrys Mutter hatte eine so große Vorliebe für diese Wanderungen, daß für eines ihrer Kinder der »Leehügel« beinahe zum Geburtsort geworden wäre.
Als dieser Eltern drittes Kind ward Henry David Thoreau am 12. Juli 1817 auf einer Farm in der Nähe von Concord, Massachusetts, geboren. Dort wuchs er unter urkräftigen Farmern, die weder Armut noch Reichtum kannten, unter harmlosen, pflichttreuen Menschen in einem Hause heran, in welchem eine frohsinnige Mutter mit bescheidenen Mitteln Sonnenschein und Behaglichkeit verbreitete, und wo ein ernster Vater in emsiger, hochgeschätzter Arbeit die Seinen treu versorgte. Schon mit zwölf Jahren nahm Thoreau sein Gewehr unter den Arm und durchstreifte jagend Moor und Wald, ruderte auf dem Musketaquid oder auf dem Assabet oder wanderte zum Waldenteich. In der guten kleinen Schule zu Concord lernte er die besten lateinischen und griechischen Klassiker kennen, doch sagte er selbst, daß er hier – und später auch in Harvard – manche Stunde, die er dem Studium widmen sollte, zum Durchstreifen der Wälder und zum Erforschen der Ströme und Teiche seiner engeren Heimat verwendete.
Im Alter von sechzehn Jahren bezog Thoreau die Universität Harvard. Da der Vater allein mit seinen bescheidenen Einnahmen den Universitätsbesuch seines Sohnes nicht bestreiten konnte, leisteten einige entfernte Verwandte und auch die ältere Schwester, die bereits Schullehrerin war, freundwillig Beihilfe. Thoreau selbst aber übte die größte Sparsamkeit. In den Ferien unterrichtete er privatim Schüler oder nahm vorübergehend Lehrerstellen auf dem Lande an. Als er 1835 an der Distriktschule in Canton während der Universitätsferien lehrte, begann er mit einem Pfarrer die deutsche Sprache zu studieren. In Harvard selbst zeichnete er sich weder durch hervorragende Geisteseigenschaften noch durch ein freundliches Wesen aus. Meistens hielt er sich von seinen Kameraden fern, las eifrig und viel, und übte strenge Selbstzucht, indem er über all sein Tun von sich selber Rechenschaft verlangte. Man hat bisweilen darauf hingewiesen, daß Thoreau der Harvarduniversität viel verdanke. Er selbst sagt jedoch in einem Brief aus dem Jahre 1843, daß er dort hauptsächlich gelernt habe, sich »gut auszudrücken« und dauernden Gewinn nur aus der Bibliothek davontrug. Er las nicht nur die lateinischen und griechischen Klassiker, sondern auch besonders englische Literatur, Chaucer, Spenser und vor allem Milton. Im übrigen beschäftigte er sich mit Naturwissenschaften. Seine Liebe zum Freiluftleben erkaltete in Harvard nicht, er sehnte sich fort »aus diesen düsteren, wenn auch klassischen Mauern« nach seiner alten, geliebten Freundin Natur.
Als er, zwanzig Jahre alt, Harvard verließ und nach Concord zurückkehrte, widmete er sich zunächst der Schulmeisterei, von dem Präsidenten der Universität, von Emerson, und dem allgemein beliebten Pfarrer Ripley mit besten Empfehlungen versehen. Mit seinem Bruder John, der seinem Herzen vielleicht von allen Menschen am nächsten stand, eröffnete er eine Privatschule und lehrte an der »Akademie« in Concord, ohne jedoch Befriedigung zu finden. Nach kurzer Zeit sehen wir ihn schon in der Bleistiftfabrik des Vaters. So oft und wann auch immer seine Arbeit es ihm ermöglichte, eilte er ins Freie, um sein Amt als »selbsternannter Inspektor der Schneestürme und Regengüsse« zu versehen, um den dämmernden Morgen und die sinkende Sonne zu überwachen und den Botschaften des Windes zu lauschen. Er entwickelte eine außerordentliche Geschicklichkeit in allen technischen Dingen, erfreute sich bald eines vorzüglichen Rufes als Landmesser, begann auch dichterisch sich zu betätigen und hielt ab und zu Vorträge im »Lycaeum« zu Concord. 1839 baute er sich selbst ein Boot und machte mit seinem Bruder John eine Ferienreise auf den Concord- und Merrimacflüssen. Eine farbensatte, gedankenreiche Schilderung dieses Ausflugs erschien zehn Jahre später (1849) unter dem Titel: A week on the Concord and Merrimac river. Das Buch ist voll herrlicher Landschaftsbilder und voll begeisterter Worte über seine Lieblingsdichter. In dem Kapitel »Montag« preist Thoreau vor allen die alten indischen Schriften. Das Kapitel »Donnerstag« enthält manches Interessante über Goethe, der »Mittwoch« wiederum Gedanken über Freunde und Freundschaft, die in ihrer psychologischen Tiefe und in ihrer heißen Sehnsucht nur mit dem herrlichsten, was Nietzsche über diese Dinge sagte (im Nachgesang »Aus hohen Bergen« z.B.) verglichen werden können. Als Thoreau 1853 von seinem Verleger siebenhundert Exemplare dieses Buches zurückerhielt, schrieb er einem Freunde: »Ich besitze jetzt seit einiger Zeit eine ziemlich umfangreiche Bibliothek, mehr als siebenhundert Bände, die ich fast alle selbst geschrieben habe.«
Allmählich erhielt Thoreau’s einziger und vertrauter Freund John einen Nebenbuhler in Emerson, der seit 1834 in Concord lebte und für den jungen Henry wachsendes Interesse empfand. 1837 hatten sie sich zuerst getroffen und schon im nächsten Jahre schrieb Emerson: »Ich habe Herzensfreude an meinem jungen Freunde. Nie, glaube ich, ist mir ein solch freimütiger, fester Charakter begegnet.« Bald darauf ward Thoreau eng mit Emerson befreundet, und seit 1840 willkommener Gast in dem Hause dieses schon damals hochberühmten Mannes. Durch Emersons Aufenthalt wurde Concord gleichsam zum amerikanischen Weimar. Reges geistiges Leben entfaltete sich in der kleinen, nur zweitausend Einwohner zählenden Stadt. In Emersons und Ripleys Hause kamen die »Transzendentalisten« zusammen, Leute, deren höchster Lebenszweck, wie Knortz sagt, das Streben nach Wahrheit war, die religiöse Zeremonien verabscheuten und christliche Ethik in den Vordergrund stellten. Transzendentalismus wurde aus Europa eingeführt. Nur wenige Schriften von Kant, Fichte und Schelling fanden den Weg über den Ozean. Nur wenige Leute lasen um diese Zeit Deutsch, manche dagegen Französisch. Ausländische Zeitungen berichteten über die Fortschritte der deutschen und französischen Spekulation. 1804 hielt Degérando in Paris bereits Vorlesungen über Kant. Schellings leitende Ideen wurden durch Coleridge verbreitet. Fouriers Bestrebungen wurden lebhaft aufgenommen und ins Praktische übersetzt. Die Schriften Carlyles über deutsche Literatur und über Goethe wurden durch Emerson dem amerikanischen Publikum zugänglich gemacht. Margarete Fuller, die Rahel des Emerson-Kreises, übersetzte Goethes Gespräche mit Eckermann, Ripley schrieb über Goethe und Schiller – kurz, eine Renaissance in Religion, Ethik, Kunst und Politik dämmerte herauf, und ernst wurde in den Zeitschriften um die neue Weltanschauung gekämpft, deren Ideen hauptsächlich das von Emerson und Margarete Fuller herausgegebene »Dial« und die New-Yorker Tribüne vertraten. »Die transzendentale Bewegung«, sagt Lowell, »war der protestantische Geist des Puritanismus, der nach neuer Betätigung drängte und aus alten Formen und Dogmen, welche ihn eher verschleierten als enthüllten, sich losringen wollte.« Und obwohl diese Bewegung nur kurze Zeit bestand, nur von wenigen, allerdings hervorragenden Menschen geleitet wurde, war der Einfluß auf die Zeitgenossen groß. Emerson, Theodore Parker, Bronson Alcott und Thoreau erzielten durch Kampf und Arbeit den praktischen Erfolg, daß ihre Mitmenschen nicht nur wißbegieriger, sondern auch zufriedener mit ihrer Lage, menschlicher in ihren Empfindungen, bescheidener in ihren Hoffnungen und glücklicher in ihrem Familienleben wurden.
Die Herausgabe des »Dial« machte viel Arbeit. Emerson war außerdem häufig von Concord abwesend, um in der weiteren Umgegend Vorträge zu halten und konnte sich wenig um Haus und Hof bekümmern. Darum bat er 1841 Thoreau, »den jungen Dichter voll von Melodien und Einfällen«, wie er an Carlyle um diese Zeit schrieb, in sein Haus zu ziehen. Thoreau nahm diese Aufforderung an und erwies Emerson hierdurch einen Freundschaftsdienst. Andere Deutungen sind unrichtig. Es ist selbstverständlich, daß das häufige und nunmehr ganz intime Zusammensein mit einem Manne von Emersons Persönlichkeit auf den vierzehn Jahre jüngeren Thoreau starken Einfluß ausüben mußte. Doch war Emerson sicher nicht allein der Gebende. Thoreau machte sich, dank seiner hervorragenden technischen Geschicklichkeit, nicht nur in Haus und Hof wohlverdient, er war es auch, der Emerson einen tieferen Einblick in die Natur eröffnete und durch seine denkbar einfachste Lebensweise dem älteren Freund geradezu als Vorbild diente. Emersons Sohn selber sagt, daß sein Vater sich »freudig von diesem helläugigen, wahrhaftigen und ernsten Manne zu den heiligsten Altären des Waldgottes führen ließ«. Thoreaus Gedichte und Essays aus dieser Zeit fanden im »Dial« Aufnahme.
Inmitten dieses sympathischen Kreises traf Thoreau der härteste Schlag seines Lebens: der Verlust seines Bruders John. Er wurde teilnahmlos gegen seine Umgebung und machte den Eindruck, als ob er sich selbst hasse. Trost suchte und fand er in der ewig gütigen Natur. »Ich finde solch ein Ereignis eher seltsam als traurig,« schrieb er später. »Wer gibt mir das Recht, traurig zu sein, wo ich noch nicht aufgehört habe mich zu wundern?«
Immer mehr fühlte er, daß sein eigentlicher Beruf die Schriftstellerei sei. Als ihm 1843 bei Verwandten Emersons in Staten Island nahe bei New York eine Erzieherstelle angeboten wurde, willigte er ein, weil er dadurch Gelegenheit erhalten konnte, mit hervorragenden Literaten und Verlegern New Yorks in persönliche Beziehungen zu treten. Auch hoffte er, eine hartnäckige Bronchitis durch die Luftveränderung zu vertreiben. Soviel wie möglich war er auch hier im Freien. Das Meer machte einen gewaltigen Eindruck auf ihn. Einige herrliche Stanzen legen davon Zeugnis ab. Bald lauschte er dem Branden der See, bald dem Brausen der Großstadt. Trotz freundlicher Bemühungen angesehener Leute zeigten sich in New Kork keine günstigen Aussichten. Ein längerer Aufenthalt wurde ihm verleidet. Im Herbst 1843 finden wir ihn schon wieder in seinem geliebten Concord. Er fabrizierte aufs neue Bleistifte, gab aber diese Beschäftigung hernach bald ganz auf, als seiner Hände Arbeit eine Auszeichnung erhielt – diese Kunst beherrschte er, jetzt hieß es, ein neues Feld der Tätigkeit bemeistern. Torrey hat recht, wenn er sagt: »Natur, Menschen, Bücher, Musik – alles diente Thoreau nur dazu, an sich selbst zu bauen.« Aber immer mehr fühlte er, daß seine Lebenskunst, die stets darin bestanden hatte, möglichst wenig zu bedürfen, ihn mit jener Muße nicht beschenkte, deren er dringend bedurfte, um Gedachtes und Geschautes in sich zu verarbeiten. Emersons »Dial« konnte nur ausnahmsweise einmal Honorar bezahlen; Landvermessungen, Tischlerei und Hilfeleistungen für die Farmer der Umgegend nahmen viel Zeit in Anspruch, brachten aber wenig Lohn. Mit anderen Worten: der fortwährende Kampf um einen noch so bescheidenen Lebensunterhalt, der Einfluß der transzendentalen Schule, der Drang, individueller Freiheit in jeder Hinsicht sich zu erfreuen, brachten allmählich in Thoreau den Plan zur Reife, eine Phase seiner transzendentalen Philosophie praktisch zu erproben: die Vereinfachung des Lebens. Schon 1839 hatte er in sein Tagebuch geschrieben: »Ich möchte meinen Instinkten leben, einen ungetrübten Eindruck in die Natur bekommen und mit allen mir verwandten Elementen in freundlichem Einklang stehen.« Und einige Jahre später (1841) schrieb er: »Ich möchte am See in der Stille wohnen, wo mir nur das Rauschen des Windes im Röhricht erklingt. Ich werde gewinnen, wenn ich alles Äußerliche von mir abschüttele. Meine Freunde fragen mich, was ich dort treiben werde? Werde ich nicht genug damit zu tun haben, die Jahreszeiten zu beobachten?«
Der Waldenteich in Concords Nähe war mit seinen frühesten Kindheitserinnerungen verknüpft. Als Jüngling war er oft in dunkeln Nächten zu seinem steinigen Ufer gepilgert und hatte bei hell loderndem Feuer Bricken gefischt. Nicht selten hatte er auch an blauen Sommertagen ein altes Boot auf dem Teich bestiegen und sich träumend von Wind und Wellen treiben lassen. Fast ebenso sympathisch war ihm die etwa zweieinhalb Meilen von Concord entfernte Hollowell Farm. Für das halbverfallene, graue Häuschen, das mitten in einem Hain roter Ahornbäume nahe am Flusse lag, bot er dem damaligen Besitzer zehn Dollars. Als aber der Kontrakt aufgesetzt werden sollte, wurde des Farmers Frau andern Sinnes – »jedermann hat solch eine Frau,« schreibt Thoreau – und der Verkauf zerschlug sich. So wurde denn 1845 das Ufer des Waldenteiches endgültig gewählt.
Hören wir Thoreau selbst: »Als ich mir klar darüber wurde, daß meine lieben Mitbürger mir kein Bureau im Rathaus, keine Pfarre oder irgend einen Broterwerb anbieten würden, daß ich vielmehr mir selbst helfen müsse, wandte ich mein Augenmerk mehr denn je den Wäldern zu. Dort war ich besser bekannt. Als ich zum Waldenteich wanderte, beabsichtigte ich dort weder billig noch teuer zu leben, sondern möglichst ungehindert Privatgeschäfte zu tun … Ich zog in die Wälder, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, alle Wirkenskraft und Samen zu schauen und zu ergründen, ob ich nicht lernen könnte, was ich lehren sollte, um beim Sterben vor der Entdeckung bewahrt zu bleiben, daß ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das Leben, was kein Leben war. Das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung üben – höchstens im Notfall. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so herzhaft und spartanisch leben, daß alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen würde. Ich wollte mit großen Zügen knapp am Boden mähen, das Leben in die Enge treiben und es auf die einfachste Formel bringen …«
Gegen Ende März 1845 lieh Thoreau von seinem Freunde Alcott eine Axt, zog zum Waldenteich, fällte Tannen und begann das Holz zum Hausbau herzurichten. Zwei bis drei Wochen widmete er froh und fleißig diesem Vergnügen. Dann stellte er mit Hilfe einiger Freunde, die er mehr aus Höflichkeit als aus Notwendigkeit herbeigerufen hatte, sein Haus auf. Die Hütte war zehn Fuß lang und fünfzehn Fuß breit, hatte einen Speicher, einen Wandschrank, ein großes Fenster und erhielt später auch einen Kamin. An Hausrat gab es nur ein Bett, einen Tisch, drei Stühle, einen Spiegel (drei Zoll im Durchmesser), einen Kessel, eine Bratpfanne, einen Schöpflöffel, einen Becher, zwei Messer und zwei Gabeln, drei Teller, ein Waschgeschirr, einen Krug für Öl und einen für Melasse und eine Lampe. Einige Ziegelsteine, die auf seinem Schreibtisch lagen und jeden Morgen abgestäubt werden mußten, warf er bald aus dem Fenster: wenn schon etwas abgestäubt werden müßte, so sollte es der geistige Hausrat sein. Jeden Morgen nahm er ein Bad im Teich. Das war religiöse Übung. Dann kam die Tagesarbeit oder die Tagesmuße. Er pflügte, noch ehe sein Haus fertig war, etwa zweieinhalb Morgen sandigen Bodens um und bepflanzte sie mit Bohnen, zum Teil mit Kartoffeln und mit Erbsen und Rüben. Im ersten Sommer arbeitete er stets von fünf Uhr bis zur Mittagsstunde auf dem Felde. Leute, die dort vorüberkamen, schauten mit Verwunderung auf den seltsamen Farmer, der, ohne Dünger auf den Acker zu bringen, um eine Zeit Bohnen pflanzte, wo andere sie bereits hackten. Der seltsame Farmer aber empfand in seiner Seele eine fast überirdische Befriedigung. Er begann seine Bohnen zu lieben, obwohl er mehr von ihnen großzog als er bedurfte. Sie brachten ihn der mütterlichen Scholle näher, und er ward stark wie Antaeus. Und wenn er mit seiner Hacke gegen einen Stein schlug, und Himmel und Erde diese Musik widerhallten, dann hatte er schon reichliche Ernte. »Es waren keine Bohnen mehr, die ich hackte, und ich war es nicht mehr, der sie hackte«, schrieb der Mystiker Thoreau … Hatte er den Morgen hindurch gearbeitet, dann erfrischte er sich durch ein zweites Bad im Teich und genoß am Nachmittag völlige Freiheit, durchstreifte Wälder und Felder, wohin auch immer die Stimmung ihn trieb. Oft widmete er den ganzen Tag der Muße. Er sagt in seinem Waldenbuch: »Bisweilen saß ich an Sommertagen, wenn ich mein gewohntes Bad genommen hatte, vom Sonnenaufgang bis zum Mittag traumverloren im Sonnenschein auf meiner Türschwelle zwischen Fichten, Walnußbäumen und Sumach in ungestörter Stille und Einsamkeit, während die Vögel ringsum sangen und geräuschlos durch das Haus flatterten. Erst wenn sich die Sonne in meinem Fenster gen Westen spiegelte, oder das Rollen eines Reisewagens auf der fernen Landstraße erklang, kam mir der Gedanke, wie schnell die Stunden verflogen. In solchen Stunden wuchs ich wie der Mais in der Nacht. Sie waren auch weitaus besser angewendet als irgend ein Werk meiner Hände hätte sein können. Sie wurden meinem Erdenwallen nicht abgezogen, sondern zugelegt.« Die Stunden wurden ihm nicht durch das Schlagen einer Uhr zersetzt. In Mondnächten ließ er auf dem Teich im Boot sich treiben und weckte mit seiner Flöte Klang das Echo der schlummernden Wälder. … In seiner Kleidung war er völlig anspruchslos. Er trennte sich ungern von alten Schuhen und Socken, sie waren ihm mit der Zeit vertraute Freunde geworden. Seine Nahrung bestand aus Reis, Maismehl, Kartoffeln und Bohnen. Nur selten fing er sich ein Gericht Fische im Waldenteich, noch seltener aß er gesalzenes Schweinefleisch. Wasser war sein einziges Getränk. Sein Brot buk er selbst.
Im Spätherbst des Jahres 1845 versah er sein Häuschen mit Bewurf und baute einen Kamin. Jetzt erst wurde sein Haus sein Heim. Doch war er täglich stundenlang bei jedem Wind und Wetter im Freien, machte heute einer einsamen Edeltanne Besuch, die einige Meilen entfernt auf einem Hügel wuchs und ging morgen zu einem Murmeltier, mit dem er sich »verabredet hatte«. Die langen Abendstunden benutzte er dazu, die Notizen, die er während seiner Wanderungen flüchtig niedergeschrieben hatte, in sein Tagebuch zu übertragen. Auf Emersons Rat hatte Thoreau kurz nach der Studentenzeit in Harvard begonnen, täglich seine Gedanken und Beobachtungen aufzuzeichnen – ein Tagebuch zu führen. Er setzte es – auch hierin eine Ausnahme unter Tausenden, wie Torrey sehr richtig bemerkt – getreulich bis zu seinem Tode fort. Diese Tagebücher sind erhalten: mehr als dreißig Bände, von denen manche mehr als hunderttausend Worte enthalten. Sie sind ein Denkmal des Sehnens und Strebens, des hohen Fluges dieses reinen Menschen, ein Schatz herrlicher Gedanken, haarscharfer Naturbeobachtungen und wunderbarer Landschaftsbilder. Unaufhörlich hat Thoreau an diesen Tagebüchern gearbeitet. Jeder Satz wurde auf das gewissenhafteste erwogen und gefeilt. Seine Absicht, aus diesen Tagebüchern »ein Buch der Jahreszeiten zu schaffen, in welchem jede Seite unter freiem Himmel in der jeweiligen Jahreszeit geschrieben sein sollte« wurde von Blake ausgeführt, der aus ihnen mit großer Sorgfalt und Liebe die drei Werke: Sommer, Winter und Herbst zusammenstellte. Eine stimmungsvolle deutsche Übersetzung des »Winter« ist bereits bei Karl Lucas, Paderborn erschienen. Und obwohl ferner viele Gedanken unmittelbar aus diesen Tagebüchern in seine Werke überflossen, bleibt doch eine solche Fülle kostbarer Früchte zurück, daß wir mit Freude die im Januar dieses Jahres begonnenen Publikationen aus diesen Tagebüchern in »The Atlantic Monthly« (Boston) begrüßen müssen.
Es ist indessen falsch, anzunehmen, daß Thoreau während seines Aufenthaltes am Walden menschliche Gesellschaft mied. Das lag nie in seiner Absicht. Er ging in jeder Woche mehrfach zum Dorf, auch im tiefsten Winter, schlenderte die Dorfstraße entlang, sprach mit Freunden und Bekannten, blieb manchmal bis zum späten Abend bei ihnen und kehrte nachts durch die dunklen Wälder zu seiner Hütte zurück. Auch kamen viele – meistens neugierige – Besucher zu ihm. Seine Tür hatte kein Schloß und keinen Riegel, sie stand bei Tag und bei Nacht offen. Vögel kamen in’s Haus geflattert, Bienen in großer Zahl fühlten sich darin wohl und schliefen bei ihm im Bette, ohne ihn je zu belästigen. Unter dem Fußboden hatte ein Hase Wohnung genommen und früh morgens weckte ihn ein Eichhörnchen, das an den Wänden und auf dem Dach des Hauses auf und ab lief. Am liebsten waren ihm Kinder oder die einfachsten Menschen – Holzfäller, Fischer, Jäger, kurz jene Leute, die viel mit den ewigen Dingen, fernab vom Menschengetümmel, verkehren. Sie waren einer freundlichen Aufnahme jederzeit sicher. Dilettierende Weltverbesserer dagegen, Schwätzer und heuchlerische Philanthropen, die nicht wußten, wann sie ihren Besuch zu beenden hatten, ließ er ohne weiteres allein und »antwortete ihnen aus immer größerer Entfernung.« –
Die auswärtige Politik der Vereinigten Staaten während des Krieges mit Mexiko hatte Thoreau tief verstimmt. Sie trug nur dazu bei, seine Verachtung gegen staatliche Einrichtungen zu steigern. Er weigerte sich beständig, Steuern an eine Regierung zu bezahlen, die sich dazu herabwürdige, den Handel mit Menschen zu billigen. »Die Regierung, die überhaupt nicht regiert,« war seiner Ansicht nach die beste. Der Steuerbeamte, der dieser Weigerung ratlos gegenüberstand, erhielt auf seine Frage, was er nun tun solle, die Antwort: »Geben Sie ihr Amt auf.« Kurze Zeit darauf ward Thoreau im Dorfe, wohin er einen Schuh zum Flicken getragen hatte, verhaftet. Als Emerson hörte, daß sein Freund die Einsiedelei am Walden mit der Gefängniszelle in Concord habe vertauschen müssen, eilte er sofort zu ihm. »Henry, warum sind Sie hier?« war seine erste Frage. »Warum sind Sie nicht hier,« lautete Thoreaus ernste Antwort. Er erhielt bald (nachdem seine Familie die geringe Summe bezahlt hatte) seine Freiheit – und auch seinen Stiefel – zurück und wanderte wieder in seine Wälder, »von wo aus er den Staat nirgends erblicken konnte.« Auch wenn er tagelang von seinem Hause abwesend war, verschloß er nicht die Tür. Abgesehen von einem Bändchen Homer wurde ihm nie etwas gestohlen und nur solche Menschen belästigten ihn, »die den Staat repräsentierten«. Die Jahreseinnahme seiner Farm betrug dreiundzwanzig Dollars, denen an Ausgaben vierzehn Dollars gegenüberstanden. Als Tagelöhner verdiente er sich nebenbei während dieser Zeit zwölf Dollars. Im zweiten Jahre war das Ergebnis noch günstiger.
Zwei Sommer und zwei Winter verbrachte Thoreau am Waldenufer und eine reiche, geistige Ernte ward ihm zuteil. Als der Sommer 1847 herannahte, fühlte er, daß er die Möglichkeiten, die ihm dieses Leben bot, erschöpft habe, daß es nun Zeit sei, eine andere Phase seines Lebens zu beginnen. Am 6. September 1847 zog er von Walden wieder nach Concord. »Warum ich die Wälder verließ«, schrieb er einige Jahre später in sein Tagebuch, »das kann ich wahrlich nicht sagen. Vielleicht trug ich nach Abwechselung Verlangen. Es gab dort ungefähr um die zweite Nachmittagsstunde so etwas wie eine Stockung …« Die herrlichste Frucht der Waldenjahre, sein »Walden«, wurde der Menschheit erst 1854 geschenkt. Aus dem Romantiker, dem Naturschwärmer und Naturforscher seines ersten Werkes war ein Philosoph und Metaphysiker geworden, der oft in epigrammatischem Stil seine Weisheit kündete, die kühnsten Paradoxe liebte und die Stimmungen der Menschenseele wie der Natur bald mit den zartesten, bald mit den kräftigsten Strichen malte. Burroughs bezeichnet Thoreaus Erstlingswerk und sein Walden »als die beiden naturwüchsigsten und antiseptischsten Bücher der englischen Literatur«. Doch »Walden« wurde vielfach gröblich mißverstanden. Man übersah, konnte oder wollte nicht sehen, daß Thoreau seine Einsiedeljahre selbst nur als ein Experiment bezeichnete. Man fragte unwillig und erstaunt, was aus den Menschen werden solle, wenn alle Thoreaus Rat und Beispiel folgen würden. Das Faß des Diogenes habe einen gesunderen Boden als die Hütte von Thoreau, behauptete die zeitgenössische Kritik. Diese Leute vergaßen jedoch, daß Thoreau der Menschheit niemals anriet, in Waldhütten zu wohnen und von Bohnen und Kartoffeln zu leben. Er hatte das Experiment gemacht, weil es ihm von seiner inneren Stimme befohlen wurde, weil er dieser Stimme stets zu gehorchen pflegte und weil er seine Individualität ihre eigenen Wege wandern lassen wollte. Ja, die Ernte war reich, so reich, daß die dankbare Nachwelt freudig auch an dieser seiner schönsten Frucht sich kräftigt, daß Tausende von Menschen fühlen: Lebenswerter scheint uns das Leben, lieblicher duften die Blumen, heller leuchtet der Sonnenschein, holder singen die Vögel, munterer plätschern die Wellen, mit heißerem Bemühen suchen wir nach der Pforte unserer Seele, unablässiger strebt unsere Sehnsucht durch Nebelmeere zu wolkenloser Reinheit empor, seit wir dich kennen, den edlen feierlichen Menschen vom Waldensee …
Thoreau bezog in Concord wieder Emersons Haus und wohnte dort während der Abwesenheit des Freundes in Europa. 1849 siedelte er in das väterliche Haus über, wo er bis zum Ende seines Lebens verblieb. Schriftstellerei war jetzt seine Hauptbeschäftigung. Wahre Freude empfand er nur beim Schaffen eines Werkes. Er geizte nicht nach Erfolg: »Ich gebe ab und zu ein paar Worte aus, um mir Schweigen dafür zu kaufen.« Außerdem hielt er in Städten und Dörfern Vorträge über alle möglichen Gebiete. Willkommene Abwechselung boten ferner kleinere und größere Reisen an die See nach Cape Cod, das er dreimal (1849, 50 und 53) besuchte, nach Canada und in die Maine-Wälder. Herrlich sind die Schilderungen der Meeresküste in »Cape Cod«, weniger erfreulich und zu sehr mit Einzelheiten überladen ist sein »Ausflug nach Canada«, der 1853 im »Putnam Magazin« erschien. Die Wanderungen in die Maine-Wälder dienten hauptsächlich dem Studium indianischer Sitten und Gebräuche. Der letzte Ausflug dorthin fand 1857 statt. Erst nach Thoreaus Tode erschien ein Werk über diese Reisen unter dem Titel »Die Mainewälder«. Es war während seiner letzten Lebensmonate sorgfältig von ihm vorbereitet worden und enthält eine Fülle botanischer, geologischer und ethnologischer Beobachtungen in poetischer und philosophischer Gewandung.
Schon im Jahre 1855 begann indessen Thoreaus Gesundheit nachzulassen. 1857 spricht er bereits von »zwei Invaliditätsjahren«. Trotzdem kampierte er oft im Freien und setzte sich allen Unbilden der Witterung aus. 1857 starb – zweiundsiebenzig Jahre alt – sein Vater. Jetzt hieß es Brot für Mutter und Schwester schaffen. Wieder wurde die Bleistiftfabrikation aufgenommen und das Einkommen dadurch vermehrt, daß er aufs neue Landvermessungen machte, bald einem Farmer ein Boot baute, bald beim Stallbau half oder ein Haus anmalte – kurz, »so viele Gewerbe ausübte, als er Finger hatte«. Dabei arbeitete er fleißig an seinen Tagebüchern und Manuskripten weiter, ohne ein größeres Werk zu veröffentlichen. Arbeitsam aber äußerlich ruhig floß sein Leben dahin.
Immer mehr aber gährte es in den Vereinigten Staaten, immer heftiger entbrannte der Kampf um die Sklavereifrage. Als der oberste amerikanische Gerichtshof den Sklavenhaltern in den Südstaaten nur allzuweit entgegenkam, indem er entschied: »Sklaven sind und bleiben unter allen Umständen Eigentum ihres Herrn, ein Aufenthalt in fremden Ländern ändert nichts an ihrer Stellung, die Sklaven müssen zu ihrer eignen Wohlfahrt in Sklaverei fortleben«, wuchs die Erbitterung gegen die Anmaßung der Sklavenhalter in drohendem Maße und wurde durch die Literatur – durch »Onkel Toms Hütte«, ein Buch, das eine Auflage von mehr als dreihunderttausend Exemplaren fand, durch die Selbstbiographie des Negers Douglas und durch Hildretts »Weißer Sklave« – lebhaft geschürt. Die Sklaverei besteht zu Recht in moralischer, religiöser und politischer Beziehung, sagte man im Süden, wo sich allmählich eine Aristokratie ausgebildet hatte, die den Menschen nach der Anzahl seiner Sklaven beurteilte und die »freie Arbeit« des Nordens, ja, die Arbeit an sich als verächtlich ansah. In den Nordstaaten aber traten Männer auf, die offen erklärten, in einem Lande nicht leben zu wollen, wo Männer und Frauen wie Vieh aufgezogen, wo »Väter, Mütter und Kinder wie Ware verkauft« würden. Noch radikaler dachte John Brown, ein begeisterter, fanatischer Puritaner, Lohgerber seines Zeichens. Er hatte sich bislang nicht am politischen Leben beteiligt, begann aber jetzt im Staate Kansas mit solcher Energie gegen die Sklaverei Opposition zu machen und so vielen Negern zur Flucht gen Norden zu verhelfen, daß der Staat einen Preis von dreitausend Dollars für seine Ergreifung aussetzte. Brown, der bereit war, aus innerster Überzeugung sein Leben für die Befreiung der Sklaven hinzugeben, zog nach Virginia. Dort bemächtigte er sich mit nur wenigen Getreuen der Rüstkammer zu Harpers Ferry, um die Aufständischen bewaffnen zu können. Doch schon am nächsten Tage wurde er nach verzweifelter Gegenwehr von den Negierungstruppen ergriffen und ins Gefängnis abgeführt. Als man ihn fragte, in wessen Namen er das Eigentum des Staates in Besitz genommen habe, antwortete er: »Im Namen Gottes, des großen Jehova!«
Ein ebenso glühender Abolitionist wie Brown war Thoreau. (Abolitionisten wurden die Leute genannt, die, ohne einer bestimmten politischen Partei anzugehören, in Wort und Schrift auf die Abschaffung der Sklaverei hinarbeiteten.) Thoreau selbst hatte ab und zu einen flüchtigen Sklaven beherbergt und gepflegt. 1857 kam John Brown nach Concord, um dort einen Vortrag über »Sklaverei« zu halten. Thoreau wurde mit ihm bekannt. Der Augenblick des ersten Sehens schlang ein Freundschaftsband um diese beiden Männer. Browns Worte: »Baue einen Palast in dir selbst, oder die Welt wird dein Kerker« waren Thoreau aus der Seele gesprochen. Mit lebhafter Anteilnahme verfolgte er hinfort die Schicksale dieses Mannes, der wie kein zweiter in dieser Frage mit ihm übereinstimmte, und der ihm wie kein zweiter berufen zu sein schien, eine leitende Rolle in dem unvermeidlichen Kampfe zu spielen. Da drang die Schreckenskunde zu ihm: Brown, sein Freund, sein geistiger Bruder, war in Gefangenschaft, stand in Virginia vor Gericht und hatte den Tod durch Henkershand vor Augen! Die Stimmen, die noch soeben dieses Mannes Lob gesungen hatten, verstummten: für den Störer des Landfriedens, für den Revolutionär und Anarchisten Brown fand niemand – auch kein Sklavereigegner – ein Wort der Verteidigung. Der Waldeinsiedler aber, der Concordphilosoph, fühlte vor Zorn über seine Landsleute, vor Mitleid mit seinem Freunde das Blut in den Schläfen pochen. Schweigen oder Abwarten dünkte ihm hier Feigheit. Er sandte in Concord von Haus zu Haus und lud die Bewohner zu einer Versammlung ein. Mitglieder politischer Vereine versuchten vergeblich, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Er sprach – sprach anderthalb Stunden lang vor einer großen Menschenmenge, verherrlichte den alten Helden, fand gleich glühende Worte für den Freund wie für den Haß gegen die Regierung … »Denkt doch an seine seltenen Eigenschaften! Jahrhunderte waren nötig, um diesen Mann zu schaffen, Jahrhunderte waren nötig, um ihn zu begreifen. Es ist kein Popanz, kein Vertreter irgend einer Partei! Einen Mann wie ihn, der aus dem kostbarsten Material geschaffen und gesandt wurde, um die zu befreien, die in Fesseln schmachten, wird die Sonne vielleicht nie wieder in diesem herrlichen Lande bescheinen! Und Ihr könnt ihn nur dazu gebrauchen ihn am Ende eines Strickes aufzuhängen! Ehrt Euch selbst und lernt ihn begreifen. Eurer Achtung wahrlich bedarf er nicht!« … So sprach ein Held für einen Helden. So lebte ein Philosoph seine Philosophie. So liebte ein Freund den Freund …
Brown aber ward gehenkt. Auf einem Acker bei Charleston starb der echte Menschenfreund. »Wie schön sind doch diese Kornfelder« waren seine letzten Worte. In den neuenglischen Staaten wurden überall Trauergottesdienste angeordnet, die Glocken läuteten und von den Kanzeln herab wurde das Volk zur Rache für den Freiheitskämpfer aufgefordert. Die Kriegsfackel loderte auch bald empor und auf dem Marsche sangen die Soldaten:
»John Browns Körper, der liegt modernd in der Erd’, Seine Seele aber zieht mit uns zum Streit. Gloria, gloria, gloria, Hallelujah!«
Und wer weiß, was geschehen wäre, wenn die ererbte Lungenkrankheit nicht schon jetzt Thoreaus Lebenskraft untergraben hätte! Vielleicht wären wir ihm auf dem Schlachtfeld wieder begegnet. Doch allzu schnell sanken seine Kräfte. Tapfer und geduldig ertrug er alles. »Es war unmöglich, in seiner Gegenwart traurig zu sein«, sagt seine Schwester. Schon 1862 starb er am sechsten Tage des Monats Mai im fünfundvierzigsten Lebensjahre. Auf dem Friedhof zu Concord liegt er begraben. Ein einfacher Stein schmückt sein Grab. Auf ihm sollten die Worte stehen, die Thoreau einst in sein Tagebuch schrieb:
»Vor Freude könnte ich die Erde umarmen, Freude erfüllt mich, daß ich dereinst in ihr ruhen werde.« –
Thoreau war eine Individualität. Er hatte keinen Vorgänger, er kann auch keinen Nachfolger haben. Manch günstiges und manch ungünstiges Urteil ist über ihn gefällt worden, sagt Torrey, eines aber läßt sich nicht leugnen: Als Ganzes genommen hatte er nicht seinesgleichen. Wohl haben auch andere Menschen Einfachheit gepredigt, in freiwilliger Armut gelebt, die Natur von Herzen geliebt und sich an ihre Brust geflüchtet, wohl haben auch andere vor und nach Thoreau die Zivilisation gering geschätzt und die Kultur zurückersehnt und ihren Landsleuten den Spiegel der Wahrheit vorgehalten, wohl haben auch andere an »eine absolute Güte«, an eine Weisheit hocherhaben über menschliches Wissen geglaubt – doch Thoreau als Ganzes: als Dichter und Idealist, als Stoiker, Zyniker, Naturforscher und Mystiker, als der Freundschaft-Ersehnende, Reinheit-Suchende, Vollendungs-Durstige, Armut-Stolze – wo hat er seinesgleichen? Er war kein Rousseau, denn Eitelkeit war ihm fremd und Geständnisse hatte er nicht zu machen. Er war kein Tolstoj, denn schon in früher Jugend fuhr er mit vollen Segeln ins weite Meer hinaus, das Wunderland seiner Sehnsucht zu suchen. Nie änderte er den Kurs. Immer blieb er sich selber treu. Er war kein Montaigne, kein Charron. Eher dann noch ein Jefferies, der wie Thoreau die Tradition verachtete, leidenschaftlich die Wälder, Felder und Ströme liebte und über die gleiche Kraft der Sprache verfügte, um Geschautes zu verkünden. Nein, als Ganzes genommen hatte er nicht seinesgleichen. Er war, wie Emerson sagt, ein Protestant à l’outrance. Er hatte keinen ausgesprochenen Beruf, heiratete nicht, wählte nicht, ging nie zur Kirche und hielt keinen Sabbat, weigerte sich Steuern zu bezahlen, aß kein Fleisch, trank keinen Kaffee oder Wein und gebrauchte keinen Tabak. Er wollte dadurch reich sein, daß er seine Bedürfnisse herabsetzte, und das, was er gebrauchte, mit eigenen Händen sich schuf. Sein Mantel war nachts seine Decke, seine Bücher band er selbst ein, seine Möbel waren seiner Hände Werk. Was er für recht hielt, verteidigte er rückhaltlos. Er kannte keine Zugeständnisse. Wie Nietzsche handelte er nach dem Grundsatz: »Ein Weg – ein Ziel – eine gerade Linie.« Wahrheit kündeten all sein Worte, all seine Taten. Er liebte sein Vaterland von Kerzen und seine Abneigung gegen englische und europäische Sitten grenzte oft an Verachtung. Er wollte nicht auf »Ruinen« wohnen. Concord selbst war ihm das Zentrum der Welt. Die Natur seiner engeren Heimat lehrte ihn die Natur des Kosmos begreifen. Freunde luden ihn ein nach dem Yellowstone, nach Südamerika mit ihnen zu reisen. Er lehnte ab. Er fand, daß die Flora von Massachusetts fast alle wichtigen Pflanzen Nordamerikas aufwies, und einem Freunde, der ihm ein Buch über eine arktische Expedition geliehen hatte, gab er es mit der Bemerkung zurück, daß die meisten in dem Buche geschilderten Phänomene auch in Concord zu beobachten seien. So innig wie sein ganzes Wesen sich zum Waldenteich und zu den Waldenwäldern hingezogen fühlte, ist jetzt seine Name mit diesem Stückchen Erde verknüpft.
Thoreaus kurze Gestalt zeigte hängende Schultern und eine auffallend flache Brust. Seine Gesichtsfarbe war hell, die Stirn nicht besonders hoch oder breit, aber voll Energie. Die Augen waren tiefblau, seine Lippen etwas vorstehend. In späteren Jahren trug er einen Vollbart. Seine Sinne waren wunderbar ausgebildet. Sie waren ihm die Eingangspforten zur Seele. Er hielt sie offen und unbefleckt. Er sah eine Wasserlilie oder ein Wasserläuferinsekt in Entfernungen, wo kein anderer sie zu erblicken vermochte. Er roch den Dampf einer Tabakspfeife oft eine Viertelmeile weit. Er konnte in der tiefsten Dunkelheit den Weg durch die Wälder finden. Es war ihm ein leichtes, die Höhe eines Baumes mit den Augen genau zu messen. Das Gewicht eines Schweines oder einer Kuh konnte er angeben wie ein Viehhändler. Die Entfernung wußte er zu schätzen wie ein Indianer. Der schlechte Geruch, den nachts die Wohnhäuser ausströmen, war ihm zuwider. Täglich lehrte ihn die Natur Neues. Burroughs sagt mit Recht: »Thoreau erforschte nicht so sehr die Natur wie das Übernatürliche; er schaute nicht die Natur an, sondern durch sie hindurch, darum machte er im naturwissenschaftlichen Sinne auch keine großen Entdeckungen.« Allerdings: er beobachtete jede Blume, jeden Vogel, die Ameise so gut wie die Bisamratte oder das Murmeltier. Er fühlt mit erstarrendem Finger durch den Schnee nach Pflanzen und untersucht sie unter dem Wasserspiegel. Er scheut keine Mühe, die wiederkehrenden Wasservögel zu belauschen und kriecht deswegen über Hügel und Sümpfe. Aber hinter all diesen Beobachtungen und Tatsachen sieht er die kosmischen Gesetze. Er ist betrübt, wenn er erkennt, daß kein Mensch flink genug ist, um bei der »ersten Frühlingsstunde zugegen zu sein«. Etwas wie »Größe« kennt er nicht. Der Waldenteich ist ihm ein kleiner Ozean und der atlantische Ozean ein großer Waldenteich. Alle seine Beobachtungen trägt er in sein Tagebuch ein. Er hat ein Verzeichnis der Pflanzen, die an einem bestimmten Tage blühen werden. Wasserlilien, Gentian und Immergrün erfreuen sich seiner besonderen Vorliebe. Er entzückt sich am Echo, »an des Waldes Stimme«. Mit Betrübnis sieht er, wie man überall die Bäume fällt. Gottlob! Die Wolken am Himmel konnte man ihm nicht abhacken!
Mit den Tieren stand er auf fast ebenso vertrautem Fuße. Hören wir, was Emerson darüber sagt: »Thoreau konnte unbeweglich stundenlang auf einem Felsen sitzen bleiben, bis die Tiere, die vor ihm geflohen waren, Vogel, Reptil oder Fisch, zurückkehrten und ihre Gewohnheiten wieder aufnahmen, ja, von Neugier getrieben, näher kamen, um ihn zu beobachten.« Wir würden es kaum glauben, wenn nicht Emerson es wäre, der weiterhin sagt: »Schlangen wanden sich um seine Beine, die Fische schwammen auf ihn zu, und ließen sich von ihm aus dem Wasser nehmen, die Vögel setzten sich auf seine Schultern (oder auf das Holz, das er in seinen Armen zur Hütte trug) und Eichhörnchen liefen ihm über die Füße, wenn das gerade der nächste Weg war.« Die Erde war für ihn kein Gegenstand kalter Beobachtungen, sondern ein großes, lebendes Wesen, und alles, was sie gebar, liebte er. »Gott, ich danke Dir,« schreibt er in sein Tagebuch, »ich bin Deiner Gnade unwürdig. Und doch ist die Welt für mich vergoldet, hohe Feiertage sind mir bereitet und mit Blumen ist mein Pfad bestreut! O, halte meine Sinne rein!« … Die einfachsten Töne waren ihm die schönste Musik. Das Bellen eines Hundes in der Nacht, ja selbst das Summen eines Telegraphendrahtes konnte ihn poetisch inspirieren. Wenn der Sturmwind um seine Hütte brauste, erklangen ihm Symphonien, und wenn vom Dorf her leise die Klänge einer Harmonika zu ihm herüberschallten, war er diesem Spielmann dankbar, weil er fühlte, daß durch dessen Musik seine Existenz vertieft wurde. Man denkt unwillkürlich an Nietzsches Wort: »Wie wenig gehört zum Glücke: Der Ton eines Dudelsacks« …
Und doch: zum dauernden Glück bedurfte Thoreau mehr. Vor allen Dingen – Freundschaft. Nach ihr sehnte er sich sein Leben lang. Zahlreiche Stellen in seinem Tagebuch weisen darauf hin. Er will nichts weiter von seinen Freunden »als Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, ein Gran wirklicher Hochachtung, eine Gelegenheit, einmal im Jahre die Wahrheit zu sprechen.« Und doch – wo waren die Freunde:
Der Freunde harr’ ich, Tag und Nacht bereit. Wo bleibt Ihr Freunde? Kommt! ’s ist Zeit! ’s ist Zeit!
Sie laden ihn zu Gast, doch »sie zeigen sich nicht«. Er »grämt sich, verhungert in ihrer Nähe«. Sie behandeln ihn derart, daß er sich »tausend Meilen weit fort« fühlt. »Ich verlasse meine Freunde beizeiten. Ich gehe fort von ihnen, und liebkose mein Freundschaftsideal.« »Wie kommt’s,« ruft er aus, »daß ich immer wieder solch hohe Anforderungen an die Menschheit stelle und so regelmäßig enttäuscht werde? Wissen meine Freunde, wie sehr enttäuscht ich bin? Ist alles mein Fehler? Bin ich zur Großmut, zur Selbstlosigkeit unfähig? Jede andere Anklage könnte ich eher gegen mich erheben!« »So ungefähr,« schreibt Thoreau, »würde ich als Freund zum Freunde sprechen: Nie erbat ich Deine Erlaubnis, Dich lieben zu dürfen. Ich besitze das Recht dazu. Ich liebe Dich nicht als etwas Individuelles, das Dir selbst gehört, sondern als etwas Universelles, Liebenswertes, das ich entdeckt habe. O, was für Gedanken ich über Dich hege! Du bist wahrhaft lauter, Du bist unendlich gut. Dir kann ich vertrauen in alle Ewigkeit. Ich wußte nicht, daß des Menschen Seele so reich sei.« … Ja, sein Freundschafts ideal fand er wohl selten verwirklicht. Vielleicht nicht einmal ganz in Emerson. 1853 schreibt er in sein Tagebuch: »unterhielt mich oder vielmehr versuchte mich mit R. W. E. zu unterhalten. Verlor Zeit, ja fast meine Identität. Er opponierte dort, wo es gar keine Meinungsverschiedenheiten gab, sprach in den Wind und ich verlor meine Zeit, indem ich versuchte mir einzubilden, nicht ich, sondern irgend ein anderer opponiere ihm.« Da mochte der Thoreau, der sagte: »Ein Wort soll vom Freund zum Freunde gehen wie der Blitz von Wolke zu Wolke, sich wohl »tausend Meilen fort« fühlen.
Frauen spielen in Thoreaus Leben keine Rolle. Eine »Jugendliebe«, die von manchen Biographen ausführlicher geschildert wird, ist ebenso uninteressant wie unbewiesen. Mit einem jungen Mädchen sich nur deshalb eine halbe Stunde lang zu unterhalten, weil sie »regelmäßige Gesichtszüge« hatte, erschien ihm ebenso zwecklos wie der Besuch von Gesellschaften. Er liebte es, allein zu sein: »Der ist ein reicher Mann und genießt die Früchte des Reichtums, der immerdar im Sommer und Winter an seinen eigenen Gedanken sich erfreuen kann. »Seine Einsamkeit«, sagt einer seiner Biographen, »war Selbstverteidigung ohne Zweifel. Sein Genius konnte so wenig wie Schmetterlingsflügel die Berührung rauher Hände vertragen.« Doch je mehr er sich in die Natur versenkte und erkannte, welche Leidenschaften in ihr sich offenbarten, desto mehr empfand er, wie etwas Wildes in ihm selbst sich regte. Er fühlte bisweilen den Drang, ein Murmeltier zu ergreifen und roh zu verzehren. »Ich werde wilder von Tag zu Tage,« steht in einem seiner Briefe, »als ob ich von rohem Fleisch mich nähre, und meine Zahmheit ist nur die Ruhe meiner Unbezähmbarkeit.« Bisweilen sehnt er sich danach, in einer entlegenen Sohle drei Wochen in Kälte und Nässe während eines Sturmes zu sitzen, um seinem Organismus Spannkraft zu geben. Indianer, halbwilde Irländer und Jäger besaßen stets seine Vorliebe. Diese Wildheit war, wie seine Widerspenstigkeit und seine revolutionäre Gesinnung, ein Erbteil französischen Blutes, während in seiner Ehrlichkeit, in der Verachtung jeder Konvention und in seiner Wahrheitsliebe das puritanische Element zum Vorschein kam.
Seiner Familie war er von Herzen zugetan. Kinder liebte er bis zu seinem Todestage. Oft zogen sie in Scharen mit ihm in Wälder und Felder zum Heidelbeersuchen hinaus, und dann wußte der Einsiedler und Philosoph Töne anzuschlagen, die unmittelbar in der Kinder Herzen drangen. Auch hier zeigte sich der einfache Mann als tiefer Psychologe.
Ja, nichts Menschliches war ihm fremd. Er liebte das Leben, die Mutter Erde und all ihre Bewohner. »Die Natur,« sagt er, »hat keinen menschlichen Einwohner, der sie zu schätzen weiß. Der Vögel Gefieder und Gesang harmonieren mit den Blumen.
Doch welcher Jüngling, welches Mädchen versenkt sich mit Inbrunst in die wilde, wonnige Schönheit der Natur? Sie blüht meistens im Verborgenen, fern von den Städten, wo die Menschen wohnen. Schwätzt vom Himmel – Ihr entweiht die Erde!«1
St. Louis, Mo., Januar 1905 Wilhelm Nobbe
Zu dieser Skizze wurden benutzt: Salt: Life of H. D. Thoreau; Stevenson: Familiar Studies of men and books; Lowell: Litterary Essays; Thoreau: Letters to various persons; Page: Thoreau, his life and Aims; Channingz The Poet Naturalist; Burroughs: Literary Values and other papers; Knortz: Geschichte der nordamerikanischen Literatur; Annie Russell Marble: Thoreau and his Friends; Alcott: Concord days; Torrey: Thoreau as a Diarist. (Atlantic Monthly) <<<
Sparsamkeit
Als ich die folgenden Seiten, oder vielmehr den größten Teil derselben schrieb, lebte ich allein im Walde, eine Meile weit von jedem Nachbarn entfernt in einem Hause, das ich selbst am Ufer des Waldenteiches in Concord, Massachusetts, erbaut hatte und erwarb meinen Lebensunterhalt einzig durch meiner Hände Arbeit. Ich lebte dort zwei Jahre und zwei Monate. Jetzt nehme ich wieder am zivilisierten Leben teil.
Ich würde meine Angelegenheiten nicht so sehr der Kenntnis meiner Leser aufdrängen, wenn nicht meine Mitbürger solch genaue Erkundigungen über meine Lebensweise eingezogen hätten, daß mancher ihr Vorgehen wohl als unerträglich bezeichnen würde, während ich es, in Anbetracht der obwaltenden Verhältnisse, als sehr erklärlich und gar leicht erträglich empfand. Die einen fragten, was ich gegessen, ob ich mich einsam gefühlt oder Furcht gehabt habe usw. Andere hätten gern gewußt, welcher Teil meines Einkommens von mir zu Wohltätigkeitszwecken bestimmt gewesen sei, und wieder andere, die große Familien hatten, wollten wissen, wieviel arme Kinder ich unterstützte. Ich bitte deshalb diejenigen meiner Leser, die kein besonderes Interesse für mich fühlen, um Verzeihung, wenn ich es wage einige dieser Fragen in diesem Buche zu beantworten. In den meisten Büchern sucht man das »Ich«, die erste Person, zu vermeiden. Hier will ich sie beibehalten. Das ist, was den Egoismus anbetrifft, der einzige Unterschied. Meistens vergessen wir, daß es doch nur die erste Person ist, die redet. Ich würde nicht so viel über mich selber sprechen, wenn es einen anderen Menschen gäbe, den ich gerade so gut kennen würde. Leider bin ich durch den engen Kreis meiner Erfahrungen auf dieses Thema beschränkt. Überdies verlange ich für meine Person von jedem Schriftsteller als Vorrede oder als Schlußwort einen einfachen und ehrlichen Bericht über sein Leben, und nicht bloß das, was er über anderer Menschen Leben hörte. Einen Bericht, wie er ihn etwa aus fernem Lande an seine Verwandten schicken würde. Denn wenn er ehrlich und lauter gelebt hat, so muß das in einem weit von mir entfernten Lande gewesen sein. Vielleicht sind diese Zeilen hauptsächlich an arme Studenten gerichtet. Meine übrigen Leser müssen sich schon die Stellen, die ihnen genehm sind, aneignen. Ich hoffe zuversichtlich, daß niemand bei der Anprobe die Nähte des Rockes ausdehnt, denn der Rock kann dem, dem er paßt, vielleicht gute Dienste leisten.
Ich möchte gern mancherlei sagen – nicht so viel über die Chinesen und Sandwichsinsulaner als über Euch, die Ihr diese Zeilen lest und die Ihr in Neuengland leben sollt; etwas über Eure Zustände, hauptsächlich über Eure äußeren Zustände oder Verhältnisse in dieser Welt, in dieser Stadt, welcher Art sie sind, ob sie notwendiger Weise so schlecht sein müssen wie sie sind, oder ob sie nicht ebenso leicht verbessert werden könnten wie nicht. Ich bin kreuz und quer in Concord herumgewandert, und überall in den Läden, in den Büros und auf den Feldern gewann ich den Eindruck, daß die Bewohner auf tausendfache, merkwürdige Weise für ihre Sünden büßten. Ich habe gehört, daß die Brahmanen sich der Hitze von vier Feuern aussetzen, ins Antlitz der Sonne schauen, oder daß sie, den Kopf nach unten, über einem Feuer hängen, daß sie über ihre Schulter gen Himmel blicken, »bis es ihnen unmöglich wird ihre natürliche Stellung wieder einzunehmen, während durch die Verdrehung des Halses nur Flüssigkeiten in den Magen gelangen können.« Ich habe gehört, daß sie ihr ganzes Leben angekettet an die Wurzel eines Baumes verbringen, oder daß sie wie Raupen kriechend ungeheure Reiche ausmessen, oder mit einem Fuße auf der Spitze einer Säule stehen. Doch diese Äußerungen bewußter Reue sind kaum unglaublicher oder erstaunlicher als die Szenen, deren Zeuge ich täglich bin. Die zwölf Arbeiten des Herkules waren belanglos im Vergleich mit denen, die meine Nachbarn unternommen haben. Denn Herkules hatte nur zwölf Arbeiten zu verrichten, dann war er fertig. Ich konnte dagegen niemals beobachten, daß diese Menschen ein Ungeheuer erschlugen oder einfingen, oder daß sie irgend eine Arbeit beendigten. Ihnen fehlte der Freund Jolaos, der mit glühendem Eisen den Hals der Hydra versengte. Darum wachsen, sobald ein Kopf zerschmettert ist, zwei neue nach.
Ich sehe junge Leute, meine Mitbürger, deren Unglück es ist, daß sie Bauernhöfe, Häuser, Scheunen, Vieh und Ackergerät geerbt haben. Denn solche Dinge sind leichter erworben als an den Mann gebracht. Es stände besser um sie, wären sie auf offener Weide geboren und von einer Wölfin gesäugt, denn dann würden sie mit klareren Augen erkennen, wo das wahre Feld ihrer Tätigkeit liegt. Wer hieß sie Sklaven des Bodens sein? Warum sollen sie ihre 60 Morgen Land verzehren, wenn ein Mensch doch nur dazu verdammt ist sein Häufchen Schmutz zu essen? Warum sollen sie gleich nach der Geburt damit beginnen ihr Grab zu graben? Sie sollen ein Menschendasein führen, sich dabei mit all diesen Dingen abplagen und so gut wie möglich vorwärts zu kommen versuchen. Wie manche arme unsterbliche Seele kreuzte meinen Weg, fast erdrückt und erstickt unter ihrer Last! Sie kroch des Lebens Gleis hinab und plagte sich mit Ställen ab, die 75 zu 40 Fuß groß waren – mit Augiasställen, die niemals gereinigt wurden, mit hundert Morgen Land, Äckern, Wiesen, Weiden und Waldparzellen! Die Unbegüterten, die sich nicht mit solchen unnötigen, ererbten Fronen herumbalgen, haben genug zu tun ein paar Kubikfuß Fleisch zu beherrschen und zu kultivieren.
Doch die Menschheit krankt an einem Irrtum. Der bessere Teil der Menschen ist bald als Dünger unter den Erdboden gepflügt. Das scheinbare Verhängnis – gewöhnlich Schicksal genannt – heißt sie, wie in einem alten Buche geschrieben steht, Schätze sammeln, welche die Motten und der Rost fressen und denen die Diebe nachgraben und stehlen. Ein Narrenleben haben sie geführt: das wird ihnen am Abend ihres Daseins, vielleicht auch schon früher klar werden. Man erzählt, daß Deukalion und Pyrrha dadurch Menschen erzeugten, daß sie Steine über ihre Häupter hinter sich warfen:
»Inde genus durum sumus, experiensque laborum Et documenta damus quia sumus origine nati.«
(Daher sind wir ein hartes Geschlecht, ausdauernd bei der Arbeit. Und für unsere Abkunft liefern wir selbst den Beweis.)
Raleighs wohlklingende Übersetzung dieser Worte lautet:
From thence our kind hard-hearted is, enduring pain and care, Approving that our bodies of a stony nature are.
So kann es gehen, wenn man einem faselnden Orakel blind gehorcht, Steine über seinen Kopf wirft und nicht sieht wohin sie fallen.
Die meisten Menschen sind, selbst in diesem verhältnismäßig freien Lande, aus reiner Unwissenheit und Verblendung so sehr durch die künstlichen Sorgen und die überflüssigen, groben Arbeiten des Lebens in Anspruch genommen, daß seine edleren Früchte nicht von ihnen gepflückt werden können. Ihre Finger sind durch übermäßige Arbeit zu plump geworden, sie zittern zu sehr bei solchem Beginnen. Tatsächlich hat der arbeitende Mensch Tag für Tag keine Zeit zur inneren Läuterung. Es ist ihm unmöglich die menschlichen Beziehungen zu den Menschen zu unterhalten. Seine Arbeit würde auf dem Markte im Preise sinken. Er hat nur Zeit eine Maschine zu sein. Wie kann der seiner Unwissenheit abhelfen – und das fordert doch seine geistige Weiterentwickelung –, der seine Kenntnisse so oft gebrauchen muß! Wir sollten ihn ab und zu aus eigenem Antrieb ernähren und kleiden, ihm eine Herzerquickung geben, bevor wir ein Urteil über ihn fällen. Die kostbarsten Eigenschaften unseres Wesens können, wie der Flaum der Früchte, nur durch die zarteste Behandlung erhalten bleiben. Doch wir behandeln weder uns selbst noch die andern so zartfühlend.
Einige von Euch sind arm, das wissen wir alle. Einige von Euch haben schwer mit dem Leben zu kämpfen und schnappen, sozusagen, von Zeit zu Zeit nach Luft. Ich bezweifle nicht, daß einige Leser dieses Buches nicht imstande sind alle die Mittagsessen, die sie in Wirklichkeit verzehrten, oder die Kleider und Schuhe, die so schnell sich abnutzen oder schon abgetragen sind, zu bezahlen, daß sie nur deshalb bis hierher gelesen haben, weil sie geliehene oder gestohlene Zeit dazu verwendeten und somit ihre Gläubiger um eine Stunde betrogen. Für mich ist es eine nackte Tatsache, daß manche von Euch ein elendes und niedriges Dasein führen, denn meine Augen sind durch die Erfahrung geschärft. Alle Eure Versuche drehen sich darum, ins Geschäft hinein- oder aus Schulden herauszukommen, aus jenem uralten Moraste, den die Römer aes alienum nannten, eines anderen Kupfer, denn einige ihrer Münzen wurden aus Kupfer verfertigt. Ihr lebt, Ihr sterbt, Ihr werdet begraben durch das Kupfer eines anderen. Immer versprecht Ihr zu bezahlen, morgen zu bezahlen, und dabei sterbt Ihr heute – bankerott. Auf alle Arten versucht Ihr Euch bei anderen einzuschmeicheln, Kundschaft zu bekommen – nur vor Gesetzesübertretungen und Gefängnis hütet Ihr Euch. Ihr lügt, schmeichelt, wählt, kriecht mit Eurer Höflichkeit in ein Schneckenhaus hinein oder dehnt Euch zu einer Wolke seichter und dunstiger Großmut aus, um Euren Nachbarn zu bewegen Euch seine Schuhe oder seinen Hut, seinen Anzug oder seinen Wagen machen zu lassen oder seinen Gewürzkram für ihn importieren zu dürfen. Ihr macht Euch krank, damit Ihr etwas für Eure kranken Tage zusammenspart, etwas, was man in einer alten Truhe oder in einem Strumpf hinter dem Wandbewurf, oder um noch sicherer zu gehen, bei einem Bankier versteckt – einerlei wo, einerlei wieviel oder wie wenig.
Ich wundere mich manchmal darüber, daß wir – ich möchte fast sagen – so frivol sein können, uns um die schmutzige, aber etwas ferner liegende Form der Sklaverei, um die sogenannte Negersklaverei zu kümmern. Gibt es doch viele schlaue und findige Sklavenhalter gerade so gut im Norden wie im Süden. Es ist hart einem südlichen, härter einem nördlichen Sklavenaufseher zu unterstehen. Am schlimmsten aber ist es um den bestellt, der sein eigener Sklaventreiber ist. Da schwätzt man vom Göttlichen im Menschen! Schaut Euch den Fuhrmann auf der Landstraße an, der zu Markte fährt bei Tag oder bei Nacht. Offenbart sich in ihm die Gottheit? Seine höchste Pflicht heißt: Füttere und tränke deine Pferde! Was gilt ihm mehr – sein Schicksal oder der Frachtverkehr? Fährt er nicht für Herrn »Nimmerrast«? Inwiefern ist er gottähnlich, inwiefern unsterblich? Seht nur, wie er sich bückt und kriecht, wie er sich planlos den lieben langen Tag quält, er der weder unsterblich noch göttlich ist, sondern nur der Gefangene und Sklave des Bildes, das er von sich selbst entwarf, und das auf seinen Taten fußt. Die öffentliche Meinung ist ein schwacher Tyrann im Vergleich zu unserer eigenen Privatmeinung. Was ein Mensch von sich selbst denkt, das ist es, wodurch sein Schicksal bestimmt oder vielmehr prophezeit wird. Wo ist der Wilberforce,1 der es vermag, selbst in den westindischen Gebieten einer launenhaften Phantasie Selbstbefreiung durchzusetzen? Man möge ferner an die Damen des Landes denken, die bis zum letzten Tage Toilettenkissen sticken, nur um kein allzu lebhaftes Interesse an ihrem Schicksal zu verraten! Als ob es möglich wäre die Zeit totzuschlagen, ohne die Ewigkeit zu verletzen.
Die Mehrzahl der Menschen verbringt ihr Leben in stiller Verzweiflung. Was wir »Resignation« nennen ist absolute Verzweiflung. Von der verzweifelten Stadt zieht man aufs verzweifelte Land hinaus. Dort tröstet man sich mit der Tapferkeit der Sumpfotter und der Moschusratte. Eine stereotype, wenn auch unbewußte Verzweiflung ist selbst hinter den sogenannten Vergnügungen und Unterhaltungen der Menschheit verborgen. Da kann von Vergnügen nicht die Rede sein, denn das kommt nach der Arbeit. Für den Weisen ist es charakteristisch, daß er nichts Verzweifeltes unternimmt.
Wenn wir uns überlegen, was (um die Worte des Katechismus zu gebrauchen) die Hauptbestimmung des Menschen ist und worin die notwendigen Lebensbedürfnisse wirklich bestehen, so scheint es, als ob die Menschen nach reifer Überlegung die ordinäre Art zu leben gewählt hätten, weil sie ihr vor jeder anderen den Vorzug geben. Sie glauben allen Ernstes keine Wahl zu haben. Frische und gesunde Naturen erinnern sich dagegen, daß die Sonne klar aufging. Es ist niemals zu spät unsere Vorurteile aufzugeben. Auf keine Folge von Gedanken oder Taten, einerlei wie alt, kann man sich ohne Prüfung verlassen. Was jedermann nachbetet oder mit Stillschweigen als wahr dahingehen läßt, kann morgen als falsch sich erweisen – als bloßer Ansichtsdunst, den manche für eine Wolke hielten, die befruchtenden Regen auf ihre Felder ergießen würde. Was alte Leute für unausführbar halten, wir versuchen es, wir finden, daß es ausgeführt werden kann. Alte Taten für alte Leute, neue Taten für die neuen! Einst genügte das Wissen unserer Ahnen nicht, um Brennmaterial zum Unterhalten des Feuers zu sammeln. Die Menschen von heute legen ein wenig trockenes Reisig unter einen Kessel und sausen um den Erdball so schnell wie die Vögel. Den Alten würde dabei, wie man sagt, angst und bange werden. Das Alter ist nicht besser, ja kaum so gut zum Lehrmeister geeignet als die Jugend. Denn es hat nicht soviel gewonnen als es verlor. Man kann mit Recht bezweifeln, ob der weiseste Mensch irgend etwas von absolutem Wert durch das Leben gelernt hat.
In Wirklichkeit vermögen die Alten der Jugend keinen wertvollen Rat zu geben. Ihre eigenen Erfahrungen sind Stückwerk geblieben, ihr Leben ist – aus persönlichen Gründen wie sie natürlich glauben– ein solch kläglicher Mißerfolg gewesen. Und doch ist es möglich, daß sie noch etwas Selbstvertrauen übrig haben, welches diese Erfahrung Lügen straft. Sie sind ja nur weniger jung als sie gewesen sind. Ich habe einige dreißig Jahre auf diesem Planeten zugebracht, und doch habe ich bislang noch nicht die erste Silbe eines wertvollen oder selbst ernsthaften Ratschlages von meinen älteren Mitmenschen gehört. Sie haben mir nichts Zweckentsprechendes gesagt, sind dazu auch wahrscheinlich nicht imstande. Hier ist das Leben – ein im wesentlichen von mir noch nicht versuchtes Experiment. Daß sie es versuchten, nützt mir nichts. Zu irgend einer Erfahrung, die ich für wertvoll halte, haben meine Ratgeber, nach meiner Überzeugung, nichts zu sagen gehabt.