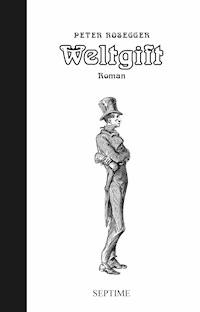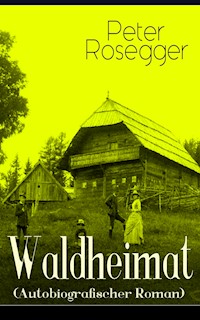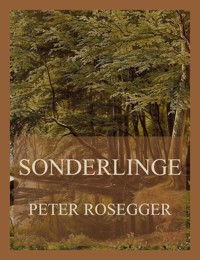Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Styria Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peter Roseggers Klassiker erstmals in verlässlicher Textfassung. Mit Materialien zum biografischen, werkgeschichtlichen und politischen Kontext. Mit keinem anderen Werk hat Peter Rosegger eine solche Breitenwirkung erzielt wie mit diesen anekdotisch-pointierten Geschichten aus seiner bäuerlichen Herkunftswelt. Noch zu Lebzeiten wurde »Waldheimat« zu einer Bezeichnung für die obersteirische Region. Er etablierte sich als »heimlicher Erzieher« und Lesebuchklassiker, festigte damit aber auch das Klischee vom unbedarften »Gschichtelerzähler« (Hermann Broch). Die Neuausgabe bricht dieses Klischee auf, macht Manipulationen an den Texten sichtbar und stellt die erzählte Kindheitswelt in ihren historischen Kontext.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ausgewählte Werke in Einzelbänden
Mit Materialien, Kommentar und Nachwort,
herausgegeben von Daniela Strigl und Karl Wagner
Band 1
Peter Rosegger
Waldheimat
Erzählungen
aus der Jugendzeit
Ausgewählt, kommentiert
und mit einem Nachwort
von Karl Wagner
Erster Teil
VOM URGROSSVATER, DER AUF DER TANNE SASS
Eine Rückschau, nach der Erzählung meines Vaters
An die Felder meines Vaters grenzte der Ebenwald, der sich über Höhen weithin gegen Mitternacht erstreckte und dort mit den Hochwaldungen des Heugrabens und des Teufelsteins zusammenhing. Zu meiner Kindeszeit ragte über die Fichten- und Lärchenwipfel dieses Waldes das Gerippe einer Tanne empor, auf welcher der Sage nach vor mehreren hundert Jahren, als der Türke im Lande war, der Halbmond geprangt haben und unter welcher viel Christenblut geflossen sein soll.
Mich überkam immer ein Schauern, wenn ich von den Feldern und Weiden aus dieses Tannengerippe sah; es ragte so hoch über den Wald und streckte seine langen, dürren, wildverworrenen Äste so wüst gespensterhaft aus, daß es ein unheimlicher Anblick war. Nur an einem einzigen Aste wucherten noch einige dunkelgrüne Nadelballen, über diese ragte der scharfkantige Strunk, auf dem einst der Wipfel gesessen. Den Wipfel mußte der Sturm oder ein Blitzstrahl geknickt haben, niemand erinnerte sich, ihn auf dem Baume gesehen zu haben.
Von der Ferne, wenn ich auf dem Stoppelfelde die Rinder oder die Schafe weidete, sah ich die Tanne gern an; sie stand in der Sonne rötlich beleuchtet über dem frischgrünen Waldessaume, und war klar und rein in die Bläue des Himmels hineingezeichnet. Dagegen stand sie an bewölkten Tagen, oder wenn ein Gewitter heranzog, starr und dunkel da; und wenn im Walde weit und breit alle Äste fächelten und sich die Wipfel tief neigten vor dem Sturme, so stand sie still, ohne Regung und Bewegung.
Wenn sich aber ein Rind in den Wald verlief und ich, es zu suchen, an der Tanne vorüber mußte, so schlich ich gar angstvoll dahin und dachte an den Halbmond, an das Christenblut und an andere entsetzliche Geschichten, die man von diesem Baume erzählte. Ich wunderte mich aber auch über die Riesigkeit des Stammes, der auf der einen Seite kahl und von vielen Spalten durchfurcht, auf der anderen aber mit rauhen, zersprungenen Rinden bedeckt war. Der unterste Teil des Stammes war so dick, daß ihn zwei Männer nicht hätten zu umspannen vermocht. Die ungeheuren Wurzeln, welche zum Teile kahl dalagen, waren ebenso ineinander verschlungen und verknöchert wie das Geäste oben.
Man nannte den Baum die Türkentanne oder auch die graue Tanne. Von einem starrsinnigen oder hochmütigen Menschen sagte man in der Gegend: „Der tut, wie wenn er die Türkentanne als Hutsträußl hätt’!“ Und heute, da der Baum schon längst zusammengebrochen und vermodert, ist das Sprüchlein in manchem alten Munde noch lebendig.
In der Kornernte, wenn die Leute meines Vaters, und er voran, der Reihe nach am wogenden Getreide standen und die „Wellen“ herausschnitten, mußte ich auf bestimmte Plätze die Garben zusammentragen, wo sie dann zu je zehn in „Deckeln“ zum Trocknen aufgeschobert wurden. Mir war das nach dem steten Viehhüten ein angenehmes Geschäft, um so mehr, als mir der Altknecht oft zurief: „Trag’ nur, Bub’ und sei fleißig; die Zusammentrager werden reich!“ Ans Reichwerden dachte ich nicht, aber das Laufen war lustig. Und so lief ich mit den Garben, bis mein Vater mahnte: „Bub’ du rennst ja wie närrisch! Du trittst Halme in den Boden und du beutelst Körner aus. Laß dir Zeit!“
Als es aber gegen Abend und in die Dämmerung hineinging und als sich die Leute immer weiter und weiter in das Feld hineingeschnitten hatten, so daß ich mit meinen Garben weit zurückblieb, begann ich unruhig zu werden. Besonders kam es mir vor, als fingen dort die Äste der Türkentanne, die in unsicheren Umrissen in den Abendhimmel hineinstand, sich zu regen an. Ich redete mir zwar ein, es sei nicht so, und wollte nicht hinsehen – da hüpften meine Äuglein schon wieder hinüber.
Endlich, als die Finsternis für das Kornschneiden zu groß wurde, wischten die Leute mit taunassem Grase ihre Sicheln ab und kamen zu mir herüber und halfen mir unter lustigem Sang und Scherz die letzten Garben zusammentragen. Als wir damit fertig waren, gingen die Knechte und Mägde davon, um in Haus und Hof noch die abendlichen Verrichtungen zu tun; ich und mein Vater aber blieben zurück auf dem Kornfelde. Wir schoberten die Garben auf, wobei der Vater diese halmaufwärts aneinanderlehnte und ich sie zusammenhalten mußte, bis er aus einer letzten Garbe den Deckel bog und ihn auf den Schober stülpte.
Dieses Schöbern war mir in meiner Kindheit die liebste Arbeit; ich betrachtete dabei die „Romstraße“ am Himmel, die hinschießenden Sternschnuppen und die Johanniswürmchen, die wie Funken um uns herumtanzten, daß ich meinte, die Garben müßten zu brennen anfangen. Dann horchte ich wieder auf das Zirpen der Grillen, und ich fühlte den kühlen Tau, der gleich nach Sonnenuntergang die Halme und Gräser und gar auch ein wenig mein Jöpplein befeuchtete. Ich sprach über all das mit meinem Vater, der mir in seiner ruhigen, gemütlichen Weise Auskunft gab und über alles seine Meinung sagte, wozu er jedoch oft bemerkte, daß ich mich darauf nicht verlassen solle, weil er es nicht gewiß wisse.
So kurz und ernst mein Vater des Tages in der Arbeit gegen mich gewesen, so heiter, liebevoll und gemütlich war er in solchen Abendstunden. Vor allem half er mir immer meine kleine Jacke anziehen, daß mir nicht kühl werde. Wenn ich ihn mahnte, daß auch er sich den Rock zuknöpfen möge, sagte er stets: „Kind, mir ist warm genug.“ Ich hatte es oft bemerkt, wie er nach dem langen, schwierigen Tagewerk erschöpft war, wie er sich dann für Augenblicke auf eine Garbe niederließ und die Stirne trocknete. Er war durch eine langwierige Krankheit recht erschöpft worden; er wollte aber nie etwas davon merken lassen. Er dachte nicht an sich, er dachte an unsere Mutter, an uns Kinder und an den durch Unglücksfälle herabgekommenen Bauernhof, den er uns retten wollte.
Wir sprachen beim Schöbern oft von unserem Hofe, wie er zu meines Großvaters Zeiten gar reich und angesehen gewesen und wie er wieder reich und angesehen werden könne, wenn wir Kinder, einst erwachsen, eifrig und fleißig in der Arbeit sein würden, und wenn wir Glück hätten.
In solchen Stunden beim Kornschöbern, das oft spät in die Nacht hinein währte, sprach mein Vater mit mir auch gern von dem lieben Gott. Er war vollständig ungeschult und kannte keine Buchstaben; so mußte denn ich ihm stets erzählen, was ich da und dort von dem lieben Gott schon gehört oder endlich auch gelesen hatte. Besonders wußte ich dem Vater manches zu berichten von der Geburt des Herrn Jesus, wie er in der Krippe eines Stalles lag, wie ihn die Hirten besuchten und mit Lämmern, Böcken, und anderen Dingen beschenkten, wie er dann groß wurde und Wunder wirkte und wie ihn die Juden peinigten und ans Kreuz schlugen. Gern erzählte ich auch von der Schöpfung der Welt, den Patriarchen und Propheten, als wäre ich dabei gewesen. Dann sprach ich auch aus, was ich vernommen von dem jüngsten Tage, von dem Weltgerichte und von den ewigen Freuden, die der liebe Gott für alle armen, kummervollen Menschen in seinem Himmel bereitet hat.
Der Vater war davon oft sehr ergriffen.
Ein anderes Mal erzählte wieder mein Vater. Er wußte wunderbare Dinge aus den Zeiten der Ureltern, wie diese gelebt, was sie erfahren und was sich in diesen Gegenden einst für Sachen zugetragen, die sich in den heutigen Tagen nicht mehr ereignen.
„Hast du noch nie darüber nachgedacht“, sagte mein Vater einmal, „warum die Sterne am Himmel stehen?“
„Nein“, antwortete ich.
„Wir denken nicht daran“, sprach mein Vater weiter, „weil wir das schon so gewöhnt sind.“
„Es wird wohl eine Zeit kommen, Vater“, sagte ich einmal, „in welcher kein Stern mehr am Himmel steht; in jeder Nacht fallen so viele herab.“
„Die da herabfallen, mein Kind“, sprach der Vater, „das sind Menschensterne. Stirbt auf der Erde ein Mensch, so fällt vom Himmel so eine Sternreispe auf die Erden. Siehst du, dort hinter der grauen Tanne ist just wieder eine niedergegangen.“
Ich schwieg nach diesen Worten eine Weile, endlich aber fragte ich: „Warum heißen sie jenen wilden Baum die graue Tanne, Vater?“
Mein Vater bog eben einen Deckel ab, und als er diesen aufgestülpt hatte, sagte er: „Du weißt, daß man ihn auch Türkentanne nennt, weil der schreckbare Türk einmal seine Mondsichel hat draufgehangen. Die graue Tanne heißen sie ihn, weil sein Geäste und sein Moos grau ist, und weil auf diesem Baume dein Urgroßvater die ersten grauen Haare bekommen hat.“
„Mein Urgroßvater? Wie ist das hergegangen?“
„Ja“, sagte er, „wir haben hier noch sechs Deckel aufzusetzen, und ich will dir dieweilen eine Geschichte erzählen, die sehr merkwürdig ist.“
Und dann hub er an: „Es ist schon länger als achtzig Jahre, seitdem dein Urgroßvater meine Großmutter geheiratet hat. Er war sehr reich und ein schöner Mensch und er hätte die Tochter des angesehensten Bauers zum Weib bekommen können. Er nahm aber ein armes Mädchen aus der Waldhütten herab, das gut und sittsam gewesen ist. Von heute in zwei Tagen ist der Vorabend des Festes Mariä Himmelfahrt; das ist der Jahrestag, an welchem dein Urgroßvater zur Werbung in die Waldhütten ging. Es mag wohl auch im Kornschneiden gewesen sein; er machte frühzeitig Feierabend, weil durch den Ebenwald hinein und bis zur Waldhütten hinauf ein weiter Weg ist. Er brachte viel Bewegung mit in die kleine Wohnung. Der alte Waldhütter, der für die Köhler und Holzleute die Schuhe flickte, ihnen zuzeiten die Sägen und die Beile schärfte und nebenbei Fangschlingen für Raubtiere machte – weil es zur selben Zeit in der Gegend noch viele Wölfe gegeben hat – der Waldhütter nun ließ seine Arbeit aus der Hand fallen und sagte zu deinem Urgroßvater: ,Aber Josef, das kann doch nicht dein Ernst sein, daß du mein Katherl zum Weib haben willst, das wär’ ja gar aus der Weis’!’ Dein Urgroßvater sagte: ‚Ja, deswegen bin ich heraufgegangen, und wenn mich das Katherl mag und es ist ihr und Euer redlicher Willen, daß wir zusammen in den Ehestand treten, so machen wir’s heut’ richtig und wir gehen morgen zum Richter und zum Pfarrer und ich laß dem Katherl mein Haus und Hof verschreiben, wie’s Recht und Brauch ist.’ – Das Mädel hatte deinen Urgroßvater lieb und sagte, es wolle seine Hausfrau werden. Dann verzehrten sie zusammen ein kleines Mahl und endlich, als es schon zu dunkeln begann, trat der jung’ Bräutigam den Heimweg an.
Er ging über die Wiese, die vor der Waldhütten lag, auf der aber jetzt schon die großen Bäume stehen, er ging über das Geschläge und abwärts durch den Wald und er war freudig. Er achtete nicht darauf, daß es bereits finster geworden war, und er achtete nicht auf das Wetterleuchten, das zur Abendzeit nach einem schwülen Sommertag nichts Ungewöhnliches ist. Auf eines aber wurde er aufmerksam, er hörte von den gegenüberliegenden Waldungen ein Gebelle. Er dachte an Wölfe, die nicht selten in größeren Rudeln die Wälder durchzogen und heulten; er faßte seinen Knotenstock fester und nahm einen schnelleren Schritt. Dann hörte er wieder nichts als zeitweilig das Kreischen eines Nachtvogels, und sah nichts, als die dunkeln Stämme, zwischen welche der Fußsteig führte und durch welche von Zeit zu Zeit das Leuchten zuckte. Plötzlich vernahm er wieder das Heulen, aber nun viel näher als das erstemal. Er fing zu laufen an. Er lief, was er konnte; er hörte keinen Vogel mehr, er hörte nur immer das entsetzliche Heulen, das ihm auf dem Fuße folgte. Als er hierauf einmal umsah, bemerkte er hinter sich durch das Geäst funkelnde Lichter. Schon hört er das Schnaufen und Lechzen der Raubtiere, die ihn verfolgen, und denkt: ’s mag sein, daß morgen kein Versprechen ist beim Pfarrer! – da kommt er heraus zur Türkentanne. Kein anderes Entkommen mehr möglich – rasch faßt er den Gedanken und durch einen kühnen Sprung schwingt er sich auf einen Ast. Die Bestien sind schon da; einen Augenblick stehen sie bewegungslos und lauern; sie gewahren ihn auf dem Baum, sie schnaufen und mehrere setzen die Pfoten an den Stamm. Dein Urgroßvater klettert weiter hinauf und setzt sich auf einen dicken Ast. Nun ist er wohl sicher. Unten heulen sie und scharren an der Rinde; – es sind ihrer viele, ein ganzes Rudel. Zur Sommerszeit war es doch selten geschehen, daß Wölfe einen Menschen anfielen; sie mußten gereizt oder von irgendeiner anderen Beute verjagt worden sein. Dein Urgroßvater saß lange auf dem Ast; er hoffte, die Tiere würden davonziehen und sich zerstreuen. Aber sie umringten die Tanne und schnürfelten und heulten. Es war längst schon finstere Nacht; gegen Mittag und Morgen hin leuchteten alle Sterne, gegen Abend hin aber war es grau und durch dieses Grau schossen Blitzscheine. Sonst war es still und regte sich im Walde kein Ästchen. Dein Urgroßvater wußte nun wohl, daß er die ganze Nacht so würde zubringen müssen; er besann sich aber doch, ob er nicht Lärm machen und um Hilfe rufen sollte. Er tat es, aber die Bestien ließen sich nicht verscheuchen; kein Mensch war in der Nähe, das Haus zu weit entfernt. Damals hatte die Türkentanne unter dem abgerissenen Wipfelstrunk, wo heute die wenigen Reiserbüschel wachsen, noch eine dichte Krone aus grünenden Nadeln. Da denkt sich dein Urgroßvater: ,Wenn ich denn schon einmal hier Nachtherberge nehmen soll, so klimme ich noch weiter hinauf unter die Krone.’ Er tat’s und ließ sich oben in einer Zweigung nieder, da konnte er sich recht gut an die Äste lehnen.
Unten ist’s nach und nach ruhiger, aber das Wetterleuchten wird stärker und an der Abendseite ist ein fernes Donnern zu hören. – Wenn ich einen tüchtigen Ast bräche und hinabstiege und einen wilden Lärm machte und gewaltig um mich schlüge, man meint’, ich müßt’ den Rabenäsern entkommen! so denkt dein Urgroßvater – tut’s aber nicht; er weiß zu viele Geschichten, wie Wölfe trotz alledem Menschen zerrissen haben.
Das Donnern kommt näher, alle Sterne sind verloschen – ’s ist finster wie in einem Ofen; nur unten am Fuße des Baumes funkeln die Augensterne der Raubtiere. Wenn es blitzt, steht wieder der ganze Wald da. Nun beginnt es zu sieden und zu kochen im Gewölke wie in tausend Kesseln. Kommt ein fürchterliches Gewitter, denkt sich dein Urgroßvater und verbirgt sich unter die Krone, so gut er kann. Der Hut ist ihm hinabgefallen und er hört es, wie die Bestien den Filz zerfetzen. Jetzt zuckt ein Strahl über den Himmel, es ist einen Augenblick hell, wie zur Mittagsstunde – dann bricht in den Wolken ein Schnalzen und Krachen los, und weithin hallt es im Gewölke.
Jetzt ist es still, still in den Wolken, still auf der Erden – nur um einen gegenüberliegenden Wipfel flattert ein Nachtvogel. Aber bald erhebt sich der Sturm, es rauscht in den Bäumen, es tost durch die Äste, eiskalt ist der Wind. Dein Urgroßvater klammert sich fest an das Geäste. Jetzt wieder ein Blitz, schwefelgrün ist der Wald; alle Wipfel neigen sich, biegen sich tief; die nächststehenden Bäume schlagen an die Tanne, es ist, als fielen sie heran. Aber die Tanne steht starr und ragt über den ganzen Wald. Unten rennen die Raubtiere wild durcheinander und heulen. Plötzlich saust ein Körper durch die Äste wie ein Steinwurf. Da leuchtet es wieder – ein weißer Knollen hüpft auf dem Boden dahin. Dann dichte Nacht. Es braust, siedet, tost, krachend stürzen Wipfel. Ein Ungeheuer mit weitschlagenden Flügeln, im Augenblicke des Blitzes gespenstige Schatten werfend, naht in der Luft, stürzt der Tanne zu und birgt sich gerade über deinem Urgroßvater in die Krone. Ein Habicht, Junge, ein Habicht, der auf der Tanne sein Nest gehabt.“
Mein Vater hatte bei dieser Erzählung keine Garbe angerührt; ich hatte den ruhigen, schlichten Mann bisher auch nie mit solcher Lebhaftigkeit sprechen gehört.
„Wie’s weiter gewesen?“ fuhr er fort. „Ja, nun brach es erst los; das war Donnerschlag auf Donnerschlag, und beim Leuchten war zu sehen, wie glühenden Wurfspießen gleich Eiskörner auf den Wald niedersausten, an die Stämme prallten, auf den Boden flogen und wieder emporsprangen. So oft ein Hagelknollen an den Stamm der Tanne schlug, gab es im ganzen Baume einen hohlen Schall. Und über dem Heugraben gingen Blitze nieder; plötzlich war eine blendende Glut, ein heißer Luftschlag, ein Schmettern, und es loderte eine Fichte. Und die Türkentanne stand da, und dein Urgroßvater saß unter der Krone im Astwerk.
Die brennende Fichte warf weithin ihren Schein und nun war zu sehen, wie ein rötlicher Schleier lag über dem Walde, wie nach und nach das Gewebe der kreuzenden Eisstücke dünner und dünner wurde, und wie viele Wipfel keine Äste, dafür aber Schrammen hatten, wie endlich der Sturm in einen mäßigen Wind überging und ein dichter Regen rieselte.
Die Donner wurden seltener und dumpfer und zogen sich gegen Mittag dahin; aber die Blitze leuchteten noch ununterbrochen. Am Fuße des Baumes war kein Heulen und kein Augenfunkeln mehr. Die Raubtiere waren durch das Wetter verscheucht worden. Also stieg dein Urgroßvater wieder von Ast zu Ast bis zum Boden. Und er ging heraus durch den Wald über die Felder gegen das Haus.
Es ist schon nach Mitternacht. – Als der Bräutigam zum Hause kommt und kein Licht in der Stube sieht, wundert er sich, daß in einer solchen Nacht die Leute ruhig schlafen können. Haben aber nicht geschlafen, waren zusammen gewesen in der Stube um ein Kerzenlicht. Sie hatten nur die Fenster mit Brettern verlehnt, weil der Hagel alle Scheiben eingeschlagen hatte.
,Bist in der Waldhütten blieben, Sepp?‘ sagte deine Ururgroßmutter. Dein Urgroßvater antwortete: ,Nein, Mutter, in der Waldhütten nicht.‘
Es war an dem darauffolgenden Morgen ein starker Harzduft gewesen im Walde – die Bäume haben geblutet aus vielen Wunden. Und es war ein beschwerliches Gehen gewesen über die Eiskörner und es war eine kalte Luft. Als sie am Frauentag alle über die Verheerung und Zerstörung hin zur Kirche gingen, fanden sie im Walde unter dem herabgeschlagenen Reisig und Moos manchen toten Vogel und anderes Getier; unter einem geknickten Wipfel lag ein toter Wolf.
Dein Urgroßvater ist bei diesem Gange sehr ernst gewesen; da sagt auf einmal das Katherl von der Waldhütten zu ihm: ,O, du himmlisch’ Mirakel! Sepp, dir wachst ja schon graues Haar!‘
Später hatte er alles erzählt, und nun nannten die Leute den Baum, auf dem er dieselbige Nacht hat zubringen müssen, die graue Tanne!“ –
Das ist die Geschichte, wie sie mir mein Vater eines Abends beim Kornschöbern erzählt hat und wie ich sie später aus meiner Erinnerung niedergeschrieben. Als wir dann nach Hause gingen zur Abendsuppe und zur Nachtruhe, blickte ich noch hin auf den Baum, der hoch über dem Wald in den dunkeln Abendhimmel hineinstand.
*
Ich war schon erwachsen. Da war es in einer Herbstnacht, daß mich mein Vater aufweckte und sagte: „Wenn du die graue Tanne willst brennen sehen, so geh’ vor das Haus!“
Und als ich vor dem Hause stand, da sah ich über dem Walde eine hohe Flamme lodern und aus derselben qualmte Rauch in den Sternenhimmel auf. Wir hörten das Dröhnen der Flammen und wir sahen das Niederstürzen einzelner Äste; dann gingen wir wieder zu Bette. Am Morgen stand über dem Wald ein schwarzer Strunk mit nur wenigen Armen – und hoch am Himmel kreiste ein Geier.
Wir wußten nicht, wie sich in der stillen, heiteren Nacht der Baum entzündete, und wir wissen es noch heute nicht. In der Gegend ist vieles über dieses Ereignis gesprochen worden und man hat demselben Wunderliches und Bedeutsames zugrunde gelegt. Noch einige Jahre starrte der schwarze Strunk gegen den Himmel, dann brach er nach und nach zusammen und nun stand nichts mehr empor über dem Wald. Auf dem Stocke und auf den letzten Resten des Baumes, die langsam in die Erde sinken und vermodern, wächst Moos.
UMS VATERWORT
Ich habe im Grunde keine schlechte Erziehung genossen, sondern gar keine. War ich ein braves, frommes, folgsames, anstelliges Kind, so lobten mich meine Eltern; war ich das Gegenteil, so zankten sie mich derb aus. Das Lob tat mir fast allezeit wohl, und ich hatte dabei das Gefühl, als ob ich in die Länge ginge, weil manche Kinder wie Pflanzen sind, die nur bei Sonnenschein schlank wachsen.
Nun war mein Vater aber der Ansicht, daß ich nicht allein in die Länge, sondern auch in die Breite wachsen müsse, und dafür sei der Ernst und die Strenge gut.
Meine Mutter hatte nichts als Liebe. Liebe braucht keine Rechtfertigung, aber die Mutter sagte: wohlgeartete Kinder würden durch Strenge leicht verdorben, die Strenge bestärke den in der Jugend stets vorhandenen Trotz, weil sie ihm fort und fort neue Nahrung gebe. Er schlummere zwar lange, so daß es den Anschein habe, die Strenge wirke günstig, aber sei das Kind nur erst erwachsen, dann tyrannisiere es jene, von denen es in seiner Hilflosigkeit selbst tyrannisiert worden sei. Hingegen lege die liebevolle Behandlung den Widerspruchsgeist schon beizeiten lahm; Kindesherzen seien wie Wachs, ein Stück Wachs lasse sich nur um die Finger wickeln, wenn es erwärmt sei.
Mein Vater war von einer abgrundtiefen Güte, wenn er aber Bosheit witterte oder auch nur Dummheit, da konnte er scharf werden. Es dauerte aber nie lange. Er verstand es nur nicht immer, das rechte Wort zu sagen. Bei all seiner Milde hatte der mit Arbeit und Sorgen beladene Mann ein stilles, ernstes Wesen; seinen reichen Humor ließ er vor mir erst später spielen, als er vermuten konnte, daß ich genug Mensch geworden sei, um denselben aufzunehmen. In den Jahren, da ich das erste Dutzend Hosen zerriß, gab er sich nicht just viel mit mir ab, außer wenn ich etwas Unbraves angestellt hatte. In diesem Falle ließ er seine Strenge walten. Seine Strenge und meine Strafe bestand gewöhnlich darin, daß er vor mich hintrat und mir mit zornigen Worten meinen Fehler vorhielt und die Strafe andeutete, die ich verdient hätte.
Ich hatte mich beim Ausbruche der Erregung allemal vor den Vater hingestellt, war mit niederhängenden Armen wie versteinert vor ihm stehengeblieben und hatte ihm während des heftigen Verweises unverwandt in sein zorniges Angesicht geschaut. Ich bereute in meinem Inneren den Fehler stets, ich hatte das deutliche Gefühl der Schuld, aber ich erinnere mich auch an eine andere Empfindung, die mich bei solchen Strafpredigten überkam: es war ein eigenartiges Zittern in mir, ein Reiz- und Lustgefühl, wenn das Donnerwetter so recht auf mich niederging. Es kamen mir die Tränen in die Augen, sie rieselten mir über die Wangen, aber ich stand wie ein Bäumlein, schaute den Vater an und hatte ein unerklärliches Wohlgefühl, das in dem Maße wuchs, je länger und je ausdrucksvoller mein Vater vor mir wetterte.
Wenn hierauf Wochen vorbeigingen, ohne daß ich etwas heraufbeschwor, und mein Vater immer an mir vorüberschritt, als wäre ich gar nicht vorhanden, und nichts und nichts zu mir sagte, da begann in mir allmählich wieder der Drang zu erwachen und zu reifen, etwas anzustellen, was den Vater in Zorn bringe. Das geschah nicht, um ihn zu ärgern, denn ich hatte ihn überaus lieb; es geschah gewiß nicht aus Bosheit, sondern aus einem anderen Grunde, dessen ich mir damals nicht bewußt gewesen bin.
Da war es einmal am heiligen Christabend. Der Vater hatte den Sommer zuvor in Mariazell ein schwarzes Kruzifixlein gekauft, an welchem ein aus Blei gegossener Christus und die aus demselben Stoffe gebildeten Marterwerkzeuge hingen. Dieses Heiligtum war in Verwahrung geblieben bis auf den Christabend, an welchem es mein Vater aus seinem Gewandkasten hervornahm und auf das Hausaltärchen stellte. Ich nahm die Stunde wahr, da meine Eltern und die übrigen Leute noch draußen in den Wirtschaftsgebäuden und in der Küche zu schaffen hatten, um das hohe Fest vorzubereiten; ich nahm das Kruzifixlein mit Gefahr meiner geraden Glieder von der Wand, hockte mich damit in den Ofenwinkel und begann es zu verderben. Es war mir eine ganz seltsame Lust, als ich mit meinem Taschenfeitel zuerst die Leiter, dann die Zange und den Hammer, hernach den Hahn des Petrus und zuletzt den lieben Christus vom Kreuze löste. Die Teile kamen mir nun getrennt viel interessanter vor als früher im Ganzen; doch jetzt, da ich fertig war, die Dinge wieder zusammensetzen wollte, aber nicht konnte, fühlte ich in der Brust eine Hitze aufsteigen, auch meinte ich, es würde mir der Hals zugebunden. – Wenn’s nur beim Ausschelten bleibt diesmal …? – Zwar sagte ich mir: das schwarze Kreuz ist jetzt schöner als früher; in der Hohenwanger Kapelle steht auch ein schwarzes Kreuz, wo nichts dran ist, und gehen doch die Leute hin, zu beten. Und wer braucht zu Weihnachten einen gekreuzigten Herrgott? Da muß er in der Krippe liegen, sagt der Pfarrer. Und das will ich machen.
Ich bog dem bleiernen Christus die Beine krumm und die Arme über die Brust und legte ihn in das Nähkörbchen der Mutter und stellte so mein Kripplein auf den Hausaltar, während ich das Kreuz in dem Stroh des Elternbettes verbarg, nicht bedenkend, daß das Körbchen die Kreuzabnahme verraten müsse.
Das Geschick erfüllte sich bald. Die Mutter bemerkte es zuerst, wie närrisch doch heute der Nähkorb zu den Heiligenbildern hinaufkäme?
„Wem ist denn das Kruzifixlein da oben im Weg gewesen?“ fragte gleichzeitig mein Vater.
Ich stand etwas abseits und mir war zumute, wie einem Durstigen, der jetzt starken Myrrhenwein zu trinken kriegen sollte. Indes mahnte mich eine absonderliche Beklemmung, jetzt womöglich noch weiter in den Hintergrund zu treten.
Mein Vater ging auf mich zu und fragte fast bescheidentlich, ob ich nicht wisse, wo das Kreuz hingekommen sei? Da stellte ich mich schon kerzengerade vor ihn hin und schaute ihm ins Gesicht. Er wiederholte seine Frage; ich wies mit der Hand gegen das Bettstroh, es kamen die Tränen, aber ich glaube, daß ich keinen Mundwinkel verzogen habe.
Der Vater suchte das Verborgene hervor und war nicht zornig, nur überrascht, als er die Mißhandlung des Heiligtums sah. Mein Verlangen nach dem Myrrhenwein steigerte sich. Der Vater stellte das kahle Kruzifixlein auf den Tisch. „Nun sehe ich wohl“, sagte er mit aller Gelassenheit und langte seinen Hut vom Nagel. „Nun sehe ich wohl, er muß endlich rechtschaffen gestraft werden. Wenn einmal der Christi-Herrgott nicht sicher geht … Bleib’ mir in der Stuben, Bub!“ fuhr er mich finster an und ging dann zur Tür hinaus.
„Spring’ ihm nach und schau’ zum Bitten!“ rief mir die Mutter zu, „er geht Birkenruten schneiden.“
Ich war wie an den Boden geschmiedet. Gräßlich klar sah ich, was nun über mich kommen würde, aber ich war außerstande, auch nur einen Schritt zu meiner Abwehr zu machen. Kinder sind in solchen Fällen häufig einer Macht unterworfen, die ich nicht Eigensinn oder Trotz nennen möchte, eher Beharrungszwang; ein Seelenkrampf, der sich am ehesten selbst löst, sobald ihm nichts Anspannendes mehr entgegengestellt wird. Die Mutter ging ihrer Arbeit nach, in der abendlich dunkelnden Stube stand ich allein und vor mir auf dem Tisch das verstümmelte Kruzifix. Heftig erschrak ich vor jedem Geräusch. Im alten Uhrkasten, der dort an der Wand bis zum Fußboden niederging, rasselte das Gewicht der Schwarzwälderuhr, welche die fünfte Stunde schlug. Endlich hörte ich draußen auch das Schneeabklopfen von den Schuhen, es waren des Vaters Tritte. Als er mit dem Birkenzweig in die Stube trat, war ich verschwunden.
Er ging in die Küche und fragte mit wild herausgestoßener Stimme, wo der Bub sei? Es begann im Hause ein Suchen, in der Stube wurden das Bett und die Winkel und das Gesiedel durchstöbert, in der Nebenkammer, im Oberboden hörte ich sie herumgehen; ich hörte die Befehle, man möge in den Ställen die Futterkrippen und in den Scheunen Heu und Stroh durchforschen, man möge auch in den Schachen hinausgehen und den Buben nur stracks vor den Vater bringen. Diesen Christtag solle er sich für sein Lebtag merken! – Aber sie kehrten unverrichteter Dinge zurück. Zwei Knechte wurden nun in die Nachbarschaft geschickt, aber meine Mutter rief, wenn der Bub etwa zu einem Nachbar über Feld und Heide gegangen sei, so müsse er ja erfrieren, es wäre sein Jöpplein und sein Hut in der Stube. Das sei doch ein rechtes Elend mit den Kindern!
Sie gingen davon, das Haus wurde fast leer und in der finsteren Stube sah man nichts mehr als die grauen Vierecke der Fenster. Ich stak im Uhrkasten und konnte durch das herzförmige Loch hervorgucken. Durch das Türchen, welches für das Aufziehen des Uhrwerkes angebracht war, hatte ich mich hineingezwängt und innerhalb des Verschlages hinabgelassen, so daß ich nun im Uhrkasten ganz aufrecht stand.
Was ich in diesem Verstecke für Angst ausgestanden habe! Daß es kein gutes Ende nehmen konnte, sah ich voraus, und daß die von Stunde zu Stunde wachsende Aufregung das Ende von Stunde zu Stunde gefährlicher machen mußte, war mir auch klar. Ich verwünschte den Nähkorb, der mich anfangs verraten hatte, ich verwünschte das Kruzifixlein – meine Dummheit zu verwünschen, das vergaß ich. Es gingen Stunden hin, ich blieb in meinem aufrechtstehenden Sarge und schon saß mir der Eisenzapfen des Uhrgewichtes auf dem Scheitel und ich mußte mich womöglich niederducken, sollte das Stehenbleiben der Uhr nicht Anlaß zum Aufziehen derselben und somit zu meiner Entdeckung geben. Denn endlich waren meine Eltern in die Stube gekommen, hatten Licht gemacht und meinetwegen einen Streit begonnen.
„Ich weiß nirgends mehr zu suchen“, hatte mein Vater gesagt und war erschöpft auf einen Stuhl gesunken.
„Wenn er sich im Wald vergangen hat oder unter dem Schnee liegt!“ rief die Mutter und erhob ein lautes Klagen.
„Sei still davon!“ sagte der Vater, „ich mag’s nicht hören.“ „Du magst es nicht hören und hast ihn mit deiner Herbheit selber vertrieben.“
„Mit diesem Zweiglein hätte ich ihm kein Bein abgeschlagen“, sprach er und ließ die Birkenrute auf den Tisch niederpfeifen. „Aber jetzt, wenn ich ihn erwisch’, schlag’ ich einen Zaunstecken an ihm entzwei.“
„Tue es, tue es – ’leicht tut’s ihm nicht mehr weh“, sagte die Mutter und begann zu schluchzen. „Meinst, du hättest deine Kinder nur zum Zornauslassen? Da hat der lieb’ Herrgott ganz recht, wenn er sie beizeiten wieder zu sich nimmt! Kinder muß man liebhaben, wenn etwas aus ihnen werden soll.“
Hierauf er: „Wer sagt denn, daß ich den Buben nicht liebhab’? Ins Herz hinein, Gott weiß es! Aber sagen mag ich ihm’s nicht; ich mag’s nicht und ich kann’s nicht. Ihm selber tut’s nicht so weh als mir, wenn ich ihn strafen muß, das weiß ich!“
„Ich geh’ noch einmal suchen!“ sagte die Mutter.
„Ich will auch nicht dableiben!“ sagte er.
„Du mußt mir einen warmen Löffel Suppe essen! ’s ist Nachtmahlszeit“, sagte sie.
„Ich mag jetzt nicht essen! Ich weiß mir keinen anderen Rat“, sagte mein Vater, kniete zum Tisch hin und begann still zu beten.
Die Mutter ging in die Küche, um zur neuen Suche meine warmen Kleider zusammenzutragen, für den Fall, als man mich irgendwo halberfroren finde. In der Stube war es wieder still und mir in meinem Uhrkasten war’s, als müsse mir vor Leid und Pein das Herz platzen. Plötzlich begann mein Vater aus seinem Gebete krampfhaft aufzuschluchzen. Sein Haupt fiel nieder auf den Arm und die ganze Gestalt bebte.
Ich tat einen lauten Schrei. Nach wenigen Sekunden war ich von Vater und Mutter aus dem Gehäuse befreit, lag zu Füßen des Vaters und umklammerte wimmernd seine Knie.
„Mein Vater, mein Vater!“ Das waren die einzigen Worte, die ich stammeln konnte. Er langte mit seinen beiden Armen nieder und hob mich auf zu seiner Brust und mein Haar ward feucht von seinen Zähren. Mir ist in jenem Augenblicke die Erkenntnis aufgegangen.
Ich sah, wie abscheulich es sei, diesen Vater zu reizen. Aber ich fand nun auch, warum ich es getan hatte. Aus Sehnsucht, das Vaterantlitz vor mir zu sehen, ihm ins Auge schauen zu können und seine zu mir sprechende Stimme zu hören. Sollte er schon nicht mit mir heiter sein, so wie es andere Leute waren, so wollte ich wenigstens sein zorniges Auge sehen, sein herbes Wort hören; es durchrieselte mich mit süßer Gewalt, es zog mich zu ihm hin. Es war das Vaterauge, das Vaterwort.
Kein böser Ruf mehr ist in die heilige Christnacht geklungen und von diesem Tage an ist vieles anders geworden. Mein Vater war seiner Liebe zu mir und meiner Anhänglichkeit an ihn inne geworden und hat mir in Spiel, Arbeit und Erholung wohl viele Stunden sein liebes Angesicht, sein treues Wort geschenkt, ohne daß ich noch einmal nötig gehabt hätte, es mit List erschleichen zu müssen.
DIE ZERSTÖRUNG VON PARIS UND ANDERE MISSETATEN
Ich habe als Kind mir meine Welt, die von Natur höllisch klein war, auseinandergedehnt wie mein Vetter Simmerl den Katzenbalg, aus dem er sich einen Tabaksbeutel machen wollte. Und es ist, bigott, ein Sack draus worden, in welchem all die unglaublichen Phantastereien einer ungezogenen Bauernbubenseele vollauf Platz gehabt haben.
Wie ich mir später die Bücher, die ich nicht kaufen konnte, selber machte, so habe ich mir auch die größten Städte der Welt, die ich nicht aufsuchen konnte, selber gebaut.
Die jahrelange Kränklichkeit meines Vaters verschaffte mir das Baumaterial. Die Hustenpulver vom Doktor, der spanische Brusttee vom Kaufmann, die Medizinflaschen vom Bader waren stets in gutes, oft sogar schneeweißes Papier eingeschlagen; aus diesem Papier schnitzte ich mit der Nähschere meiner Mutter, oder, wenn ich diese schon zerbrochen oder verloren hatte, mit jener der Magd, allerlei Häuser, Kirchen, Paläste, Türme, Brücken, bog sie geschickt zur passenden Form und stellte sie in Reihen und Gruppen auf den Tisch. Das gesuchteste Material hierfür waren wohl die alten Steuerbücheln mit ihren steifen Blättern; und kam es freilich vor, daß über der ganzen Hauptfronte eines Herrenpalastes das „Datum der Schuldigkeit“ stand oder ein Kirchturm anstatt Fenster und Uhren nichts als lauter Posten der „Abstattung“ hatte. Als es aber ruchbar worden war, daß ich meine Prachtbauten mit den blutigen Steuersummen der Bauern aufführe, da gab’s eine kleine Revolution, indem mein Vater einmal mit der flachen Hand mir einige öffentliche Gebäude unter den Tisch hinabwischte.
Eines Tages ging ich einer Hirtenangelegenheit wegen ins Ebenholz hinaus. Ich hatte die Magd ersucht, ob sie mir nicht ihre heilige Monika mit in den Wald leihen möchte.
„Du lieber Närrisch!“ hatte die Magd geantwortet, „wenn sie nur ganz wär’, aber es ist mir die Maus dazugekommen. Was übriggeblieben ist, das magst haben.“
So nahm ich das Büchlein von der heiligen Monika mit in das Ebenholz. Aber als ich in demselben zu lesen begonnen hatte, hub im Sacke die Nähschere meiner Mutter zu sticheln an: ob ich die Geschichte von dieser Heiligen denn nicht schon längst auswendig wisse? Ob die Maus nicht etwa schon das Beste weggenagt hätte? Ob ich mir für diese grauen und angefressenen Blätter eine bravere Verwendung denken könne, als daraus die schöne Weltstadt Paris zu bauen? – Ich wollte der alten Nähscheere meiner Mutter nicht widersprechen.
Nun stand zur selben Zeit im Ebenholz noch die alte Schlagerhütte, die einst ein Bauernhäuschen gewesen und zwischen dem jungen Fichtenanwuchs verlassen und öde hocken geblieben war. Die Fenster waren ohne Gläser, die Tür war aus den Angeln gehoben und auf der Schwelle wucherten Brennesseln. Die Luft in der Hütte roch ganz moderig und jedes Geräusch widerhallte grell an den Wänden, als wollte das alte Zimmerholz mit dem Eintretenden alsogleich ein Gespräch führen. Mir war dieser Bau unheimlich gewesen bis zu jenem Tage, da mich und unseren Knecht Markus im Wald ein scharfer Wetterregen überraschte und wir uns in die Hütte flüchteten.
Seither war mir die Hütte heimlich. Und nun ging ich ihr zu, setzte mich an den großen, wurmstichigen Tisch und schnitzte aus den Blättern der „heiligen Monika“ die große Weltstadt Paris. Ich stellte die geschnitzten und zurechtgebogenen Häuser in langen Gassenreihen auf, und die Gassen und Plätze bevölkerte ich mit blauen Heidelbeeren und roten Preiselbeeren – erstere waren die Männer, letztere die Frauen. Um das Königsschloß postierte ich Reihen von Stachelbeeren, das waren die Soldaten.
Als der Tisch voll geworden war und ich trunkenen Blickes hinschaute auf die vieltürmige Stadt und ihre belebten Gassen, die ich gegründet und wie ein Schutzgeist beschirmte, dachte ich: Die Männlein und Weiblein tun zuviel miteinander um. So soll über diese Stadt einmal eine Straf Gottes kommen. Ein Sturmwind? – Ich blies drein – hei, purzelten ganze Häuserfronten über und über. Sie wurden wieder erbaut. Da endlich aber der Abend kam und meines Bleibens in der Hütte nicht mehr länger sein konnte, sann ich nach, wie ich die Stadt Paris am großartigsten zugrunde gehen lassen könnte. – Eine Feuersbrunst? – Es waren gerade die Streichhölzer aufgekommen und ich trug ein Päckchen im Säckel.
Das Feuer entstand mitten in der Stadt und nach wenigen Sekunden standen ganze Viertel in Flammen. Die Bevölkerung war starr vor Schreck, das Feuer wogte hin und die Mauern zitterten und die kahlen Ruinen ringelten sich. Da der Königspalast verschont bleiben zu wollen schien, so blies ich die Flamme gegen denselben hin – wehe, da flogen die brennenden Häuser über den Tisch und auf den Fußboden, wo in der Ecke noch ein Bund Bettstroh lag. Jetzt wurde der Spaß Ernst. Das Papier hatte so still gebrannt, das Stroh knisterte schon vernehmlicher und ein greller Schein erhellte die Hütte.
Ich wollte eben davonstürzen, als unser Knecht Markus zur Tür hereinsprang und mit einem buschigen Baumwipfel das Feuer totschlug.
Knecht Markus war verschwiegen, war ein Ehrenmann, aber das sagte er mir, wenn ich mich mit Sengen und Brennen auf den Etzel hinausspielen wolle, so täte er es dem Kaiser schreiben, daß er mich rechtzeitig köpfen lasse.
Von diesem Tage an habe ich keine Stadt mehr gegründet und keine mehr zerstört. Ich ging von der Baukunst zur Musik und Malerei über.
Ich hatte bei herumziehenden Musikanten, die vor unserer Haustür uns das Leben schön machten, allerlei Saiteninstrumente kennen gelernt. Ich hatte einen alten Harfenisten nach Beendigung seines Ständchens sogar einmal angesprochen, ob er es für einen Sechser erlauben könne, daß ich mit ihm zum nächsten Nachbar gehe, um sein Spiel dort noch einmal zu hören; worauf der Künstler antwortete, für einen Sechser bleibe er an unserer Tür stehen und spiele, solange ich wolle. Damals ist mir der ganze Wert unserer legierten Silbersechser zum Bewußtsein gekommen. Nun hatten wir aber an jenem Tage in unserer Stube einen alten, brummigen Schuster und der hatte gerade seinen Kopfwehtag. Als ich denn vor dem spielenden Musiker die Hände in den Hosentaschen dastand, die Zehen in den Sand bohrte, gleichsam, als wollte ich mich einwurzeln, sprang plötzlich der Schuster mit grüngelbem Gesichte zur Tür heraus und ließ einen tollen Fluch fahren über das verteufelte Geklimper.
Mitten in der Herrlichkeit brach der Harfner das Spiel ab. Für einen solchen Baß sei sein Instrument zu fein, meinte er, rückte die Harfe auf den Buckel und ging davon. Seit jenem Tage schreibt sich mein Haß gegen die Schuster, die ihren Kopfwehtag haben.
Die Harfe ging mir nicht aus dem Kopfe. In unserem Rübenkeller stand ein altes, säuerlndes Fäßchen, das mein Vater beim Stockerwirt allemal für die drei Faschingstage mit Apfelmost füllen ließ. Nun war es längst leer und diese Leere kam mir zustatten. Ich stülpte das Fäßchen auf, zog über den Boden Zwirnsfäden wie Saiten, so daß diese je nach ihrer Länge einen verschiedenen Ton gaben, wenn ich sie mit dem Finger berührte. Da hatte ich ein Saiteninstrument mit dem respektabelsten Resonanzboden. Doch erinnere ich mich nicht mehr, inwiefern ich damit meinen musikalischen Hang ausgebildet habe – ich weiß nur, daß zum nächsten Fasching, als ich unseren tanzlustigen Mägden auf meiner „Harfe“ was aufspielen wollte, wieder frischer Most in dem Fäßchen war.
In denselben Jahren hatte ich mit einem jungen Studenten Bekanntschaft gemacht, mit dem Söhnlein eines Nachbars, welches in Graz auf Geistlich studierte, auf die Vakanzen stets nach Hause kam und Reichtümer mitbrachte. Ich erwarb mir des Studenten Gunst, indem ich ihn öfters auf unseren Schwarzkirschbaum lud, wo es zu schnabulieren gab. Der Student riß zwar ein um das andere Ästlein ab, um zur süßen Frucht zu gelangen, aber mein Vater, der sonst solcherlei Verstümmelungen scharf ahndete, war der Meinung, einem angehenden Priester dürfe man nichts verwehren, er würde dereinst den Kirschbaum schon in sein Meßopfer einschließen, daß er gedeihe und immerwährend fruchtbar sei. Der Student war für solche Rücksichten erkenntlich und stellte mir all seine Bücher, Landkarten, Schreib- und Zeichensachen zur Verfügung. Als sich der angehende Theologe mit den Büchern auf sein Hirtenamt vorbereiten sollte, übte ich mit ihnen das meine bereits aus. Doch ließ ich meine Kühe und Ochsen Rinder sein, lag im grünen Grase und las. – O ihr armen Bücherwürmer in den staubigen Bibliotheken, ihr habt gar keine Ahnung davon, was im Waldschatten ein
Buch ist. – Viele Bücher würden leicht auch den im Walde Liegenden beunruhigen, verwirren und entmarken; aber ein Buch genießt man dort ganz aus und gedeiht dabei. Ich denke hier an das Lesebuch für die Gymnasialklassen, reich an Gedichten und Aufsätzen von deutschen Dichtern. Ich konnte es nicht einmal ganz verstehen, aber es wirkte tiefer auf mich, als alle spätere Leserei zusammen. – Als die Kirschen alle waren und die Blätter des Baumes gelb wurden, packte der Student seine Bücher zusammen und ging wieder in die „Studie“.
Einmal ließ er mir ein Kästchen mit Wasserfarben zurück. Jetzt schnitt ich mir eine kleine Haarlocke vom Haupte, band sie an ein Stäblein und mit solchem Pinsel begann ich zu malen. Eine große Anzahl der Heiligenbildchen, die heute noch in verschiedenen Gebetbüchern der Gegend zu finden, ist mit meinem Haar gemalt worden. Die Leute haben sich hell verwundert, wenn sie mir zugeschaut und gesehen, wie man mir nichts dir nichts die Muttergottesen macht. Einmal kam der alte Schneiderjackel, Küster von Krieglach, in unser Haus, um den Pfarrerzehent abzuholen; der sah mich malen. „Na“, sagte er fortwährend, „aber da gehört was dazu! Jetzt malt so ein kleiner Schlingel da himmlische Leut’! Und daß es eine Form hat! Ein hellrotes G’wandl, ein schön’s! Ein Gesicht – wie er aber das Gesichtel macht! Die ganze Fleischfarb’ – und ’s Göscherl! Und die Augen, die blauen, wie sie auslugen! –Spitzbub, du! Freilich, den Heiligenglanz auch, na, der darf nicht fehlen. Wär’ nit ganz, wenn der fehlen tät’! – Schon eine Menge so Bildln hast da! – Bist aber ein Kreuzköpfel – du mußt schon ein Maler werden! Alles von dir selber hast gelernt? Ist viel! Ist viel das! Schau, das tät’s nit, die Bildln muß ich alle mitnehmen, ’s tät’s nit anders, die müssen ihre heilige Weih’ kriegen. Dank’ dir Gott, Schwarzkünstler, kleiner!“
Vor meinen Augen tat er die Bildchen – es waren deren allerlei und eine große Anzahl – zusammen, schob sie in seinen Sack und ging davon. Mir blieb der Verstand stehen. Aber mir schwoll der Kamm, als ich bald darauf hörte, der Küster hätte bei seiner Wallfahrt mit der Krieglacher Kreuzschar nach Mariazell meine Heiligenbilder am Gnadenaltare weihen lassen und sie hernach an die Wallfahrer verteilt. – Unter anderen ist später auch der alte Riegelberger in den Besitz eines solchen Heiligtums gekommen. Er soll es allemal, so oft er sein Gebetbuch aufschlug, geküßt haben; als er es aber erfuhr, von wem das Bildchen herrühre, ist er schnurgerade in unser Haus gegangen und hat mich zur Rede gestellt, warum ich mit heiligen Dingen Frevel treibe? Ob ich’s vielleicht leugnen wolle? geweihte Sachen hätte ich gemalt!
„Ja“, sagte ich, „wenn Ihr das Kalb auf den Kopf stellt, wird es freilich den Schweif in die Höhe recken.“
„Willst mich fean (höhnen), Bub?“
„Die Bilder sind zuerst gemalt und nachher geweiht worden.“
Es hielt schwer, ihm die Sache begreiflich zu machen und er rief immer wieder aus, zerfetzen möchte er das schlechte Zeug, wenn’s ihm um die heilige Weih’ nicht leid täte.
Ein andermal hatte ich mit demselben Manne eine viel gefährlichere Begegnung. Es waren zur Zeit noch die kleinen Papierzehner im Land. Ein solches Notlein habe ich wundershalber einmal nachgemacht. Dem Knecht Markus kam es zu Augen, der schmunzelte das Streifchen an und ersuchte mich, daß ich es ihm ein wenig leihe. Einen Tag später begegnete ich auf dem Feldwege dem Riegelberger. Er grinste mich schon von weitem an und lächelte mir dann freundlich zu: „Büberl, du wirst aufgehenkt.“ „Ihr meint, weil ich die heilige Magdalena gemalt hab’?“ „O, die laßt keinen henken. Aber die falschen Banknoten! Ja, lieber Freund! Einen hab’ ich von dir in der Brieftaschen und geh’ gerade, mir jetzt dafür Tabak kaufen.“
Ich denke, daß ich über diese Mitteilung sehr erschrocken bin, aber in demselben Augenblick ist mir ein Gedanke durch den Kopf geflogen, den ich einfing, weil er mir nicht schlecht vorkam.
„Erschrocken bin ich nur, weil Ihr den schrecklichen Frevel begehen wollt.“
„Möcht’ wissen, wieso ich –?“
„Das Papierzehnerl, das Ihr von mir in der Brieftasche habt, ist unter meine Heiligenbilder gekommen. Ist in Zell geweiht worden!“
„Geh’, geh’, das Geld nimmt keine Weih’ an“, versetzte der Riegelberger.
„Das Geld freilich nicht, das weiß ich, aber mein Zehner ist keins. Und Ihr wollt Euch für geweihte Sach’ Tabak kaufen? Ist schon recht, probiert es nur! Werdet schon sehen, wie Euch ein solcher Tabak in die Nase beißen wird!“
„Du, Bub!“ rief er, „wenn du alleweil nur Leut’ foppen willst!“
Er zog die Brieftasche hervor, das Papierstreifchen heraus, auch den Tabaksbeutel, und sagte: „Auf ein Pfeiferl hab’ ich noch in der Blader. Was gibst mir zu Lohn, wenn ich mir das Pfeiferl mit deinem neuen Zehner anzünde? Dir zu Gnaden tu’ ich’s, und jetzt geh’ und arbeit’ was, bist schon groß genug dazu. Ich, wenn ich dein Vater wär’, wollt’ dir deine Fabeleien und Schmierereien schon vertreiben! Arbeiten, daß die Schwarten krachen, ist gescheiter!“
’s ist doch der beste Rat gewesen, den er mir hätte geben können. Er ist auch gar bald befolgt worden. Aber in den Feierabendstunden habe ich meine kindischen Spiele und künstlerischen Beschäftigungen getrieben, weit über die Kindesjahre hinaus. Und wenn ich meine heutigen Taten betrachte – ’s ist alles nur Versuch und Spiel. Es war ein kleines Kind, es ist ein großes Kind – ich bin damit zufrieden.
WIE DER MEISENSEPP GESTORBEN IST
In meinem Vaterhause fand sich die „Lebensbeschreibung Jesu Christi, seiner Mutter Maria und vieler Heiligen Gottes. Ein geistlicher Schatz von Pater Cochem“. Das war ein altes Buch; die Blätter waren grau, die Kapitelanfänge hatten wunderlich große Buchstaben in schwarzen und roten Farben. Der hölzerne Einbanddeckel war an manchen Stellen schon wurmstichig, und eine der ledernen Klappen hatte die Maus zernagt. Seit vielen, vielen Jahren war im Hause niemand gewesen, der darin hätte lesen können; was Wunder, wenn die Tierlein Besitz nahmen von Cochems „Leben Christi“ und aus dem „geistlichen Schatz“ ihre leibliche Nahrung zogen.
Da kam ich, der kleine Junge, verjagte die Würmer aus dem Buche und fraß mich dafür selber hinein. Täglich las ich unseren Hausleuten vor aus dem „Leben Christi“. Den jungen Knechten und Mägden gefiel der neue Brauch just nicht, denn sie durften dabei nicht scherzen und nicht jodeln; die älteren Hausgenossen aber, die schon etwas gottesfürchtiger waren, hörten mir mit Andacht zu „und das ist“, sagten sie, „als wie wenn der Pfarrer predigen tät’; so bedeut ausführen und so eine laute Stimm’!“
Ich kam in den Ruf eines Vorlesers und wurde ein gesuchter Mann. Wenn irgendwo in der Nachbarschaft jemand krank lag oder zum Sterben, oder wenn er gar schon gestorben war, so daß man an seiner Leiche zur Nacht die Totenwache hielt, so wurde ich von meinem Vater ausgebeten, daß ich hinginge und lese. Da nahm ich das gewichtige „Leben-Christi-Buch“ unter den Arm und ging. Es war ein hartes Tragen und ich war dazumal ein kleinwinziger Knirps.
Einmal spät abends, als ich schon in meiner kühlen und frischduftenden Futterkammer schlief, in welcher ich zur Sommerszeit bisweilen das Nachtlager hatte, wurde ich durch ein Zupfen an der Decke von unserem Knecht geweckt. – „Sollst fein geschwind aufstehen, Peter, sollst aufstehen. Der Meisensepp hat seine Tochter geschickt, er laßt bitten, du sollst zu ihm kommen und ihm was vorlesen! er wollt’ sterben. Sollst aufstehen, Peter.“ –
So stand ich auf und zog mich eilends an. Dann nahm ich das Buch und ging mit dem Mädchen von unserem Hause aufwärts über die Heide und durch die Waldungen. Das Häuschen des Meisensepp stand einsam mitten im Wald.
Der Meisensepp war in seinen jüngern Jahren Reuter und Waldhüter gewesen; in letzterer Zeit hatte er sich nur mehr mit Sägeschärfen für Holzhauerleute beschäftigt. Und da kam plötzlich die schwere Krankheit. Wie wir, ich und das Mädchen, in der stillen, sternenhellen Nacht so durch die Ödnis schritten, sagten wir keines ein Wort. Schweigend gingen wir nebeneinander hin. Nur einmal flüsterte das Mädchen: „Laß her, Peter, ich will dir das Buch tragen.“
„Das kannst nicht“, antwortete ich, „du bist ja noch kleiner wie ich.“
Nach einem zweistündigen Gang sagte das Mädchen: „Dort ist schon das Licht.“
Wir sahen einen matten Schein, der aus dem Fenster des Meisenhauses kam. Als wir diesem schon sehr nahe waren, begegnete uns unser Pfarrer, der dem Kranken die heiligen Sakramente gereicht hatte.
„Der Vater – wird er wieder gesund?“ fragte das Mädchen kleinlaut.
„Ist noch nicht so alt“, sagte der Priester; „wie Gott will, Kinder, wie Gott will.“
Dann ging er davon. Wir traten in das Haus.
Das war klein und nach der Art der Waldhütten standen die Familienstube und die Schlafkammer gleich in der Küche. Am Herd in einem Eisenhaken stak ein brennender Kienspan, von dem die Stubendecke in einen Rauchschleier gehüllt war. Neben dem Herde auf Stroh lagen zwei kleine Knaben und schlummerten. Sie waren mir bekannt vom Walde her, wo wir oft mitsammen Schwämme und Beeren suchten und dabei unsere Herden verloren; sie waren noch um etliche Jahre jünger als ich. An der Ofenmauer saß das Weib des Sepp, hatte ein Kind an der Brust und sah mit großen Augen in die flackernde Flamme des Kienspans hinein. Und hinter dem Ofen, in der einzigen Bettstatt, die im Hause war, lag der Kranke. Er schlief; sein Gesicht war recht eingefallen, das grauende Haar und der Bart ums Kinn waren kurz geschnitten, so daß mir der ganze Kopf kleiner vorkam als sonst, da ich den Sepp auf dem Kirchweg gesehen hatte. Die Lippen waren halb offen und blaß, durch dieselben zog ein lebhaftes Atmen.
Bei unserem Eintritt erhob sich das Weib leise, sagte eine Entschuldigung, daß sie mich aus dem Bette geplagt habe, und lud ein, daß ich mich an den Tisch setzen und die Eierspeise essen möge, die der Herr Pfarrer übrig gelassen hatte, und die noch auf dem Tische stand.
Bald saß ich auf dem Fleck, und jetzt aß ich mit derselben Gabel, die er hatte in den Mund geführt!
„Jetzt schläft er passabel“, flüsterte das Weib nach dem Kranken deutend. „Vorhin hat er allweg Fäden aus der Decke gezupft.“
Ich wußte, daß man es für ein übles Zeichen auslegt, wenn ein Schwerkranker an der Decke zupft und kratzt; „da kratzt er sich sein Grab“. Ich entgegnete daher: „Ja, das hat mein Vater auch getan, als er im Nervenfieber ist gelegen. Ist wieder gesund worden.“
„Das mein’ ich wohl auch“, sagte sie, „und der Herr Pfarrer hat dasselbe gesagt. – Bin doch froh, die Beicht’ hat der Seppel recht fleißig verrichten mögen und ich hab’ jetzt wieder rechtschaffen Trost, daß er mir noch einmal gesund wird. – Nur“, setzte sie ganz leise bei, „das Spanlicht leckt alleweil so hin und her.“
Wenn in einem Hause das Licht unruhig flackert, so deutet das der Glaube des Volkes: es werde in demselben Hause bald ein Lebenslicht auslöschen. Ich selbst glaubte daran, doch um die Häuslerin zu beruhigen, sagte ich: „Es streicht die Luft alles zuviel durch die Fensterfugen, ich verspür’s auch.“ Sie legte das schlummernde Kind auf das Stroh; auch das Mädchen, welches mich geholt, war schon zur Ruh’ gegangen. Wir verstopften hierauf die Fensterfugen mit Werg.
Dann sagte das Weib: „Gelt, Peter, du bleibst mir da über die heutige Nacht; ich wüßt’ mir aus Zeitlang nicht zu helfen. Wenn er munter wird, so liest uns was vor. Gelt, du bist so gut?“
Ich schlug das Buch auf und suchte nach einem geeigneten Lesestück. Allein, Pater Cochem hat nicht viel geschrieben, was armen weltlichen Menschen zum Troste sein könnte. Pater Cochem meint, Gott wäre gerecht und die Leute wären sündig, und die meisten Menschen liefen schnurgerade der Hölle zu.
Es mag ja wohl sein, dachte ich mir, daß es so ist; aber dann darf man’s nicht sagen, die Leute täten sich nur grämen und des weiteren blieben sie so sündig wie früher. Wenn sie sich bessern hätten können, so hätten sie’s längst schon getan.
Die schreckhaften Gedanken gingen durch das ganze Cochemsche Buch. Fürwitzigen Leuten gegenüber, die mich nur anhörten, der „lauten Predigerstimm“ wegen, donnerte ich die Greuel und Menschenverdammung recht mit Vergnügen heraus; wenn ich aber an Krankenbetten aus dem Buche las, da mußte ich meine Erfindungsgabe oft sehr anstrengen, daß ich während des Lesens die harten Ausdrücke milderte, die schaudererregende Darstellung der vier letzten Dinge mäßigte und den grellen Gedanken des eifernden Paters eine freundlichere Färbung geben konnte.
So plante ich auch heute, wie ich, scheinbar aus dem Buche lesend, dem Meisensepp aus einem anderen Buche her Worte sagen wollte von der Armut, von der Geduld, von der Liebe zu den Seinen und wie darin die wahre Nachfolge Jesu bestehe, die uns – wenn die Stunde schlüge – durch ein sanftes Entschlummern hinüberführe in den Himmel.
Endlich erwachte der Sepp. Er wendete den Kopf, sah sein Weib und seine ruhenden Kinder an; dann erblickte er mich und sagte mit lauter, ganz deutlicher Stimme: „Bist doch gekommen, Peter. So dank’ dir Gott, aber zum Vorlesen werden wir heut’ wohl keine Zeit haben. Anna, sei so gut und weck’ die Kinder auf.“
Das Weib zuckte zusammen, fuhr mit der Hand zu ihrem Herzen, sagte aber dann in ruhigem Tone: „Bist wieder schlechter, Seppel? Hast ja recht gut geschlafen.“
Er merkte es gleich, daß ihre Ruhe nicht echt war.
„Tu dich nicht gar so grämen, Weib“, sprach er, „auf der Welt ist’s schon nicht anders. Weck’ mir schön die Kinder auf, aber friedsam, daß sie nicht erschrecken.“
Die Häuslerin ging zum Strohlager, rüttelte mit bebender Hand am Schaub, und die Kleinen fuhren halb bewußtlos empor.
„Ich bitt’ dich gar schön, Anna, reiß’ mir die Kinder nicht so herum“, verwies der Kranke mit schwächerer Stimme, „und die kleine Martha laß schlafen, die versteht noch nichts.“
Ich blieb abseits am Tisch sitzen und mir war heiß in der Brust. Die Angehörigen versammelten sich um den Kranken und schluchzten.
„Seid ihr nur ruhig“, sagte der Sepp zu seinen Kindern, „die Mutter wird euch schon morgen länger schlafen lassen. Josefa, tu’ dir das Hemd über die Brust zusammen, sonst wird dir kalt. Und jetzt – seid all weg schön brav und folgt der Mutter, und wenn ihr groß seid, so steht ihr bei und verlaßt sie nicht. – Ich hab’ gearbeitet meiner Tag’ mit Fleiß und Müh’; gleichwohl kann ich euch weiter nichts hinterlassen, als dieses Haus und den kleinen Garten, und den Reinacker und den Schachen dazu. Wollt’ euch’s teilen, so tut es brüderlich, aber besser ist’s, ihr haltet die Wirtschaft zusammen und tut hausen und bauen. Weiters mach’ ich kein Testament, ich hab’ euch alle gleich lieb. Tut nicht ganz vergessen auf mich und schickt mir dann und wann ein Vaterunser nach. – Und euch, die zwei Buben, bitt’ ich von Herzen: Hebt mir mit dem Wildern nicht an; das nimmt’ kein gutes End’. Gebt mir die Hand darauf. So. – Wenn halt einer von euch das Sägefeilen wollt’ lernen; ich hab’ mir damit viel Kreuzer dermacht; Werkzeug dazu ist da. Und sonst wißt ihr schon, wenn ihr am Reinacker die Erdäpfel anbaut, so setzt sie erst im Mai ein; ’s ist wohl wahr, was mein Vater fort gesagt hat, bei den Erdäpfeln heißt’s: baut mich an im April, komm’ ich, wann ich will; baut mich an im Mai, komm’ ich glei (gleich). – Tut euch so Sprüchlein nur merken. – So, und jetzt geht wieder schlafen, Kinder, daß euch nicht kalt wird, und gebt allzeit Obacht auf eure Gesundheit. Gesundheit und gutes Gewissen, das ist das beste. Geht nur schlafen, Kinder.“
Der Kranke schwieg und zerrte an der Decke.
„Frei zuviel reden tut er mir“, flüsterte das Weib gegen mich gewendet. Eine bei Schwerkranken plötzlich ausbrechende Redseligkeit ist ja auch kein gutes Zeichen.
Nun lag er, wie zusammengebrochen, auf dem Bette. Das Weib zündete die Sterbekerze an.
„Das nicht, Anna, das nicht“, murmelte er, „ein wenig später. Aber einen Schluck Wasser gibst mir, gelt?“
Nach dem Trinken sagte er: „So, das frisch’ Wasser ist halt doch wohl gut. Gebt mir recht auf den Brunnen Obacht. Ja, und daß ich nicht vergess’, die schwarz’ Hosen legst mir an, und das blau’ Jöppel, weißt, und draußen hinter der Tür, wo die Sägen hängen, lehnt das Hobelbrett, das leg’ über den Schleifstock und die Drehbank; für drei Tag’ wird’s wohl halten. Morgen früh, wenn der Holzjodel kommt, der hilft mich schon hinauslegen. Schau aber fein gut, daß die Katz’ nicht dazu kommt; die Katzen gehen los und schmecken’s gleich, wenn wo eine Leich’ ist. Was unten bei der Pfarrkirche mit mir geschehen soll, das weißt schon selber. Nicht zu lang’ bimmeln (läuten); kostet Geld und hilft nicht viel. Meinen braunen Lodenrock und den breiten Hut schenk’ den Armen. Dem Peter magst auch was geben, daß er heraufgegangen ist. Vielleicht ist er so gut, und liest morgen beim Leichwachen was vor. Es wird ein schöner Tag sein morgen, aber geh’ nicht zu weit fort von heim, es möcht’ ein Unglück geschehen, wenn draußen in der Lauben das Licht brennt – Nachher, Anna, such’ da im Bettstroh nach; wirst einen Strumpf finden, sind etlich’ Zwanziger drin.“
„Seppel, streng’ dich nicht so an im Reden“, schluchzte das Weib.
„Wohl, wohl, Anna – aber aussagen muß ich’s doch. Jetzt werden wir wohl nicht mehr lang’ beisammen sein. Wir haben uns zwanzig Jahre gehabt, Anna. Mußt nicht weinen, Anna, mußt nicht weinen, du bist mein alles gewesen; kein Mensch kann dir’s vergelten, was du mir bist gewesen. Das vergess’ ich dir nicht im Tod und nicht im Himmel. Mich gefreut’s nur, daß ich in der letzten Stund’ noch was mit dir reden kann, und daß ich gleichwohl soviel bei Verstand bin.“
„– Stirb doch nicht gar hart, Seppel“, hauchte das Weib und beugte sich über sein Antlitz.
„Nein“, antwortete er ruhig, „bei mir ist’s so, wie bei meinem Vater: leicht gelebt und leicht gestorben. Sei nur auch du so und leg’ dir’s nicht schwer. Wenn wir nun auch wieder jedes allein ankommen, zusammen gehören wir gleichwohl noch und ich heb’ dir schon ein Platzel auf im Himmel, gleim (nahe) an meiner Seit’, Anna, gleim an meiner Seit’. Nur das tu’ um Gottes willen, die Kinder zieh’ gut auf.“
Die Kinder ruhten. Es ward still und mir war, als hörte ich irgendwo in der Stube ein leises Schnurren und Spinnen. –
Plötzlich rief der Sepp: „Anna, jetzt zünd’ die Kerzen an!“
Das Weib rannte in der Stube herum und suchte nach Feuerzeug; und es brannte ja doch der Span. – „Jetzt hebt er an zu sterben!“ wimmerte sie. Als aber die rote Wachskerze brannte, als sie ihm dieselbe in die Hand gab, als er den Wachsstock mit beiden Händen umfaßte und als sie das Weihwassergefäß vom Gesimse nahm, da wurde sie scheinbar ganz ruhig und betete laut: „Jesus, Maria, steht ihm bei! Ihr Heiligen Gottes, steht ihm bei in der höchsten Not, laßt seine Seele nicht verloren sein! Jesus, ich bete zu deinem allerheiligsten Leiden! Maria, ich rufe deine heiligen sieben Schmerzen an! Du, sein heiliger Schutzengel, wenn seine Seel’ vom Leib muß scheiden, führ’ sie ein zu den himmlischen Freuden!“
Sie schluchzte und weinte nicht; sie war ganz die ergebene Beterin, die Fürbitterin.
Endlich schwieg sie, beugte sich über das Haupt des Gatten, beobachtete sein schwaches Atemholen und hauchte: „So behüt’ dich Gott, Seppel, tu’ mir meine Eltern und unsere ganze Freundschaft (Verwandtschaft) grüßen in der Ewigkeit. Behüt’ dich Gott, mein lieber Mann! Die heiligen Engel geben dir das Geleit’ und der Herr Jesus mit seiner Gnad’ wartet schon deiner bei der himmlischen Tür.“
Er hörte es vielleicht nicht mehr. Seine blassen, halboffenen Lippen gaben keine Antwort. Seine Augen sahen starr zur Stubendecke auf. Und aus den gefalteten Händen aufragend brannte die Wachskerze; sie flackerte nicht, still geruhsam und hell, wie eine schneeweiße Blütenknospe stand die Flamme empor – sein Atemzug bewegte sie nicht mehr.
„– Jetzt ist er mir gestorben!“ rief das Weib aus, schrill und herzdurchdringend, dann sank sie nieder auf einen Schemel und begann kläglich zu weinen. Die wieder erwachenden Kinder weinten auch; nur das kleinste lächelte …
Die Stunde lag auf uns wie ein Stein.