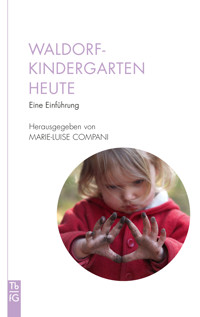
Waldorfkindergarten heute E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die zum größten Teil neu geschriebenen Beiträge machen mit allen wesentlichen Elementen des Waldorfkindergartens und der Waldorfkindertagesstätte vertraut und bieten eine umfassende, aktuelle Einführung in die Waldorfpädagogik für das Vorschulalter. Die Autorinnen und Autoren beschreiben anschaulich den pädagogischen Ansatz und die Grundlagen der frühkindlichen Bildungsprozesse.Bildungsprozesse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIE-LUISE COMPANI
WALDORFKINDERGARTEN HEUTE
Mit Beiträgen von: Susanne Altenried, Marie-Luise Compani, Sabine Deimann, Claudia Grah-Wittich, Brigitte Huisinga, Ulrike Kaliss, Petra Kühne, Martina Kuhlmann, Peter Lang, Claudia McKeen, Andreas Neider, Frodo Ostkämper, Susanne Rothfuß, Elke Rüpke, Hubert Staneker, Kathinka Südhof, Petra Thal und Susanne Vieser
WALDORF-KINDERGARTEN HEUTE
Eine Einführung
Herausgegeben von Marie-Luise Compani
Verlag Freies Geistesleben
Inhalt
Vorwort
Geleitwort
I. Waldorfkindergarten heute
Peter Lang Waldorfkindergärten weltweit
Die Gründung der Waldorfschule
Die Entwicklung der Waldorfkindergärten
Die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten
Recht auf Kindheit – eine weltweite Herausforderung
Claudia Grah-Wittich Ein Blick auf die Situation des Kindes heute
Zur Lage in Krippe und Kindergarten
Zur Grundhaltung in der Kinderbetreuung
II. Pädagogische und menschenkindliche Grundlagen
Claudia Grah-Wittich Menschenkundliche Grundlagen der Waldorfpädagogik
1. Der besondere Zeitraum der ersten drei Lebensjahre
2. Der Kräftezusammenhang des Lebendigen oder des Ätherischen
3. Die richtige Umgebung für das Kind
4. Empathie und ihre Voraussetzungen
Claudia McKeen Die Metamorphose von Wachstumskräften in Denkkräfte
Die Kräfte der Aufrichtung und Bewegung und das innere Verhältnis zum Raum
Von den formbildenden Kräften des Leibes zum bewussten Formerfassen
Leibliche Grundlagen für Erinnern und vorstellendes Denken
Der Übergang vom Kindergarten in die Schule. Aspekte der Schulreife
Frodo Ostkämper Was macht den Waldorfkindergarten zu einem Bildungsort? Die Gestaltung einer entwicklungsgemäßen Umgebung und Beziehung
Die Förderung elementarer Bildung
Bildungsverständnis
Leibbildung und kindliches Welterleben
Kinder bilden sich selbst
Förderung der Selbsttätigkeit des Kindes
Elke Rüpke Zum Verständnis des Lernens in der Waldorfpädagogik
Was wird unter «Lernen» verstanden?
Wie ist nun der waldorfpädagogische Zugang zum Lernen?
Das Lernen in verschiedenen Altersstufen
Claudia Grah-Wittich Kindheit schützen – die Notwendigkeit von Selbsterziehung der Erwachsenen
Ein pädagogisches Grundgesetz
Gemeinsamer Entwicklungsprozess
Ausbildung als Raum für Selbstentwicklung
Der Erwachsene als Vorbild auf drei Ebenen
Für-sich-Sein und Zusammensein
Basis und Säulen einer gesunden Kindheit
Die Pole von Selbstlernen und Beziehungslernen
Susanne Altenried Wer bist du? Innere Stimmen und äußere Zuschreibung – Umgang mit Identität und Geschlechtlichkeit im ersten Jahrsiebt
Standortbestimmung
Die Rolle der Leiblichkeit im ersten Jahrsiebt
Wie können wir in diesem Zusammenhang Sexualität verstehen?
Menschenkundliche Betrachtung
Das Kind sensibel begleiten
Konzept Familie
Bedeutung der psychosexuellen Entwicklung für das Kind
Merkmale kindlicher Sexualität
Unterschiede zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität
Akzeptanz von Diversität
III. Waldorfkindergarten in der Praxis
Susanne Vieser Das Selbstverständnis der Pädagogin im Gruppenalltag
Einleitung
Das Kind im Mittelpunkt
Basis der Erziehung: Kenntnis der Entwicklung
Umraum ermöglicht Entfaltung
Die Pädagogin als Erziehungskünstlerin
Susanne Altenried Das freie Spiel – Wegbereiter und Wegbegleiter ins Leben
Spiel ist ein Grundbedürfnis des Kindes
Das Spielfeld der Potenziale. Was ist Freispiel?
Spielraum – Entwicklungsraum
Spiel und Nachahmung – Bindung und Freiheit. Beobachtungen zu den Entwicklungsstufen des Kindes
Entwicklungsphasen – Spielphasen
Die Bedeutung der Puppe im Spiel
Entfaltungsräume öffnen. Die Aufgabe der Erzieherin während der Freispielzeit
Susanne Altenried Die Bedeutung des Rhythmus. Lebendige Tagesgestaltung
Rhythmus ist das Element des Lebens
«Noch einmal!»
Rhythmen in verschiedenen Zeitabschnitten
Marie-Luise Compani Die Tätigkeiten der Erwachsenen im Kindergartenalltag
Hauswirtschaftliche Arbeiten
Die Pflege des Außengeländes
Eine jahreszeitliche Tätigkeit
Vorbereitungen der Jahresfeste
Gestalterische Tätigkeiten
Handwerkliche Tätigkeiten
Petra Thal Reigen im Waldorfkindergarten
Warum braucht es einen Reigen im Kindergarten?
Der frei gestaltete rhythmische Reigen
Vorbereitung für den rhythmischen Reigen
Voraussetzung für den rhythmischen Reigen
Besondere Aspekte des rhythmischen Reigens
Sabine Deimann Elementare Eurythmie im Kindergarten
Eurythmie-Tag im Kindergarten
Eine bewegte Märchenstunde
Rhythmisierung als Grundprinzip
Aufbau und Methodik
Die Mitwirkung der Erzieherin
Anmerkungen zur Praxis heute
«Balsam für die Seele»
Sprache ist Bewegung – und Ausdruck des Lebendigen in uns
Eurythmie und die «Wortmusik» der gesprochenen Sprache
Formkraft und Wirkung der Sprachlaute
Gesundheitsförderung durch elementare Eurythmie
Petra Kühne Ernährung im Kindergarten
Die Grundlagen – was braucht ein Kind?
Vom Säugling zum Kindergartenkind
Die Welt ist voller Wahrnehmungen
Abwechslung und Beständigkeit
Essensrhythmen
Essen ist Leben
Ernährungsbildung – wie lernen die Kinder gesunde Ernährung?
Wenn etwas nicht vertragen wird
Die Qualität der Lebensmittel
Ernährung in der Kleinkindzeit (1 – 3 Jahre)
Ernährung im Kindergartenalter (4 – 6 Jahre)
Wie soll die Nahrung sein: mit Fleisch – vegetarisch – vegan?
Die Lebensmittel in der Kinderernährung
Marie-Luise Compani / Brigitte Huisinga Die Betreuung der Kinder unter drei Jahren
Philosophie: Die Haltung zu Kind und Familie
Pädagogische Ausrichtung und Schwerpunkt der Einrichtung
Bildungs- und Erziehungsziele
Entwicklungsschritte des Kindes
Entwicklung der Sinne
Umgebungsgestaltung
Die Rolle des Erwachsenen
Die Gestaltung des pädagogischen Alltags
Zum Rhythmus im Tageslauf
Die Gestaltung von Übergängen
Abschied von der Krippe
Marie-Luise Compani Die Situation der angehenden Schulkinder im Kindergarten
Das Phänomen der Langeweile
Die Entwicklungsbeobachtung
Die Schulfähigkeit des Kindes
Was braucht das Kind in seinem letzten Jahr vor seiner Schulzeit?
Schulkindangebote
Ulrike Kaliss Waldorfkindergarten in der Natur
Entstehung und Form der Draußen-Kindergärten
Was bedeutet uns die Natur?
Was die Kinder suchen und brauchen
Was kann die Naturpädagogik bieten?
Die «klassischen» Elemente des Waldorfkindergartens
Der Erzieher in der Naturpädagogik
Kathinka Südhof / Susanne Rothfuß Alle Kinder sind gleich verschieden. Inklusion in einem Waldorfkindergarten
Definition
Inklusion als Recht
Das anthroposophische Bild von Menschen mit Behinderung
Voraussetzungen, Herausforderungen und Konzepte im inklusiven Waldorfkindergarten
Andreas Neider Wie beugen wir der Digitalisierung der kindlichen Lebenswelt vor?
Die Ausgangslage: Digitale Geräte sind auch im Vorschulalter immer mehr verfügbar
Die Entwicklung der Digitalisierung
Medienkompetenz durch Medienbalance
Das Prinzip der Medienbalance
Erster Bereich: Sprache
Zweiter Bereich: Musik
Dritter Bereich: das Spiel
Digitale Medien im ersten Jahrsiebt?
Martina Kuhlmann Die Rechte der Kinder. Partizipation im Waldorfkindergarten
Der Waldorfkindergarten als Lernort der Demokratie
Claudia Grah-Wittich Warum Elternarbeit heute so wichtig ist
Die Kinder spiegeln ihre Umgebung
Das Verhältnis von Eltern und Institution
Verschiedene Ebenen der Elternmitwirkung
Qualitäten der Elternberatung
Ausblick
Hubert Staneker «Unternehmen Waldorfkindergarten» Selbstorganisation und Pädagogik – der zweifache Auftrag
1. Warum Selbstorganisation?
2. Wie kann Selbstorganisation gelingen? Zusammenarbeit in den Einrichtungen
3. Was können wir tun, um unsere Selbstverwaltung weiterzuentwickeln?
4. Verein – Genossenschaft und Selbstorganisation: Besonderheiten und Konsequenzen
5. Zusammenfassung
Allgemeine Literaturhinweise
Bildnachweis
Die Autorinnen und Autoren
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich freue mich, dass nun die dritte, grundlegend überarbeitete und aktualisierte Auflage des Buches Waldorfkindergarten heute vorliegt und viele Autorinnen und Autoren dafür neu gewonnen werden konnten. Herzlichen Dank an sie alle, dass sie trotz ihrer vielen Aufgaben an ihren jeweiligen Wirkungsstätten zum Gelingen dieser Ausgabe beigetragen haben! Der Dank gilt auch der «Vereinigung der Waldorfkindergärten», die es mit einem finanziellen Beitrag ermöglicht hat, dass dieses Buch erscheinen konnte.
Weltweit haben sich viele Veränderungen seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe 2011 ergeben, und Kindheit ist mehr als je zuvor bedroht. Seit der Verabschiedung der Kinderrechte durch die Vereinten Nationen 1989 ist das Thema Kindheit stärker in den Fokus der allgemeinen Betrachtungen in den verschiedenen Kontinenten und Kulturen gerückt. Dennoch erleben wir weltweit eine permanente Korruption der Kinderrechte. Kinder sind das schwächste Glied der Gesellschaft und erleben unendliches Leid durch Krieg, Flucht, Vertreibung und Verschleppung. Auch wenn wir hierzulande nicht unmittelbar von diesen Katastrophen betroffen sind, so ist es im weitesten Sinne doch für alle, die mit Kindern arbeiten und leben, entscheidend, dass Kinder unter den heutigen Verhältnissen gesund aufwachsen können.
Die Jahre der Pandemie sind nicht spurlos an unserer Gesellschaft vorbeigegangen, und während dieser Zeit waren in erster Linie Kinder von den Auswirkungen der strikten Beschränkungen, etwa der Schließung von Schulen und Kindergärten, betroffen. Neben dem Bewegungsmangel und dem ansteigenden Medienkonsum zeigen sich die Folgen inzwischen in einer Zunahme chronischer und psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter.
Des Weiteren betrifft der zunehmende Fachkraftmangel viele Kindergärten und Tagespflegeeinrichtungen, und die häufige Fluktuation der Fachkräfte destabilisiert zusätzlich das System der Kinderbetreuung und führt zu einer Unzufriedenheit aufseiten der Eltern wie der Pädagoginnen und Pädagogen.1 Auch hier sind die Leidtragenden die Kinder. Daher müssen auch Arbeitszeit- und Betreuungsmodelle sicherlich neu gedacht und erarbeitet werden.
Aus der Erkenntnis, dass das gegenwärtige Leben viele Fragen und Forderungen an uns stellt – etwa nach sozialer Gerechtigkeit, nach Gleichberechtigung, nach Veranlagung von Gesundheit und der Bildung des gesamten Menschen –, hat Rudolf Seiner bereits vor über einhundert Jahren die Grundlagen der Waldorfpädagogik entwickelt. Diese Fragen und Aufgaben sind heute genauso aktuell wie damals und fordern unsere Gesellschaft heraus. Schon 1907 machte Steiner deutlich: «Nicht Forderungen und Programme sollen aufgestellt, sondern die Kindesnatur soll einfach beschrieben werden. Aus dem Wesen des werdenden Menschen heraus werden sich wie von selbst die Gesichtspunkte für die Erziehung ergeben.»2
Kenntnisse über die Entwicklung des Kindes, die Steiner in zahlreichen Vorträgen zur Menschenkunde beschrieben hat, bilden eine wichtige Grundlage für die pädagogische Arbeit der Waldorfkindergärten. Die Kinder in der sich ständig wandelnden Welt wirklich wahrzunehmen ist eine weitere Aufgabe, die sich daraus ergibt: zeitgemäß auf die Bedürfnisse der heranwachsenden Generation einzugehen und die Kinder und Jugendlichen zu begleiten, sodass sie dann die Chance haben, ihr Leben frei zu ergreifen und zu gestalten.
Waldorfkindergärten verstehen sich als «lernende Organisationen», die sich den Herausforderungen der Gesellschaft stellen und nach Lösungen zum Wohle der Kinder suchen. So liegt es an den Kollegien und jeder einzelnen pädagogischen Fachkraft, sich weiterzubilden, lebenslang zu lernen und sich somit immer wieder auf das Wesentliche in der Entwicklungsbegleitung der Kinder zu besinnen.
Das Buch mag hierzu eine Anregung geben, um Hintergründe besser zu verstehen und ein tieferes Verständnis für die Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern zu ermöglichen.
Frankfurt am Main, im Dezember 2024
Marie-Luise Compani
1Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den folgenden Beiträgen zumeist die weibliche Form – also «Erzieherin» oder «Pädagogin» – verwendet. Alle wertgeschätzten männlichen Erzieher und Pädagogen mögen sich hiermit aber gleichermaßen angesprochen fühlen.
2Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft (1907), in: Lucifer-Gnosis. Grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus «Luzifer» und «Lucifer-Gnosis» 1903–1908, GA 34, Dornach: Rudolf Steiner Verlag 21987, S. 311f.
Geleitwort
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns sehr, dass durch die Unterstützung der Vereinigung der Waldorfkindergärten e. V. mit all ihren Mitgliedseinrichtungen die Veröffentlichung dieses Buches in der 3. Auflage ermöglicht worden ist. Unser besonderer Dank gilt Marie-Luise Compani, die sich für die Neuausgabe dieses Buches eingesetzt und als Herausgeberin engagiert hat. Wir bedanken uns auch bei allen Autorinnen und Autoren, die mit ihren unterschiedlichen Beiträgen und Perspektiven zu einem fundierten Einblick in die Waldorfpädagogik der frühen Kindheit einladen und ein tieferes Verständnis der kindlichen Entwicklung ermöglichen. Auf verschiedenste Weise wird geschildert, wie sich die tragenden und leitenden Ideen dieser Pädagogik lebendig in der Praxis der Waldorfkindertageseinrichtungen, vor allem durch die dort tätigen Pädagoginnen und Pädagogen, widerspiegeln.
Das Erscheinen dieser Neuausgabe fällt in eine Zeit, in der allerorts und täglich Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen unter dem Druck des Fachkräftemangels stehen und in der hohe Krankheitsausfälle die Qualität der täglichen Arbeit in Kindertageseinrichtungen aller pädagogischen Richtungen beeinträchtigen. Mit großer Besorgnis ist zu beobachten, wie sich die über Jahre errungenen Aus- und Weiterbildungsstandards für pädagogische Fachkräfte angesichts dieser Situation im kontinuierlichen Sinkflug befinden. Eltern bangen täglich darum, ob die Kindertageseinrichtung, die ihr Kind besucht, überhaupt geöffnet sein wird. Während einerseits der Wert frühkindlicher Bildungsangebote als fundamentaler Grundstein für das ganze Leben postuliert wird und Sorgeberechtigte vor diesem Hintergrund über Jahre zunehmend das Gefühl vermittelt bekamen, dass eine professionelle und institutionalisierte Betreuung für das Wohl ihrer Kinder das Mittel der Wahl sei, trauen sie sich nun andererseits kaum noch, nach der Qualität des Angebots zu fragen, das wir als Gesellschaft für ihre Kinder zur Verfügung stellen. Augen zu – und durch? Besser nicht! Denn den Preis für die frühkindliche Bildungsmisere werden letztendlich die Kinder tragen.
Das vorliegende Buch wird diese komplexe Problemlage natürlich nicht lösen können – dazu ist es auch nicht gedacht. Aber es ist zu hoffen, dass es unterschiedlichen Gruppen von Leserinnen und Lesern in verschiedenster Weise Anregungen geben kann.
Pädagogischen Fachkräften in Waldorfkindergärten kann es eine Unterstützung sein, sich auf die Hintergründe und Zielsetzungen der täglichen pädagogischen Arbeit zu besinnen und sich in Bezug auf Fragen, die sich hierzu stellen, noch sprachfähiger zu machen. Waldorfpädagogik hat Antworten auf die Bildungs- und Erziehungsfragen von heute!
Möglicherweise bietet dieses Buch Kolleginnen und Kollegen, die sich bislang mehr mit anderen pädagogischen Ansätzen beschäftigt haben oder sich in der Ausbildung befinden, einen Einblick in die Theorie und lebendige Praxis der Waldorfkindertageseinrichtungen. Wir hoffen, es ermutigt dazu, sie als Entwicklungs- und Entfaltungsorte für Kinder und Erziehende kennenlernen zu wollen. Die allgemein angespannte Situation, die derzeit herrscht, hat eben auch zur Folge, dass sich pädagogische Fachkräfte genau überlegen können, wie und wo sie sich mit ihrer Kraft zukünftig einsetzen werden.
Dies gilt nicht zuletzt auch für alle Sorgeberechtigten, die durch die Wahl des Krippen- und Kindergartenplatzes entscheidenden Einfluss auf die Bildungslandschaft nehmen, in der sich ihr Kind bewegt. Für dessen ganze Biografie und auch für seine Gesundheit ist eben viel weniger entscheidend, was es lernt, als die Frage, wie und zu welcher Zeit, also in welchem Lebensalter und auf welchem Entwicklungsstand, es mit bestimmten Herausforderungen und Inhalten umgehen sollte. Dabei ist die sich entfaltende Individualität ihres Kindes nicht das Ergebnis des Erziehungsprozesses, sondern sie ist von Beginn an aktiv an diesem Geschehen beteiligt.
So hoffen wir, dass dieses Buch von vielen interessierten Leserinnen und Lesern wahrgenommen wird. Die Tatsache, dass jeder Beitrag für sich ein abgeschlossenes Kapitel behandelt, trägt sehr zur Lesefreundlichkeit bei, lädt ein zum Stöbern zwischen den Artikeln und dazu, sich Stück für Stück mit den Themen zu beschäftigen.
Für die Vereinigung der Waldorfkindergärten
Sabine Cebulla-Holzki
I. Waldorfkindergarten heute
1Vgl. z. B. Peter Loebell (Hrsg.), Waldorfschule heute. Eine Einführung, Stuttgart 2011; Wolfgang Held, Das ist Waldorfschule!, Stuttgart 2019; sowie Frans Carlgren / Arne Klingborg, Erziehung zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf Steiners, Stuttgart 122019.
2Näheres dazu siehe z. B. Stefan Leber, Historische und gesellschaftliche Zusammenhänge der Waldorfschulen, in: Peter Loebell (Hrsg.), Waldorfschule heute. Eine Einführung, Stuttgart 2011, S. 36ff.
3Rudolf Steiner, Aussagen vom 23.6.1920 und vom 21.12.1921. Siehe dazu auch Helmut von Kügelgen, Das Recht auf Kindheit. Idee und Ausbreitung der Waldorfkindergärten, in: Stefan Leber (Hrsg.), Waldorfschule heute. Eine Einführung in ihre Lebensformen, Stuttgart 2001, S. 99.
4Aktualisierte Zahlen finden sich unter www.waldorfkindergarten.de, unter www.iaswece.org und www.waldorfschule.de
5Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft (1907), in: Lucifer-Gnosis. Grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus «Luzifer» und «Lucifer-Gnosis» 1903–1908, GA 34, Dornach: Rudolf Steiner Verlag 21987, S. 311f.
6Emmi Pikler, Lasst mir Zeit. Die selbstständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen, München: Pflaum Verlag 2001.
II. Pädagogische und menschenkindliche Grundlagen
Claudia Grah-Wittich Menschenkundliche Grundlagen der Waldorfpädagogik
1. Der besondere Zeitraum der ersten drei Lebensjahre
Die ersten drei Jahre des Kindes zeichnen sich als Entwicklungsraum dadurch aus, dass wir an dem heranwachsenden Menschen den starken Gegensatz zwischen den ihm angeborenen Fähigkeiten und Kompetenzen (z. B. den Saugen an der Mutterbrust) und seiner gleichzeitigen existenziellen Schutzlosigkeit und Abhängigkeit von den ihn umgebenden Erwachsenen erleben kann. Das ist wie ein Widerspruch erlebbar, der uns Rätsel aufgibt. Wenn man ein Kind jedoch individuell und situativ wahrnimmt, sollte man dessen bereits vorhandenen Kompetenzen von Anfang an respektieren und ihm gleichzeitig die nötige Fürsorge und Pflege angedeihen lassen; so überbrückt man den scheinbaren Widerspruch. Nur wenn man diese Autonomie des Kindes berücksichtigt, wird in den ersten drei Jahren die Erziehung zur Freiheit angebahnt – als Voraussetzung und Grundlage für eine spätere Friedensfähigkeit und Sozialkompetenz.
Das Kind ist in den ersten drei Jahren noch ganz eins mit seiner Umgebung, was sich in seiner außerordentlichen Anpassungsfähigkeit und Beeinflussbarkeit zeigt. Dies kann von seiner Umgebung leicht ausgenutzt werden. Deshalb ist es nötig, einen Schutzraum zu bilden, in dem das Kind als Individualität auf seine Art, in seiner Zeit und seinen Entwicklungsimpulsen gemäß, lernen und Basiskompetenzen ausbilden kann. Es braucht dazu einerseits vielfältige Anregungen seitens seiner Umgebung. Andererseits sind seine Eigenbewegungen und Impulse, sein Interesse an einer Sache und seine emotionale Beteiligung von essenzieller Bedeutung, weil dadurch Entwicklung stattfindet sowie die Sinne geschult werden und das Gehirn sich in einer dem Kind gemäßen Art und Weise ausformen kann.
Rudolf Steiner weist noch auf ein weiteres bedeutsames Element hin: «Zu den Kräften, welche bildsam auf die physischen Organe (Anm.: dazu gehören auch die Sinnesorgane) wirken, gehört also Freude an und mit der Umgebung. Heitere Mienen der Erzieher, und vor allem redliche, keine erzwungene Liebe. Solche Liebe, welche die physische Umgebung gleichsam warm durchströmt, brütet im wahren Sinn des Wortes die Formen der physischen Organe aus.»1
Freude und Liebe seitens der Bezugspersonen umhüllen das Kind mit seelischer Wärme und helfen ihm in seiner Entwicklung. Diese ichhaften Seelenqualitäten tragen somit wesentlich dazu bei, dass ein Kind in der Lage ist, die Basiskompetenzen zu erwerben, auf denen alle spätere Entwicklung aufbaut.
Ein Betreuungskonzept für Kinder unter drei Jahren sollte aus all diesen Gründen grundlegend anderen Richtlinien folgen als Konzepte für Kindergärten: Denn in den ersten drei Jahren lernen Kinder nicht nur gehen, sprechen und denken, in diesem Zeitraum ist ihre potenzielle Bildungsfähigkeit generell am größten und somit auch die Chance, sie optimal zu fördern. Die Gefahr, Entwicklungschancen zu verpassen und Einseitigkeiten zu veranlagen, ist jedoch ebenso groß.
Urgeste der Menschwerdung – das Himmelskreuz
Der Vorgang oder – poetischer ausgedrückt – das Geheimnis der Menschwerdung liegt als zentrale Urgeste nicht nur der Schwangerschaft zugrunde, sondern zeigt sich auch in den ersten drei Jahren der kindlichen Entwicklung: Die Polarität eines weiblichen und eines männlichen Elternteils ist die Voraussetzung für die Zeugung eines Dritten – so setzt sich der Lebensstrom im Kind fort.
Durch die Konzeption kommt es innerhalb der ersten etwa 21 Entwicklungstage zu einer nachweisbaren molekularen und genetischen Manifestation des zuvor nicht sinnlich wahrnehmbaren, rein geistig-vorgeburtlich vorhandenen Menschenkerns in seiner individuellen Einmaligkeit – in einer von den Eltern bereitgestellten Physis. Eine einzigartige Individualität entsteht in einem belebten Leib. Wer von der Existenz einer geistigen Welt neben der irdisch-sinnlichen ausgeht, kann diesen Inkarnationsvorgang eines rein geistigen Wesens in eine leiblichsinnliche Körperlichkeit erahnen. Bildlich gesprochen werden dadurch Himmel und Erde in dieser Individualität lebenslang verbunden: Vom Moment der Zeugung an gestaltet der Mensch seine Biografie – bis hin zu seiner späteren sozialen Umgebung – in der Auseinandersetzung mit Himmel und Erde, Geist und Materie, Licht und Dunkelheit.
Das Neugeborene, wie der Mensch überhaupt, ist somit «Bürger zweier Welten» (geistig und irdisch-leiblich). Es ist darüber hinaus eingespannt in die seelische Polarität von mütterlichem und väterlichem Element. Neben der geistigen (Himmel, Erde) haben wir somit auch eine seelische Polarität, gegeben durch die Eltern. Diese jeweilige Doppelzugehörigkeit ist in allen großen wie auch in allen alltäglichen Entwicklungsvorgängen als vertikale und horizontale Strebensrichtung vorzufinden.
Einflüsse auf die kindliche Entwicklung
Das ganz Besondere und Einzigartige der ersten drei Jahre liegt darin, dass sich das Kind in dieser Zeit erst langsam in seinen Leib einlebt (inkarniert) und damit noch offen ist für alle Einflüsse, noch verbunden mit der Welt, aus der es kommt – der geistigen Sphäre. Nicht umsonst sagt der Volksmund, ihm «steht der Himmel noch offen». Über die Nachahmung verbindet sich das Kind in diesen ersten drei Lebensjahren mit seiner Umgebung – es befindet sich dabei in einem traumartigen Bewusstseinszustand. Nur dadurch kann es die Grundfähigkeiten von Gehen, Sprechen und Denken wie von höheren Kräften und Wesenheiten intendiert erwerben.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, in welchem Ausmaß die kindliche Entwicklung in den ersten drei Jahren von einem unbewussten höheren Selbst gelenkt wird – beim Erwerb genau der Fähigkeiten, die den Menschen zum Menschen machen:
Beim Aufrichten und Gehenlernen überwindet das Kind die physische Schwerkraft.
Beim Sprechenlernen kommt es ins Gespräch mit anderen Menschen und findet sich damit in der Menschheit ein.
Beim Denkenlernen stellt der Mensch aus sich selbst heraus geistig den für die sinnliche Wahrnehmung verloren gegangenen Zusammenhang zur Welt wieder her.
Durch den Erwerb dieser Fähigkeiten gewinnt das Kind Schritt für Schritt mehr «Selbstgefühl». Unermüdlich schaffend und übend, erlebt es sich zunehmend als selbstwirksames Eigenwesen. Das Verständnis oder zumindest die Offenheit, die Eltern und Erziehende dem Vorgeburtlichen des Menschen gegenüber haben, und die Bedeutung, die es für sie hat, spielen dabei eine wesentliche Rolle. Denn selbst wenn die vorgeburtliche Existenz der Individualität des Kindes (oder der daran anschließende Gedanke der Reinkarnation) nur hypothetisch angenommen wird, eröffnet eine solche Perspektive die Möglichkeit, dessen Autonomie von Anfang an in der Betreuung zu berücksichtigen, das heißt konkret: mit dem höheren Selbst des Menschenkindes, mit seiner einzigartigen Persönlichkeit, zu rechnen und sie bewusst zu befragen.
In der Schwangerschaft bildet sich der physische Körper mit allen Anlagen und Organen, und er befindet sich dabei in einem sich ständig verändernden Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Umgebung, dem mütterlichen Organismus. Nach der Geburt müssen wir nun bewusst und aktiv die jeweiligen Bedingungen herstellen, die das Kind auf seinem Weg von größtmöglicher Abhängigkeit zu größtmöglicher Selbstständigkeit benötigt. Die institutionelle Kinderbetreuung in den ersten drei Jahren im Bereich der Waldorfkrippe oder des Waldorfkindergartens versucht diese sonst in der Familie stattfindende Entwicklung möglichst wesensmäßig nachzubilden.
Entwicklung zwischen verschiedenen Polen
Das Kind ist von Geburt an ein kompetentes Wesen,2 in dem potenziell alle Möglichkeiten für eine gesunde Entwicklung schlummern. Das kann bei jedem noch so kleinem Schritt, insbesondere aber im Rahmen der Bewegungsentwicklung, verfolgt werden: Das Kind führt individuell geprägte, aber doch von einem Weltenrhythmus durchzogene Bewegungen aus, die immer wiederkehren: Dehnung, Zusammenziehen, Drehung, Öffnen, Schließen, rechte Betonung, linke Betonung, nach vorne und nach hinten.
Das «große Himmelskreuz» des Menschen lässt sich demnach bis in jede Einzelheit der kindlichen Entwicklung hinein wiederfinden: Im Hin- und Herpendeln zwischen geistiger Individualität und physischem Erbstrom bzw. zwischen mütterlichem und väterlichem Element, mit jeder inneren oder äußeren Bewegung versucht das Kind, sich selbsttätig mit Himmel und Erde zu verbinden, bemüht es sich, das richtige Verhältnis zwischen den seelischen Qualitäten z. B. von Mutter und Vater zu finden.
In der Pflege empfängt es dabei Angebote vom Erwachsenen aus der unmittelbaren menschlichen Umgebung und nimmt sie auf.
Durch die Eigentätigkeit bzw. -bewegung ruft es andere Umgebungskräfte herein.
Beide Gesten verlangen eine schützende Hülle: Das Kind kann seine Eigentätigkeit unter der Einwirkung des Kosmos nur dann autonom und frei entfalten, wenn es sich bei der allmählichen Aneignung von Kulturfähigkeiten in dem Klang und den Schwingungen menschlicher Interaktion geborgen fühlt.
2. Der Kräftezusammenhang des Lebendigen oder des Ätherischen
Die Wesensglieder
Rudolf Steiner unterschied in seiner Anthropologie bei der menschlichen Wesenheit verschiedene «Wesensglieder», die sich nach und nach bis etwa zum einundzwanzigsten Jahr inkarnieren: den physischen Leib, den Lebens- oder Ätherleib, den Astralleib und den Ich-Leib bzw. den Ich-Organismus. Diese leiblichen Funktionen durchdringen einander teilweise, unterscheiden sich aber in Größe, Form, Funktion und Beschaffenheit:
Der physische Leib ist aus festen, mineralischen Stoffen aufgebaut, die uns Halt und Kontur geben. Wir haben ihn mit Mineralen, Pflanzen und Tieren gemeinsam.
Was dem physischen Leib jedoch Leben einhaucht und Wachstum ermöglicht, ist der Lebensleib, auch Ätherleib genannt. Ihn haben wir mit Pflanzen und Tieren gemeinsam. Er steuert alle Flüssigkeitsprozesse und ist ein reiner Kräfteorganismus.
Der Astralleib wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass wir alles, was uns geschieht, auch als innerseelischen Vorgang empfinden können. Wir haben ihn mit den Tieren gemeinsam. Er ist ein reiner Lichtleib und folgt den Gesetzen des Luftigen.
Der individuelle Ich-Leib ist rein menschlicher Natur. Sein Element ist die Wärme. Wärme ist immer ein Indiz für Ich-Tätigkeit, sei es nun Körper-, Seelen- oder Geisteswärme.
Die Geburt der Wesensglieder in Jahrsiebten
Die anthroposophische Menschenkunde3 spricht von unterschiedlichen Geburten (der Wesensglieder), die der Mensch durchmacht, bis er sich mit etwa einundzwanzig Jahren schließlich zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit entwickelt hat. Auf diesem Wege gibt es markante Punkte, an denen bestimmte Reifungsprozesse erkennbar zum Abschluss kommen.
1. Physische Geburt
Die erste Geburt erfolgt nach der neunmonatigen Schwangerschaft und setzt den physischen Leib frei. Mit der physischen Geburt kommt das gesunde Kind mit allen Anlagen auf die Welt, die es für seine Entwicklung braucht. Es wird mit der Trennung der Nabelschnur von seiner physischen Abhängigkeit gegenüber dem mütterlichen Organismus frei.
2. Die Geburt des Lebens- oder Ätherleibes
Im Hinblick auf den ätherischen Organismus und all seine Lebensfunktionen bleibt das Kind in den ersten Monaten jedoch noch vollständig von der Umwelt abhängig, vor allem von der Mutter. Wir können auch von einer ätherischen Embryonalentwicklung sprechen, die mit dem Hervortreten der härtesten körperlichen Einlagerungen, den eigenen Zähnen, etwa mit dem siebten Lebensjahr endet und damit – auch nach allgemeinem Verständnis – in der Regel die Schulreife kennzeichnet.
Dieser Reifeschritt, der vor allem den Kopf betrifft und mit dem Nervensystem zusammenhängt, kennzeichnet alle Formprozesse des Organismus: Die formenden Wachstumskräfte werden nun frei vom physischen Leib, frei für das gestaltende, abstrakte Denken; dies wird auch als die «Geburt des Ätherleibes» bezeichnet. Dadurch wird der Lebenskräfteib des Kindes frei von den Umgebungshüllen, dem «ätherischen Mutterleib», und steht dem Kind für die Lernvorgänge in der Schule fortan als eigenständiger Organismus zur Verfügung.
3. Die Geburt des Seelen- oder Astralleibes
Die Ätherkräfte, die das rhythmische System und die Geschlechtsorgane ausdifferenzieren, sind etwa bis zum vierzehnten Lebensjahr im Körper und in den Wachstumsvorgängen tätig. Erst mit der Geschlechtsreife – der Möglichkeit der biologischen Fortpflanzung – haben sie ihre Aufgabe erfüllt, werden frei vom Ätherleib und stehen nun als Potenzial für ein differenziertes Gefühls- und Seelenleben zur Verfügung. Dieser Vorgang wird als Geburt des Seelen- oder Astralleibes bezeichnet.
4. Ich-Geburt
Die Ätherkräfte des Stoffwechselsystems werden erst mit der Mündigkeit frei – was auch als «Geburt der Ich-Organisation» bezeichnet wird. Nun erst ist der mündige – und damit auch strafmündige – junge Mensch vollends in der Lage, selbst die Verantwortung für den weiteren Lebensweg, etwa die Ausbildung oder das Studium, zu übernehmen.
Metamorphose der Wesensglieder
Der Kräftezusammenhang, in dem sich das Kind im ersten Jahrsiebt, vor allem aber in den ersten drei Jahren, entwickelt und bewegt, ist die Sphäre des Lebendigen, der dynamischrhythmischen Ätherkräfte, die heute von vielen Seiten bedroht wird. Wir müssen das Ätherische in seinem Wirken verstehen, wenn wir ein die Lebenskräfte förderliches Betreuungskonzept in den Waldorfkrippen für die ersten drei Jahre einrichten wollen.
Das setzt auch ein Verständnis des Steinerschen Paradigmas von der Metamorphose der Wesensglieder voraus: Steiner spricht zum einen von «inkarnierender» Wesensgliedertätigkeit, durch die Wachstum und körperliche Entwicklung möglich wird und die alle Wachstums- und Regenerationsprozesse ab dem Moment der Zeugung umfasst. Von «exkarnierender» Tätigkeit spricht er im Zusammenhang mit dem Leibfrei-Werden der Wesensglieder, sobald sie ihre inkarnierende Arbeit getan haben. Erst dadurch wird seelisch-geistiges Leben möglich, das als unser leibfreies Potenzial ewiger Natur ist. Der Prozess der Metamorphose von inkarnierender in exkarnierende Wesensgliedertätigkeit vollzieht sich aber nicht nur in Form der geschilderten Wesensgliedergeburten – die besonders markante Reifeschritte darstellen –, sondern lebenslänglich, von der Geburt bis zum Tod.
Wachstum und Denkvermögen
Die Schwelle zwischen Körper und Seele ist das Herz als Ort, an dem die ätherischen Kräfte den Körper verlassen können. Denn das Herz ist der einzige Ort, an dem der Blutkreislauf, der Träger des Ätherischen, während der Diastase für Momente zum Stillstand kommt: Das Leben entweicht, es exkarniert und wird zu Geist – und bildet so die Grundlage für unser Denk-, Fühl- und Willensvermögen.
Dieses Forschungsergebnis Rudolf Steiners führt zu einem neuen Verständnis des Leib-Seele-Zusammenhangs und bietet die Möglichkeiten, die Fachgebiete von Pädagogik und Medizin in ihrem Zusammenhang zu verstehen. Denken, Fühlen und Wollen als seelisch erfahrbare Qualitäten werden in ihrem Leibbezug durchschaubar:
Der Ätherleib ist als Träger des Gedankenlebens zu erkennen
der Astralleib als Träger des Gefühlslebens
und die Ich-Organisation als Träger des Wollens bzw. Tuns.
Eine gesunde Inkarnation des Ätherleibes ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern muss durch die Erziehung unterstützt werden. Wird sie durch kognitives Frühtraining und die Förderung abstrakten Denkens behindert, emanzipiert sich der Ätherleib zu früh, und ein Mangel an Vitalität in der zweiten Lebenshälfte ist die Folge.
Nachlassende Abhängigkeit der ätherischen Kräfte
Mit Blick auf die Geburt des Lebens- oder Ätherleibes erkennen wir: Die ätherische Abhängigkeit klingt im Laufe des ersten Jahrsiebtes allmählich ab, indem die Lebenskräfte aus dem Kosmos und der menschlichen Umgebung, die das Kind wie eine Hülle umgeben, allmählich mit seinen eigenen Lebenskräften verschmelzen, bis diese am Ende des ersten Jahrsiebtes als ätherischer Organismus frei werden. Der Prozess der Aneignung, Verdichtung und Entfaltung der Lebenskräfte vollzieht sich demnach in einem sehr engen,
Das Verhältnis der physischen Schwangerschaft von 9 Monaten zur ätherischen Schwangerschaft von 7 Jahren – ein sich verringerndes Abhängigkeitsverhältnis
jedoch ständig sich verringernden Abhängigkeitsverhältnis zum «ätherischen Mutterleib» der Umgebung. Und so wie der Embryo in den ersten zwölf Wochen in einem äußerst abhängigen und labilen Verhältnis zur Umgebung, dem Mutterleib, steht und erst ab der 24. Woche mit ärztlicher Hilfe Überlebenschancen hat, so steht das Kind nach der Geburt in den ersten 2,2 Lebensjahren in einem vergleichbar abhängigen Verhältnis zu seiner physischen Umgebung. Entsprechend können wir sagen, dass ein Kind erstmals mit etwa viereinhalb Jahren (4,4 Jahren) mit großer gezielter Unterstützung ätherisch unabhängig sein könnte – allerdings nur im Sinne einer Frühgeburt. Die tatsächliche Unabhängigkeit von seiner ätherischen Umgebung erlangt es erst mit sieben Jahren.
Mit diesem Vergleich soll nicht gegen die frühe Institutionalisierung der kindlichen Lebenswelt (Kinderkrippe, Kindertagesstätte usw.) gesprochen werden, sondern vielmehr der Blick der Verantwortlichen darauf gelenkt werden, was seitens der Umgebung zu leisten ist und was das Kind für seine ätherisch-körperliche Entwicklung braucht.
Die Bedeutung der Eigentätigkeit des Kindes
Durch die Eigenbewegungen und -aktivitäten des Kindes beim unermüdlichen Tätigsein werden die im Physischen verankerten Organe, vor allem die Sinne, geschult, und dadurch wird auch das Gehirn individuell geformt. Die fortwährende Bewegung regt die Lebenskräfte an, die den Leib bilden und durchformen. Die Organe werden zwar während der neunmonatigen Schwangerschaft gebildet, müssen danach aber lebensvoll betätigt werden und brauchen physische, seelische und geistige Anregung, um sich auf individualisierte Art und Weise ausformen und ausgestalten zu können. Was im ersten Jahrsiebt, vor allem aber in den ersten drei Jahren, in den Organen – allem voran im Gehirn – an Form und Gestalt angelegt wird, ist bestimmend für das ganze weitere Leben. In späteren Jahren bedeutet Entwicklung nur noch Wachstum dieser im ersten Jahrsiebt angelegten Formen. Die immer weitergehende Verdichtung der Ätherkräfte aus der Hülle der Umgebung lässt den physischen Leib mittels Bewegung und eigenaktives Tun zu einem «verlässlichen Patron» (Steiner) werden. Der eigentätige Wille spiegelt sich auch in der fortschreitenden Vernetzung von Verschaltungen im Gehirn: 80 Prozent davon vollzieht das Kind in den ersten drei Lebensjahren.
Das Kind wird zwar mit einer Art «Modellleib», der aus dem Erbstrom heraus gebildet wurde, geboren, verwandelt ihn aber bis zum siebten Lebensjahr – je nach Individualität mehr oder weniger – in einen individualisierten eigenen Leib, bis hin zu den eigenen Zähnen. Freude und Liebe in der Umgebung hüllen die Regungen des Kindes in seelische Wärme und sind neben Sauerstoff und Licht die wichtigsten Elemente, damit die Aneignung des noch «fremden» Erbleibes durch die eigene Individualität gelingen kann.
3. Die richtige Umgebung für das Kind
Wie bereits dargestellt, bringt das Kind alle Fähigkeiten mit, um aus sich selbst heraus zu wachsen und sich zu entwickeln – wenn die Umgebung entsprechend gestaltet ist. Das heißt, die vom Erwachsenen gestaltete Umgebung bildet die Grundlage für Entwicklung und Gedeihen des Kindes. Wie sich das Wasser seinen Weg in seinem Bachbett sucht, jede Pflanze in der Ausgestaltung ihrer Art sich der Umgebung anpasst und sich nach den vorhandenen Bedingungen richtet, so gleicht sich das Kind unabhängig von Veranlagung und Potenzial seiner physischen, seelischen und geistigen Umgebung an.
Was dem Kind angeboten wird an
physischer Substanz: wie Nahrung, Kleidung und Spielmaterialien
ätherischer Substanz: wie klare, nachvollziehbare Strukturen und sinnhafte Zusammenhänge
seelischer Substanz: wie emotionale Befindlichkeit
geistiger Substanz: wie Sensibilität für sein Wesen, aber auch für kosmische und andere unsichtbare Zusammenhänge,
davon wird es im Rahmen seiner Möglichkeiten Gebrauch machen und profitieren. Das Kind wird sich durch alles, was ihm angeboten wird, entweder willkommen und beheimatet fühlen oder sich als Fremdling empfinden und sich nach «besseren Zeiten» sehnen. Die ersten, empfindenden Fragen des Neugeborenen lauten deshalb sinngemäß:
Bin ich auf der Erde richtig?
Bin ich gewollt von der Umgebung?
Kann ich mich in meinem Wesen in Freiheit entfalten?
Bietest du mir eine Beziehung an?
Je nachdem, welche Antworten das Kind in seiner Umgebung vorfindet, wird es unterschiedliche Voraussetzungen haben, sich in seinem Leben mit der Welt und seinen biografischen Aufgaben auseinanderzusetzen.
Die Verantwortung für die Gestaltung der Umgebung obliegt Eltern, professionellen Betreuenden, Pädagoginnen und Pädagogen in gleichem Maße, auch wenn die natürlichen Blutsbande in der Familie anderen Gesetzen unterliegen und oft mehr die Möglichkeit zu instinktivem Handeln bieten, während die professionelle Herangehensweise eine bewusste Auseinandersetzung mit der Kindesnatur verlangt. Im günstigsten Fall wird unser Bemühen um eine angemessene Pädagogik des Lebensanfangs langfristig auch einen bewussteren Umgang mit dem Kind im Elternhaus fördern und gegebenenfalls Licht auf viele Nöte von Familien werfen, die von den verschiedensten Zeiterscheinungen geplagt werden und ihnen oft ratlos gegenüberstehen.
Ein günstiges Entwicklungsklima schaffen
Die Umgebungsgestaltung beginnt bei der inneren Haltung und Gesinnung des Erwachsenen und bildet somit als erste Umgebung die wichtigste Hülle für das Kind. Im optimalen Fall kann unsere Gesinnung dem Kind Zugang zu seiner geistigen Heimat bieten, ja ihm Heimat sein und uns gleichzeitig dazu inspirieren, die physische Umgebung für seine individuelle Entwicklung passend zu gestalten.
Unsere Haltung wird auch durch die Art und Weise, wie wir sprechen, zum Ausdruck gebracht. Sprechend offenbaren wir, «wes Geistes Kind» wir sind: Indem wir Kinder Anweisungen und Erklärungen geben, indem wir sie korrigieren, dirigieren, analysieren und verurteilen, distanzieren wir uns von ihnen und üben ihnen gegenüber Macht aus. Das ist heute so verbreitet, dass man Gefahr läuft, diesen defizitären Blick für «normal» zu halten. Doch Kinderseelen «frieren» in solch einer Atmosphäre – und reagieren schon sehr früh mal mit Rückzug, mal mit Rebellion.
Nehmen wir als Pädagogen jedoch die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes bewusst in den Blick, wirkt das wie ein zutiefst nährendes Lebenselixier, das Zukunftskräfte keimen lässt. Denn ein solcher entwicklungsoffener, positiver Blick bleibt zu keiner Zeit an möglichen Defiziten und problematischem Verhalten hängen, sondern richtet sich auf das, was werden will. Er weist über alles hinderlich Erscheinende hinaus in Richtung Entwicklungspotenzial – und mehr noch: Er ruft diese Entwicklung erst hervor, wie die Sonne das Wachstum der Pflanzen. So entsteht eine Wärmehülle, die jeder Entwicklungsprozess braucht.
Innerer Dialog mit dem Kind und mit sich selbst
Entwicklungsoffenheit im Sinne eines Geist-Erkennens bedeutet, das Kind innerlich immer wieder zu befragen:
Wohin geht dein Weg?
Was kann ich dazu beitragen, damit du diesen Weg gut gehen kannst?
Oder, um es mit den Christusworten (Lk 18,41) zu sagen: «Was willst du, dass ich dir tun soll?»
Voraussetzung für eine solche unbefangen-fragende Haltung ist die Bereitschaft des Pädagogen, innezuhalten, den Blick nach innen zu wenden und auch einen Dialog mit sich selbst zu führen, sich selbst im Sinne einer geistigen Selbstbesinnung zu befragen:
Bin ich feinfühlig und wach genug, dieses Kind zu begleiten?
Was kann ich tun, um es besser zu verstehen?
Welche Fähigkeiten will diese Begegnung in mir hervorrufen?
Inwiefern sitzen wir «im gleichen Boot»?
Das Bespiel einer solchen Besinnungsübung ist die von Rudolf Steiner angeregte Übung, in ruhigen Augenblicken zu versuchen, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, oder die entwickelte Gewohnheit, innere Stille aufzusuchen. Das sind hygienische Übungen zur Verbesserung der gegenseitigen Wahrnehmung. Es kommt nicht darauf an, welche Vorstellungen oder Bilder von Erziehung wir als Pädagogen im Kopf haben, nicht darauf, was wir wissen, sondern ob wir in der Lage sind, Kinder in ihrem Sosein wirklich wahrzunehmen und gleichzeitig für sie wahrnehmbar zu sein. Der britische Psychologe Donald W. Winnicott schreibt: «Wenn ich sehe und gesehen werde, so bin ich.»4
4. Empathie und ihre Voraussetzungen
Wir können das einzelne Kind in seinem Sosein, seiner individuellen Einzigartigkeit nur wahrnehmen, wenn wir als Erziehende die Fähigkeit der Empathie entwickeln und ständig pflegen. Empathie setzt die seelischen Qualitäten der Gegenwärtigkeit, der Authentizität und der Wertschätzung voraus, die wir gewissermaßen als Vorstufen der Empathie betrachten können und die ebenfalls der Übung bedürfen.
Gegenwärtigkeit
Wenn wir gegenwärtig sein wollen, müssen wir uns Fragen nach unserer Aufmerksamkeit stellen:
Wo bin ich mit meinen Gedanken und Gefühlen in Anwesenheit des Kindes?
Bin ich eventuell bei meinen Sorgen und Nöten?
Eltern von unruhigen Kindern können bestätigen, dass die motorische Unruhe ihrer Kinder oft ein Spiegel ihrer eigenen inneren Unruhe und gedanklichen Abwesenheit ist. Das zu bemerken ist bereits der erste bedeutende Schritt zur Gegenwärtigkeit, wie sie in der Plastik des griechischen Wagenlenkers in vollendeter Form dargestellt wird, der die Zügel seines Gespannes lose in Händen hält, um sie nur dann anzuspannen, wenn es die Umstände erfordern. Erwachsene in der Haltung der Gegenwärtigkeit werden vom Kind als anwesend erlebt. Das Kind fühlt sich von anwesenden Erwachsenen wahrgenommen, vor allem wenn es Hilfe und Aufmerksamkeit braucht oder danach fragt.
Authentizität
Doch Präsenz ist nur die Tür in eine weitere Dimension der Begegnung, die Authentizität, das Wie. Da zu sein für das Kind ist viel, reicht aber nicht – wir müssen in unserem
Wagenlenker von Delphi, Bronzestatue, ca. 478–474 v. Chr. (Archäologisches Museum Delphi)
Fühlen in Übereinstimmung mit uns selbst sein und so für das Kind als eigene Persönlichkeit wahrnehmbar sein. Wir müssen uns fragen:
Wie begegne ich dem Kind?
Bin ich dabei authentisch oder imitiere ich jemanden aus der Vergangenheit, z. B. die eigene Mutter, ohne es bemerkt zu haben?
Oder folge ich etwa Erziehungsstilen oder -dogmen, die ich nicht individualisiert habe? Stehe ich voll und ganz hinter diesen Werten?
Kann ich Mutter sein oder spreche ich immer von mir in der dritten Person als von der «Mama»?





























