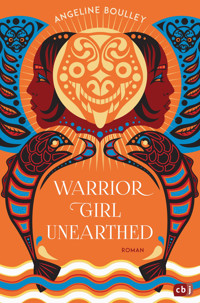
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Ich würde alles tun, um unsere Vorfahren nach Hause zu holen.«
Perry Firekeeper-Birch weiß ganz genau, wer sie ist: der entspanntere Zwilling, die Unruhestifterin, die beste Anglerin auf Sugar Island. Ihre Pläne führen sie nie zu weit weg von ihrem Zuhause und sie würde es nicht anders haben wollen. Aber dann verschwinden plötzlich indigene Frauen aus Perrys Umfeld. Ihre eigene Familie wird in die Ermittlungen zu einem Mord hineingezogen und gierige Grabräuber versuchen aus Artefakten, die rechtmäßig Perrys Anishinaabe Tribe gehören, Profit zu schlagen. Und Perry beginnt, alles infrage zu stellen. Kurzerhand beschließt sie, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Doch bei ihrem Plan gerät Perry ins Kreuzfeuer alter Rivalitäten und Geheimnisse und sie ist sich nicht sicher, ob sie die Wahrheit herausfinden kann, bevor ihre Vorfahren und die verschwundenen Frauen für immer verloren sind …
Nach dem Sensationserfolg von »Firekeeper's Daughter« folgt nun das zweite Buch von New-York-Times-Bestsellerautorin Angeline Boulley über eine Native American, die einen Weg finden muss, ihre Ahnen nach Hause zu holen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Angeline Boulley
Aus dem amerikanischen Englisch von Petra Bös
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die den einzelnen Wochen vorangestellten Zitate sind als Destillat des jeweils nachfolgendes Textabschnittes anzusehen, wobei die Zitate zusammen ein wertschätzendes Kollektiv zum Thema Native Americans bilden.
© 2023 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Copyright: © 2023 by Angeline Boulley. All rights reserved.
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Warrior Girl Unearthed« bei Henry Holt and Company, a registered trademark of Macmillan Publishing Group, LLC, New York
Aus dem amerikanischen Englisch von Petra Bös
Lektorat: Regine Teufel
Umschlagkonzeption und -illustrationen: Suse Kopp, Hamburg
Inspiriert von einem Design von Moses Lunham
sh · Herstellung: AJ
Satz und E-Book-Konvertierung:: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29336-9V002
www.cbj-verlag.de
Für unsere 108.328 Vorfahren, die immer noch in Institutionen aufbewahrt werden; und für all jene, die daran arbeiten, sie nach Hause zu holen.
ERSTE WOCHE
»Als ein Anthropologe gefragt wurde, wie die Native Americans Amerika nannten, bevor die Weißen kamen, antwortete er einfach mit ›unser‹.«
Vine Deloria, Jr., »Custer Died for Your Sins: An Indian Manifesto«
KAPITEL 1
Kapitel 1
Montag, 9. Juni
Ich rase mit dem Jeep über Sugar Island. Meine Schwester und ich teilen uns das Auto. Die aufgehende Sonne zu meiner Linken ist schon über der Baumgrenze. Ich verstelle die Sonnenblende, um das grelle Licht abzuschirmen. Genau das sollten umsichtige Fahrer tun: Ablenkung möglichst vermeiden.
Ich konzentriere mich auf die Straße und halte Ausschau nach dem Schild des Cultural Camps. Pauline neben mir verrenkt sich fast den Hals, um zu sehen, wie viel der Tacho anzeigt. Sie schüttelt den Kopf und seufzt. Ich nehme es als Herausforderung und schalte sanft in den fünften Gang, während ich abbiege. Die Reifen quietschen.
»Denk daran, was Auntie Daunis gesagt hat«, warnt sie mich.
»Du meinst über unser Geburtstagsgeschenk mit der Extraportion Ermahnung?«
»Alles Gute zum Sechzehnten, meine Süßen.« Pauline imitiert Aunties Stimme, die etwas tiefer ist als ihre eigene. »Viel Spaß mit dem braven Pony, aber …«
Ich unterbreche sie fast schon knurrend: »Aber, dass eines klar ist: Wenn ich euch bei irgendwas Verrücktem erwische, hole ich mir den Jeep zurück und trete euch in den Arsch.«
Wir lachen in zwillingstypischem Einklang.
Ich erwähne nicht, was Auntie nur zu mir gesagt hat: Und dazu gehört auch Rasen.
»Warum hast du es so eilig?«, fragt Pauline. »Ist ja nicht so, dass du was zu tun hättest.«
Niemand kann mir so auf die Nerven gehen wie meine Schwester. Ich funkle sie an.
»Moment mal. Bist du immer noch angepisst wegen letzter Woche? Ernsthaft? War es für die arme Perry so eine Qual, eine Woche lang ein paar Universitäten zu besuchen? Die Tour hätte dich inspirieren sollen.« Sie zieht das Wort in-spi-rie-ren in die Länge.
»Das hat mich eine Woche Angeln gekostet!«
Sie schnaubt. »Besser, du wärst zu Hause geblieben. Dann hätten wir nicht Elvis Juniors Atomfürze ertragen müssen.«
Sie hat recht. Ich habe unseren stinkenden Hund, der von gekochtem Essen höllische Blähungen bekommt, als Waffe benutzt. Ich verkneife mir ein Grinsen. Auf einem verblichenen Schild entziffere ich, dass das Sugar Island Ojibwe Tribe’s Cultural Camp eine Viertelmeile entfernt ist.
»Oh my God.« Pauline spürt noch immer meinen Ärger, gibt sich aber nicht geschlagen. Mit einer zusätzlichen Silbe genuschelt, klingt es wie Gaaw-duh. »Es waren doch nur ein paar Unis.«
»Neun Universitäten.« Ich wiederhole die Anzahl auf Ojibwemowin. »Zhaangaswi!«
Sie zuckt bei meinem scharfen Ton zusammen. Ohne hinzusehen, spüre ich ihren Blick auf mir. Meine Stimme wird sanfter, während ich abbremse, um abzubiegen.
»Pauline, das waren neun Universitäten, die mich sowieso niemals aufnehmen würden, selbst wenn ich es wollte. Was nicht der Fall ist.« Ich trete auf die Bremse und setze den linken Blinker, weil man nie weiß, wer einen beobachtet und es Auntie direkt erzählen würde. »Ich möchte nirgendwo anders sein als auf Sugar Island.«
»Du willst Sugar Island nie verlassen?«, fragt sie in ihrer üblichen erstaunten, verurteilenden Art. »Überhaupt nie?«
»›Überhaupt nie‹ klingt gut«, sage ich beim Abbiegen.
»Es gibt noch andere Unis, die dir gefallen könnten! Mackinac State College ist mein Plan B, du könntest dich dort bewerben.«
»Nope, alle Denkmäler an diesen Schulen sind alte Zhaaganaash-Typen. Keine Natives. Kolonisten. Willst du tatsächlich an einer Uni studieren, an der Frauen und PoC unsichtbar sind?«
Pauline ignoriert mich und prüft stattdessen, ob vielleicht eine Haarsträhne aus ihrem fest gewundenen Knoten aus tiefschwarzem Haar herausgerutscht ist. Sie legt eine Hand an ihr Ohr und reibt die Stelle.
»Du siehst gut aus, Egg«, versichere ich ihr.
Sie rollt mit den Augen, als sie ihren heimlichen Spitznamen hört, lässt aber ein winziges Lächeln durchblitzen.
Die schmale Schotterstraße ist ein Hindernisparcours aus Kurven, Senken und Unebenheiten, der sich über eine Ewigkeit erstreckt. Sie endet in einer Wendeschleife vor einer abbruchreifen Blockhütte. Früher organisierte unser Tribe hier Camps, bei denen wir lernten, Felchen zu räuchern und Ahornsirup herzustellen.
»Warum lässt der Tribe die Sommerpraktikanten für die Einführung hierherkommen anstatt in das fancy neue Camp in der Stadt? Ist dieser Ort nicht verflucht?«, frage ich und fahre vor den Eingang.
Wie immer hat meine Schwester auf alles eine Antwort.
»Kein WLAN. Kein gescheites Netz.« Sie schaut in den Spiegel an der Sonnenblende und trägt ihren schimmernden pfirsichfarbenen Lippenstift auf. Er setzt sich von ihrer dunklen Haut ab. »Damit wir ohne Ablenkung in die Kultur eintauchen können.«
»Wohl mehr in Moskitoschwärme.« Ich greife nach dem Insektenspray in der Mittelkonsole.
Pauline nimmt es, bevor sie die Tür aufmacht. Sie winkt einer Gruppe Mädchen zu, die genau wie sie angezogen sind, kurze Jumpsuits mit Blumenmuster und Wedge Sneaker. Sie umarmen sich, als hätten sie sich ein Jahr nicht gesehen und nicht eine Woche.
Meine Schwester bietet Mückenschutz an und wird für ihre Voraussicht gefeiert. Sie streckt ihr langes, schlankes braunes Bein aus, das mit schimmernder Bodylotion eingecremt ist, damit es jemand mit dem Moskitokiller einsprüht.
Ein lauter Schlag lässt mich zusammenfahren.
Lucas Chippeway steht vor dem Jeep. Seine Handfläche schwebt über der dunkelgrünen Motorhaube und es folgt ein zweiter kräftiger Schlag. Bevor er mit einem Drumsolo loslegen kann, drücke ich auf die Hupe.
»Beweg dich, Lucarsch«, sage ich.
Er zeigt ein schräges Grinsen, weswegen ihn alle zum Hottie erklärt haben, außer Pauline und ich.
»Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Ich konnte Pauline heute Morgen nicht mitnehmen. Ich habe bei Granny übernachtet und war nicht sicher, ob ich rechtzeitig wieder auf der Insel sein würde.«
Lucas nickt drei Mädchen zu, die gerade Selfies machen, sie aber erst später werden posten können. Sie kichern, bevor sie ihm den Rücken zudrehen. Er tut, als bemerke er nicht, dass sie es darauf anlegen, sein schelmisches Lächeln und seinen trainierten Körper mit auf dem Foto zu haben.
»Tut es dir leid, dass du keinen Praktikumsplatz bekommen hast?« Er kommt zu meinem Fenster geschlendert. »Vierhundert die Woche, zehn Wochen lang. Ganz schön Kohle.«
»Es tut mir kein bisschen leid, dass ich mich vor den Vorstellungsgesprächen gedrückt habe, um angeln zu gehen.« Ich lache über meinen eigenen Witz und füge bitterernst hinzu: »Aber rat mal, was passiert ist. Pauline hat den Praktikumsplatz im Tribal Council bekommen. Sie ist die einzige Highschool-Schülerin, die in den vier Jahren, seit es das Kinomaage-Sommerpraktikumsprogramm gibt, dort aufgenommen wurde.«
Ich mache mich gerne über meine Schwester lustig, aber nur vor Lucas, niemals vor anderen.
»Ich hab so was gehört. Soll ich sie trotzdem danach fragen?« Zerstreut schnipst er einen Moskito weg, der es gewagt hat, auf seiner braunen Haut zu landen.
»Ja, mach mal. Sag ihr, dass die Praktikantenstellen nach Noten vergeben wurden. Das habe ich Mom und Pops erzählt, damit sie mich nicht nach meinen Vorstellungsgesprächen fragen.«
Pauline ruft nach Lucas und geht zur Blockhütte.
»Ich muss los, Pear-Bear. Sorry, muss scheiße sein, nicht ich zu sein.« Er zeigt wieder sein typisches Lächeln.
»Too bad. So sad. Gonna fish with my dog and my dad«, jamme ich zu M.I.A.s Bad Girls.
Wieder auf der Straße drücke ich aus einem unschlagbaren Grund aufs Gas: einfach so. Einfach, weil der Jeep den ganzen Tag mir gehört, während Pauline bei der Praktikumseinführung ist. Einfach, weil ich den Fisch schon schmecken kann, den ich fangen und heute Abend braten werde. Einfach, weil ich die Collegebesuche letzte Woche überlebt habe, für die meine ersten kostbaren Ferientage draufgegangen sind.
Ich trillere ein leidenschaftliches, schrilles Lee-Lee zum Auftakt des Perry-Firekeeper-Birch-Chill-out-Sommers. Mein offenes Haar fliegt mir um den Kopf wie ein Tornado. Ich drehe die Musik auf und singe mit M.I.A.
»Live fast, die young. Bad girls do it well.«
Da vorne überquert jemand die Straße. Ich erkenne den dünnen, langgliedrigen Typen ganz in Schwarz. Stormy Nodin war Uncle Levis bester Freund. Ich tippe die Bremse an und drehe die Musik leiser.
»Aaniin«, begrüße ich ihn.
Er hebt zur Bestätigung lediglich sein Kinn.
»Ando-babaamibizodaa«, biete ich ihm an, obwohl er meine Angebote, ihn mitzunehmen, bisher noch nie angenommen hat.
Mit einer schnellen Handbewegung lehnt er ab.
Ich probier’s mit einer anderen Einladung, dieses Mal zum Fischessen heute Abend.
»Onaagoshi wiisinidaa. Giigoonh gi-ga-miijimin.«
Sofort nimmt er die Einladung mit einem Kopfnicken an. Hoffentlich bringt mir mein Lieblingsangelplatz Glück und die Fische beißen heute an. Stormy Nodin hat nämlich, auch wenn er noch so dünn ist, einen gesunden Appetit.
»Baamaapii«, sage ich und winke ihm zu.
Die Reifen lassen den Kies aufspritzen, als ich davonbrause.
Der dicke schwarze Hund kommt aus dem Nichts. Kein Hund. Ein Bärenjunges. Es rennt über die Straße.
Blankes Entsetzen packt mich. Während mein Fuß das Bremspedal berührt, spule ich auch schon die Ratschläge meiner Eltern im Kopf ab.
Bremsen. Langsamer.
Bremsen. Nicht schlingern.
Das Bärenjunge verschwindet im Straßengraben.
Bremsen. Wo es einen gibt, gibt es einen zweiten, höre ich meine Eltern einstimmig sagen.
Ich blinzle und da ist Mama Bär auch schon und läuft ihrem Jungen hinterher.
Mein Herz setzt aus, als sie auf dem Weg stehen bleibt. Noch bevor meine Eltern sich in meinem Kopf wiederholen können, schlingere ich. Der Jeep schießt über die Schotterstraße. Ich halte auf die Fliederbüsche zu, schlittere aber stattdessen gegen ein Metalltor.
Ich schließe die Augen, als Metall auf Metall trifft und etwas vor meinem Gesicht explodiert.
Der geöffnete Airbag versperrt mir die Sicht. Mein Herz klopft dreimal so schnell wie normal. Ich hole tief Luft. Der Sicherheitsgurt drückt gegen meinen Brustkorb, was unangenehm ist, aber nicht wehtut. Ich kann Arme und Beine bewegen.
Es geht mir gut.
Nimm dein Handy, schalte das Aufnahmegerät ein, und dann steig, so schnell du kannst, aus dem Wagen aus, höre ich Pops’ Anweisungen in meinem Kopf. Schneide mit dem Multifunktionswerkzeug, das am Türgriff befestigt ist, beide Bänder des Sicherheitsgurts durch. Denk daran, das Notfalltelefon von der Mittelkonsole mitzunehmen. Bring dich in einiger Entfernung in Sicherheit. Nimm weiter die Umgebung und das Auto auf.
Ich richte meine Handykamera auf den Dampf, der unter der Motorhaube des Jeeps hervorquillt, während ich mich rückwärts vom Auto entferne.
Drück die Alarmtaste auf dem Notfallhandy, sodass ich, Mom, Auntie Daunis und deine Schwester einen Anruf und eineSMSmit deinem Standort bekommen.
Ich zögere, bevor ich die Alarmtaste drücke. Mein Herzschlag hat sich normalisiert. Der Kühler ist beschädigt, aber ich glaube, sonst nichts. Es sieht mehr nach einem Blechschaden als nach einem richtigen Unfall aus.
Pops ist unterwegs Richtung Süden, um etwas abzuholen, das er auf Craigslist gekauft hat. Pauline ist im Einführungskurs. Mom ist bei der Arbeit. Auntie? Auf keinen Fall. Ihre Warnung, nichts Verrücktes zu tun, klingt mir immer noch im Ohr.
Aber ich war nicht leichtsinnig. Es war ein Bär. Alles ging so schnell.
Ich könnte zurück zu Stormy Nodin gehen, aber der traditionelle Heiler wird mir vermutlich keine große Hilfe sein, es sei denn, dass man mit Gebeten auf Ojibwemowin einen Kühler reparieren kann.
Ich muss den Jeep in eine Werkstatt auf dem Festland bringen. Obwohl Pops einfach alles reparieren kann, wollte Auntie, dass Pauline und ich für den Unterhalt und die Reparaturen des Jeeps aufkommen. Mit dem Geld auf meinem Bankkonto von Geburtstagen und dem Babysitten kann ich einen Abschleppwagen bezahlen.
Jacks Abschleppdienst macht Werbung im Radio und ein Typ mit tiefer Stimme wiederholt ständig deren Telefonnummer und sagt Ruf an! Ich komme sofort. Als ich einmal mit Granny June in Aunties Auto saß, spielten sie das im Radio. Auntie wollte eine Beschwerde einreichen, aber Granny rief: Einen Teufel wirst du tun! Mehr als diese billigen Kicks kann ich mir nicht leisten.
Mit dem Notfalltelefon rufe ich die Nummer aus der Radiowerbung an. Während ich auf Jack warte, filme ich weiter. Da ich das klobige Notfalltelefon nicht mehr brauche, schiebe ich es hinten in meine Jeans. Ein Telefon neben deiner Poritze unterzubringen, ist nicht so witzig, wie es klingt. Pops will, dass wir jede Situation ernst nehmen. Men of Color – ganz gleich, ob sie Anishinaabe oder Schwarz oder beides wie Pops sind – nehmen die Sicherheit ihrer Kinder nicht auf die leichte Schulter.
Ich verbringe die Wartezeit damit, mir eine gute Geschichte auszudenken, damit ich wegen des Jeeps keinen Ärger mit Auntie bekomme. Dreißig Minuten später sehe ich den Abschleppwagen die Straße entlangholpern und es ist mir noch nichts eingefallen. Als Jack näher kommt, bemerke ich das Auto der Tribal Police hinter dem Abschleppwagen.
Jack hält kurz nach der Privatzufahrt an. Der Streifenwagen bleibt ein paar Meter zurück. Ein Polizist steigt aus dem Auto, ich erkenne ihn und schalte meine Aufnahme aus.
Officer Sam Hill ist harmlos. Alle nennen ihn nur Was-zum, so wie in Was-zum-Teufel?. Das ist eine altmodische Redensart, die ich nicht verstehe. Aber ich verstehe, dass Spitznamen manchmal seltsam sein können. Früher war er Sicherheitsofficer in der Tribal-Grundschule Was-zum kommt auf uns zu.
»Miigwech, Jack.« Ich reiche ihm meine Debitkarte. »Kannst du den Jeep in die Werkstatt deines Bruders bringen?« Sollten Jack und Zack Zwillinge sein, werde ich nach einem Zwillingsrabatt fragen.
»Weiß er schon Bescheid?« Jacks Stimme klingt nicht so tief wie im Radio.
»Ich ruf ihn aus dem Abschleppwagen an.«
Was-zum schaltet sich ein. »Wie ist das passiert, Perry?«
»Ein Bär.« Ich zeige ein breites Lächeln. Es gibt keinen Grund, irgendwelche Fragen zu stellen. Es war nicht meine Schuld. Kein Grund für einen Strafzettel. Kein Grund, mich zu durchsuchen. Und kein Grund, den Tribal Police Captain zu informieren.
Jack befestigt die Anhängerkupplung des Jeeps am Abschleppwagen. Officer Was-zum verabschiedet sich mit einem Winken. Als ich in Jacks Truck steige, um mit ihm zu Zacks Werkstatt in die Stadt zu fahren, lächle ich immer noch. Ich höre förmlich Paulines übliches Gezanke.
Muss schön sein, so sorglos durchs Leben zu gehen.
Meine Antwort macht sie immer wütend.
Es ist fantastisch.
Ein einziger Blick auf Auntie Daunis verdirbt mir meinen köstlich gebratenen Barsch. Sie stapft mit großen funkelnden Augen auf das Lagerfeuer zu. Der aufgetürmte Messy-Bun aus dunkelbraunen Haaren fügt ihrer sowieso schon beachtlichen Größe noch locker sechs Zentimeter hinzu. Und mit den sechs Zentimeter hohen Absätzen ihrer schwarzen Ankleboots ist sie irgendetwas zwischen 1,85 und zwei Metern. Auntie könnte die Zwillingsschwester des Medizinmanns sein, mit ihrer schwarzen Jeans und dem schwarzen Henley-Shirt. Missbilligend presst sie ihre rot geschminkten Lippen aufeinander.
In Gedanken verfluche ich denjenigen, der gepetzt hat. Jack. Zack. Officer Was-zum. Alle auf der Fähre zum Festland. Jeder außer Stormy Nodin, der nur spricht, um zu beten.
Gut, dass Mom und Pops ins Haus gegangen sind, um sich noch mehr Kartoffelsalat zu holen. Pauline ist genauso schweigsam wie Stormy, der sich Barsch reinstopft, als hätte er seit Tagen nichts gegessen. Sogar Elvis Junior kuscht bei Aunties donnerndem Auftritt.
Mit geschlossenen Augen stelle ich mich auf den Crash ein.
»Bist du gerast?«
»Es war eine Bärin mit ihrem Jungen.«
»Bist du gerast?«, wiederholt sie.
»Ein bisschen.«
»Fährst du auch so, wenn mein Kind bei dir im Auto sitzt?«
»Nein.«
»Zack meint, dass sich der Schaden auf dreitausendzweihundert belaufen wird«, sagt Auntie.
Pauline sieht aus, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. Scheiß drauf! Ich hab keine Angst.
»Ich werde mit ihm eine Lösung finden«, sage ich monoton.
Auntie zieht eine Augenbraue hoch. Jetzt habe ich Angst.
»Ich habe Zack bezahlt. Du schuldest mir das Geld«, sagt sie.
Scheiße. Mit Zack hätte ich bessere Bedingungen aushandeln können. Er sagte, er würde einen Schuldschein mit Zinsen über zwei Jahre akzeptieren, bis ich achtzehn würde und die Gewinnbeteiligung ausbezahlt bekäme, die Tribal Citizens vom Superior Shores Casino erhalten.
Ich bin versucht zu sagen, dass die Stoßstange des Jeeps schon seit Ewigkeiten mit Klebeband am Rahmen befestigt war. Das Metalltor war nicht sein erster Gegner. Das gute Pony hat schon einiges erlebt.
Meine Schwester ist ein Genie, aber ich bin keine Idiotin. Ich warte auf Aunties Urteil.
»Im Kinomaage-Programm gibt es noch einen freien Praktikumsplatz. Du fängst morgen früh um 9 Uhr an. Alle Gehaltszahlungen gehen an mich, bis die 3.200 Dollar vollständig abbezahlt sind. Du gehst ins Tribal Museum. Dein Vorgesetzter ist Cooper Turtle.«
Pauline keucht laut. Auch ich spüre einen scharfen Luftzug in meiner Lunge.
Und so löst sich mein Chill-out-Sommer in Rauch auf. Einfach so.
KAPITEL 2
Kapitel 2
Dienstag, 10. Juni
Pauline und ich haben uns auf ein System geeinigt, wer vorne sitzen darf, wenn Mom oder Dad uns irgendwo hinfahren. Sie darf bei der Hinfahrt auf den Beifahrersitz und ich auf der Rückfahrt. Als Mom uns zu unserem Kinomaage-Praktikum fährt, bin ich kurz überrascht, dass meine Schwester hinten sitzen möchte.
Aber ich gehöre nicht zu denen, die ein unerwartetes Geschenk ausschlagen. Ich setze mich auf den Beifahrersitz und lasse einen Ahornsirup-Rülpser. Mom hat heute Morgen Pancakes gemacht, was sie wochentags eigentlich nie tut. Diese Aufmerksamkeiten müssen Teil einer unausgesprochenen Vereinbarung sein: Seid nett zu Perry, da sie für einen Doofkopf arbeitet. Diese Feststellung lässt meinen nächsten Rülpser eher sauer als süß schmecken.
Ich sollte mit Pops und Elvis Junior beim Angeln sein und nicht auf dem Weg in die Stadt.
Während wir darauf warten, an Bord der Fähre zu gehen, nehme ich ein Säckchen Pfeifentabak von der Mittelkonsole. Ich biete Pauline und Mom eine Prise semaa an, bevor ich doppelt so viele der aromatischen Krümel für mich selbst nehme. Wir verstreuen die semaa-Gabe, als wir den St. Marys River überqueren.
Der Fährhelfer winkt Mom an Bord. Ich öffne die Fensterscheibe, bevor sie den Motor abstellt. Die kühle Brise trägt den Geruch von Fisch und Autoabgasen zu mir.
»Warum fahren wir nicht los?«, ruft meine Schwester, um das Aufprallen und Flügelschlagen aus ihrem Handy zu übertönen.
»St.-Marys-Stau«, sagt Mom. »Und dreh dieses Floppy-Birds-Spiel leiser.«
»Flappy Bird«, verbessert Pauline.
Ich flechte mein langes schwarzes Haar auf eine Seite, während wir darauf warten, dass der Eisenerzfrachter auf dem Weg zu den Soo-Locks-Schleusen und von dort zum Lake Superior vorbeifährt.
Pops hat als junger Mann auf den Frachtern gearbeitet. Ich kann ihn mir nicht unter Deck in einem Maschinenraum vorstellen, da er am liebsten in unserem Garten oder auf einem Fischerboot ist. Oder bei Zeremonien das Feuer hütet. Auf jeden Fall im Freien.
Allein der Gedanke, irgendwo in muffiger Luft zu arbeiten, wo es keine Fenster gibt, verursacht mir Übelkeit.
Mit einem langen Tuten des Fährhorns fahren wir los. Mom schmunzelt über etwas, das sie im Rückspiegel sieht. Ich halte den Kopf aus dem Fenster und blicke nach hinten auf eine vertraute Gestalt.
Cooper Turtle steht in der hinteren Ecke der Fähre, den Blick auf Sugar Island gerichtet. Seine Kleidung – ein dunkelblaues Poloshirt und eine khakifarbene Hose – ist das einzig Normale an ihm. Sein walnussbrauner Arm ist wie zum Gruß gebogen, um baamaapii von der Insel unserer Anishinaabe-Vorfahren zu erbitten. Seine Haltung erinnert an die altertümlichen Indianerstatuen, die vor den Zigarrengeschäften aufgestellt waren.
Diesen schweigenden Protest bekundet er seit einigen Jahren, seit der Tribal Council entschieden hat, das Sugar Island Cultural Learning Center – einschließlich der Bibliothek und der Ahnenarchive sowie das Museum – von der Insel ins Stadtzentrum von Sault St. Marie zu verlegen. Viele Tribal Citizens waren verärgert, so auch Mom und Auntie. Aber Kooky Cooper Turtle ist der Einzige, der immer noch protestiert.
Ich danke Schöpfer für den Fluss, bevor ich semaa aus dem Fenster auf das Wasser streue. Ich schicke noch ein Gebet hinterher. Pauline schaut mich mitfühlend an und fährt mit ihrem eigenen Gebet fort. Sie wiederholt wahrscheinlich meine Bitte um Beistand, damit ich diesen Sommer überlebe.
Mom lässt uns vor dem Tribal-Verwaltungsgebäude aussteigen. Das Cultural Learning Center ist direkt daneben. Es zuckt um ihren Mund und so warte ich auf ihre weisen Worte.
»Das wird sicher interessant«, sagt sie, bevor sie davonfährt.
Pauline bleibt zurück. Bestimmt haben sie ihr aufgetragen, ein Auge auf mich zu haben. Sieh zu, dass Perry auch wirklich ins Museum geht. Als ob ich riskieren würde, nicht zur Arbeit zu gehen und von Aunties Spionen verfolgt zu werden.
»Jetzt geh schon«, rufe ich ihr zu.
Schnaubend reißt Pauline die gläserne Eingangstür auf.
Ich sollte netter zu meiner Schwester sein. Der Jeep gehört zur Hälfte ihr. Wegen des Unfalls hat sie überhaupt nicht gemeckert. Wäre es andersrum gewesen, hätte ich nicht so reagiert.
Es hat schon seine Gründe, dass sie der »nette Zwilling« genannt wird.
Ich seufze, bevor ich zur nächsten Tür gehe. Der Tribe hat das Gebäude, das einmal ein kleines Einkaufszentrum werden sollte, renoviert. Mom hat gesagt, dass die Läden so chic waren, dass sich die Geschäftsleute die überteuerte Miete nicht leisten konnten. Es stand ein Jahr leer, bis der Tribal Council beschloss, dass es »zukunftsorientiertes Denken« sei, das Cultural Learning Center hier anzusiedeln. Die Idee dahinter war, dass das Center in der Stadt für Touristen und Einheimische leichter zugänglich wäre und sie auf diese Art unsere Geschichte und Kultur kennenlernen würden.
Einen Schreckensmoment lang stelle ich mir vor, wie Kooky Cooper die Riemen an der Tafel einstellt, die ich als wandelndes Plakat durch die Stadt tragen soll, um für das Tribal Museum zu werben.
Ich betrete einen breiten Flur, der sich über die gesamte Länge des Gebäudes erstreckt. Die Cultural Ressource Library ist auf der linken Seite, das Tribal Museum auf der rechten. Auf einem Schild werden Museumsbesucher gebeten, sich beim Empfang der Cultural Ressource Library am anderen Ende des Flurs anzumelden.
»Aaniin«, begrüße ich die Frau am Empfang. »Perry Firekeeper-Birch meldet sich zur Arbeit.«
Die mürrische Empfangsdame schaut demonstrativ auf ihre Armbanduhr.
»Du bist früh dran«, sagt sie, als wäre ich Stunden zu spät.
Ich lächle und schiele auf ihr Namensschild. »Soll nicht wieder vorkommen, Miss Manitou.«
Sie nimmt ihr Headset, drückt auf einen Knopf und sagt: »Sie ist da.« Ohne auch nur »baamaapii« zu sagen, legt sie auf.
»Er erwartet dich im Museum. Durch diese Tür. Ich drücke gleich den Summer.«
»Mino giizhigat.« Ich wünsche ihr einen schönen Tag.
Sie antwortet mit »hmm«.
»Ähm … Miss Manitou? Könnten Sie kurz warten, bevor Sie die Tür öffnen? Ich bin gleich zurück.« Ohne eine Antwort abzuwarten, stürze ich aus dem Museum.
Neben dem Verwaltungsgebäude gibt es einen kleinen Park. Hinter einer Bank entdecke ich einen Lebensbaum. Ich flüstere ein Gebet und verstreue semaa aus meiner Tasche, bevor ich zwei flache Zweige vom Strauch abbreche. Giizhik gibt mir Schutz und Stärke. Ich ziehe meine Sneaker aus, lege die Medizin hinein und ziehe sie vorsichtig wieder an. Jetzt bin ich bereit.
»Alles bestens«, rufe ich ihr vom Eingang zu.
Der Summer ertönt, und ich höre das leise Klicken, als sich das elektronische Schloss öffnet. Ich war schon zu Exkursionen hier, aber noch nie, wenn alle Lichter ausgeschaltet waren. Die gespenstische Lobby erstreckt sich über die gesamte Breite. Durch einen Torbogen führt ein u-förmiger Weg die Besucherinnen und Besucher durch das Museum, bevor sie durch einen zweiten Torbogen am anderen Ende der Lobby wieder herauskommen. Die Auslagen des Geschenkeladens nehmen die gesamte Länge der Wand zwischen den beiden Bögen ein.
Mit der Taschenlampe meines Handys suche ich auf dem Tresen nach einer Nachricht, die mein Vorgesetzter mir vielleicht hinterlassen hat. Ich finde nichts und mache mich auf den Weg zu den ausgestellten Objekten. Meine Sneaker durchbrechen eine kaum sichtbare rote Lichtschranke an der Türschwelle. Der Bewegungsmelder aktiviert die erste Ausstellung – unsere Schöpfungsgeschichte. Die schwarze Decke wird zu einem Nachthimmel voller blinkender, stecknadelgroßer Lichter. Der klare Klang einer Trommel hallt durch den Raum. Die Stimme eines Ältesten spricht erst auf Ojibwemowin, dann auf Englisch.
Erwartet Cooper Turtle von mir, dass ich durch die ganze Ausstellung gehe?
Anstatt weiterzugehen, sollte ich lieber zurück zum Museumseingang. Ich könnte Miss Manitou fragen, ob Cooper einen bestimmten Treffpunkt angegeben hat, aber sie scheint nicht von der hilfsbereiten Sorte zu sein.
Vom Ende der Ausstellung fällt Licht in den hinteren Teil des Eingangsbereichs. Jemand muss es gerade eingeschaltet haben, sonst hätte ich es zuvor bemerkt. Ich folge dem Licht wie eine Motte.
Im Museum wird unsere Geschichte von der Vergangenheit bis zur Gegenwart dokumentiert. Im letzten Teil wird gezeigt, dass wir heute eine Brücke sind zwischen unseren Vorfahren und denen, die nach uns kommen. Zeitgenössische Kunst ist neben älteren Exponaten ausgestellt, um den Einfluss früherer Generationen zu zeigen.
Die Einbauleuchten in dem großen Saal sind runtergedimmt. Auf der anderen Seite des Raums sind unter einem Scheinwerfer zwölf Körbe aus Schwarzesche auf einer Ausstellungsvitrine aufgereiht.
Ich gehe hinüber. Mein Atem wird schneller, als ich den größten Korb in der Mitte direkt unter dem Spot sehe. Etwas an seiner Form ist mir vertraut. Es spricht mich an.
Nokomis Marias Flechttechnik war so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Meine Urgroßmutter mütterlicherseits färbte die Esche-Streifen stets mit Blütenblättern in leuchtenden Farben. Sie legte zwei verschiedenfarbige Streifen übereinander und flocht sie gedreht in den Korb ein. Dadurch wurde die zweite Farbe auf der Innenseite jeder Windung sichtbar.
Zitternd nähere ich mich der Ausstellungsvitrine.
Nokomis signierte die Körbe mit ihrem Namen, dem Jahr und einem Symbol für den Monat. Ein Ahornblatt mit einem Tropfen zum Beispiel war das Zeichen für Ziisbaakodoke Giizis, für den Sugar-Making Moon, also den Monat März.
Ich schaue mich im Raum um und habe plötzlich das gruselige Gefühl, dass ich beobachtet werde. Cooper ist nirgends zu sehen. Ich greife nach dem Korb, weil ich das Zeichen meiner Urgroßmutter spüren muss.
»Nicht anfassen«, sagt eine harsche Stimme.
Ich drehe mich um. Mein Herz rast.
»Mr Turtle?«, rufe ich und sehe mich nach Kooky Cooper um. Keine Antwort. Ich suche nach Überwachungskameras und Lautsprechern. Dann drehe ich mich wieder zur Ausstellungsvitrine. Ich halte die Hände auf dem Rücken und beuge mich vor, um die Innenseite der Windung besser zu sehen.
Etwas unter dem Korb zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Eine Hand. In dem langen Glaskasten. An einem braunen Arm. Ich trete zurück, um die Statue im Glaskasten in voller Länge betrachten zu können.
Sie blinzelt.
»What the fuck!«, kreische ich.
Cooper Turtle rollt sich aus dem sargähnlichen Glaskasten, dessen Rückwand jetzt nach oben aufgeschwungen ist, wie ein altes Garagentor. Er landet auf dem Boden hinter dem Kasten. Sein Lachen ist ein keuchendes he-he-he-he, das so lange anhält, dass ich mich frage, ob er einen Asthmaanfall hat. Er winkt ab, als ich nach ihm sehen will.
»Das war nicht cool«, sage ich, als er endlich aufsteht. Über seinem dunkelblauen Shirt trägt er ein zweites. Schwarze Buchstaben auf einem weißen T-Shirt: DASISTEINECHTERINDIANER.
»Tut mir leid, Kleine Schwester.« Cooper beugt sich vor, um wieder zu Atem zu kommen. Er wischt sich Lachtränen aus den Augen. »Ich konnte einfach nicht anders. Weißt du, warum?« Er fährt fort: »Bald nach meiner Geburt wurde meine Mutter sehr krank. Sie hatte weder Schwestern noch Cousinen in der Nähe. Also gab mich mein Vater zu einer Zhaaganaash-Frau zum Stillen. Sie stillte mich, bis es meiner Mutter besser ging. Jahre später traf ich die Verwandten meiner Frau bei einem Familientreffen, und ihre Tante sagte, dass ich das indianische Baby gewesen sei, das sie vor dem Verhungern gerettet habe.«
Mir fehlen die Worte. Aber Cooper legt jetzt erst richtig los.
»Alles ist miteinander verbunden, Kleine Schwester. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Der Anfang und das Ende. Die Antworten sind da, noch bevor die Fragen gestellt werden. Du musst dahin zurückgehen, wo du angefangen hast. Und wenn du vom Weg abkommst, hältst du besser die Augen offen.«
Ich will ’nen anderen Job.
Mein erster Auftrag lautet, alle Glasvitrinen im Museum von außen zu putzen. Cooper zeigt es mir an dem Glaskasten, in dem er gerade noch gelegen hatte.
»Du nimmst ein sauberes Tuch. Du besprühst das Tuch, nicht das Glas.« Er zieht ein dünnes Mikrofasertuch von einem Stapel in einem Wäschekorb und besprüht es mit einem violetten Glasreiniger. »Auf der Innenseite musst du die Vitrinen hin und her wischen und auf der Außenseite in kreisrunden Bewegungen. Und wenn du noch Streifen siehst, weißt du genau, auf welcher Seite sie sind.« Damit ich es auch wirklich nicht vergesse, gibt er mir eine Eselsbrücke: »Innen – gerade Linien wie ein Käfig oder eine Gefängniszelle. Außen – Spiralen wie Wolken.«
Cooper zeigt auf den Wäschekorb. Ich hole mir ein Tuch und nehme die violette Sprühflasche, die er mir entgegenstreckt. Mit spitzen Lippen zeigt er auf die nächste Glasvitrine. Ich wische und imitiere dabei seine rotierende Bewegung.
»Genau, Perry-san. Auftragen. Polieren.« Er lacht sich schlapp, als er Mr Miyagi aus Karate Kid zitiert. Sein Lachen klingt wie das He-he-he-he von vorhin, nur nicht so fiepend.
Mein neuer Chef lässt mich in dem großen Ausstellungsraum zurück. Er muss an einem Bewegungsmelder vorbeigekommen sein, da der Raum plötzlich hell erleuchtet ist. Hier gibt es gefühlt hundert Glaskästen.
Ich will … nein … ich brauche einen anderen Job.
Ich weiß auf die Minute genau, wann meine Mittagspause beginnt. Ich lasse mein Putztuch fallen und flüchte wie ein Dieb aus dem Museum.
»Oha«, ruft Pauline von der Parkbank. »So gierig auf Mittagessen?«
Ich halte an. Gierig? Ja. Auf Mittagessen? Chi gaawiin. Großes Nein.
Pauline steht auf. Nach einem schnellen Blick zum Verwaltungsgebäude reibt sie mit dem Finger die Stelle hinter ihrem Ohr.
»Was ist los?«, frage ich, während sie wieder auf die Ziegelwand schaut.
»Ähm. Der Tribal Council hat uns zum Mittagessen eingeladen und …« Ihre Hand bleibt hinter ihrem Ohr.
Warum ist sie wegen eines Mittagessens so nervös?
Dann dämmert es mir. Sie meint mit uns nicht sich und mich. Der Tribal Council kümmert sich um die College-Praktikanten. Pauline fühlt sich schlecht, weil wir nicht zusammen essen.
»Keine Sorge«, sage ich leichthin.
»Ich könnte dir ein Sandwich rausschmuggeln«, bietet sie an.
»Nee. Ich hab noch was zu erledigen.« Als sie die Stirn runzelt, füge ich schnell hinzu: »Alles gut, Egg.« Ihr Gesicht hellt sich auf. »Wir sprechen später«, rufe ich und gehe die Straße runter.
Ich weiche den Touristen aus, die durch die vielen Souvenirläden gegenüber der Soo-Locks-Schleusen schlendern. Die Sonne scheint mir warm in den Nacken, aber ich kann es nicht genießen. Schon bald sehe ich in einem der Läden ein Schild AUSHILFEGESUCHT im Fenster. Ich hole tief Luft und checke mein Spiegelbild. Mein dicker, geflochtener Zopf fällt über meine Schulter. Ich verscheuche einen schrecklichen Gedanken, der sich mir aufdrängt. Ich bin froh, dass Mom mich heute Morgen gezwungen hat, mein T-Shirt zu wechseln. Mein »Merciless Indian Savage«-T-Shirt hätte bei der Jobsuche sicher nicht den besten ersten Eindruck hinterlassen.
Alle vorhandenen Flächen sind mit Nippes für Touristen zugestellt. Tassen, Bilderrahmen und Gästetücher mit der Mackinac Bridge, einem Frachter, Bären oder Fischen. Riesige, mit Stechmücken bemalte Cribbage-Bretter mit der Überschrift OFFIZIELLERWAPPENVOGELVONMICHIGAN.
Ich stehe eine Weile an der Kasse, bis die Verkäuferin Augenkontakt aufnimmt.
»Guten Tag. Mein Name ist Perry und ich würde gerne hier arbeiten. Ich könnte sofort anfangen.« Ich sehe sie mit demselben Lächeln an, wie Pauline ihre Lehrer ansieht.
»Die Stelle ist bereits vergeben.« Ihre Augen passen nicht zu ihren höflichen Worten. Oh, so ist das also, sage ich mir.
Ich höre Paulines Stimme in meinem Kopf. Es geht nicht immer um die Hautfarbe.
»Soll ich das Schild für Sie aus dem Schaufenster entfernen?«, biete ich ihr mit scheinheiliger Stimme an, die zwischen meinen Zähnen rau wird.
Ihre Wangen werden hochrot. Ich warte nicht, bis sie eine Entschuldigung hervorstottert.
Wieder auf dem Gehweg hole ich tief Luft und gehe weiter. Das nächste AUSHILFEGESUCHT-Schild steht im Fenster einer Eisdiele. Ich kenne die Angestellten. Es sind Klassenkameraden, die Pauline sicher gerne einstellen würden, aber mich nicht.
Fakt ist, wenn du dich in der Schule gegen die rassistischen Beleidigungen der Kids wehrst, bekommst du schnell den Ruf, dass man dir besser aus dem Weg geht. So zu tun, als wäre ich meine beliebte Zwillingsschwester, wird nicht funktionieren. Wir haben zwar fast identisch unser Leben angefangen, wie Mom und Pops meinen; aber dass ich sechzehn Jahre Vollgas gegeben habe, hat sichtbare Unterschiede hinterlassen. Meine linke Augenbraue ist von einer Narbe unterbrochen. Als ich neun war, habe ich meinen gebrochenen kleinen Finger so gut versteckt, dass, als sie es schließlich bemerkt haben, meine Fingerspitze komisch angewachsen war. Im Großen und Ganzen ist mein Körper eine Straßenkarte der Abenteuer, die meine vorsichtigere Zwillingsschwester vermieden hat.
Ich gehe zur Rezeption eines nahe gelegenen Motels. Es gehört zu den wenigen, die nicht abgerissen wurden und jetzt als retro-cool gelten. Auf dem Schild steht NEUERBESITZER anstatt AUSHILFEGESUCHT, aber einen Versuch ist es wert. Ich frage den schmuddelig aussehenden Jungen, ob ich mit dem Geschäftsführer über einen Job sprechen könnte.
»Wie alt bist du?« Seine ungewöhnlich tiefe Stimme überrascht mich. Ich dachte, er sei jünger als ich, obwohl das schwer zu sagen ist, da sein hellbraunes Haar alles oberhalb seiner Schultern verdeckt.
»Sechzehn.«
»Mann«, sagt er. »Die stellen hier keine Minderjährigen ein.«
»Um Zimmer zu putzen?« Ich hebe meine vernarbte Augenbraue.
»Einträge im Jugendstrafregister tauchen bei einer Überprüfung nicht auf.«
»Aber ich habe keinen Eintrag.«
»Glückwunsch.« Er klatscht begeistert in die Hände.
Shit. Die dritte Niederlage. Ich schaue auf die Uhr. Wenn ich mich beeile, kann ich mir ein Sandwich kaufen und schaffe es rechtzeitig zurück ins Museum.
Ich beschließe, ihn aufzuziehen. »Warte mal … und dein Führungszeugnis war sauber?«
Er lacht, was mehr wie ein Donnergrollen klingt.
»Sie stellen auch keine Klugscheißer ein«, sagt er.
Als ich die Tür öffne, rufe ich über meine Schulter zurück: »Kommt mir aber so vor.«
Mom hält vor der Parkbank, wo ich seit 17.01 Uhr sitze. Pauline ist gerade erst gekommen.
»Ambe.« Sie gibt uns ein Zeichen und zeigt dann auf ihre Uhr. »Wewiib.«
Die Fähre fährt alle Viertelstunde vom Festland ab, also entweder geben wir Gas, damit wir die um 17.15 Uhr erreichen, oder wir trödeln und landen auf der um 17.45 Uhr. Eigentlich wollte ich dann schon beim Fischen sein.
Ich setze mich auf den Vordersitz. Nicht nur, weil ich dran bin, sondern er ist auch einen Meter näher und vom stundenlangen Glaspolieren tut mir alles weh. Als ich an den Türgriff fasse, schmerzt jeder Muskel.
»Gichiwipizon.« Mom erinnert uns daran, die Sicherheitsgurte anzulegen, während sie über eine gelbe Ampel fährt.
Pauline wiederholt jede einzelne supergeile Sache, die sie heute im Tribal Council gemacht haben.
»Den ganzen Morgen gab es eine Vorstellungsrunde, wo jedes Tribal-Council-Mitglied Geschichten erzählt hat. Wir mussten Fragen über uns beantworten, aber es war wie eine Gameshow aufgebaut. Ah, und ratet mal, was passiert ist?«, sagt sie, ohne drauf zu warten, dass wir raten. »Vier Tribal-Council-Mitglieder werden sich jeweils einen Praktikanten aussuchen, der ihnen zuarbeitet. Da ich die einzige Highschool-Schülerin bin, wird mich wahrscheinlich keines der Executive-Council-Mitglieder auswählen. Ich würde gerne mit Wendy Manitou arbeiten. Sie reist ständig zu öffentlichen Anhörungen nach Washington, D. C. Aber sie wird wahrscheinlich einen der juristischen Vorpraktikanten nehmen. Mom, was denkst du, wer mich aussuchen wird?«
Ich bemühe mich, das Gespräch auszublenden. Ich will mich nur noch umziehen, meinen Rucksack und mein Angelzeug schnappen. Der beste Platz für Gelbbarsch ist das seichte Wasser entlang des Nordufers, ungefähr eine halbe Meile von unserem Grundstück entfernt. Dort gibt es jede Menge Grashüpfer, Elritzen und Wiggler als Köder. Ich kann den ganzen Abend fischen.
»Erde an Perry«, sagt Mom lachend. »Ich hab dich gefragt, wie dein Tag war.«
»Ich habe acht Stunden lang Glasvitrinen geputzt«, maule ich. Den Teil mit der Jobsuche lasse ich weg.
Mom fährt in unsere halbrunde Einfahrt. Elvis Junior rast mit wedelndem Schwanz auf den SUV zu. Pops sitzt auf der Treppe vor dem Haus neben einem kleinen Jungen, der genüsslich selbst gemachtes Zitroneneis leckt.
»Ach, das hab ich ganz vergessen«, sagt sie. »Daunis hofft, dass eine von euch mit Waabun spielen kann. Sie muss etwas erledigen und wollte nicht, dass er drei Stunden im Auto sitzen muss, wenn er auch draußen sein kann.«
Unser kleiner Cousin ist cool und geht gerne angeln. Aber ihn mitzunehmen, bedeutet, dass ich mich nicht so entspannen kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Der fünfjährige Waabun ist schneller und leiser, als ihm guttut. Es kam schon vor, dass er ohne einen Ton verschwunden ist.
Andererseits, Auntie einen Gefallen zu tun, könnte helfen, die Sache mit dem Jeep wieder gutzumachen.
»Hey, Waab, wer zuerst beim Klettergerüst ist«, rufe ich.
Schon im nächsten Moment ist er auf dem Weg zum riesigen Klettergerüst und der Baumfestung, die sich über mehrere Bäume am Rand des Vorhofs erstreckt. Waabun rennt an dem burgähnlichen Baumhaus vorbei in den Wald. Sein dunkelbrauner Zopf schlägt rhythmisch gegen seine Schulterblätter. Junior, der neben dem Jungen herläuft, stupst ihn zurück in den Garten.
Im Stammbaum von meinem Hund lässt sich sicher ein Hütehund finden.
Ich hatte nicht erwartet, dass mein Körper noch mehr schmerzen könnte als vorhin, als ich in den SUV gestiegen bin. Während der Fahrt nach Hause hat sich jeder Muskel verspannt. Sogar zum Baumhaus zu humpeln, ist eine Qual. Aber es hilft, mit meinem kleinen Cousin zu spielen. Er ist so schnell und unberechenbar, dass ich reagiere, ohne groß zu überlegen, wie sehr jede Bewegung wehtut.
Nach einer Stunde Spielen fühle ich mich einigermaßen gedehnt. Nach dem Abendessen nehme ich unsere Angelruten und lasse Waabun die Köderbox tragen.
Es gibt so viele Dinge, die ich an meinem Cousin mag. Jetzt gerade schätze ich seine Bereitschaft, den Köder selbst auf den Haken zu stecken. Pauline ist immer so zimperlich und lässt es mich machen.
»Wie hast du so gut angeln gelernt, Auntie Perry?«, fragt Waab, als ich einen Fisch aufspule, der wie eine Ballerina herumwirbelt. Seine funkelnden hellbraunen Augen sind groß vor Staunen.
Ich mag es, dass er mich bewundert.
»Als ich ein kwezans war, noch jünger als du jetzt, hat mein Pops mich und Pauline zum ersten Mal zum Fischen mitgenommen. Sie weinte um die Würmer, obwohl wir semaa verstreuten, um den Würmern miigwech für ihr Leben zu sagen. Ich küsste jeden Wurm, bevor ich ihn auf den Haken steckte. Pops meinte, dass das eine gute Einstellung sei.«
Waabun hört mir aufmerksam zu.
»Ich habe sofort einen Fisch gefangen. Pops sagte, dass ich Talent hätte. Ich konnte ruhig dasitzen und auf alle Geräusche hören. Auf das Wasser, den Wind, die Bäume, die Vögel, auf alle Lebewesen … wenn du darauf achtest, kannst du sie sprechen hören. Sie geben dir Hinweise, die du enträtseln musst.«
»Hört Auntie Pauline auch hin?«
»Sie hört ein paar Dinge, aber nicht alles«, sage ich.
»Aber sie liest mehr Bücher als du«, stellt er fest.
Ich bin dafür bekannt, alles zu sagen, was mir in den Kopf kommt. Aber wenn ich mit meinem kleinen Cousin spreche, achte ich sorgfältig auf das, was ich sage. Er ist ein scharfsinniger Denker und ich will ihn nicht durcheinanderbringen.
»Waab, Bücher sind wunderbar. Aber von Gichimanidoo zu lernen, ist auch wunderbar. Schöpfer gab uns Helfer, um uns Dinge zu lehren, sogar noch, bevor Bücher erfunden wurden. Wir haben aus Geschichten gelernt, die weitererzählt wurden. Und wir haben gelernt, dass auch wir Helfer sind. Wir sind mit jedem einzelnen Lebewesen, mit jedem Baum und Fluss verbunden. Das Fischen lehrt dich das. Immer wieder.«
Ich nehme einen weiteren Wurm.
»Gichi miigwech, akii-zagaskway.« Ich küsse den ekeligen Wurm. »Weißt du, was ich gesagt habe?«
»Großes Dankeschön … Wurm?«
»Ja. Erdwurm. Akii bedeutet Erde. Zagaskway bedeutet Egel, ein Blutegel.« Ich lasse ihn jede Silbe mit mir zusammen sagen. »Das sind die dicken, kurzen Würmer, die sich an deinem Zeh festsaugen, wenn du die Füße zu lange im Wasser lässt.«
»Ist Blutsauger ein schlimmes Wort?«
»Nein. Deine Mama hat mir beigebracht, wie seine Medizin wirkt. Zagaskway hat eine Medizin in seinem Mund, die das Blut am Gerinnen hindert. Manchmal ist das eine hilfreiche Gabe, die der Egel mit uns teilt. Alles und jeder hat Gaben, die er mit uns teilen kann.«
»Ist es deine Gabe, mit Fischen zu sprechen?«
Ich lache. »Vielleicht. Oder vielleicht ihnen zuzuhören.«
Waabun stößt einen tiefen Seufzer aus. »Du bist so klug, Auntie.«
Da er immer noch die Angelrute festhält, flüstere ich ihm nur etwas ins Ohr, anstatt ihn fest zu drücken.
»Was bedeutet das?« Seine wachen Augen haben die Farbe eines Rehs.
»Mein Herz gehört dir, Kleiner Cousin. Ich bin ein Wurm, der um deinen kleinen Finger gewickelt ist.«
KAPITEL 3
Kapitel 3
Freitag, 13. Juni
Mom fährt uns zum Chi Mukwa Recreation Center für das ganztägige Kinomaage-Seminar, das alle Praktikanten freitags besuchen müssen. Außer der Eishalle, den Basketball- und Volleyballfeldern, dem Fitnesscenter und dem Tim Horton’s Coffee Shop gibt es dort auch Versammlungsräume. Im Chi Mukwa Center wäre ich gerne an jedem anderen Fleck außer in dem großen Konferenzraum mit neunzehn weiteren Praktikanten.
Pauline lässt mich für ihre Tribal-Council-Praktikantenfreunde stehen. Sie tragen königsblaue Polohemden. Ich bemerke eine Gruppe von vier Praktikanten in roten Polohemden und eine weitere in grasgrünen. Meine Schwester hat die Einheitsklamotte nicht erwähnt, als sie sagte, dass es für die Freitagsseminare einen Dresscode gibt – Shirt mit Kragen und Hose, Shorts oder Skorts. Jeans sind verboten. Deshalb sehe ich jetzt mit meinem gestreiften Golf-Shirt und der khakifarbenen Hose wie ein Model aus dem Lands’-End-Katalog aus.
Ich steuere direkt auf den Tisch mit dem Catering zu. Mit einem Donut in der Hand setze ich mich an einen der hinteren Tische.
»Pearl Mary Firekeeper-Birch, stimmt’s?«, sagt eine lebhafte Nish kwe mit einer vintage Katzenaugenbrille. Der hohe Pferdeschwanz, der schicke Schal um ihren Hals und das Klemmbrett in der Hand vervollständigen den Eindruck einer Kreuzfahrt-Chefstewardess, was sicher beabsichtigt ist.
»Perry«, sage ich, den Mund voll mit einem gepuderzuckerten Donut.
»Pardon?« Sie spricht es Par-DONG aus.
Ich schlucke. »Ich werde Perry genannt.«
»Fein, du darfst den Namen aufschreiben, den du willst.« Sie legt ein leeres Namensschild und einen roten Filzstift neben meinen halb aufgegessenen Donut. »Vergiss nicht, deine Einsatzstelle unter deinen Namen zu schreiben.« Auf ihrem Namensschild steht: CLAIREBARBEAU, PRAKTIKA & AUSLANDSSEMESTER.
Es trudeln immer noch Leute ein. Bis jetzt kenne ich ungefähr die Hälfte der Praktikanten. Ich schätze, dass die anderen Tribal Citizens im Collegealter nicht hier aufgewachsen sind. Während des zehnwöchigen Sommerpraktikums schlafen sie im Studentenwohnheim der Lake Superior State University.
»Hast du ›Klugscheißer‹ auf dein Namensschild geschrieben?« Die Stimme ist tief und erinnert mich an Jacks Radiospot. Es ist der Typ aus dem Motel, nur dass sein Vorhang aus hellbraunen Haaren jetzt hinten zusammengebunden ist, wie für ein Abschlussfoto oder fürs Gericht. Ich kann jetzt seine blauen Augen sehen, passend zu den Polohemden der Tribal-Council-Praktikanten. Ohne die zerzausten Haare im Gesicht sieht er richtig männlich aus. Sein kantiger Kiefer lässt seine Wangen eingefallen wirken. Dazu steht seine jungenhafte, schlaksige Figur in krassem Kontrast, als hätte seine Pubertät unterhalb des Halses stagniert.
»Haben sie dir im Motel gekündigt?«, frage ich ihn mürrisch.
»Nee«, sagt er mit einem Lächeln, das seine Apfelbäckchen hervortreten lässt. »Ich war dort in der Mittagspause, damit meine Mutter schnell eine Besorgung machen konnte.«
Er setzt sich neben mich und greift nach einem Filzstift. Sein glatter Unterarm hat ein helles Braun. Er kritzelt etwas auf sein Namensschild. Erik Miller … und seine Einsatzstelle hat irgendetwas mit Einkaufen zu tun?
»Du hast eine Handschrift wie ein Serienmörder«, sage ich.
Erik Millers Lachen ist ein dunkler Bass, kein einziger hoher Ton.
Lucas betritt den Raum, sieht mich und stolziert wie ein männliches Laufstegmodel umher, mit Blue-Steel-Blick und allem Drum und Dran.
»Rutsch rüber«, sage ich zu Erik. Ich deute mit meinen Lippen auf den leeren Stuhl auf seiner anderen Seite.
Lucas begrüßt mich mit einem »Hey, ich bin der zweitbeste Angler auf Sugar Island«.
»Ich weiß, dass du das bist, und was bin ich?«, frage ich.
Lucas lacht und nimmt meine Stichelei gelassen hin. Er dreht sich zu Erik und hebt eine Augenbraue.
»Lucarsch«, sage ich und betone seinen Namen absichtlich falsch. »Das ist Erik, er ist ein Klugscheißer. Seine Mutter arbeitet im Freighters Motel. Und offensichtlich ist er Tribal.«
»Meinen Eltern gehört das Motel«, erklärt Erik. »Meine Mutter und ich sind Tribal-Mitglieder.«
Ich verbessere ihn. »Tribal Citizens. Clubs haben Mitglieder. Nations haben Citizens.«
»Tribal Citizen«, wiederholt Erik. »Gefällt mir.«
Ich setze die Vorstellungsrunde fort. »Das ist Lucas Chippeway. Seine Granny June bezahlt mir, seit er sechs Jahre alt ist, ein wöchentliches Taschengeld, damit ich mit ihm befreundet bin.«
Sie nicken sich bromäßig zu, bevor Lucas wieder in seine Prahlerei über die riesigen Fische verfällt, die er angeblich fängt, wenn ich nicht dabei bin.
Claire, unsere Kreuzfahrt-Stewardess, klatscht in die Hände, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen.
»Willkommen zu unserem ersten Freitagsseminar«, sagt sie. Alle johlen und klatschen, was ihr Gesicht zum Strahlen bringt. Ich bin versucht, ein Lee-Lee zu trillern, nur um zu sehen, wie sie reagiert.
Pauline sitzt mit den anderen in den königsblauen Polos an dem Tisch ganz vorne im Raum. Sie dreht sich zu mir um und formt mit den Lippen: Sei nett.
Pssst. Nett wird überbewertet. Ich tue so, als würde ich mit dem Mittelfinger in der Nase bohren. Sie rollt mit den Augen und schaut wieder nach vorne.
Claire spricht weiter: »Wie ihr wisst, seid ihr vier Tage in der Woche an der euch zugewiesenen Kinomaage-Einsatzstelle. Jeden Freitag werdet ihr hier mit den anderen Praktikanten Teamaufgaben lösen, über unsere Geschichte lernen, die Regierung und Programme kennenlernen, um ein besseres Verständnis von unserem Tribe zu bekommen.«
Claire klatscht wieder, und zwar so lange, bis alle mitklatschen. Sie erinnert mich an einen Little-League-Baseball-Coach, der für jeden Spieler klatscht, auch für die, die ins Aus geschlagen haben. Nicht, dass mir das jemals passiert wäre. Ich war fantastisch. Der Coach war ganz schön sauer, als ich mich im Jahr darauf nicht angemeldet habe. Mom und Pops haben so eine Regel, dass man ein Team nicht verlassen darf, wenn man sich einmal verpflichtet hat.
Warte. Wird es für Mom und Pops in Ordnung sein, wenn ich diesen Job durch einen anderen ersetze? Schließlich ist meine einzige Verpflichtung, Auntie die Reparaturkosten für den Jeep zurückzuzahlen.
»Okay, lasst uns der Reihe nach erzählen, was ihr diese Woche gemacht habt«, sagt Claire.
Paulines Hand schnellt augenblicklich nach oben. Ich habe ein Flashback an die Mittelstufe, an die Zeit, als wir das letzte Mal gemeinsam Unterricht hatten. Meine Zwillingsschwester hat die Zeit von der 6. bis zur 8. Klasse damit verbracht, sich hektisch zu melden, wenn die Lehrer Fragen stellten.
Als die Kinomaage-Seminarleiterin meine Schwester aufruft, trillere ich ein Lee-Lee. Alle Köpfe drehen sich zu mir um.
»Oje«, ruft Claire.
In der Zwischenzeit steht Pauline auf, um allen von der besten Woche ihres Lebens zu erzählen.
»Aaniin, Pauline Firekeeper-Birch indizhnikaaz. Waabizhish indoodem. Ziisabaaka Minising indonjiba. Hallo. Mein Name ist Pauline Firekeeper-Birch. Marder-Clan. Von Sugar Island. Ich gehe zur Sault Highschool und komme im Herbst in die 11. Klasse. Ich arbeite beim Tribal Council, und das Beste in dieser Woche war, alle Mitglieder des Council kennenzulernen.«
Die folgenden Vorstellungen blende ich aus und spiele mit Lucas Stein-Schere-Papier. Ich blicke nicht auf, bis Erik für seine Vorstellung aufsteht.
»Hey. Ich bin Erik Miller von Escalante. Das liegt im Süden von Michigan, auch bekannt als der Arsch der Welt. Meine Eltern haben vor Kurzem das Freighters Motel gekauft.« Er räuspert sich, wodurch seine Stimme noch tiefer wird. »Ab Herbst werde ich auf das Mackinac State College gehen.«
Ernsthaft? Ich dachte, er wäre noch in der Highschool. Zum Glück spricht Erik Mackinac richtig aus. Man schreibt es am Ende zwar mit ›c‹, spricht es aber wie ein ›w‹ aus. Mackinaw, nicht Mackinack.
Nach einigen Ähms und Ähs erinnert er sich daran, was er noch erzählen soll.
»Oh, richtig, ich bin beim Superior Shores ›Wareneingang und Versand‹ eingesetzt. Ähm. Das Interessanteste, was ich diese Woche gemacht habe? Kein Plan. Ich habe geholfen, ein paar Mini-Kühlschränke abzuladen.«
Ich lächle. Eriks Woche klingt in etwa wie meine. Ich überlege, von welchem Highlight ich erzählen soll – das Reinigen der Glasvitrinen am Dienstag, das Polieren der Holzoberflächen am Mittwoch oder das Staubsaugen aller Teppiche des Museums und das Fegen des gruseligen Kellers, den Cooper »das Archiv« nennt.
Natürlich erzähle ich nichts von meinen Bemühungen, in der Mittagspause einen besseren Job zu finden.
Lucas’ Vorstellung habe ich kaum beachtet, bis er Fisch erwähnt.
»Ich arbeite für das Tribal Fisheries and Wildlife Management, das heißt, ich verdiene Zhooniyaa beim Fischen, Fährtenlesen und Fallenstellen. Ich betanke die Boote, daher war mein Highlight, mit jedem Boot eine Runde zu drehen. Echt nice!«
Ich bin so neidisch, dass ich ihn treten könnte. Wenn ich gewusst hätte, dass ich zu einem Praktikum gezwungen werden würde, hätte ich mit Lucas um diese Fischereistelle gebattelt.
Da ich immer noch nicht weiß, was ich sagen soll, lasse ich mir Zeit beim Aufstehen, als ich an der Reihe bin.
»Aaniin. Perry Firekeeper-Birch indizhnikaaz. Waabizhish indoodem. Ziisabaaka Minising indonjiba. Ni-wiisagendam giizhiishiig.« Lucas schnaubt neben mir. Pauline kichert und rollt mit den Augen. Ich schaue in die Runde, um zu sehen, wer es sonst noch verstanden hat. Zwei der Praktikanten von hier grinsen. »Hallo. Ich bin Perry Firekeeper-Birch. Marder-Clan. Von Sugar Island.« Meinen letzten Satz übersetze ich nicht.
Ein Schweißtropfen läuft von meinem Hals zum Bund meiner khakifarbenen Hose. Ist die Klimaanlage eigentlich an? Okay, Schule und Highlight der Woche. »Ich bin in der 11. Klasse an der Malcolm.« Ich sehe, wie einige Praktikanten, die denken, dass die alternative Highschool für schlechte Schüler ist, sich bereits ein Urteil über mich bilden.
»Ich arbeite im Tribal Museum mit Cooper Turtle.« Ein paar Leute flüstern ihren Teamkollegen etwas zu. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was sie über meinen Vorgesetzten sagen.
Ich überlege, ob ich ein Highlight erzählen soll, das dem Bild, das alle von Kooky Cooper haben, entspricht. Gestern zum Beispiel, als ich den Lagerraum im Keller gefegt habe, kam er und schloss die Tür, um alleine zu sein. Kurz darauf hörte ich den Sound einer Handtrommel und ein Lied, das zu gedämpft war, um es wiedergeben zu können.
»Mein Highlight war, dass ich Museumsbesucher herumführen durfte.« Die Lüge fließt aus meinem Mund wie der süße Saft aus einem Zucker-Ahornbaum. Ich setze mich schnell wieder hin, ohne irgendwelche Reaktionen der anderen abzuwarten.
»Hey.« Erik stupst Lucas an. »Was hat sie gesagt, das so komisch war?«
Lucas kichert. »Das ist ein alter Trick der Natives, um herauszufinden, wer die Sprache versteht.« Er grinst stolz in meine Richtung. »Sie hat allen gesagt: ›Es tut weh, wenn ich pinkle.‹«
Nachdem alle von ihren Highlights erzählt haben, will Claire, dass die Teams zusammensitzen. Sie steckt mich mit Lucas, Erik und einem Mädchen mit Namen Shense Jackson in eine Gruppe. Wir vier haben alle Einzeleinsatzplätze.
Shense ist zwar ein Jahr über mir an der Malcolm, aber wir dürften dieselben Credits haben. Sie hat letztes Jahr den Großteil des Unterrichts wegen Morgenübelkeit verpasst, die ihre ganze Schwangerschaft hindurch anhielt.
Claire macht ein paar Ankündigungen.
»Ich habe das schon bei der Orientierung erwähnt, aber es schadet nicht, es zu wiederholen«, sagt sie. »Es ist möglich, dass ihr aus verschiedenen Gründen einem anderen Team zugewiesen werdet. Das kommt jeden Sommer vor.«
Als Nächstes fordert Claire alle Teams auf, sich einen Teamnamen auszudenken. Sie arbeitet sich zuerst zu unserer Gruppe vor und macht einen Vorschlag: »Team Einsame Wölfe«.
Ich stöhne und gebe vor, mein Knie angeschlagen zu haben. Bevor sie einen weiteren Namen vorschlagen kann, werde ich aktiv.
»Team Misfit Toys«, sage ich. »Kennst du den Film Rudolph the Red-Nosed Reindeer, den Weihnachtstrickfilm über diese Insel, auf die Santa das ganze abgelehnte, minderwertige Spielzeug schickt?«
Claire runzelt die Stirn. »Das lässt an eine Gruppe denken, die weniger wert ist als die anderen.«
»Die Wasserpistole, aus der Gelee kommt, und der Zug mit den viereckigen Rädern«, ruft Lucas.
»Charlie-in-the-Box«, sagt Shense. Ihr herzförmiger Mund sieht aus wie aus einer Lippenstiftwerbung.
»Stimmt«, sage ich und versuche, mich an das andere Spielzeug zu erinnern. »Gab es nicht einen schwimmenden Vogel?«
»Ja, ja, ja.« Lucas vollführt fast einen Happy Dance.
»Hey, Klug…« Ich kann mich gerade noch bremsen. »Erik. Bist du mit ›Team Misfit Toys‹ einverstanden?«
»Sicher.«
»Dann steht es fest«, sage ich zu Claire. »Team Misfit Toys. Einzigartig. Anders, aber auf eine gute Art.«
Das Lächeln unserer Kreuzfahrt-Stewardess wird etwas kühler, und ihr Schritt ist etwas weniger dynamisch, als sie davongeht.
Erik wendet sich an unser viertes Mitglied. »Wie spricht man deinen Namen aus?«
»Shense reimt sich auf Chauncey«, sagt sie und wünscht sich vermutlich, dass sie für diese Frage jedes Mal einen Dollar bekäme.
Auf Shenses Namensschild steht, dass sie im Büro der Security im Superior Shores Casino and Resort eingeteilt ist. Ihr Vater leitet den Überwachungsdienst. Es gibt Einstellungsrichtlinien, um Vetternwirtschaft zu vermeiden. Aber es kann gut sein, dass ihr Vater um eine Ausnahme gebeten hat, da sie eine Praktikantin und keine permanente Angestellte ist. Gut für Shense. Ich würde keine Sekunde zögern, mit meinem Pops zu arbeiten, wenn ich könnte.
Claire steht vorne und bittet um unsere Aufmerksamkeit.
»Jede Woche werden sich die Teams Herausforderungen stellen, um Punkte zu sammeln. Ich werde den Punktestand im Auge behalten und am Ende jedes Seminars angleichen.«
Sie macht eine Pause, um Spannung aufzubauen. Ich fühle es nicht so, aber manche sind offensichtlich begeistert.
»Jedes Team wird im Laufe des zehnwöchigen Programms ein soziales Projekt planen und durchführen. Während des letzten Freitagsseminars wird jedes Team sein Projekt präsentieren, das unabhängig bewertet werden wird. Die Bewertung eures Projekts zusammen mit der wöchentlich erreichten Punktzahl ergibt das Gewinnerteam.« Claire schaut über die Brille, die ganz vorne auf ihrer Nasenspitze sitzt. »Das Gewinnerteam erhält einen Bonus von 4.000 Dollar … für jedes Teammitglied.«
»Holy shit, das ist ein Bonus von 100 Prozent«, entfährt es Lucas laut. Alle lachen.
»Lu-CASH«, sage ich zu ihm.
»Du weißt Bescheid.«
Im Stillen geht jeder im Kopf durch, wie er den Bonus ausgeben könnte. Ich hätte genug für ein Jon-Boot. Ein Boot, das wendig genug ist, um an die Stellen der Insel zu kommen, wo Pops’ Boot nicht hinkommt.
Nach einer Toilettenpause kommen wir für die erste Teamchallenge wieder zusammen.
Claire erklärt sie uns. »Als Erstes kommt eine Art Jeopardy-Spiel, bei dem jede Kategorie etwas mit unserem Tribe zu tun hat: Geschichte, Sprache, Kultur und Wissenswertes über Sugar Island. Ihr bestimmt ein Teammitglied, das euch vertritt.«
Diese Punkte könnte ich für Team Misfit Toys holen.
Ein Mitglied des Team Tribal Council erzählt den anderen beiden von Pauline: Sie ist von Sugar Island, Klassenbeste, spricht die Ojibwe-Sprache und kennt viele unserer kulturellen Lehren. Es gefällt mir nicht, wie ein Typ, ein Jura-Erstsemester, sich zurücklehnt, um meine Schwester abzuchecken, als wäre sie ein Stück Fleisch.
»Unsere Sprache heißt Anishinaabemowin«, sagt sie. »Oder Ojibwemowin.«
Jemand sagt: »Siehst du? Deshalb sollte sie uns vertreten.«
Ich bemerke, wie sich Pauline von dem Jura-Erstsemester wegdreht, um ihr Haar hinters Ohr zu streichen.
Die Angstneurose meiner Zwillingsschwester kann in mehrere Stufen eingeteilt werden, gleich dem militärischen Verteidigungsbereitschaftszustand. Je niedriger die DEFCON-Stufe, desto mehr nimmt Paulines Angst zu.
Ich stelle mich vor Erik und sage: »Ich wähle dich, Pikachu.«
»Im Ernst?« Eriks Augen treten hervor. »Ich weiß absolut gar nichts über den Tribe.«
»Ich fühle, die Macht ist mit diesem ungetesteten Jedi«, sage ich zwinkernd zu Lucas.
»Testen, wir werden ihn.« Lucas’ Yoda-Imitation ist annehmbar.
»Sollten wir nicht versuchen, wenigstens ein paar Punkte zu machen?«, fragt Shense.
»Ich meine, dass wir Erik auf dem heißen Stuhl sehen möchten. Bisschen wie Schikane, aber auf die nette Art«, sagt Lucas.
»Lasst uns das vergeigen, dann denken alle, wir sind Team ›Dabeisein ist alles‹. Dann mischen wir sie auf, wenn sie am wenigsten damit rechnen«, sage ich. »Ich leg mich gern mit andern an.«
»Das stimmt«, bestätigt Lucas.
Eriks Grimasse verzieht sich langsam zu einem Lächeln.
»Ich stelle mich freiwillig zur Verfügung«, erklärt sich unser Opferlamm bereit.
Claire lässt Pizzas und Salat hereinbringen. Anscheinend dürfen wir freitags eine Stunde früher nach Hause gehen, wenn wir die Mittagspause ausfallen lassen und stattdessen einen Arbeitslunch machen. Wir sollen während des Essens Ideen für unser soziales Projekt sammeln.
Anstatt einen Vorschlag zu machen, will Lucas wissen, was Pauline und ich heute Abend vorhaben.
»Vollmondzeremonie«, antworte ich. »Auntie holt Granny June ab.«
»Ah«, sagt er. »Und was ist mit dir, Erik?«
»Ich muss im Motel arbeiten«, sagt Erik schulterzuckend.
Obwohl Lucas Shense nicht gefragt hat, antwortet sie trotzdem.
»Ich bringe mein Baby fürs Wochenende zu ihrem Vater nach St. Ignace.« Sie lächelt verschroben und zeigt dabei einen schiefen Eckzahn.
Claire erinnert alle daran, dass es ein Arbeitsessen ist und dass wir Ideen sammeln sollen.
»Ich bin für das, was Perry gut findet.« Shense entschuldigt sich, um Milch abpumpen zu gehen.
Einen 4.000-Dollar-Bonus zu bekommen, ist schon verlockend, aber ich würde trotzdem lieber mit dem Kinomaage-Praktikum aufhören, wenn ich einen anderen Job finden könnte. Vielleicht sollte ich mich beim Brainstorming für das Projekt besser zurückhalten.
»Mir fällt nichts ein«, sage ich und stehe auf, um meinen Pappteller wegzuwerfen.
Ich gehe zum Stillraum, direkt neben den Toiletten. Ich klopfe, betrete den Raum und frage Shense, ob ich ihr etwas bringen kann.
»O ja. Ich habe mir zwei Stück Pizza genommen, aber ich hätte gerne noch etwas.« Sie wackelt an der Milchpumpe, die sie auf ihren Busen gesetzt hat. »Mein Appetit beim Stillen ist genau das Gegenteil von dem, als ich schwanger war.«
»Bin gleich wieder da«, sage ich.
»Miigwech. Was Vegetarisches wäre schön, wenn es das gibt?« Bevor ich die Tür hinter mir schließen kann, fügt sie hinzu: »Vor allem keine Peperonisalami, von Fett wird mir immer noch schlecht.«
Drei Minuten später bin ich mit einer ganzen vegetarischen Pizza zurück. Shense bricht in Tränen aus. Freudentränen, versichert sie mir, während sie sich ein Stück nimmt.
»Ein binoojii zu bekommen, bringt die Hormone völlig durcheinander.« Shense fummelt an der Milchpumpe herum, um sie auf die andere Brustwarze zu setzen. Sie zuckt zusammen, als die Milchpumpe brummend anläuft.
»Bin gespannt, was für ein Projekt sie sich ausdenken werden«, sagt sie.
Ich schaue mir jeden einzelnen Belag der vegetarischen Pizza genau an.
»Shense, weißt du, wer im Moment Leute sucht?« Ich spüre ihren Blick, schaue aber nicht auf.
»Ist es so schlimm?«
»Ich will einfach eine Alternative«, sage ich.
Kooky Cooper ist nicht so schrecklich. Er ist nicht gemein oder gruselig. Er ist eben ein Freak. Die Aufgaben, die er mir gibt, sind nicht schlimm, aber langweilig. Wenn ich schon arbeiten muss, möchte ich etwas tun, das ich mir ausgesucht habe.
Shense zählt ein paar Fast-Food-Lokale auf. Ich will mich schon desinteressiert abwenden, entschließe mich dann aber, ehrlich zu sein.
»Das letzte Mal, als ich in so einem Laden war, hat irgendein Arsch das Schwarze Mädchen am Drive-in-Fenster mit dem N-Wort bezeichnet. Aber das war nicht das Schlimmste. Ich bin schon so oft beschimpft worden. Es ist jedes Mal wie eine Welle, die dich runterdrücken soll. Das Schlimmste war, dass keiner etwas gesagt hat, nicht mal der Manager.« Ich schüttle den Kopf. »Es ist wie Wellen, die gegen Felsen schlagen und zurück in den See klatschen. Die Wellen kommen aus allen Richtungen auf dich zu. Aber die Welle, die dich unter Wasser zieht, siehst du nicht kommen.«
»Wow. Das ist ja beschissen«, sagt sie.
»In so einem Schuppen würde ich es nicht lange aushalten, Shense.«
»Du könntest den Police-Captain-Lover deiner Tante dazu bringen, die Nummernschilder aufzuschreiben und jeden ausfindig zu machen, der dich dumm anmacht.«
»Daunis und TJ Kewadin sind nur Freunde«, stelle ich richtig.
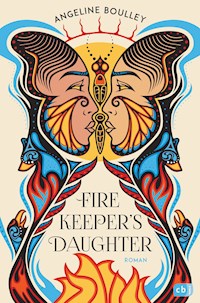













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














