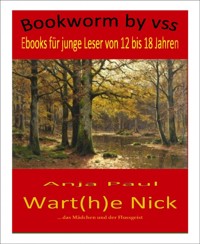
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Riesengroß ist die Enttäuschung der dreizehnjährigen Hanna, als ihre Mutter ihr zwei Wochen vor Ferienbeginn eröffnet, dass die Urlausreise, auf die sie sich so gefreut hatte, ausfallen müsse. Tante Kerstin ist krank geworden, und Hanna muss mit ihrer Mutter in die einsame Siedlung am Fluss fahren, um die Kranke zu pflegen. Es scheinen langweilige Ferien zu werden. Doch schon bald häufen sich mysteriöse Vorgänge bei denen der ruhig dahin fließend Fluss Warthe eine zentrale Rolle zu spielen scheint. Ein Flussmonster greift Hanna an, und dann taucht ein geheimnisvoller Junge auf. Eine zauberhafte Geschichte, in der sich Realität, Fantasy und Mystery auf wunderbare Weise mischen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wart(h)e Nick
... das Mädchen und der Flussgeist
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenText
Bookworm by vss – Band 3
Anja Paul – Wart(he) Nick
1. eBook-Auflage – September 2013
© vss-verlag Hermann Schladt
Titelbild: Armin Bappert unter Verwendung eines Fotos von Walter Moras
Lektorat: Werner Schubert
Anja Paul
Wart(h)e Nick
… das Mädchen und der Flussgeist
1. Kapitel
Zwei Wochen vor unserer geplanten Reise in den Süden kam Mama von der Arbeit nach Hause und erklärte mir, dass unser Urlaub auf unbestimmte Zeit verschoben werden müsse.
»Es tut mir leid«, rechtfertigte sie sich. »Aber Tante Kerstin ist krank geworden. Sehr krank. Sie kommt allein nicht mehr zurecht.«
»Dann soll sie in ein Krankenhaus gehen oder in ein Heim oder was weiß ich«, erwiderte ich.
Mama schüttelte den Kopf. »Sie hat mich um Hilfe gebeten. Ich bin ihre Schwester. Ich kann sie nicht im Stich lassen.«
»Aber sie kann uns den Urlaub verderben. Toll!«, schrie ich, rannte die Treppe hoch und verschanzte mich in meinem Zimmer.
Mama versuchte nicht, mich zurückzuhalten. Sie wusste, dass ich nicht lange wütend sein kann. So war es auch diesmal. Als sie zum Abendbrot rief, ging ich nach unten. Schweigend aßen wir eine Weile, dann versuchte ich es ein letztes Mal mit einem schwachen Protest.
»Muss ich wirklich mitkommen? Ich würde lieber hierbleiben. Ich kann Tante Kerstin nicht leiden.«
Das stimmte nicht ganz. Ich hätte sagen müssen, dass ich mit ihrer Art zu leben nichts anfangen konnte. Meine Tante wohnte allein in einem Haus am Fluss und war der langweiligste Mensch, den man sich vorstellen kann. Dauernd wollte sie mich in den Wald schleppen, um mit mir seltene Pflanzen zu suchen. Manchmal weckte sie mich mitten in der Nacht, um mir ein Wildschwein zu zeigen, das vor ihrer Gartenpforte stand, oder eine Eule im Baum gegenüber. Außerdem nörgelte sie ständig an meinem Aussehen herum, meine Haare waren ihr zu lang und meine T-Shirts zu eng.
Meine Haare würde ich mir nie im Leben abschneiden lassen. Sie sind rotbraun, und in der Sonne glänzen sie fast kupferfarben. Jedes Mädchen in meiner Klasse beneidet mich darum. Um meine Sommersprossen weniger. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Sie gehören zu mir wie meine grünen Augen. Katzenaugen, sagt Mama immer. Ich glaube, ich kann damit im Dunkeln besser sehen als andere Menschen.
Doch zurück zu meiner Tante. Ich musste sie tatsächlich Tante nennen. Obwohl sie jünger war als Mama, bestand sie darauf. Tante Kerstin. Das war doch albern.
Mama sagte: »Du kannst nicht allein zu Hause bleiben, Hanna. Du bist erst dreizehn.«
»Klar!«, entgegnete ich. »Erst dreizehn. Wenn ich mal Unterstützung von dir brauche, in der Schule oder sonst wo, heißt es immer: Mach das allein, du bist schließlich schon dreizehn.«
»Das ist was anderes«, sagte Mama mit einer energischen Handbewegung, die jede weitere Diskussion ausschloss.
Und so fuhren wir eine Woche später auf der Autobahn und schwiegen uns an. Der Kofferraum war voll, wir hatten fast unseren gesamten Hausrat mitgenommen, und ich wurde das unbestimmte Gefühl nicht los, dass unser Aufenthalt in Drift – dort wohnte meine Tante – ewig dauern konnte.
Wir hielten am Rand der Feriensiedlung. Wo andere nur ihren Urlaub verbringen, in einem kleinen Sommerhäuschen, da lebte sie das ganze Jahr über. Allein.
Einmal hatten wir sie im Winter besucht. Die ganze Siedlung war wie ausgestorben, die Gärten verwaist. Die Warthe war völlig zugefroren, und ein scharfer, eisiger Wind blies durch die Ritzen der Holzhütte. Wir saßen in Decken eingehüllt am Kamin, tranken irgendeinen angeblich gesunden, aber scheußlich schmeckenden Tee und starrten auf die Eisblumen an den Fenstern. So verschroben war meine Tante. Nie wieder, so schwor ich mir damals, nie wieder wollte ich einen Fuß in diese Feriensiedlung setzen. Kein Wunder, dass mein Onkel vor Jahren die Flucht ergriffen hatte. Ich weiß es von Mama; sie war damals mehrere Wochen fort gewesen, um meine Tante zu trösten.
Als wir in Drift ankamen, stand kein einziges Auto auf dem Parkplatz. Wir luden unser Gepäck aus. Ich wunderte mich, wie still es hier war. Es herrschte zwar kein Bilderbuchwetter, aber es war trocken und warm, und eigentlich hätten wenigstens ein paar Leute unterwegs sein müssen. Doch hier fehlte jegliche Bewegung. Die Warthe floss träge vor sich hin, kein Boot war weit und breit zu sehen, kein Angler saß auf der Brücke, kein Spaziergänger starrte Löcher in die Umgebung, kein Jogger hechelte den schmalen Sandweg entlang.
Nur Vögel und Grillen waren zu hören.
Auch Mama schaute sich einen Moment lang verwundert nach allen Seiten um. Dann schüttelte sie den Kopf und klappte die Sackkarre auf.
Ach, das habe ich noch vergessen zu erwähnen: Meine Tante wohnte am Ende einer autofreien Zone, und sie war sehr glücklich darüber. Wir waren es nicht. Schwer bepackt und beladen arbeiteten wir uns vor.
Wir redeten nicht, dafür waren wir zu sehr mit unserem Gepäck beschäftigt. Doch ich glaube, wir dachten beide das Gleiche. »Irgendetwas stimmt hier nicht.«
Die Gärten waren verwildert und von Unkraut überwuchert. Die kleinen Häuschen wirkten ausgestorben, tot. Einige Scheiben waren zu Bruch gegangen, Zaunlatten hatten sich gelöst, Gartenpforten hingen nur noch lose in den Angeln. Je weiter wir zur Hütte meiner Tante vordrangen, desto größer wurde das Ausmaß der Verwüstung. Die Karre, auf die wir den größten Teil unseres Gepäcks geladen hatten, blieb immer häufiger in hohem Unkraut stecken. Den letzten Teil des Weges mussten wir sie tragen.
Endlich hatten wir das letzte Anwesen in der langen Reihe von Ferienhäusern erreicht. Es lag etwas abseits und wirkte fast gepflegt neben den anderen Grundstücken. Das wollte etwas heißen, denn meine Tante war ein Naturfreak, was bedeutete, sie ließ auch in ihrem Garten der Natur freien Lauf.
Die Pforte stand weit offen. Auch die Tür zu ihrem Holzhäuschen war nicht verschlossen. Nur angelehnt. Und das machte uns wirklich Angst. Wir ließen das Gepäck unbeaufsichtigt auf dem Weg stehen und näherten uns dem Haus. Langsam auf den Zehenspitzen wie das Sondereinsatzkommando in einem schlechten Krimi. Alle Jalousien waren heruntergelassen, als gäbe es etwas zu verbergen. Mama öffnete die Tür, wir schlüpften hinein, die Tür fiel mit einem lauten Knall hinter uns zu. Ich lief zurück und rüttelte an der Klinke.
»Lass!«, sagte Mama. »Wir müssen uns um Tante Kerstin kümmern.«
Es war düster wie in einer Gruft. Und irgendwie roch es auch so. Ich spürte meinen Herzschlag überdeutlich. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit. Bei Mama dauerte es länger. Sie tastete sich unbeholfen zur Treppe vor, die in den zweiten Stock führte.
Plötzlich hörte ich von oben ein heiseres Stöhnen. Es kam näher. Und dann sah ich es. Ein Gespenst in einem weißen Flatterding taumelte die Treppe herunter. Ich begann zu schreien.
2. Kapitel
Mama presste mir die Hand auf den Mund. »Willst du sie umbringen?«
»Hä?«, krächzte ich. Es war das Einzige, was ich herausbrachte. Fasziniert starrte ich die geisterhafte Erscheinung an. Es war meine Tante. Besser gesagt das, was von ihr noch übrig war. Sie war mindestens um die Hälfte ihres Körpergewichtes geschmolzen, und das wollte etwas heißen.
Meine Tante aß nur Körner und Kräuter und hatte die entsprechende Figur. Jetzt sah sie allerdings aus wie ein Skelett, und das weiße Nachthemd flatterte um sie herum. Kein Wunder, dass ich sie für ein Gespenst gehalten hatte.
»Wieso habt ihr nicht gerufen?«, fragte sie kläglich.
»Wir hatten Angst um dich. So duster wie es hier ist. Wir dachten, dir wäre etwas zugestoßen.«
Mama lief nach oben, um meine Tante zu stützen. Ich schaltete das Licht ein. Meine Tante atmete röchelnd und setzte sich auf die unterste Treppenstufe.
»Geht schon mal vor in die Küche. Ich muss mich einen Moment lang ausruhen.«
Mama blieb stehen. »Lass die Küche. Du gehst ins Wohnzimmer und ruhst dich aus. Ich koche einen Tee und eine Suppe. Wann hast du das letzte Mal gegessen?«
Meine Tante zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn du nicht gekommen wärst.«
»Soll ich einen Arzt rufen?«, fragte Mama besorgt.
»Nein. Der kann mir auch nicht helfen. Es ist nichts Organisches, das habe ich schriftlich.«
Mama führte meine Tante ins Wohnzimmer, das in der unteren Etage lag, und bettete sie auf das Sofa.
»Bleib du bei ihr!«, befahl sie mir. »Ich bin gleich wieder da.«













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















