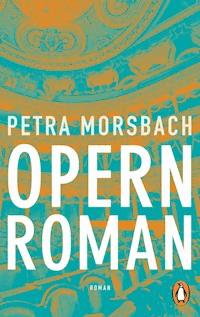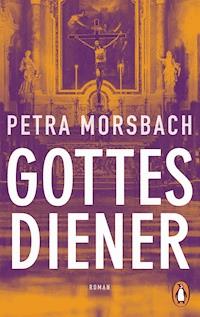Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum ist Marcel Reich-Ranicki in seiner Autobiographie »Mein Leben« weniger aufrichtig, als er glaubt? Liefert uns Alfred Andersch so viele Details seiner Schulstunde in »Der Vater eines Mörders«, um uns in die Irre zu führen? Und welche Wahrheit tritt uns aus Günter Grass' längst kanonisierter »Blechtrommel« entgegen, die scheinbar mustergültig das »Dritte Reich« bewältigt hat? Wie viele Autoren täuschen diese drei sich und ihre Leser, und wie alle täuschen sie nicht gut genug: Es gibt eine Wahrheit des Erzählens, die mehr zu wissen scheint als der Erzähler selbst. Dieser Wahrheit ist die Romanautorin Petra Morsbach auf der Spur. In ihrem unbestechlichen und präzisen Essay gewinnt Petra Morsbach provokante Erkenntnisse über die uns scheinbar so wohlvertrauten Bücher, und manch einer wird sein festes Urteil revidieren müssen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Arbeit wurde vom
Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg,
und vom Herrenhaus Edenkoben gefördert.
Inhalt
Vorwort
»Die Beweislast für meine Unschuld ist erdrückend« - Über den vermeintlichen Eigensinn der Sprache
Die Wahrheit ist immer konkret
»Um die allergröbste Mißdeutung auszuschließen«
Der Vater eines Mörders
von Alfred Andersch
»Die Mitschüler erschwerten mir den Alltag«
Mein Leben
von Marcel Reich-Ranicki
»Sie fanden Oskar nicht, weil sie Oskar nicht gewachsen waren«
Die Blechtrommel
von Günter Grass
Nachwort
Anhang
Textnachweise
Über das Buch
Über die Autorin
Anmerkungen
Detailliertes Inhaltsverzeichnis
Vorwort
»Die Beweislast für meine Unschuld ist erdrückend« - Über die Wahrheit der Sprache
Beispiel
Wahrheit?
Traum und Kunst
Sprache und Wahrheit
Erzählen und Wahrheit
Literarisches Erzählen
Erkenntnis und Individualität
Woran erkennt man Erkenntnis?
These
Die Wahrheit ist immer konkret - Beispiele
»Um die allergröbste Mißdeutung auszuschließen«
Der Vater eines Mörders
von Alfred Andersch
Erste Sätze
Erklärungen
Innerer Monolog
Erzählperspektive
Zwischendiagnose
Handlung
Vorläufiges Resultat einer Begegnung
Der Titel der Erzählung
»Nachwort für Leser«
Der Autor
Eine psychologische Diskussion
Erste Rezensionen
Gründe für eine Rezeption
»Die Mitschüler erschwerten mir den Alltag«
Mein Leben
von Marcel Reich-Ranicki
Autobiographie
Die erste Seite
Generalthema und wichtigste Motive
Erzähltechnik
Die Wirkung auf den Leser
Die nächste Lebensstation: Berlin
Genese eines Kritikers
Liebe zur Literatur
Verfolgung
Opfer
Die Täter
Kurzer moralischer Exkurs
Nachkriegszeit (1944-58)
Literaturpapst
Der Kritiker und die Schriftsteller
Gelungenes Porträt
Marcel Reich-Ranicki als Kritiker
In eigener Sache
»Sie fanden Oskar nicht, weil sie Oskar nicht gewachsen waren« Die Blechtrommel von Günter Grass
Visitenkarte, wie immer
Oskars Ursprungslegende
Weitere ironische und komische Effekte
Drittes Kapitel: Oskar Matzerath
Zwischenbilanz
Die Größenphantasie: kurzer psychologischer Exkurs
Oskar Matzeraths Entwicklung
Oskars Umwelt
Triumph und Allmacht
Moralische Macht
Vatermord
Moralische Ohnmacht
Das zentrale Thema: Verführung
Wirkungen
Nachwort
Anhang
Textnachweise
Über das Buch
Über die Autorin
Anmerkungen
Vorwort
Warum sagen wir vieles nicht so, wie wir wollen? Warum übertreiben oder verschweigen wir, gebrauchen vage Sätze, falsche Worte? Warum gilt das insbesondere für unsere Erzählungen? Warum überhaupt hat es eine solche Bedeutung, wie wir unsere Erlebnisse erzählen, obwohl wir doch scheinbar reden können, wie’s uns passt? Nehmen wir mehr wahr, als wir wahr haben möchten? Und, falls ja: Was zwingt uns, dieses »Mehr« auch auszudrücken? Ist es die »Wahrheit«? Woher käme sie? Warum hat der Begriff eine solche Bedeutung für uns, und warum tun wir uns mit ihm so schwer?
Man kann das Wort »Wahrheit« auch vermeiden. Nach einem kaum widerlegbaren Diktum von Nietzsche gibt es keine Wahrheit, nur Interpretationen1. Aber: Es gibt doch Interpretationen von sehr unterschiedlichem Wert. Worin besteht der Unterschied? Worin der Wert? Und, um hier versuchsweise die »Wahrheit« durch den Begriff »treffende Deutung« zu ersetzen: Kann es also sein, dass unsere Sprache tatsächlich eine Tendenz zu dieser treffenden Deutung hat, womit ich mit »uns« nicht nur Logiker und Philosophen meine, sondern auch Leute, die über Sprache noch nie nachgedacht haben, und sogar notorische Lügner?
Der vermeintliche »Eigensinn« der Sprache fasziniert mich, seit ich bewusst denken kann. Ich erlebe ihn täglich, beim Zuhören wie beim Lesen, beim Reden und Schreiben. Beim Lesen, wenn ich einen Autor in seinen Sätzen, seiner Wortwahl, seinem Duktus zu erkennen meine, als säße er leibhaftig vor mir. Beim Schreiben, wenn ich in meiner eigenen Sprache Möglichkeiten oder Defekte erkenne, von denen ich nichts ahnte; und natürlich, wenn meine Sätze mich nachts wecken und Korrekturen anbieten, als wollten sie besser werden. Mir schien immer, die Sprache sei unbestechlich, und nur unsere individuellen Grenzen (Zeit, Faulheit, Verstandesschwäche, Angst) hinderten uns daran, ihre Weisheit wahrzunehmen.
Eines Tages fragte ich mich, ob man all das nicht genauer beschreiben könne. Dieses Buch ist das Resultat.
Es teilt sich in einen kurzen »theoretischen« und einen längeren »praktischen« Teil. Auch der theoretische Teil entspringt der Praxis, er geht von meiner künstlerischen Erfahrung aus und setzt entsprechende Akzente.
Der praktische Teil ist die Probe aufs Exempel: Eine Wahrheit des Erzählens findet man nur in konkreten Erzählungen. Ich suchte mir einige nach Thema oder Stil möglichst vertrackte Bücher unterschiedlichen Niveaus heraus. Der besseren Verständlichkeit wegen waren es deutschsprachige Erzählungen der letzten Jahrzehnte, und zwar Der Vater eines Mörders von Alfred Andersch (1980), Mein Leben von Marcel Reich-Ranicki (1999), und Die Blechtrommel von Günter Grass (1959). Alle drei waren bei Kritik wie Publikum höchst erfolgreich und haben sich hunderttausendfach verkauft. Auch das war mir wichtig: Man muss sie nicht gelesen haben, um meine Argumentation zu verstehen – ich zitiere ausführlich –, aber wer sie kennt, kann meine Analyse mit mehr eigenen Eindrücken vergleichen.
Ich spreche über Grundlagen des Erzählens, aber jedes Buch hat auch ein aufwühlendes Thema, enthält viel Stoff und wirft Fragen auf, die über Stil und Struktur hinaus gehen. Ich stelle mich diesen Fragen, da ohne sie mancher Sprachknoten nicht zu lösen wäre. Dabei agiere ich zwangsläufig subjektiv, also geprägt von meiner eigenen Kunst, Herkunft und Gegenwart. Ich habe das benannt, soweit es mir bewusst war. Wo nicht, wird es für andere an meiner Sprache ablesbar sein.
Mein Buch richtet sich nicht in erster Linie an Literaturspezialisten, sondern an alle, die gern zuhören und erzählen, an Schreibende, die ähnliche Fragen haben, an Leser, die es genauer wissen wollen, und an alle, die sich angerührt fühlen von der Klarheit und dem Geheimnis unserer Sprache.
I. »Die Beweislast für meine Unschuld ist erdrückend« –
Über den vermeintlichen Eigensinn der Sprache
Beispiel
Es gibt in der Selbstbiographie von Franz Grillparzer (17911872) eine bestürzende Stelle. Eine Magd hatte »nach Mitternacht und gegen Morgen« den jungen Mann durch Klopfen geweckt, er möge »um Gotteswillen« hinüberkommen,
da die gnädige Frau durchaus nicht ins Bett zurückgehen wolle. Ich eilte ins Zimmer meiner Mutter und fand diese halb angekleidet an der Wand zu Häupten ihres Bettes stehend. Ich beschwor sie, sich keiner Verkältung auszusetzen und sich wieder niederzulegen, erhielt aber keine Antwort. Ich faßte sie an, um allenfalls ihrer Schwäche nachzuhelfen, da, bei dem Scheine des von der Magd gehaltenen Lichtes, sehe ich ihre Züge starr und leblos. Ich hielt meine Mutter tot in meinen Armen. Wahrscheinlich war ihr während der Nacht der Gedanke wiedergekommen in die Kirche zur Kommunion zu gehen. Während sie sich ankleiden wollte, traf sie ein Schlagfluß, wobei ihr Rücken gegen die Mauer lehnte, während ihre Knie sich gegen den vor ihr stehenden Nachttisch stemmten, so daß sie aufrecht im Tode dastand. Das Entsetzen dieses Moments läßt sich begreifen. Da aber vielleicht noch Hilfe möglich sein konnte, befahl ich den Mägden die Frau ins Bette zu bringen und eilte augenblicklich fort nach dem Arzte, der mir auch ebenso schnell folgte. Als wir kamen, hatten sich die dummen Weibsbilder nicht getraut die Tote anzufassen und sie stand immer noch neben ihrem Bette. Wir brachten sie in dieses, wobei aber sogleich der Arzt erklärte, daß hier von einer Hilfe keine Rede mehr sei.2
Nicht nur die Szene selbst, auch der Widerspruch zwischen Inhalt und Duktus der Erzählung ist unheimlich. Der Inhalt erstaunt: Tote lehnen nicht an der Wand. Der Duktus aber ist sorgfältig, nüchtern, von fast stoischem Realismus. Was steckt hinter diesem Trauma im Kanzleistil?
Sehen wir genauer hin. Warum soll der Sohn »um Gotteswillen« hinüberkommen, wenn die Mutter bloß nicht ins Bett will? Wie kann ein »Nachttisch« das Gewicht eines Menschen auffangen? Und sinken Sterbende nicht in sich zusammen, anstatt steif stehen zu bleiben? Weiter: Warum legt der Sohn die Mutter, die er schon in seinen Armen gehalten hatte, nicht selbst ins Bett? Warum unterläuft in diesem Zusammenhang ihm, der insgesamt eher einen bürokratischen Stil pflegt (»Wir brachten sie in dieses«), der aggressive Ausrutscher gegen die Mägde (»dummen Weibsbilder«)?
Was weiß der Leser bis dahin über die Mutter? Sie war früh verwitwet und arm, ein Sohn hatte sich umgebracht. Kurz vor dieser Szene heißt es, sie habe in letzter Zeit »gekränkelt«.
Sie hatte ihr achtundvierzigstes Jahr erreicht und befand sich auf dem gefährlichen Punkt wo die weibliche Natur einen großen Umschwung erleidet.
Hinweis auf Wechseljahre?
Trotz des Beistandes eines sehr geschickten Arztes, verschlimmerte sich ihre Krankheit von Tag zu Tag, sie konnte endlich das Bette nicht mehr verlassen, ja es stellte sich periodenweise eine eigentliche Geistesverwirrung ein.
Depression?
In diesem Zustande begehrte sie, da die österliche Zeit heranrückte, aufzustehen und zur Kommunion zu gehen, obschon sie sonst gerade nicht sehr religiös gestimmt war.
Schuldgefühl?
Der Arzt jedenfalls rät nicht nur vom Kirchenbesuch, sondern auch von der Kommunion im Hause »wegen der damit verbundenen Aufregung« ab. »Sie könnte, meinte er, sich und andern zur Qual in ihrem gegenwärtigen Zustande noch mehrere Jahre leben.« Spricht das nicht sogar für eine schwere seelische Erkrankung?
Um sie zu beruhigen, versprach ich ihr nächsten Tages den Priester mit dem Allerheiligsten holen zu lassen, indem ich hoffte, daß bis dahin sich ihre Besinnung wieder hergestellt haben würde. Und so legte ich mich zu Bette.
Wenige Stunden später wird der Sohn von der Magd geweckt.
Eine weitere Auffälligkeit: Warum findet diese hochemotionale Situation in der Erzählung keinen direkten Ausdruck (»Das Entsetzen dieses Moments läßt sich begreifen«)? War dem Dichter die Mutter gleichgültig? Nein, eher das Gegenteil, lesen wir auf der nächsten Seite:
Was ich empfand könnte nur derjenige beurteilen, der das, ich möchte sagen, Idyllische unsers Zusammenlebens gesehen hätte. Seit ich nach dem Versiegen ihrer eigenen Hilfsquellen allein die Bedürfnisse des Hauses bestritt, vereinigte sich für sie in mir der Sohn und der Gatte. Sie hatte keinen Willen als den meinigen, mir fiel aber auch nicht ein einen Willen zu haben, der nicht der ihrige gewesen wäre. Alles Äußerliche überließ ich ihr blindlings, wogegen sie sich aber auch allen Einmengens in meine Gedanken, Empfindungen, Arbeiten und Überzeugungen gleicherweise enthielt.
Es gibt nur einen einzigen, aber umso stärkeren Hinweis auf die Erregung des Sohnes in dieser Szene: Nachdem er die Mutter schon tot in den Armen gehalten hatte, rennt er hinaus, einen Arzt zu holen, da »vielleicht noch Hilfe möglich sein konnte«. Man kann das als Schockreaktion verstehen. Aber als der Dichter die Szene aufschrieb, waren über dreißig Jahre vergangen. Was war so unerträglich, dass es sein Verstandeswissen noch nach Jahrzehnten außer Kraft setzte, als wäre die Katastrophe nie verarbeitet worden? Was war an ihr so unbegreiflich, dass die Mutter, in einer phantastisch symbolisierenden Verarbeitung, immer noch wie eine Untote in des Sohnes Erinnerung »neben ihrem Bette stand«?
Die Nachforschung ergibt: Die Mutter hatte sich erhängt3. Offenbar brachte Grillparzer es auch dreißig Jahre später nicht über sich, diese Tatsache beim Namen zu nennen. Möglicherweise haben Trauma und Schuldgefühl seine Erinnerung teilweise gelöscht, und was wir lesen, ist die aufrichtigste Darstellung, die er geben konnte. Ich glaube nicht, dass er bewusst gelogen hat. Die Autobiographie dieses zerrissenen, bitteren, zwanghaften Menschen ist ein Dokument skrupulöser Selbsterforschung. Gerade ihre Lakonie und Sachlichkeit machen ihre Intensität aus, und ihr literarischer Rang steht außer Zweifel, auch wenn sie eigentlich als Sachtext konzipiert wurde: Grillparzer begann die Niederschrift 1853 auf Anfrage der Wiener k.u.k. Akademie der Wissenschaften, kam in seiner Schilderung aber nur bis zum Jahr 1838, in dem er mit seiner philosophischen Komödie Weh dem, der lügt durchfiel und sich aus dem literarischen Leben zurückzog. Das Manuskript wurde in seinem Nachlass gefunden und postum 1872 veröffentlicht.
Hätte Grillparzer geschrieben: »Meine Mutter verstarb am …. an einem Schlaganfall«, hätte niemand das in Frage gestellt. Denn eine standardisierte Feststellung bietet, wenn man den Kontext nicht kennt, keinen Anlass zum Zweifel. Dadurch, dass der Autor die Geschichte erzählte, hat er die Spur gelegt. Kein Außenstehender hat ihn gezwungen. Er tat das anscheinend Notwendige: Er fasste das Trauma in eine Form, in der er es gerade noch ertrug. Es war die genaueste Deutung, zu der er im Augenblick des Erzählens von sich aus fähig war. Und nicht, dass er die Wahrheit verschleiert, ist das Frappierende, sondern dass er sich selbst des Verschleierns überführt. »Der Selbstverrat dringt den Menschen aus allen Poren«, sagte Sigmund Freud4. Man kann es auch anders formulieren: Vielleicht gibt es etwas im Menschen, das ihn, oft sogar gegen seinen Willen, zur Wahrheit drängt?
Wahrheit?
Mit Wahrheit meine ich die Erkenntnis der eigenen Situation. Da unsere Situation von innerem Erleben ebenso bestimmt wird wie von äußeren Fakten, hat jede Wahrheit eine stark subjektive Komponente. Fakten und Erleben bedingen einander und können gleichzeitig Quelle schwerer Konflikte sein. Diese Konflikte bearbeitet der Mensch mit Hilfe der Sprache. Hauptziel der Bearbeitung ist für ihn, seine Biographie so zu deuten, dass er in seiner Umwelt handlungsfähig bleibt. Um dieser Handlungsfähigkeit willen geht er bei seiner Deutung gelegentlich Kompromisse ein, wie Grillparzers Bericht zeigt. Allerdings sind der Deutungswillkür Grenzen gesetzt: Der Mensch kann verdrängen, er kann lügen - beides tut er oft -, aber er wird dadurch die Probleme nicht los. Anscheinend gibt es etwas in ihm, das nach Objektivität strebt und die tiefere Klärung der Situation verlangt. Das ist es, was ich Wahrheit nennen möchte. Sie setzt sich meist nicht durch, aber sie spielt immer mit. Ihr Instrument ist die Sprache, und ihr wirksamstes Genre ist die Erzählung, wie ich im Folgenden zeigen möchte.
Wir Menschen, das unterscheidet uns vom Tier, deuten unser Leben, und zwar ununterbrochen. Wir deuten, indem wir uns selbst oder anderen erklären, was wir erlebt haben, wie wir es sehen und wie wir daraufhin handeln wollen oder auch nicht. Unsere Deutung, auch die bescheidenste, muss dem Vergehen der Zeit Rechnung tragen, deshalb ist das Basisverfahren unserer Deutung das Erzählen. Wir wollen und müssen wissen, wer wir sind und woran wir sind, denn von unserem Selbst- und Weltverständnis hängt unsere Handlungsfähigkeit ab, also in gewissem Maß auch unser Schicksal.
In der Praxis haben wir freilich erhebliche Schwierigkeiten mit der Wahrheit.
Zum Beispiel individuelle: Schon als ganz kleine Kinder möchten wir geliebt werden. Davon hängt gerade in diesem Stadium unser Überleben ab, das bestimmt unsere ersten Gedanken. Die notwendige Fiktion eines liebenswerten, zumindest annehmbaren Ich wird uns durch unser weiteres Leben begleiten. Unsere ersten, kindlichen Deutungen folgen schlichten Mustern: Es gibt den erlebenden Helden (uns) und eine Reihe guter oder böser Nebenfiguren, die ausschließlich auf uns bezogen sind. Aber mit den Jahren wird alles komplizierter. Wir machen erschreckende, peinliche, angstauslösende Erfahrungen. Wir können uns helfen, indem wir sie erzählen. Gern erzählen wir sie so, dass wir bei Anderen Trost und Bestätigung finden. Trost und Bestätigung sind so wichtig, dass wir um ihretwillen gelegentlich von den Fakten abweichen. Dabei kollidiert unser Wahrheitsbedürfnis mit unseren Selbst-Fiktionen. Auch dieses Phänomen wird uns durch unser Leben begleiten. Vielleicht erlangen wir durch den »abweichenden« Bericht den erwünschten Trost, aber die Beruhigung ist nur oberflächlich, denn wenn man’s falsch erzählt, gilt der Trost ja nicht einem selber, sondern der Lüge. Schlimmstenfalls nimmt die Bedrückung noch zu, so dass man die Geschichte immer wieder und immer falscher erzählen muss, um noch kurzfristig Beruhigung zu spüren.
Man kann also ein Erlebnis auf mehr oder weniger »richtige« oder »falsche« Weise erzählen. Selten sind die Verhältnisse so eindeutig wie in Grillparzers Trauma-Geschichte, doch der Unterschied zwischen dem, wie man’s erlebt hat, und dem, wie man’s gern hätte, spielt immer eine Rolle. Wahrscheinlich kennt jeder von uns die Erfahrung, wie er sich beim Erzählen einer Alltagskrise mühsam, immer wieder blockiert von Stolz und Scham, stufenweise zu »richtigeren« Versionen durchrang. Vielleicht hat der eine oder andere sich unter Krämpfen dem angstbesetzten Kern des Problems angenähert und dort staunend Erleichterung gefunden, weil die tiefere, treffende Deutung, auch wenn sie nicht schmeichelhaft war, Einsicht in größere Zusammenhänge und neue Perspektiven, also Hoffnung, bot. Vielleicht hat er sich an dieser Stelle erstaunt gefragt, welche Katastrophe er eigentlich befürchtet hatte.
Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist er viel früher umgekehrt. Denn die tiefere Deutung strapaziert etliche vermeintlich lebenswichtige Vorstellungen. Zunächst müssen wir uns von der Heldenperspektive trennen: Wir sind nicht das Zentrum der Welt, und die anderen handeln nicht auf uns zu, sondern jeder für sich. Das ist die erste Stufe. Wir sind nicht immer unschuldig an den Konflikten, in die wir geraten. Das ist die zweite Stufe. Und es kommt noch schlimmer: Wir sind nicht so gut, wie wir gern wären, nicht so liebenswert, nicht so schön, nicht so stark. Schließlich muss eine tiefe Deutung noch die Grundbedingung einer Existenz verarbeiten, die kurz, gefährlich, ungerecht und absurd erscheint und deren Sinn höchst ungewiss ist. Das gelingt unterschiedlich: Eine Deutung, die den einen erleichtert, kann den anderen in Wut und Verzweiflung stürzen und einem dritten schon als Ahnung unerträglich sein.
Zu den individuellen Schwierigkeiten mit der Wahrheit kommen die sozialen: Wir können nur in einem sozialen Umfeld überleben, streben als soziale Wesen einen Deutungskonsens an und wollen unsere Biographien koordinieren. Andererseits sind wir in der sozialen Alltagspraxis Partei: Wir müssen im eigenem Interesse handeln und deuten, uns etwa im Bewerbungsgespräch positiv darstellen, uns in Konflikten behaupten, unsere Privatsphäre schützen. Wir ahnen vielleicht, dass wir um eines hochwertigen sozialen Konsenses willen auf allzu egoistische Deutungen verzichten sollten, und befürchten gleichzeitig gesellschaftlichen und psychischen Schaden, wenn wir es tun.
Unser Verhältnis zur Wahrheit ist also ambivalent. Wir wollen einerseits möglichst genau wissen, woran wir sind, und andererseits doch lieber nicht. Wir sehnen uns nach der Wahrheit und fürchten sie. Wir spüren, dass Wahrheit Hoffnung bedeuten könnte, aber statt unsere Hoffnung der Wahrheit anzuvertrauen, unterwerfen wir lieber die Wahrheit unserer Hoffnung. Wir beugen die Wahrheit und werfen es uns vor. All diese Leidenschaften wirken mit elementarer Kraft auf uns ein, und all unsere Erzählungen sind von ihnen gezeichnet. Unsere Welt ist ein Chaos von mehr oder weniger bemühten und hilflosen, aber auch von wahnhaften, zynischen, betrügerischen Deutungen, ein Chaos, das nicht nur Lärm und Missverständnisse bedeutet, sondern auch Ausbeutung und Krieg. Und nirgends gibt es einen übermenschlichen, von allen respektierten Schiedsrichter, der verbindlich sagte, welche Deutung die richtige wäre und welche nicht.
Traum und Kunst
Angesichts dieser Schwierigkeiten mag es wie ein Wunder erscheinen, dass überhaupt reiche und tiefe Deutungen möglich sind. Aber es gibt sie. Woher sie kommen, ist ein Rätsel. Wir haben eine Phantasie, die unabhängig von unserem strategisch wertenden Bewusstsein arbeitet und zum Beispiel im Traum, wenn das Bewusstsein geschwächt oder ausgeschaltet ist, unsere inneren Konflikte bearbeitet. Diese Phantasie kann es schaffen, im Traum unsere wunde Seele gleichzeitig zu konfrontieren und zu schonen, indem sie das Ich aufteilt und seine Funktionen auf andere Objekte überträgt. An anderen Figuren kann man eigene Probleme leichter erkennen, da das Ego nicht direkt bedroht scheint. Wir sehen also, mehr oder weniger verschlüsselt, in einem verdichteten Szenario aus einem gewissen Abstand unsere Sache verhandelt. Das bedeutet noch nicht Rettung oder Heilung, ist aber bereits unentbehrliche Deutungsarbeit. Man kann Träume mit Worten deuten, um ihre Essenz auch dem analytischen Bewusstsein zugänglich zu machen. Aber schon der Traum selbst ist Deutung – die genaueste Deutung, zu der der Träumer im Augenblick des Traums von sich aus fähig ist.
Wir sehen als Träumende in einem verdichteten Szenario aus einem gewissen Abstand unsere Sache verhandelt: Das ist auch der Kern der Kunst. Was der Traum im Individuum leistet, leistet die Kunst im größeren sozialen Zusammenhang. Kunst ist auch Verständigung anhand fremder Erzählungen, die keiner anwesenden Partei dienen und folglich unabhängig sind. Wahrscheinlich hat das vor Tausenden Jahren mit Sagen und Heldengeschichten begonnen: Die Götter- und Heldengeschichten gehörten allen gleichermaßen und hatten enorme integrative Kraft. Sie wurden zunächst mündlich, dann schriftlich tradiert. Sie formten die Identität und erweiterten das Bewusstsein der Hörer, wurden fortgeschrieben, ergänzt, ersetzt und bekamen eine solche Bedeutung, dass eine eigene Berufsgruppe entstand: die der Schriftsteller.
Schriftsteller sind Menschen, die eine bestimmte Art des Deutens zu ihrem Beruf gemacht haben. Sie tun das, was jeder von uns tut, nur auf handwerklich höherem Niveau, da sie die Zeit, die andere Leute in der Fabrik, im Büro oder am Herd verbringen, auf die Entwicklung ihres Sprachvermögens und die Arbeit der Deutung sowie auf das Finden und Erfinden von Geschichten verwenden können. Idealerweise liefern die Schriftsteller Modellerzählungen, die präzis, überparteilich und konkret anhand fiktiver Schicksale unsere Gegenwart spiegeln. Idealerweise kann die literarische Deutung unsere Realität ohne Rücksicht auf herrschende Ideologien schildern und, ohne jemanden bloßzustellen, zu unseren tiefsten Problemen und heimlichsten Phantasien vordringen. Sie lockt durch Intensität und ästhetische Qualität. Sie fängt individuelles Leben in seiner Vergänglichkeit ein. Eine geglückte Erzählung rührt immer auch an die tieferen Fragen unserer Existenz, so dass wir uns in ihr wiedererkennen, selbst wenn die beschriebene Epoche samt ihrem Personal längst untergegangen ist. Das ist Kunst.
Idealerweise ist die literarische Deutung frei, also im Gegensatz zu allen anderen Deutungen nicht von persönlichen Interessen gesteuert. In der Praxis aber haben Schriftsteller die gleichen Schwierigkeiten mit der Wahrheit wie alle anderen Menschen: Sie kämpfen um ihr Ego, hadern mit ihrem Schicksal, sind beschränkt und von Vorurteilen geprägt und wollen außerdem noch im sozialen Kontext bestehen, was unter anderem bedeutet, dass sie ihre Bücher verkaufen müssen. Die edelste und unabhängigste Deutung geht unter, wenn keiner sich dafür interessiert. Der Autor muss also ein Publikum fesseln, dessen Wahrheitseifer begrenzt ist. Die vielleicht größte Leidenschaft des Menschen ist sein Selbst. Erzählungen, die Größenphantasien bedienen (also den Leser zur Identifikation mit einem überhöhten Helden einladen), finden die breiteste Gegenliebe und beherrschen traditionell unsere Bestsellerlisten. Erzählungen mit Wahrheitsanspruch finden theoretisch den höchsten Respekt, so dass jede Kultur, die auf sich achtet, einen kleinen Kulturpool pflegt, in dem der Anspruch hochgehalten wird. Da einerseits auch hochgehaltener Anspruch das Ego bedient und somit korrumpiert, da andererseits aber die Sehnsucht nach Wahrheit auch im schlichtesten Genre immer wieder aufblitzt, gibt es alle erdenklichen Mischformen. Auch in der Literatur also mag es wie ein Wunder erscheinen, dass reiche und tiefe Deutungen möglich sind. Aber es gibt auch sie, und verblüffenderweise herrscht über solche Einzelleistungen ein erstaunlicher Konsens über die Zeiten, Länder und Kulturen hinweg, was umso bemerkenswerter ist, als literarische Deutungen mit kommerzieller oder politischer Macht selten langfristig durchgesetzt werden können. Auch hier wirkt eine Phantasie, die unabhängig von unserem strategischen Bewusstsein arbeitet. Wir könnten sie, wie die des Traums, eine unzensierte kreative Deutung nennen, die unserem Wahrheitsstreben entspricht. Woher dieses Wahrheitsstreben kommt, wissen wir nicht. Aber es scheint, wie im individuellen Traum, einer Notwendigkeit der Seele zu entspringen. Unsere Tagträume werden von unseren Wünschen bestimmt, unsere Nachtträume von unseren Nöten. Die Bilder und Szenen der Nachtträume haben eine ganz andere Komplexität und Intensität als die der auf Lustgewinn zielenden Tagträume. Dieser Unterschied in Macht und Effekt wird den meisten Träumern bewusst sein. Ich denke, er macht den Unterschied zwischen guter und trivialer, also Wunscherfüllungs-Literatur, aus. Freilich sind auch hier die Übergänge fließend, es dominiert ein stark durchmischtes Mittelfeld. Der Autor vom unteren Ende der Skala, der vorsätzlich kalt die Instinkte des Publikums bedient, ist sicher nicht repräsentativ, denn alle Künstler begannen zumindest als Träumer. Der Künstler vom oberen Ende der Skala, der unbeeinträchtigt frei und traumhaft sicher mit klarem Verstand aus den Tiefen seiner Seele schöpft, dürfte noch seltener sein; falls es ihn überhaupt gibt.
Sprache und Wahrheit
Geleistet wird diese Differenzierung durch das erstaunliche Instrument der Sprache. Mit ihrer komplexen Grammatik, die keiner sich ausgedacht hat, mit ihrem Reichtum an Worten, Ebenen und Strukturen vermag sie alle bewussten und unbewussten Bereiche unseres Erlebens auszudrücken und enthält das ganze uns wahrnehmbare Rätsel unserer Existenz. Es ist verblüffend, wie viele Bezüge ein normaler gesprochener Dialog enthalten kann weit über die ausgetauschten Informationen hinaus. Die Beziehung der Sprecher zueinander, ihre Absichten und Ansprüche, ihre Temperamente, ihr Verstand, Witz, Gefühl, all das ist in ihrer Rede verzeichnet. Der Bedeutungsunterschied zwischen den Sätzen »Ich weiß es nicht« und »Woher soll ich das wissen?« ist, bei gleicher Grundaussage, offenbar. Der psychische Hintergrund von Fehlleistungen wie »zum Vorschwein kommen« oder »…möchte auf das Wohl unseres Jubilars aufstoßen«5 gehört seit Sigmund Freuds Psychopathologie des Alltagslebens zu unserem Allgemeinwissen. Immer wieder hören wir zauberhaft kreative Selbstaussagen: »…ein Glas Chamapagner aufmachen!« (Dr. Edmund Stoiber)6, »Die Beweislast für meine Unschuld ist erdrückend« (Sektenführerin Uriella)7. Schon Standardwendungen (»Das ist mir runtergefallen«) sagen meist mehr, als der Sprecher glaubt. Und ganz normale Wörter wie Enttäuschung und Versehen können erstaunlich hintergründig sein: als hätte, da wir sie erfanden, eine Weisheit in uns gewirkt, derer wir uns gar nicht bewusst waren.
Erzählen und Wahrheit
Aufs Erzählen trifft das noch stärker zu. Jede Erzählung deutet ein Stück Erfahrung, wodurch sie den Erzähler persönlich stärker fordert. Die Erzählung gibt also nicht nur seine Beobachtung wieder, sondern auch seine Interpretation.
Das gilt schon im Alltag. Eine Behauptung (zum Beispiel die von Müller: »Schmidt ist gemein«) ist unverbindlich. Um sich ein Bild zu verschaffen, muss man Müller erzählen lassen. Was hat Schmidt gesagt / getan? Wie und bei welcher Gelegenheit? Wie hat Müller reagiert? Warum so und nicht anders? Wie stand er vorher zu Schmidt, was hatte er erwartet? Schon nach drei Fragen wird, sofern Müller fähig ist, über sich Auskunft zu geben, die Geschichte sehr komplex. Aber gerade und nur in ihrer Komplexität ist sie triftig zu deuten.
Die Erzählung ist besonders deutungshaltig, weil sie so vielschichtig ist: Aus hundert Faktoren, die eine Situation bestimmen, muss der (mündliche) Erzähler blitzschnell das Wichtigste in eine kurze Lautkette transformieren; das ist ein dynamischer, hochkomplexer Vorgang, der ohne Intuition nicht möglich wäre. Anders gesagt: Die Erzählung enthält so viele Bezüge und Ebenen (Fakten, Personen, Absichten, Ablauf, Gefühle, Erlebnis), dass sie sich vom Bewusstsein nie ganz steuern lässt. So übernimmt die Sprache als halb- oder vorbewusstes Ausdrucksmittel die Führung.
Andererseits hängt die Qualität einer Erzählung auch von der Deutungsleistung des Erzählers ab: Unkontrolliertes Plappern bringt ebensowenig wie dürre Statements. Deutungsleistung nenne ich die sprachliche Gestaltung einer differenzierten Wahrnehmung. Beides ist mit geistigem und emotionalem Aufwand verbunden.
Warum? Weil ein neues Muster gefunden werden muss. Natürlich gibt es gängige alte Muster für alle Standardsituationen unseres Lebens, und natürlich sind wir versucht, unser Leben ihnen anzupassen. Wenn wir jung sind, kommen wir ohne sie gar nicht aus: Sie sind die Fabeln, nach denen wir unsere ersten Erfahrungen strukturieren. Es gibt archaische, kulturelle und modische Standardfabeln: »Mein Land ist das beste.« »Ich kann nichts dafür.« »Ich habe Pech in der Liebe.« Sie sind selten ganz falsch, aber eben auch selten richtig, weil sie ungenau sind. Sie zu übernehmen ist auf den ersten Blick bequemer als selbst zu denken und zu deuten, allerdings muss man etliche unpassende Details ausblenden, um ihnen zu entsprechen. Diese unterdrückten Details werden von unserer Phantasie oder unseren Träumen aufgenommen und können ein Eigenleben entwickeln, das unser Bewusstsein bedroht. Eine rohe Deutung kann uns nur zufriedenstellen, solange unser Erleben ihrem Muster vollkommen entspricht. Hindert sie uns daran, unsere Situation differenziert wahrzunehmen, kann sie uns unglücklich, sogar gefährlich machen.
Der Erzähler also, der sich von der Standardfabel löst und sein Erlebnis als etwas Neues wahrnimmt und darstellt, vollbringt eine Deutungsleistung. Je genauer, persönlicher, diffe