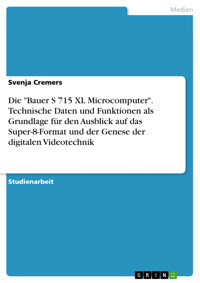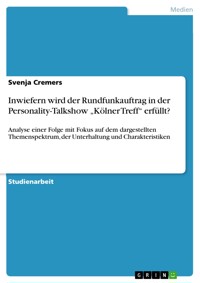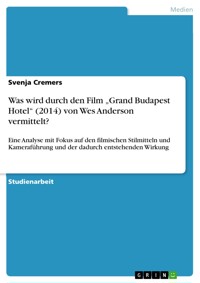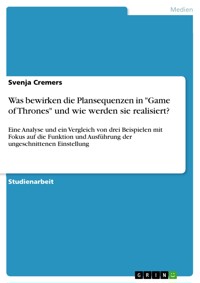
Was bewirken die Plansequenzen in "Game of Thrones" und wie werden sie realisiert? E-Book
Svenja Cremers
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2022 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Film und Fernsehen, Note: 12, Philipps-Universität Marburg, Veranstaltung: Theorie, Geschichte und Ästhetik der ungeschnittenen Einstellung im narrativen Kinofilm, Sprache: Deutsch, Abstract: Filmschnitte und kurze Einstellungen lassen sich seit der Entwicklung der Montage, die durch David Ward Griffith etabliert wurde, in den heutigen visuellen Medien häufig erkennen. Die Montage besitzt viele Charakteristiken, die primär Filmemacher*innen seit Jahrzehnten dazu bewegen, sie als Mittel zu benutzen. Vor allem in Actionszenen lässt sich normalerweise ein schneller Schnittrhythmus finden, der die Zuschauer*innen in die gesamte, rasante Situation platziert. Im Gegensatz dazu steht die lange, kontinuierliche Einstellung oder auch die Plansequenz oder der Long Take. Diese werden oft mit Arthousefilmen assoziiert, wo sie auch heutzutage noch Verwendung finden. Aber ungeschnittene Einstellungen lassen sich auch in Blockbustern finden, so wie in Serien. Die vorliegende Hausarbeit behandelt drei Beispiele von ungeschnittenen Einstellungen aus der Fantasy- und Dramaserie "Game of Thrones". Die drei Beispiele sind Einstellungen aus Schlachten, jedoch insofern voneinander zu unterscheiden, dass sie jeweils die Vorbereitung auf den Kampf, das Ereignis des Kampfes und die Flucht vor dem Kampf, beziehungsweise dessen Auswirkungen zeigt. Die Analyse bezieht sich auf diese drei Sequenzen, dabei wird der Fokus auf die Wirkung der Einstellung und wie diese Wirkung entsteht gesetzt. Hier wird der Bezug zum Seminar hergestellt, die Einstellungen werden auf Kamerabewegung, Kamerafokus, Positionierung der Figuren und der Kamera, Raumeröffnung und performative Aspekte untersucht und was sie für das Publikum bewirken. So soll ein analytischer Blick auf die Sequenzen geschaffen werden. Anschließend an die tiefergehende Analyse werden die drei ungeschnittenen Einstellungen auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Ausführung und Wirkung verglichen. Das erarbeitete Material wird in einem Fazit nochmal zusammengetragen und resümiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis
I. Einleitung
II. Einordnung
1. Annäherung an eine Definition der ungeschnittenen Einstellung:
2. Beispiele in Game of Thrones:
III. Analyse der ungeschnittenen Einstellungen in Game of Thrones
1. Beispiel aus The Long Night:
2. Beispiel aus Battle of the Bastards:
3. Beispiel aus The Bells:
IV. Vergleich der analysierten ungeschnittenen Einstellungen:
V. Fazit:
VI. Abbildungsverzeichnis:
VII. Literaturverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Screenshot aus "The Long Night". Game Of Thrones, HBO, 2019. Minute 2:12
Abbildung 2: Screenshot aus "The Long Night". Game Of Thrones, HBO, 2019. Minute 2:24
Abbildung 3: Screenshot aus "The Long Night". Game Of Thrones, HBO, 2019. Minute 3:12
Abbildung 4: Screenshot aus "Battle of the Bastards". Game of Thrones, HBO, 2016. Minute 39:50
Abbildung 5: Screenshot aus "The Bells". Game of Thrones, HBO, 2019. Minute 1:08:13
I. Einleitung
Filmschnitte und kurze Einstellungen lassen sich seit der Entwicklung der Montage, die durch David Ward Griffith etabliert wurde, in den heutigen visuellen Medien häufig erkennen. Die Montage besitzt viele Charakteristiken, die primär Filmemacher*innen seit Jahrzehnten dazu bewegen, sie als Mittel zu benutzen. Vor allem in Actionszenen lässt sich normalerweise ein schneller Schnittrhythmus finden, der die Zuschauer*innen in die gesamte, rasante Situation platziert. Im Gegensatz dazu steht die lange, kontinuierliche Einstellung oder auch die Plansequenz oder der Long Take. Diese werden oft mit Arthousefilmen assoziiert, wo sie auch heutzutage noch Verwendung finden. Aber ungeschnittene Einstellungen lassen sich auch in Blockbustern finden, so wie in Serien. Die vorliegende Hausarbeit behandelt drei Beispiele von ungeschnittenen Einstellungen aus der Fantasy- und Dramaserie Game of Thrones. Die drei Beispiele sind Einstellungen aus Schlachten, jedoch insofern voneinander zu unterscheiden, dass sie jeweils die Vorbereitung auf den Kampf, das Ereignis des Kampfes und die Flucht vor dem Kampf, beziehungsweise dessen Auswirkungen zeigt. Die Analyse bezieht sich auf diese drei Sequenzen, dabei wird der Fokus auf die Wirkung der Einstellung und wie diese Wirkung entsteht gesetzt. Hier wird der Bezug zum Seminar hergestellt, die Einstellungen werden auf
II. Einordnung
1. Annäherung an eine Definition der ungeschnittenen Einstellung:
Eine eindeutige Definition lässt sich zu ungeschnittenen Einstellungen nicht festlegen. Zunächst kann festgehalten werden, dass sich die ungeschnittene oder lange Einstellung von den kurzen, geschnittenen Einstellungen abgrenzen lässt. Thomas Rothschild beschreibt den Unterschied folgendermaßen:
Wenn über den Zusammenhang von Bildkomposition und Dauer im Film die Rede ist, muss also außer der Länge einer Einstellung auch berücksichtigt werden, ob deren Inhalt unverändert, also starr bleibt wie eine für eine gewisse Dauer projizierte Fotografie, oder ob er sich zwischen zwei Schnitten oder Blenden wandelt. (52)
Zudem benennt er die unterschiedlichen Wirkungsweisen. Seiner Ansicht nach überrumpelt die kurze Einstellung die Zuschauer*innen, während die lange Einstellung einen „eigenständigen, kritischen, distanzierten Blick“ ermöglicht (Rothschild 58). Unter der langen, oder auch ungeschnittenen Einstellung, kann man die Plansequenz oder den Long Take verstehen. Plansequenz bedeutet grob übersetzt die „zusammenhängende Fläche“ (Böttcher 114). Sie ist eine autonome Einstellung, eine Handlungseinheit, die den Status einer Sequenz besitzt (Beller 29). Dabei werden die „einzelnen Kamerapositionen und Handlungsebenen im Raum mit aufwendigen Kamerabewegungen oder durch Verlagerung der Tiefenschärfe verbunden“ (Korte 48). Sie wird als Mittel verwendet, um „die visuelle, sprachliche, räumliche und zeitliche Kontinuität eines Handlungsablaufs hervorzuheben“ (ebd.). Hans Beller vergleicht zudem die Plansequenz mit dem Long Take, indem er sagt, dass beide Begriffe sich meist so definieren lassen, dass die Bewegung in der ununterbrochenen Einstellung und Dynamik nicht durch die Montage erzeugt werden (29). Der Long Take lässt sich so definieren, dass eine Szene in Echtzeit, an einem Stück, gefilmt wird und die Handlungen oftmals in dieser ungeschnittenen Szene abgeschlossen sind („Filmlexikon – was ist ein Long Take?“). Klassische Schnitte werden beispielsweise durch Szenenänderung ersetzt und der Long Take unterstützt die Atmosphäre einer Filmszene „ohne jedoch unbedingt eine bestimmte Dramaturgie zu inszenieren“ (ebd.). Plansequenz, ungeschnittene oder lange Einstellung und Long Take lassen sich so ähnlich definieren, haben gewisse Überschneidungen aber eben auch Unterschiede, sodass sie nicht eindeutig als Synonyme gelten, beziehungsweise auch unterschiedlich definiert werden können.
In dieser Hausarbeit aber werden aufgrund der eben herausgearbeiteten, sich überschneidenden Definitionen und der Einfachheit halber die Begriffe als Synonyme füreinander verwendet.
2. Beispiele in Game of Thrones:
Um lange Einstellungen analysieren zu können, werden drei Beispielsequenzen aus Game of Thrones verwendet. Die Serie lässt sich in die Genres Fantasy, Drama und Action einordnen. Sie wurde für den Sender HBO entwickelt und umfasst 8 Staffeln, die im Zeitraum von 2011 bis 2019 ausgestrahlt wurden. Entwickler der Serie sind David Benioff und D. B. Weiss. Sie basiert auf der Bücherreihe Das Lied von Eis und Feuer
III. Analyse der ungeschnittenen Einstellungen in Game of Thrones
1. Beispiel aus The Long Night:
The Long Night ist die dritte Folge der 8. Staffel. Sie wurde am 28. April 2019 auf HBO ausgestrahlt (ebd.). Inhaltlich befasst sie sich mit dem Kampf gegen die weißen Wanderer. Die ungeschnittene Einstellung eröffnet die Folge. Sie geht 1 Minute und 22 Sekunden.
Sie beginnt mit einer Großaufnahme der nervös zitternden Hände von Samwell Tarly, ein Kameraschwenk nach oben zeigt sein Gesicht, indem sich ebenfalls die Nervosität vor dem bevorstehendem Kampf ablesen lässt. Nachdem er dazu aufgefordert wird, läuft die Figur durch einen Gang, die Kamera folgt ihm dabei. Durch den dunklen Gang und die Menschen, die ihm entgegenkommen, wirkt der Bildausschnitt zunächst beengt, die Figur ist der Bildmittelpunkt (Siehe Abb. 1). Am Ende des Ganges ist der Hof zu sehen, wo sich schon von weitem die Bewegung der Truppen erschließen lässt. Dadurch gewinnt der Raum an Tiefe (Siehe Abb. 1). Auf dem Hof angekommen, ziehen weitere Truppen an der Figur vorbei, sowie Menschen, die umherlaufen, um sich auf die Schlacht vorzubereiten. Die Kamera fährt um 90 Grad um die Figur herum, diese ist nun von der Seite zu erkennen, wie sie den vorbeiziehenden Kämpfern hinterherschaut. Der Fokus der Kamera verlagert sich, durch die sich verlagernde Tiefenschärfe wird die Aufmerksamkeit des Publikums auf den verletzten Mann gelenkt (Siehe Abb. 2). Zudem wird dadurch der Raum weiter eröffnet. Sam geht weiter, diesmal auf die Kamera zu, diese fährt weiter nach hinten und ermöglicht so, den Hof mit den Menschen darzustellen. Diese rennen an der Figur vorbei, während er im stetigen Schritttempo weitergeht. Die Kamera verlagert ihren Bildmittelpunkt auf Tyrion Lannister durch einen Schwenk, Samwell Tarly verlässt den Bildausschnitt. Nun folgt die Kamera diesem Hauptcharakter, der ebenfalls zunächst auf die Kamera zuläuft. Sie wendet sich während des stetigen Weiterlaufens um 180 Grad, sodass Tyrion nun von hinten im Fokus der Kamera steht. Dadurch wird der Hof, beziehungsweise der Raum der Kamera, erneut weiter sichtbar gemacht. Die maschierenden Truppen kommen nun frontal auf die Kamera zu, an Tyrion vorbei. Die Kamera folgt ihm weiter, während er sich eine Waffe und eine Tasche holt. Durch einen Schwenk der Kamera werden weitere Hauptcharaktere, Bran Stark und Theon Greyjoy, die den Truppen hinterherlaufen, in das Bildzentrum gesetzt. Während sie vorbeiziehen, schwenkt die Kamera zurück auf Tyrion und richtet sich so aus, dass er sich im linken Drittel des Bildes befindet, während in den anderen zwei Dritteln der Hof erkennbar ist (Siehe Abb. 3). Damit endet die ungeschnittene Einstellung.
Die gesamte Sequenz ist von Dynamik geprägt. Wie Hans Beller schon anmerkte, wird bei der ungeschnittenen Einstellung die Dynamik nicht durch die Montage erzeugt (29). Die Dynamik entsteht hier durch das ungeschnittene, jedoch wird weiterführend durch das Fortbewegen, sowohl von den Truppen und Kämpfern als auch von den Figuren selbst, ein dynamischer Fluss erzeugt. Die Kamera ist nicht statisch, die Figuren nicht starr, sondern durchgehend in Bewegung. Auch der Hintergrund ist ständig in Bewegung, durch die rennenden Menschen. Wenn man das auf den Kontext der Folge, beziehungsweise der Sequenz bezieht, ist diese Darstellungsweise der Bewegung passend, da so die Panik und die Eile verdeutlicht wird. Durch die ruhige Kameraführung lässt sich aber erkennen, dass es sich noch nicht um die akute Situation handelt, sondern eben nur um die Vorbereitung darauf.
Ein weiterer Aspekt, der zu beachten ist, ist der Raum. Der Ort der Handlung dieser ungeschnittene Einstellung ist Winterfell, im Laufe der Einstellung wird den Zuschauer*innen der gesamte Hof sowie der Weg dahin eröffnet. Nach dem beengendem Gang, wo nur Samwell Tarly im Fokus der Kamera steht (Siehe Abb. 1), entfaltet sich der Raum durch beispielsweise Verlagerung der Tiefenschärfe und durch Positionierung der Charaktere. Die Aufmerksamkeit des Publikums wird ebenfalls durch die Fokussetzung der Kamera in essentiellen Momenten verlagert (Siehe Abb. 2). Der Raum wird geöffnet und dargestellt, bleibt allerdings kontinuierlich. Dies ist charakteristisch für ungeschnittene Einstellungen, da räumlicher und zeitlicher Wechsel eher durch Montage funktioniert. Nach Böttcher wollen in einer ungeschnittenen Einstellung „[z]wei Komponenten des Filmbilds […] also intakt, ungeschnitten bleiben: Der Raum und die Zeit.“ (115). Hier wird der Ort eröffnet, bleibt aber derselbe, die Sequenz läuft in Echtzeit ab. Das bildet einen kontinuierlichen Handlungsfluss und lässt das Publikum die Sequenz in realer Zeit nachempfinden. Diese Echtzeit und filmische Realität sind weitere Charakteristiken der Plansequenz. Die Einstellung zeigt durch die Kontinuität die Anspannung, Unruhe und die Furcht, die die gesamten Figuren antreibt. Vor allem durch den Wechsel der zentralen Figur, vom ängstlichen Samwell Tarly zu Tyrion, der angespannt aber gesammelt wirkt (Siehe Abb. 3), wird in einer einzigen Einstellung die Bandbreite der Emotionen vor dem Krieg dargestellt. Die Plansequenz zeigt konkret und in voller Präsenz das, was der bevorstehende Krieg mit den Menschen und den Hauptcharakteren macht. Als Anfangssequenz, die eine Folge mit vielen, schnellen Schnitten in den Kampfszenen einleitet, bildet sie somit einen Kontrast und zeigt die filmische Wirklichkeit.
Um diese ungeschnittene Einstellung zu kreieren, ist ein hohes Maß an Performativität ausschlaggebend. Es wird mit zahlreichen Menschen im Hintergrund gearbeitet, die alle auf ihrer bestimmten Position sein müssen, um diese Sequenz zu bilden. Da die Kamera durchgehend in Bewegung ist, müssen die einzelnen Figuren, Truppen und rennenden Menschen genau positioniert sein, sodass sie nicht zur falschen Zeit in oder aus dem Bild laufen, beispielsweise auch bei dem Figurenwechsel von Sam zu Tyrion. Da die gesamte Sequenz fortgängig abläuft, darf es kein unbeabsichtigtes Stocken bei den Truppen, den Menschen oder Hauptfiguren geben, da dies den Fluss stören würde. Sobald also ein Fehler passiert, was bei dieser Anzahl an Menschen schnell passieren kann, verliert die Einstellung an Dynamik und Wirksamkeit. Somit ist hohes, performatives Niveau essentiell.
Abschließend lässt sich die Szene noch auf André Bazins Grundsatz beziehen „[w]enn das Wesentliche eines Ereignisses von der gleichzeitigen Anwesenheit zweier oder mehrerer Handlungsfaktoren abhängt, ist es verboten zu schneiden“ (Fischer 84). Da hier die Emotionen beziehungsweise die Vorbereitungen der Hauptcharaktere Sam und Tyrion, sowie der gleichzeitigen Vorbereitung der anderen Kämpfer im Vergleich dazu dargestellt werden soll, ist es laut Bazin hier verboten zu schneiden. Das Wesentliche, die Vorbereitung auf den Krieg von allen Parteien, wird durch das Ungeschnittene verstärkt und hätte nicht die gleiche Wirksamkeit, wenn hier Montage stattgefunden hätte.
2. Beispiel aus Battle of the Bastards:
Die Folge Battle of the Bastards ist die neunte Folge der 6. Staffel und wurde am 19. Juni 2016 ausgestrahlt (Hottes, „Game of Thrones: Staffeln und Episodenguide“). Sie thematisiert die Schlacht um Winterfell zwischen Jon Snow und Ramsey Bolton. Die ungeschnittene Einstellung lässt sich zu Beginn der Schlacht finden und geht 59 Sekunden.
Die Sequenz zeigt den Teil der Schlacht in voller Gesamtheit, ist inmitten dieser integriert. Sie beginnt mit einem Kameraschwenk auf Jon Snow, der so halbnah und zentral im Bild ist. Die Figur bleibt in Bewegung, dreht sich und kämpft, bleibt jedoch immer im Bildausschnitt und meist auch zentral. Die Kamera folgt Jon, wenn er Gegnern ausweicht oder mit diesen kämpft, bleibt er immer in ihrem Fokus. Die Kamera neigt sich, wenn er sich bückt um Pfeilen auszuweichen. Die Zuschauer*innen verfolgen so die Handlungen von Jon, als wären sie Teil der Schlacht. Nach dem Tod eines Gefolgsmannes ist Jon nah im Bild zu sehen, was seine Emotionen und seinen Zorn wirksamer darstellt. Danach geht er wieder in den Zweikampf, weiterhin im Fokus der Kamera, die ihm folgt. Während Jon auf einen Gegner im Zorn einsticht, wird sein Gesicht wieder nah gezeigt, es befindet sich im rechten Drittel des Bildes (Siehe Abb. 4). So wird zunächst wieder seine Emotion verdeutlicht, es bildet aber auch eine gewisse Raumtiefe, da man in den anderen zwei Dritteln der Kamera einen Reiter auf Jon zu galoppieren sieht. Die Rezipient*innen sehen die Gefahr, die aus der Distanz auf den Hauptcharakter zukommt. In dem einen Drittel des Bildes findet zeitgleich etwas anderes statt als in den anderen beiden Dritteln. So wird der Reiter von einem anderen Reiter umgerannt, während die Figur weiterhin auf seinen Gegner fokussiert ist. Nach dem Reiter wird ein Gegner zu Fuss offenbart, der auf Jon losgeht. Dieser bemerkt es und es führt nach der Teilung der Handlung in einem Bildausschnitt wieder zu einem Zweikampf. Damit endet die ungeschnittene Einstellung und es wird im weiteren Verlauf der Schlacht wieder auf Montage gesetzt.
Während der gesamten Sequenz wird eine wackelige Kameraführung genutzt, die als Stilmittel fungiert und so die Einstellung subjektiv darstellt. Es handelt sich um einen Tracking Shot. Durch diese Kamerabewegung bekommen die Zuschauer*innen das Gefühl, selbst Teil der Sequenz zu sein und selbst inmitten der schnellen, hektischen Schlacht anwesend zu sein und dabei Jon zu folgen. Dieser Realismus, der unteranderem durch Plansequenzen vermittelt werden soll, wird so verstärkt. Das Publikum nimmt eine subjektive Rolle in der Schlacht ein. Die Intensität und Unruhe wird weitergehend auch durch die Krieger und Pferde erzeugt, die sich permanent in der Sequenz befinden. Im Hintergrund lassen sich die Massen an Kämpfern erkennen, was ebenfalls Tiefe erzeugt und die Raumnutzung erkennen lässt, beispielsweise auch zu sehen in Abbildung 4. Aber sie reiten oder rennen auch an der Kamera vorbei oder durch das Bild, was die Illusion der Anwesenheit des Publikums in der Schlacht und das Chaos weiterhin bestärkt. Hier wird die Gewalt und die Brutalität nicht verherrlicht sondern entfaltet sich in ihrer gesamten Vehemenz. Der Regisseur der Folge, Miguel Sapochnik, hatte genau diese Intention bei dem Entwickeln dieser Sequenz. In einem Interview mit Entertainment Weekly sagte er:
That is to say, you experience this moment as an objective observer in all its glory with no sense of danger from the inevitable impact of hundreds of these huge stampeding animals. I was interested in what it must feel like to be on the ground when that sh- happens. Absolute terror? A moment of clarity? What goes through your head when you are right in the thick of it?
Dieses Miterleben und die Positionierung des Publikums in das Geschehen ist also das Hauptargument für die Nutzung der Plansequenz.
Es lässt sich sagen, dass es sich bei diesem Beispiel einer ungeschnittenen Einstellung um eine Pseudo-Plansequenz handelt. Es werden unmögliche Bilder geschaffen, allein dadurch, dass es unmöglich ist mit so vielen Pferden und Statisten eine ungeschnittene Schlachtszene zu koordinieren, zudem hier Tier und Mensch in Gefahr geraten würde. Hier wird wahrscheinlich auf digitale Bearbeitungsmöglichkeiten wie CGI zurückgegriffen. Auch lassen sich hier einige versteckte, beziehungsweise unsichtbare, Schnitte vermuten. Bei Sekunde 0:33 der 0:59-sekündigen Plansequenz wird das Bild für eine kurze Zeit schwarz, durch das Vorbeireiten eines Pferdes. Es ist der Moment in dem Jon kurz innehält, um anschließend weiter in der Schlacht zu kämpfen. Die Perspektive verändert sich leicht, es könnte sich aber auch um eine einfache Kameraneigung handeln, die durch das Pferd kurzzeitig unterbrochen wurde. Deswegen kann man nicht sagen, dass es sich hier um einen eindeutigen Schnitt handelt. Aufgrund der aber ohnehin vorhandenen Undurchführbarkeit der Sequenz unter Realbedingungen, ist diese Annahme aber naheliegend. Zudem kann man sich fragen, ob bei jedem Pferd oder Menschen, der an der Kamera vorbeiläuft und wo das Bild für kurze Zeit schwarz wird, ein Schnitt gesetzt wurde. Aber allein daran, dass man sich die Frage stellen kann, was echt in dieser ungeschnittenen Einstellung ist und was nicht, beziehungsweise ob überhaupt was echt sein könnte, lässt sich der Charakter dieser Plansequenz erkennen. Marius Böttcher sagte dazu, man „kann […] der Plansequenz eine Frage stellen, die in der Montage nie gestellt wird: Ist das echt?“ (116). Auch beschreibt er anschließend daran, dass es das nicht immer ist und auch nicht sein muss (ebd.). Durch versteckte Schnitte oder CGI werden physikalische und technische Bedingungen erweitert, die Grenzen des Möglichen werden aufgehoben. Durch die Pseudo-Plansequenz wird also weder die Kontinuität oder die Teilhabe des Publikums verhindert, sie wird lediglich ihrer Grenzen behoben, die Auswirkungen und Intentionen bleiben gleich.
Zuletzt lässt sich erneut André Bazins bereits genannter Leitsatz auf diese ungeschnittene Einstellung anwenden. Die Faktoren sind hier die Handlung des Protagonisten sowie die Schlacht um ihn herum. Ohne die Gewalt und Gefahr, die mit dieser Schlacht einhergeht, würde Jons emotionaler und physischer Kampf nicht so wirken. Aufgrund der Essentialität dieser beiden Handlungsfaktoren, darf hier, nach Bazin, zurecht nicht geschnitten werden.
3. Beispiel aus The Bells:
Die Folge The Bells ist die fünfte Folge der 8. Staffel, die vorletzte Folge der gesamten Serie, und wurde am 12. Mai 2019 ausgestrahlt (Hottes,„Game of Thrones: Staffeln und Episodenguide“). Die Folge thematisiert die Zerstörung von King`s Landing durch Daenerys Targaryen. Die ungeschnittene Einstellung geht 1 Minute und 26 Sekunden.
Die Einstellung beginnt mit einer Menge an Menschen, die in einem Raum verletzt und verängstigt Schutz vor der Zerstörung ihrer Heimatstadt suchen. Durch eine Kamerafahrt werden sie näher ins Bild gerückt und Arya Stark läuft von links in den Bildausschnitt rein. Die Kamera bleibt zunächst starr auf den Figuren. Sobald Arya sich mit einer Mutter und ihrem Kind erhebt, neigt sich mit ihr auch die Kamera. Die Figuren bleiben in ihrem Fokus, während sie aus dem Raum hinauslaufen. Es handelt sich hier um eine Rückfahrt, die Figuren gehen quasi auf die Kamera zu. Sie gehen aus dem Raum hinaus, wo sich zunächst die Belichtung verändert. In dem Raum, sowie in dem Gang nach draußen, war eher gedämpftes Licht, während das Sonnenlicht auf der Straße die Destruktion erst in voller Gänze zu erkennen gibt, beispielsweise das Blut an den Wänden oder die zerstörten Fassaden (Siehe Abb. 5). Zwei Flüchtige rennen durch das Bild und die Kamera schwenkt ihnen hinterher. Dadurch wird der Raum der Straße eröffnet, es entsteht Raumtiefe durch den Verlauf dieser Straße. Die Straße führt durch einen Torbogen. Durch die umliegenden Häuserwände und die Steinbrocken und Gebäudeteile, die auf der Straße liegen, entsteht die Ansicht, dass der Torbogen und die weiterführende Straße der Fluchtpunkt des Bildes sind, durch den diese Tiefe entsteht (Siehe Abb. 5). Von diesem Fluchtpunkt aus reitet ein Reiter auf die Kamera zu. Das Publikum sieht die Figuren im rechten Drittel des Bildes, während dahinter, vom tiefsten Punkt des Raumes, der Reiter die flüchtigen Menschen tötet. Anschließend sind Arya, die Mutter und das Kind, mit denen sie zu fliehen versucht, wieder im Bildmittelpunkt, im Hintergrund sieht man den Reiter immer noch, ein anderer Reiter kommt von links ins Bild. Die Figuren rennen weiter auf die Kamera zu, weiterhin zentral, während um sie herum die Gewalt gezeigt wird, vor der sie fliehen. Weitere Menschen laufen durch das Bild. Die Mutter mit dem Kind und Arya werden von den Reitern getrennt, die Mutter und das Kind entfernen sich aus dem Bildausschnitt, werden von den Reitern verdeckt. Die Kamera folgt Arya mit einer Neigung, als diese zu Boden fällt. Dort verharrt sie kurz mit Arya und folgt ihr weiter, als sie sich erhebt, um zu der verletzten Mutter und dem Kind zu gehen. Währenddessen rennen Menschen weiter durch das Bild, was zunächst weiteres, zur Szenerie passendes, Chaos erzeugt und dem Publikum vorenthält, was mit der Mutter geschehen ist. Die Zuschauer*innen hören das Kind nur nach seiner Mutter rufen und Arya auf sie zugehen, aber durch die Unruhe im Bild, sowohl durch die rennenden Menschen als auch durch die zerstörte Kulisse, ist die Mutter noch nicht gänzlich zu erkennen. Dadurch wird Spannung erzeugt und mit den Erwartungen des Publikums gespielt. Eine Kamerafahrt und -neigung rückt die Mutter und die Tochter in den Vordergrund. Es wird wieder zu Arya geschwenkt, diesmal hat sich allerdings die Perspektive geändert. Jetzt wird die Figur nicht mehr so wie vorher, als sie im Bildmittelpunkt war, in einer Normalperspektive gezeigt, sondern von unten, in einem leichten Low-Angle-Shot. Dadurch sieht man nicht nur den Platz, wo sie sich befinden und die dort sichtbaren Auswirkungen der Zerstörung, sondern wird so hinzukommend auch der Himmel eröffnet, auf den die Hauptfigur auch blickt. Man sieht, neben den Rauchschwaden und brennenden Dächern, den Drachen, der für die Zerstörung verantwortlich ist, aus der Ferne auf sie zufliegen (Siehe Abb. 6). Dadurch wird die drohende Gefahr verstärkt. Die Kamera folgt Arya weiter, als sie versucht die verletzte Mutter und ihr Kind vor der nähernden Gefahr zu retten. Im Hintergrund sieht man weiter parallel die Zerstörung und die panischen Menschen umher rennen. Die drei Figuren sind wieder zentral im Bild, im Himmel hinter ihnen sieht man weiterhin den Drachen, der sich schnell nähert. So wird Dramatik geschaffen und die Zuschauer*innen werden sowohl mit der Vernichtung der Stadt und ihrer Bewohner*innen als auch mit der drohenden Gefahr für die drei Charaktere in dem selben Bild konfrontiert. Die Mutter fällt zurück und die Kamera fährt stetig weiter nach links, folgt Arya wie sie versucht das Kind von der Mutter wegzuziehen. Das gelingt ihr nicht und die Kamera folgt Arya weiter bis hinter die schützenden Mauern, bis die Flammen das gesamte Bild einnehmen. Damit endet die lange Einstellung und das Publikum impliziert durch die Flammen, dass die Mutter und das Kind, dessen Rettung die Haupthandlung der ungeschnittenen Einstellung war, es nicht überlebt haben. Die gesamte Plansequenz endet so mit einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, dass der gesamte Rettungsversuch, der durch das Ungeschnittene an Spannung und Subjektivität gewann, umsonst gewesen war. Diese Hoffnungslosigkeit lässt sich als Parallele zu der Realität eines Krieges beschreiben, wo eben nicht wie bei typischer Hollywooddramaturgie alle Missionen ein glückliches Ende haben. Durch die Plansequenz als Stilmittel wird der Realismus weiter hervorgehoben.
Auch lässt sich die Einstellung hier erneut als Tracking Shot bezeichnen. Sie fokussiert Arya und die flüchtigen Figuren, meist durch eine Rückfahrt. Durch die wackelige Kameraführung wird eine Immanenz des Publikums geschaffen. So wie in der Plansequenz aus Battle of the Bastards haben die Rezipient*innen das Gefühl, Teil der Flucht zu sein. Helmut Korte bemerkt dazu, dass man in einer ungeschnittenen Einstellung „ vielmehr auf Kamerabewegung, Beleuchtung, Spiel der Darsteller und den unbemerkten Schnitt [setzt], um Handlungsfluss und Einfühlungsprozess des Publikums in die erzählte Geschichte nicht störend zu unterbrechen“ (41). All diese Aspekte lassen sich in dieser Beispielplansequenz finden. Durch eben diese Aspekte wird die Tragweite und die Auswirkungen des Kampfes bewusst. Zudem wird zeitgleich die Angst und die Panik der Betroffenen und der Protagonistin Arya Stark verdeutlicht. Also lässt sich auch hier erneut Bazins Grundvoraussetzung anwenden. Handlungsfaktoren sind hier die Flucht und die Angst der Figuren, sowie die Zerstörung der Stadt, die beide miteinander zusammenhängen und so ohne Schnitt dem Publikum offenbart werden sollen.
Auch hier lässt sich sagen, dass es sich um eine Pseudo-Plansequenz handelt, da hier erneut physikalische Grenzen überwunden werden. Zunächst einmal wird in dieser Sequenz wahrscheinlich mit CGI gearbeitet worden sein, um die brennenden Gebäude, die Fassaden und vor allem den Drachen zu bearbeiten. Auch ist fraglich, inwiefern mit den Reitern gearbeitet werden konnte oder ob es sich dabei auch um digitale Bearbeitung handelt. Während der vorbeirennenden Menschen, durch die das Bild für kurze Zeit schwarz wird, wie schon bei der Sequenz aus Battle of the Bastards, könnte auch ein unsichtbarer Schnitt stattfinden, der so allerdings nicht offensichtlich war. Aber erneut ändert die fragliche Echtheit nichts an den Charakteristiken einer Plansequenz, sondern bieten so nur die Möglichkeit, diese Handlung in ihrer gesamten Radikalität darzustellen und die Rezipient*innen so auch in unmögliche Bilder zu immersivieren. Trotzdem lässt sich neben den virtuellen Aspekten auch die Performativität erkennen, die für diesen Long Take nötig ist. Denn die Schauspielerinnen müssen auf dem Weg die genauen Momente, wo sie zum Beispiel getrennt werden oder ausweichen müssen, einhalten, um den Fluss und die Kontinuität zu erhalten. Auch wird mit vielen, sich fortgehend bewegenden Statisten oder beispielsweise fallenden Gebäudeteilen gearbeitet, was ebenfalls einer Koordination bedarf.
IV. Vergleich der analysierten ungeschnittenen Einstellungen:
Die drei Beispielplansequenzen gleichen und unterscheiden sich in manchen Faktoren, woraus sich bestimmte Charakteristiken einer ungeschnittenen Einstellung herausarbeiten lassen. Der Aspekt, den alle drei Beispiele gemeinsam haben, ist, dass immer jeweils ein Protagonist der Serie fast die gesamte Sequenz über im Fokus der Kamera und entweder zentral im Bild (Siehe Abb. 1 & 6) oder im rechten oder linken Bilddrittel (Siehe Abb. 2,3 & 4) ist. Nur wenn die Aufmerksamkeit des Publikums auf einen bestimmten Bildausschnitt gelenkt werden soll, ist es nicht so. Bei der Sequenz aus The Long Night wechseln sich die zentralen Figuren durch einen Kameraschwenk. Bei den anderen beiden Sequenzen bleibt die zentrale Person konstant. Das hängt auch damit zusammen, dass die Sequenzen aus Battle of the Bastards und The Bells beide als Tracking Shots bezeichnet werden können, die den Figuren folgen und sie stets als Handlungsobjekt definieren. Bei den beiden Sequenzen sorgt die ruckelige Kameraführung dafür, dass man als Zuschauer*in das Gefühl hat, in der Situation anwesend zu sein. Hier handelt es sich um extreme Gefahrensituationen und durch das Ungeschnittene wird das Publikum selbst darin involviert und empfindet so, als würde man gerade neben Jon Snow in der Schlacht stehen oder als würde man mit Arya Stark vor der Zerstörung fliehen. Diese Realität, die durch die ungeschnittene Einstellung geschaffen wird, wird in Echtzeit erlebt und sorgt für die entstehende, subjektive Position, die die Zuschauer*innen einnehmen. Bei allen ungeschnittenen Einstellungen findet eine Immersion statt, jedoch unterscheidet sich die Art. In The Long Night ist die Kamera zwar auch in Bewegung und folgt den Figuren, jedoch ist sie dabei ruhig und auch die Menschenmassen wirken vergleichsweise ruhig und geordnet im Gegensatz zu den beiden anderen Beispielen. Der Inhalt lässt sich hier also auch in dem Stil der Plansequenz wiedererkennen.
Ein weiterer Punkt, der Plansequenzen charakterisiert und sich in allen Sequenzen finden lässt, ist die Tiefenschärfe. Bei der Tiefenschärfe wird der Fokus der Zuschauer*innen auf bestimmte Bildteile gelenkt (Negenborn „die Schärfentiefe/ Tiefenschärfe“). In der Sequenz aus The Long Night wird der Fokus beispielsweise auf einen verletzten Mann gelenkt (Siehe Abb. 2), der hinter der Figur dadurch zu erkennen ist und den Ernst der Lage verstärkt. Ansonsten lässt sich in allen Long Takes eine große Tiefenschärfe finden, da das Bild so neben den Figuren und deren Handlung, beziehungsweise Emotionen, auch den Hintergrund offenbart und damit verknüpft. Durch die zerstörte Kulisse in The Bells (Siehe Abb. 6) oder die zahlreichen Kämpfer in Battle of the Bastards (Siehe Abb. 4), die durch die große Tiefenschärfe dargelegt werden, werden die Rezipient*innen mit dieser Bedrohung und Destruktion deutlich konfrontiert. Dafür lässt sich der Begriff der geteilten Aufmerksamkeit verwenden. Peter Wuss sagt dazu:
Denn indem die Plansequenz dank der Schärfentiefe dem Rezipienten permanent den visuellen Zugriff auf den gesamten Lebensausschnitt ermöglicht, den die Kamera über eine größere Zeitspanne erfasst, kultiviert sie offenbar die spezifischen Praktiken der geteilten Aufmerksamkeit. (554)
Dadurch wird das Analysierte verdeutlicht. Durch die Tiefenschärfe und die Anwesenheit mehrerer Handlungsfaktoren, die die Plansequenzen ausmachen, wird die Aufmerksamkeit des Publikums geteilt und der gesamte Kontext wird zugänglich gemacht. Dabei spielt auch die Kontinuität eine Rolle. Durch das Ungeschnittene erleben die Rezipient*innen die Sequenz in Echtzeit und werden kontinuierlich den gesamten Verhältnissen ausgesetzt, egal ob es Kriegsvorbereitungen, der Kampf an sich oder die Flucht vor der Gefahr ist. Diese Kontinuität haben alle drei analysierten Beispiele gemeinsam und lässt sich als essentielles Charakteristikum von Plansequenzen definieren.
Was sich bei den Sequenzen aus The Bells und The Long Night beobachten lässt, ist die Raumeröffnung und die Nutzung des Raumes. Bei dem Long Take aus Battle of the Bastards bleibt die Figur ungefähr auf dem gleichen Raum, die Kulisse an sich verändert sich nicht und es geht hier nicht darum, den Raum zu eröffnen und möglichst viele Winkel der Schlacht zu zeigen, sondern die Realität der Schlacht an sich. In den anderen beiden Sequenzen ist der Raum ein essentieller Faktor. Es soll die Zerstörung von King´s Landing und der belebte Hof von Winterfell konstruiert werden, dies ist ebenso fundamental wie die Empfindungen und Handlungen der Figuren. Somit wird durch Kamerabewegung, Bewegung der Figuren und Tiefenschärfe der Raum eröffnet und für das Publikum als ein essentieller Teil des Bildes wahrnehmbar gemacht.
Der letzte Aspekt ist die Performativität der Long Takes. Wie bereits herausarbeitet, handelt es sich bei den Sequenzen aus The Bells und Battle of the Bastards um Pseudo-Plansequenzen, was deren Status als ungeschnittene Einstellung aber nicht aberkennt. Bei dem ersten Beispiel aus The Long Night kann man nicht eindeutig sagen, dass es sich nicht um eine wahrhaftige ungeschnittene Einstellung handelt. Da sich leider kein Behind-the-Scenes Material dazu finden lässt, lässt sich nur vermuten, wie diese Sequenz gedreht worden sein könnte. Es könnte natürlich CGI oder sonstige Methoden verwendet worden sein, allerdings kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass bei diesem Long Take nicht weiter modelliert wurde. Dadurch wird erneut der Typus der ungeschnittenen Einstellung deutlich, da sie sich allein dadurch, dass man sich fragt, ob es echt sein könnte, schon von der Montage differenziert.
So kann das Wesen der ungeschnittenen Einstellung durch die Analyse und den Vergleich von den drei Beispieleinstellungen aus
V. Fazit:
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass man sich in dieser Hausarbeit dem Typus von ungeschnittenen Einstellungen durch eine tiefergehende Analyse und einen anschließenden Vergleich annähern konnte. Durch eine erste begriffliche Einordnung wurde zunächst klar, dass sich die Begriffe ‚Plansequenz‘, ‚Long Take‘ und ‚ungeschnittene‘ oder ‚lange Einstellung‘ nicht eindeutig und mit völliger Übereinstimmung definieren lassen. Relevant sind hier vor allem die Begriffe der Kontinuität des Zeitlichen und Räumlichen, der eigenständige Blick der Rezipient*innen, die einzelnen Handlungsebenen, die verbunden werden und die Bewegung und Dynamik, die hier nicht durch die Montage entstehen. Diese anfänglich ausgearbeiteten Wesenszüge wurden nun in einer Analyse von drei Beispielen aus der Fantasy-Drama Serie Game of Thrones untersucht, erweitert und modifiziert. Die Beispiele aus The Long Night, Battle of the Bastards und The Bells
VI. Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Screenshot aus "The Long Night". Game Of Thrones, HBO, 2019. Minute 2:12
Abbildung 2: Screenshot aus "The Long Night". Game Of Thrones, HBO, 2019. Minute 2:24
Abbildung 3: Screenshot aus "The Long Night". Game Of Thrones, HBO, 2019. Minute 3:12
Abbildung 4: Screenshot aus "Battle of the Bastards". Game of Thrones, HBO, 2016. Minute 39:50
Abbildung 5: Screenshot aus "The Bells". Game of Thrones, HBO, 2019. Minute 1:08:13
VII. Literaturverzeichnis:
„Battle of the Bastards“. Game of Thrones, HBO, 2016. Minute 38:55-39:54.
„Einführung in die Filmsprache: Alles, was du über die Kameraperspektive wissen musst“. Filmpuls.filmpuls.info/kameraperspektive/ . Zugriff: 02. August 2022.
„Game of Thrones: Das Lied von Eis und Feuer“. IMDb.www.imdb.com/title/tt0944947/ . Zugriff: 02. August 2022.
„Long Take“. Muthmedia.nur-muth.com/filmlexikon/long-take/ . Zugriff: 02. August 2022.
„The Bells“. Game of Thrones, HBO, 2019. Minute 1:07:39-1:09:05.
„The Long Night“. Game of Thrones, HBO, 2019. Minute 01:52-3:14.