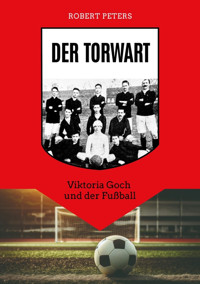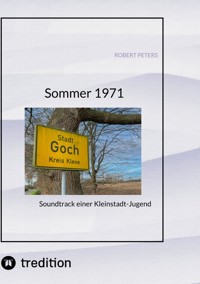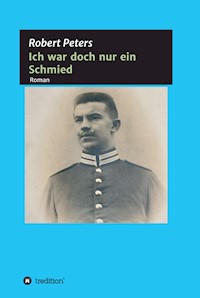8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch "Was für ein Theater" erzählt die Geschichte des Kinos aus der Perspektive von Otto Skoetsch. Der Essener Schreiner hat genug vom Alltag in der Werkstatt und der Enge der Zechensiedlung, in der er mit seinen Eltern lebt, die aus Masuren eingewandert sind. Er geht 1903 nach Amerika. In New York arbeitet er auf dem Bau. Der Besuch in einem Nickelodeon verändert sein Leben. Er sieht seinen ersten Film, den "Großen Eisenbahnraub", und er verfällt dem neuen Medium. Skoetsch kehrt mit der Geschäftsidee Kino nach Deutschland zurück. "Was für ein Theater. Eine Geschichte der Gocher Lichtspiele" erzählt vom Kino in der kleinen Stadt, seinem Aufstieg und seinem Niedergang. Erzählt wird Geschichte einer Familie und die Geschichte des Films vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu den 2020er Jahren. Das Buchspürt der Faszination des Mediums nach, der Magie des Films, der alltäglichen Zauberei, wenn durch Licht und Schatten lebendige Bilder entstehen und was diese Zauberei in den Köpfen der Menschen anrichtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
„Im Kino gewesen. Geweint.“
FRANZ KAFKA
Die Geschichte orientiert sich an biografischen und historischen Daten.
Die Handlung, die diese Daten verknüpft, ist zwar erfunden, aber vielleicht nahe an der Wirklichkeit.
Für Wolfgang und Carlo
ROBERT PETERS
WAS FÜR EIN THEATER
EINE GESCHICHTE DER Gocher LICHTSPIELE
© 2024 Robert Peters
Gestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Coverfoto: Joachim Lück, Golifreunde
Verlagslabel: Robert Peters
Druck und Distribution
im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5,
22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Robert Peters, Hauptstraße 232, 41236 Mönchengladbach, Germany.
Inhalt
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
1. Hamburg
2. New York
3. Der Kinematograph
4. Maria Blömer
5. Publikumsrenner
6. Otto wird ein Kinomann
7. Chicago und Carl Laemmle
8. Die Heimkehr
9. Otto Kommt Nach Goch
10. Die Gocher Lichtspiele
11. Die Verlobung
12. Die US-Filme und die Macht des Kinos
13. Das Theater – Auch Mal Ganz Wörtlich
14. Wilhelmines Tod
15. Die Cyankali-Krise und die Fehlende Lizenz
16. Nazizeit und Volkserziehung
17. Das Kino in Trümmern
18. Auferstanden aus Ruinen
19. Der Sohn ist der Chef
20. Familienbetrieb mit Ergänzungen
21. Drei Kinos in Einer Kleinen Stadt
22. Die Aufklärungsfilme – und Wieder Wird Gepredigt
23. Das Fernsehen Kommt – ins Kinderzimmer
Dank
Was für ein Theater
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
1. Hamburg
23. Das Fernsehen Kommt – ins Kinderzimmer
Dank
Was für ein Theater
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
1
HAMBURG
Otto Skoetsch will nach Amerika. Er hat genug von Essen und der Enge der Bergarbeitersiedlung. Zunächst landet er allerdings in Hamburg in einer Halle mit vielen Betten und vielen anderen Auswanderern. Im Zwischendeck einer großen Fähre erlebt er, dass eine Seefahrt manchmal alles andere als lustig ist. Zum seinem Glück hat er Freunde gefunden. Das erleichtert die Überfahrt, und es hält den Traum am Leben.
Das Letzte, was Otto Skoetsch an diesem trüben späten Septembertag von Deutschland sah, war die Insel Helgoland. Im Dunst über dem schiefergrauen Meer war schemenhaft der große Leuchtturm zu erkennen und blassrot schimmernde Felsen. Er erinnerte sich dunkel an weit zurückliegende Schulstunden, in denen die Insel ein Thema im Erdkunde-Unterricht gewesen war.
Die Briten hatten sie vor 13 Jahren ans Deutsche Reich übergeben, das wusste er noch, dafür hatte Deutschland großherzig auf irgendwelche Kolonien verzichtet. Das wusste er aber nicht mehr so genau. Es war ihm auch nicht wichtig.
Als Helgoland hinter den auf- und absteigenden Bergen aus Salzwasser endgültig in der Nordsee versank, klopfte ein Gefühl der Freiheit durch Ottos Adern, eine fröhliche Erregung, die er zum letzten Mal gespürt hatte, als er beschloss auszuwandern.
An den Moment dachte er jetzt wieder. Er hatte in der Werkstatt gestanden und Bretter gehobelt. Eine langweilige Arbeit, bei der man dennoch aufpassen musste, dass der Hobel nicht in einem Astloch hängenblieb. Das fuhr einem in den Arm, gab fiese Unebenheiten auf dem Holz und beschädigte manchmal die Klinge – alles nicht erstrebenswert und immer ein Anlass für eine lautstarke Ansprache des Meisters.
Es roch nach den frischen Spänen, die vom Brett flogen, durch das Fenster schien die Sonne, in ihren Strahlen tanzten Teilchen aus Holz und Staub ein flirrendes Ballett. Es sah ein bisschen so aus, wie er sich den sprühenden Sternennebel an der Spitze eines Zauberstabs vorgestellt hatte, als er ein Kind war und mit Begeisterung Bilderbücher ansah.
Er war nun aber kein Kind mehr. Er war Geselle, 22 Jahre alt und groß genug für andere Träume. In den tanzenden Teilchen sah er sein gelobtes Land flimmern, er sah Amerika wie auf den Bildern der Zeitschriften und der Reklametafeln, riesige Hochhäuser, weites Land, große Städte. Und er sah vor allem: Dollarscheine, viele Dollarscheine und ein neues Leben.
Vom alten hatte er jetzt schon genug, von der Zechensiedlung, in der er mit den Eltern unter einem Dach lebte, von der Werkstatt am Tag, von den langweiligen Abenden und den Sonntagen mit Kirchgang und den Vorträgen des Vaters. „Du weißt doch gar nicht, wie gut du es hast.“ Ja, ja.
Seinem Meister hatte er schon mal von seinen Träumen erzählt. „Du hasse nich mehr alle“, sagte der nur, „wat willste denn in Amerika? Da ham se gerade auf dich gewartet. Dat is doch Spinnerei. Bleib mal lieber inne Werkstatt, da weiße, watte has‘.“
Bei seinem Vater konnte er damit schon gar nicht landen. Er hielt nichts von Träumen, und Amerika wollte er sich nicht mal vorstellen – mit all dem Wasser dazwischen, den fremden Menschen und der anderen Sprache. Er selbst war mit 30 Jahren aus einem kleinen Ort in Masuren nach Essen gekommen.
Er arbeitete als Bergmann unter Tage – ein gefährlicher, aber einträglicher Beruf, jedenfalls viel einträglicher als die Schufterei auf dem Bauernhof in der alten Heimat, wo er als Knecht wenig mehr als sein täglich Brot hatte. Und er hatte immer gehofft, dass Otto ihm zur Zeche folgen würde. Die Schreinerlehre hatte der Sohn auch auf Zollverein im Ortsteil Schoppenberg gemacht.
Zum Glück musste er nur selten für Reparaturen einfahren und blieb meistens über Tage. Aber er fürchtete die Fahrten mit dem Förderkorb in die heiße Tiefe so sehr, dass er vor dem Einsteigen regelrechte Panikattacken bekam.
Kilometer von Stein zwischen sich und der Welt da oben ließen sein Herz klopfen, die dünne, staubige Luft ließ seine Lungen pfeifen. Die Rückreise aus der Tiefe war jedesmal seine persönliche Himmelfahrt ins Licht. Mit jeder Rückkehr aus dem schwarzen Loch wurde der Gedanke an die nächste Einfahrt unerträglicher. Otto hielt es nicht lange aus, er ging zu einem Möbelschreiner.
Das konnte sein Vater gerade noch ertragen. Auswanderungspläne nicht. „Du hast doch hier dein Auskommen, und du sprichst ja nicht mal amerikanisch“, sagte er.
„Du hast doch in Polen oder Russland, oder wo das ist, dein Auskommen gehabt und bist trotzdem ausgewandert. Außerdem sprechen die englisch.“
„Das war Ostpreußen, und es ist deutsch. Und eine neue Sprache musste ich auch nicht lernen.“
„Hättest du mal besser getan, dein Deutsch versteht ja keiner. Statt Ostpreußen sagst du Ostpreißen.“
„Unverschämter Bengel!“
So ging das viele Wochen.
Otto hielt nicht viel vom Leben seines Vaters, von der Siedlung neben der Zeche, den kleinen, schmalen Häuschen, die von der Zeche vermietet wurden, den Gärten mit den Ställen, in denen Hühner und manchmal die Bergmanns-Kuh, eine Ziege, gehalten wurden. Seine Eltern hatten nur Hühner, und sie bauten ihr eigenes Gemüse an – Kohlrabi, Spinat, Zwiebeln, Kohl. Das war ihm alles viel zu bäuerlich, zu dreckig, zu klein.
Er hielt allerdings viel von Widerworten, und er ließ sich ungern etwas sagen, vor allem von seinem Vater nicht, dessen Stirn im Streit vor Wut glühte und dessen Schläfenadern hervortraten wie dicke Wülste am Kopf. Wenn er ihn so weit hatte, war Otto zufrieden. Es verschaffte ihm eine regelrechte Genugtuung.
Die Mutter verschwand bei solchen Auseinandersetzungen hinter einem unsichtbaren Vorhang, der die Gegend um den Kohleherd vom Küchentisch trennte. Sie machte sich ganz klein, knetete im Kummer nur stumm die Hände und schaute verzweifelt auf das Bild von Jesus an der Wand mit dem großen, roten, von einem Strahlenkranz umgebenen Herz. „Jesus“, sagte sie leise, „Jesus und Maria.“ Es hörte sich an wie „Jesses und Mária.“
Das half aber auch nicht weiter. Otto reckte die dünne, spitze Nase ein bisschen höher. „Ihr könnt machen, was ihr wollt, ich habe Geld gespart, und ich fahre.“ Sein Vater knurrte leise vor sich hin, über seinem Kopf schienen kleine Wolken des Zorns zu dampfen. So recht glauben wollte er es nicht. Aber er würde schon sehen.
Vor einem halben Jahr war das gewesen.
Otto hatte ernst gemacht. Vom Meister ließ er sich den restlichen Lohn auszahlen, packte ein paar Sachen zusammen und sein Werkzeug. In die Kiste kamen der Hobel, zwei Bleistifte, der Zollstock, ein Winkelmaß, die Schmiege mit den verstellbaren Winkeln, ein Stechbeitel, der Handbohrer und eine Handsäge. In den Koffer aus dicker Pappe legte er seinen Arbeitsanzug, Wäsche, ein Paar Arbeitsschuhe, Waschzeug und zwei Hemden. Er zog seinen einzigen Anzug an, setzte den Hut auf und fuhr mit der Eisenbahn nach Hamburg.
Es schien ganz leicht.
Hinter Dortmund allerdings, wo das westfälische Land so weit wurde und die Industrieanlagen verschwanden, als hätte sie eine große Hand einfach wegradiert, wurde ihm ein wenig komisch zumute, und der trotzige Mut schwand ihm ein bisschen. Würde das alles gut gehen?
Er fühlte sich nicht mehr ganz so stark wie einige Stunden zuvor, als er die weinende Mutter umarmt und sich wortlos mit einem kräftigen Händedruck von seinem Vater verabschiedet hatte. Er kam sich ziemlich klein vor in dem rumpelnden Abteil der dritten Klasse.
Aber das ging vorbei. Irgendwann lehnte er den Kopf ans Fenster und nickte leise im Takt der Eisenbahn ein. Padamm, padamm, padamm.
Hamburg war groß, der Hafen riesig. Doch Otto ließ sich nicht einschüchtern, nicht mehr. Dieses Gefühl hatte er in der Eisenbahn niedergerungen. Es schien, als sei er irgendwo hinter Dortmund zum Mann geworden, ein zwar schmächtiges, aber sehniges und entschlossenes Kerlchen.
Er hatte die Adresse der Reederei Hapag, und er fand den Weg vorbei an Lastkarren und Hafenschuppen, an Menschen mit Schiebermützen und fremdartigen Gesichtern, an Matrosen und Marktfrauen, Scheuermännern, Arbeitern und solchen, die Auswanderer werden wollten wie er.
Otto hatte sich vorgestellt, an einen Schalter zu treten wie im Essener Hauptbahnhof, eine Fahrkarte zu kaufen und nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag in See zu stechen.
Das war sehr optimistisch, zu optimistisch, wie sich zeigen sollte. Es gab zwar einen Schalter, und er konnte auch eine Passage wählen. Er kaufte ein Ticket zu 150 Mark für die Überfahrt III. Klasse, ein bedeutender Teil seiner Ersparnisse, soviel verdiente ein einfacher Arbeiter im Jahr. Aber sein Schiff ging erst in drei Wochen.
Skoetsch schluckte. Der Mann am Schalter, ein dicker Kerl mit rotem Gesicht, war solche Reaktionen offenbar gewohnt, und er wusste auch einen Rat: „Unsere Reederei hat die Auswandererhallen auf der Elbinsel Veddel bauen lassen. Da können Sie für zwei Mark am Tag ein Bett und drei Mahlzeiten bekommen.“ Er sagte: „am Tach.“ So sprach man hier.
Was blieb Otto schon übrig? Er wollte ja nicht nach drei Tagen reumütig wieder zu Hause auf der Schwelle stehen wie ein Verlierer. Deshalb zahlte er 42 Mark im Voraus, bekam ein zweites Ticket und die Wegbeschreibung.
Die Hallen waren nicht so schlimm, wie er zunächst gedacht hatte. Es gab natürlich keine einzelnen Zimmer, sondern nur Schlafsäle, selbstverständlich nach Geschlechtern getrennt. Die Decken waren allerdings hoch, und die Räume waren gut belüftet.
Es roch jedenfalls deutlich besser als in dem Ledigenheim, in dem Ottos Essener Mitgeselle Roland hausen musste, zwischen ungewaschenen Männern, stinkenden Socken und Tabakqualm, dass einem die Augen tränten. Otto hatte sich da nie sehr lange aufgehalten, es war für seine lange, spitze, empfindliche Nase eine einzige Zumutung.
In Hamburg sendete sein Riechorgan keine Gründe zur Klage. Und das Essen war nicht übel, morgens und abends meistens Brot mit Dauerwurst oder Hering, zu Mittag eine Suppe oder Eintopf. Es reichte. Wenn es mal zu eintönig schien, tröstete sich Otto mit seinen Fantasiebildern von Amerika, die er mühelos beschwören konnte wie in einer inneren Ausstellung, die er bei Bedarf besuchte.
Er sah dann die Freiheitsstatue, das Meer, die Prärie und eine riesige Stadt, er sah Weite für die Augen und für den Geist. Es war ihm dann, als habe er die Fesseln der engen Zechensiedlung bereits abgelegt. Ein gutes Gefühl.
Einen kleinen Vorgeschmack auf die Einbürgerungsformalitäten bekam er schon mal in Hamburg. Bevor er nämlich sein Bett beziehen durfte, musste er sich wie jeder andere künftige Auswanderer einer strengen Hygiene-Kontrolle unterziehen. Und geduscht wurde auch. Vor Jahren habe es einen Seuchenausbruch gegeben, wurde ihm erklärt. Die Dusche kostete nichts. Das fand Otto gut.
In den Hallen gab es nur normale Waschräume ohne Dusche, und das Wasser war kalt. Kein Grund zu murren, urteilte Otto, das war daheim auch nicht besser. Geduscht wurde dort nur in der Waschkaue auf Zeche, ein richtiges Badezimmer hatte niemand, und die Aborte waren kleine Holzhäuschen im Garten, in deren Türen ein Herz gesägt war – ob zur besseren Belüftung oder aus romantischen Gründen, wusste er nicht. Wahrscheinlich zur besseren Belüftung, sehr romantisch war das Häuschen nicht. Auf dem großen Gelände auf der Elbinsel konnten wohl 5000 Menschen untergebracht werden, erzählte der Nachbar im Bett zu Ottos rechter Hand (wenn er auf dem Rücken lag, rechter Hand). Er zeigte ihm auch das kleine Geschäft, in dem man Bier, Brot und Süßigkeiten kaufen konnte. Was man so braucht zum Überleben.
Und er führte Otto in den Gemeinschaftssaal, wo sich die in der Nacht getrennten Eheleute oder Familien trafen und in dem manchmal eine Musikkapelle aufspielte. Dann war es ein kleines Volksfest. Es war wirklich auszuhalten.
Ottos Bettnachbar hieß Heinrich Verhoeven („Du kannst aber Heinz zu mir sagen“), war Bauer, und er kam aus einem Dorf an der holländischen Grenze, Pfalzdorf hieß es. Davon hatte Otto noch nie etwas gehört.
„Ich mache jetzt, was meine Vorfahren schon machen wollten“, erklärte Heinz und strich sich durch das pechschwarze Haar, das ihm bis auf den Kragen seines blauen Hemdes fiel und die gleiche Farbe wie sein kleiner Schnurrbart hatte. Der Schnurrbart war an den Seiten ein wenig nach oben gezwirbelt. Er sollte wohl mal so aussehen wie der vom Kaiser, das wollten viele. Aber bis dahin war noch ein Weilchen Pflege nötig.
„Ich gehe wirklich nach Amerika. Meine Leute wollten schon vor mehr als 150 Jahren da hin.“
„Warum denn?“
„Sie stammten aus der Pfalz und waren leider evangelisch. Sie konnten ihre Religion in der Heimat nicht ausüben, weil es der Landesherr nicht wollte. Und sie waren arm. Deshalb wollten sie von Rotterdam nach Amerika segeln. Alles war wohl besser als die Pfalz.“
„Und das hat nicht geklappt?“
„Sie waren schon den ganzen Weg bis zur Grenze gekommen, da verboten die Holländer in Schenkenschanz, das ist bei Kleve, die Durchreise nach Rotterdam.“
„Dann sind sie umgekehrt?“
„Man kann eher sagen: Sie sind geblieben. Auf ihre Bitte hin hat König Friedrich II. selbst eine Ansiedlung in der Gocher Heide erlaubt.“
„Ist es da denn so schlimm, dass du dich davongemacht hast?“
„Schlimm ist das falsche Wort. Aber wir sind da immer unter uns, weil die umliegenden Ortschaften alle katholisch sind, und die Leute nichts mit uns zu tun haben wollen – wir übrigens auch nicht mit ihnen. Mit der Zeit kennt man wirklich jeden im eigenen Dorf. Und da hat einmal abends einer in der Schule einen Vortrag über Amerika gehalten. Da muss ich hin, hab ich gedacht. Meine Eltern waren nicht begeistert, aber sie haben die Überfahrt gezahlt.“
„So weit wäre es bei meinen nicht gekommen“, sagte Otto, „ich musste selbst bezahlen. Aber ich glaube auch, dass es in Amerika etwas Besseres gibt als Schreinerei oder Schuften im Bergbau.“
„Oder Äcker pflügen mit dem Pferd.“
„Oder Äcker pflügen mit dem Pferd, ja.“
Otto fand Heinz sympathisch, er mochte auf Anhieb dessen dunkle Augen, in denen neben viel Gutmütigkeit immer ein bisschen Abenteuerlust schimmerte. Und er glaubte, mit einem sicher 1,80 Meter großen Freund, dessen eindrucksvolle Muskelberge nicht zu übersehen waren, würde die große Reise bestimmt deutlich angenehmer und weniger gefährlich sein.
Skoetsch war vergleichsweise zierlich, und in seinem blassen, schmalen Gesicht wohnte weniger Abenteuerlust als Schläue. Sie passten also gut zusammen.
Im Bett auf der anderen Seite hatte sich ein wortkarger Kerl mit einem kantigen Gesicht und untersetzter Statur eingerichtet. Mit der Zeit taute aber auch er ein bisschen auf. Er hieß Fritz Kowalski, „eigentlich Friedrich, aber alle sagen Fritz“, war wie Heinz und Otto Anfang 20, und er hatte im Essener Pütt als Bergmann gearbeitet. Allerdings nicht wie Ottos Vater auf Zollverein, sondern auf Helene und Amalie in Altenessen.
„Ich hatte die Schnauze voll vom Staub und der Hitze und der Dunkelheit“, sagte Fritz. Dafür hatte Otto großes Verständnis. So waren sie also bereits zu dritt in dem großen Wartesaal, und sie hatten alle eine Fahrkarte für die Hapag-Fahrt nach New York. Im Unterschied zu den feineren Herrschaften mit Passagen in der ersten und zweiten Klasse, die mit der Bahn nach Cuxhaven reisten und dort am neuen Landesteg der Reederei das große Schiff bestiegen, mussten Otto, Fritz und Heinz mit einem Tenderschiff die Elbe durchfahren, weil die dicken Pötte zu viel Tiefgang hatten, um nach Hamburg zu kommen.
An Bord des Tenderschiffs gewöhnten sie sich nach drei Wochen Warten in den Hamburger Hallen an den Seegang. Und in Cuxhaven staunten sie beim Umsteigen über die Größe des Fährschiffs. 2500 Passagiere fanden Platz in den Schiffen der Hamburg-Amerika-Linie.
Nicht alle hatten es freilich so gemütlich wie die fast 400 Gäste der ersten Klasse, denen jeder erdenkliche Luxus geboten wurde. Im Zwischendeck, wo Otto, Heinz und Fritz nun neun Tage verbringen mussten, war es eng, stickig und feucht. Und es stank erbärmlich.
An die Luft ging es nur zu festgelegten Stunden. Wenn es stürmisch wurde, blieb auch der „Freigang“ aus. Dafür roch man im Zwischendeck die Eimer für die Notdurft, die in den Ecken standen, und die Folgen der Seekrankheit, die viele ereilte, das Trio der jungen Auswanderer aus Essen und Pfalzdorf zum Glück nicht.
Es war vermutlich aus einer besonderen Laune des Schicksals ebenso wetterfest wie die Seeleute, die selbst bei heftigem Wellengang nicht aus der Ruhe kamen. Den großen Schiffen machte auch widriges Wetter nicht so viel aus, die Seeleute kannten da ganz andere Pötte, auf denen man im Sturm herumflog wie Spielzeug, wenn man sich nicht irgendwo festhalten konnte.
Das „Atlantische Tageblatt“ schrieb dagegen über eine Sturmfahrt in einer Fähre der Hamburg-Amerika-Linie: „Das Schiff liegt auf dem Wasser wie ein Schwan, der mit Grazie die Wellenberge teilt.“
So poetisch konnte Otto das nicht sehen, schließlich erlebte er nur unter Deck mit, wie der Schwan im Sturm die Wellenberge teilte. Im niedrigen Saal der billigen Passagiere aus Polen, Slowenien, Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich schüttelte der Sturm die Belegschaft ordentlich durch, und die vielen Sprachen, in denen darüber je nach Temperament laut oder wimmernd geklagt wurde, gaben einen Vorgeschmack auf die neue Welt, in die alle wollten und deren Verheißung sie tapfer durchhalten ließ, auch wenn es im Bauch des Schiffs rumpelte, ächzte und krachte wie in einer riesigen Fabrik. In einer riesigen, stinkenden Fabrik.
2
NEW YORK
Die große Stadt ist ein großer Schock. Wer die Dächer der Häuser sehen will, bekommt Nackenschmerzen. Aber es gibt Arbeit. Und Geld. Und ein Bett. Und einen kostenlosen Englischkurs mit irischen Einschlägen.
Kein Sturm ist für immer. Das war eine schöne Erkenntnis. Und deshalb erlebten Otto, Fritz und Heinz die Einfahrt ins gelobte Land während der Deckstunde an der frischen Luft. Sie atmeten tief durch und pumpten ihre Lungen voll mit dieser Frische und ihre Herzen voll mit Zuversicht. Es war ein starkes „Alles wird gut“-Gefühl.
Es ging vorbei an Sandy Hook, der Nordspitze der Vereinigten Staaten, durch „The Narrow“ in den Hafen von New York. Die Auswanderer fühlten sich nun bereits wie Einwanderer, angekommen in ihrem Traumland, dessen Luft schon jetzt nach Salz schmeckte und nach Freiheit, vor allem nach Freiheit.
Der Hamburger Hafen, der betriebsam und groß war, gemessen an allem, was die Drei aus Essen und Pfalzdorf bis dahin in ihrem Leben gesehen hatten, wirkte wie eine Puppenstube gegen das Treiben auf dem Wasser, das sie nun erlebten.
Seedampfer, Flussdampfer, Fähren und Barkassen drängten sich auf der Fahrt in den Hudson. Lagerschuppen glitten am Ufer vorbei. Es war fast zu viel für Augen und Ohren nach neun Tagen im stickigen Zwischendeck in seiner dunklen Ödnis.
Alles war größer, voller, lebendiger, und in den Ohren dröhnten die Schiffssirenen und die Motorengeräusche. Musik war das für Otto, die Musik der freien Welt, die zu Tönen gewordene Verheißung. Er bekam Gänsehaut am ganzen Körper.
In Hobroken wurde das Schiff vertäut, eine Schar von Ärzten, Einwanderungskommissaren, Passinspektoren und Zollbeamten mit hohen Hüten und amtlichen Mienen bestieg den Dampfer. Diese wichtigen Menschen erledigten die Einreiseformalitäten für die wohlhabenden Passagiere, die ohne lange Wartezeit ebenso umstandslos von Bord gingen und US-amerikanischen Boden betraten, wie sie aus der schmucken Anlegehalle in Cuxhaven aufs Schiff gelangt waren und Deutschland verlassen hatten.
Otto fragte sich, was derart vom Schicksal bevorzugte Menschen in Amerika wollten, sie hatten doch alles.
Für die ärmere Bevölkerung und damit auch für Otto, Heinz und Fritz ging es weiter zur Quarantäne-Station auf Ellis Island, eine Insel mitten im Fluss. Es dauerte einen quälend langen Tag, ehe die Männer den ersehnten Stempel bekamen; Zollbeamte hatten sie befragt, Ärzte hatten sie abgehorcht, ihnen wurde in den Hals geschaut, dass Heinz sich schon vorkam wie eine Kuh auf dem heimischen Hof; sie mussten ihre Unterschriften unter zahlreiche Dokumente setzen, von deren Inhalt sie beim besten Willen nicht mehr als ein Bruchteil begriffen.
Selbstverständlich unterschrieben sie trotzdem alles. Und ihnen fielen beim Warten zwischen den einzelnen Stationen vor Müdigkeit beinahe die Augen zu. Aber sie hielten durch, natürlich hielten sie durch.
Und dann durften sie an Land. Es war der Schock der neuen Welt. Überall Automobile, Pferdefuhrwerke, Straßenbahnen, die ebenfalls von Pferden gezogen wurden, Menschen, die aneinander vorbeihasteten, jeder schien enorm viel zu tun zu haben. Und jeder war in außerordentlicher Eile.
Es war laut, Autos hupten, Sägen kreischten irgendwo, ein großes Brett fiel krachend zu Boden, dass sie vor Schreck zusammenfuhren. Und über diesem ganzen Getriebe diese riesigen Häuser, Wolkenkratzer nannte man die, sie wuchsen tatsächlich so hoch wie die Träume derer, die sie jetzt ungläubig anstarrten und beim angestrengten Blick in die Höhe zum Ende dieser Türme einen steifen Nacken bekamen.