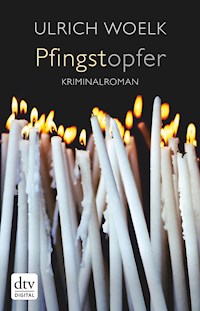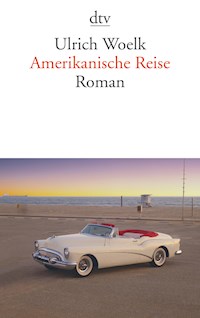8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebesgeschichte, eine Tragödie Roland Ziegler ist 36 Jahre alt, Unternehmer und ein kluger, selbstbewusster Mann. Im Herbst 1999 lernt er in Berlin zufällig Zoë kennen, eine etwas jüngere Jazzsängerin. Überraschend begleitet sie ihn auf eine Reise nach Amsterdam, wo sie für Roland zu seiner großen Liebe wird. Die Geschichte seiner eigenen Familie und des Unternehmens aber holt ihn ein: Er wusste zwar, dass sein Unternehmen während des Kriegs Zwangsarbeiter beschäftigte, aber erst jetzt erfährt Roland, dass sich seine Eltern deshalb in den Sechzigerjahren getrennt hatten. Plötzlich steht infrage: Wer ist Zoës Mutter, und wer ist Zoë? Ein Roman, der mit viel Spannung auslotet, wie unsere Geschichte die Gegenwart prägt – und unsere Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
ULRICHWOELK
WASLIEBEIST
Roman
EINS
DAFÜR, DASS ER EPILEPTIKER IST, hat er seinen Weg gemacht. Er ist sechsunddreißig, promovierter Jurist und hält zehn Prozent der Anteile des elektrotechnischen Familienunternehmens, das sein Großvater in den dreißiger Jahren gegründet hat. Auf dem Markt für Großtransformatoren und Starkstrom-Umspannanlagen ist die Firma weltweit mit Erfolg aktiv. Anlagen der Ziegler Group stehen unter anderem in Kanada, Mexiko und Südafrika.
Das sind die Länder, in denen er vor Ort war, was mit seiner Krankheit nicht selbstverständlich ist. Manche Fluggesellschaften verlangen von Epileptikern, dass sie sich vor dem Abflug beim Kabinenpersonal melden. Man möchte während des Flugs keine unliebsamen Überraschungen erleben. Er gibt seine Epilepsie beim Check-in trotzdem nicht mehr an. Durch die Wahl des richtigen Medikaments ist er seit ungefähr zehn Jahren anfallsfrei. In dieser Hinsicht hat er Glück gehabt, denn Anfallsfreiheit wird medikamentös keineswegs bei allen Epileptikern erreicht.
Deswegen beunruhigt ihn das unheilvolle, schwer zu fassende Gefühl, das sich in ihm verdichtet, als er in Berlin vor einem Straßencafé aus dem Taxi steigt. Für Ende Oktober ist es ungewöhnlich warm und schwül. Der Luftzug eines Busses wirbelt ein paar Blätter über den Gehweg. Irgendetwas geschieht in diesem Moment in ihm. Er spürt einen Druck in der Magengegend und eine unbestimmte, in nichts wurzelnde Angst.
Er lockert den Knoten seiner Krawatte, aber diese Geste, mit deren Beiläufigkeit er sich selbst ein wenig beruhigen möchte, bringt keine Erleichterung. Das vage, vom Bauch aufsteigende Gefühl säuerlicher Wärme lässt nicht nach und auch die unbestimmte Angst nicht, so dass er schließlich denkt: Was, wenn es die Vorahnung eines kommenden Anfalls ist?
Die Tür des Cafés steht offen. Hinter dem Panoramafenster zur Straße lesen die Gäste Zeitung oder beschmieren kleine Brötchen mit Marmelade. Es ist Frühstückszeit. Dass in dem Café gelesen wird, wertet er als Beleg dafür, dass es sich bei den Gästen um besonnene, informierte und letztlich intelligente Mitmenschen handelt. Sollte er einen Anfall haben, wäre das sicher ein Vorteil. Von dem zufällig zusammengewürfelten Straßenpublikum in einer Großstadt wie Berlin lässt sich das wahrscheinlich nicht sagen.
Außerdem könnte der Fußboden dort ein Holz- oder Teppichboden sein und also federnd oder sogar weich im Vergleich zu den harten Betonplatten des Gehwegs. Das Café scheint den Schutz zu bieten, den er braucht, falls es wirklich zu einem Anfall kommen sollte. Ihm bleibt nicht viel Zeit, sich zu entscheiden. Oft vergehen nur Sekunden, bis sich aus der Vorahnung eines epileptischen Anfalls – einer Aura – ein Anfall entwickelt.
Er weiß, welche Optionen er hat und was in seinem Körper möglicherweise geschehen wird, aber dass es geschehen könnte, trifft ihn nach zehn Jahren ohne Anfall unvorbereitet und hart. Vielleicht irrt er sich ja. Vielleicht interpretiert er nur die Tatsache fälschlicherweise als Aura, dass der Himmel sich allmählich bewölkt und die Luft drückend wird, so wie es am Morgen in den Radionachrichten, die er im Hotel beim Rasieren gehört hat, angekündigt worden ist.
Das Sicherste wäre es ohne Zweifel, sich sofort hinzulegen, an Ort und Stelle, im Anzug und mit Aktentasche. Auf dem Gehweg liegend könnte er einen Anfall abwarten, ohne durch einen Sturz gefährdet zu sein. Manche Epileptiker, die eine Aura spüren, handeln so. Es ist vernünftig. Die irritierten, befremdeten und vielleicht auch ärgerlichen Blicke von Passanten stören sie nicht. Aber er möchte so nicht mehr angesehen werden. Nicht nach zehn Jahren ohne Anfall. Nicht nachdem er seinen Weg gemacht hat.
Er betritt das Café wie in Trance. Tische, Stühle und der Tresen, an dem Kaffee und Speisen ausgegeben werden, haben nüchterne, funktionelle Formen. Das Licht und die Farben sind warm und freundlich. Er setzt sich auf den ersten Stuhl, den er erreicht, und fühlt sich danach etwas sicherer, auch wenn es nach wie vor möglich ist, dass er das Bewusstsein verliert.
Auren sind nicht eindeutig. Unter medizinischen Gesichtspunkten sind sie kleine Anfälle, begrenzte epileptische Ereignisse, die mal in einen sogenannten Grand-mal-Anfall mit Krämpfen und Bewusstseinsverlust münden, mal aber auch folgenlos abklingen. Während er versucht, die Wahrscheinlichkeiten abzuwägen, die für das eine oder andere sprechen, sagt eine Stimme: »Entschuldigung.«
Die Frau, die vor ihm steht, trägt eine verwaschene schwarze Jeans mit ein paar Rissen und darüber ein ebenfalls schwarzes T-Shirt mit einer großen weißen Aufschrift, von der aber nur die Buchstaben IGH zu erkennen sind. Anfang und Ende des Schriftzugs werden von einer abgewetzten Lederjacke verdeckt. IGH – als Jurist assoziiert er RIGHT.
Die Frau ist Ende zwanzig und hat dunkle, kurz geschnittene Haare. Hier und da schießen ein paar eigenmächtige Strähnchen hervor. Ihr Gesicht ist schmal, hell. Sie betrachtet ihn irritiert, wie er da im Anzug und mit Aktentasche vor ihr sitzt. Vermutlich ist er nicht der Typ von Mann, mit dem sie üblicherweise zu tun hat. »Entschuldigen Sie«, sagt sie noch einmal, »aber Sie sitzen auf meinem Platz.«
Auf dem Tisch steht eine Schale mit einem zur Hälfte getrunkenen Milchkaffee. Das bemerkt er erst jetzt. Daneben liegt eine aufgeschlagene Ausgabe des Spiegel vor einem Aschenbecher mit zwei ausgedrückten Zigaretten.
Er murmelt: »Tut mir leid … es geht schon wieder.«
Sie sagt: »Stimmt etwas nicht?« Und als er nichts entgegnet und nur eine unklare, halb zustimmende, halb abwehrende Bewegung mit dem Kopf macht, fügt sie hinzu: »Ich bringe Ihnen ein Glas Wasser.«
Wie nahezu alle Epileptiker ist er darum bemüht, seine Krankheit gegenüber anderen zu verbergen. Es gibt zu viele Vorurteile über Epileptiker. Manchmal heißt es, epileptische Erkrankungen seien den Menschen anzusehen, was nicht stimmt. Oder die Epilepsie wird als eine Form von geistiger Behinderung betrachtet, die auch die Intelligenz begrenzt. Oder man hält Epileptiker für aggressiv und unterstellt ihnen, dass sie besonders häufig psychische Probleme haben bis hin zur Schizophrenie.
All das ist Unsinn. Es gibt keine Belege für irgendeine dieser Behauptungen. Manchmal gibt es Vorerkrankungen des Gehirns, zum Beispiel Tumore, die sowohl für die Epilepsie als auch für psychische oder geistige Probleme verantwortlich sind. Doch die meisten Epilepsien sind idiopathisch – das heißt, es lässt sich keine krankhafte Veränderung des Gehirns feststellen, die als Ursache für die Epilepsie in Frage kommt. In allen Tests erweisen sich die Gehirne idiopathischer Epileptiker als intakt und unauffällig. So ist es auch bei ihm.
Die Frau, auf deren Platz er sitzt, bringt ein Glas Wasser und stellt es vor ihn auf den Tisch. Er bedankt sich.
»Es geht schon wieder.«
»Vielleicht ist es das Wetter«, sagt sie und setzt sich. Als sie sich den Stuhl zurechtrückt, gibt ihre Lederjacke den Blick auf die T-Shirt-Parole frei. Quer über ihrer Brust steht nicht RIGHT, sondern FIGHT!
Allmählich geht es ihm wieder besser. Vielleicht war es wirklich nur das schwüle Wetter. Oder er hat etwas Verdorbenes gegessen, zum Beispiel das Rührei vom Frühstücksbuffet, bei dem er einen Moment gezögert hat. Er atmet durch.
»Ich muss sowieso weiter«, sagt er. »Sie sind mich gleich los.«
Jetzt lacht sie plötzlich, charmant und neugierig, offenbar ist ihr Unmut verflogen: »Wer sagt denn, dass ich Sie gleich wieder loswerden möchte? Wohin müssen Sie denn so dringend?«
Er sagt: »Zum Bundeskanzler.«
»Natürlich!«
Sie denkt, er scherzt mit ihr. Sie denkt, jetzt, da es ihm besser geht, ist es ein Spiel, vielleicht sogar ein Flirt. Sie klappt die Spiegel-Ausgabe zu, um zu unterstreichen, dass ihr die Lektüre nicht besonders wichtig gewesen ist – jedenfalls deutet er ihre Geste so. Nach dem Zuschlagen des Magazins sieht er nun dessen Cover, auf dem Adolf Hitler ganzseitig abgebildet ist, groß und frontal. Darunter heißt es: Die reale Macht des Bösen. Ist das so? Ist die Macht Hitlers noch real? Oder ist er nur noch eine Horrorfigur aus dem Gruselkabinett der Weltgeschichte?
Sie zündet sich eine Zigarette an und inhaliert tief. Aus der Art, wie sie raucht, schließt er, dass die Mischung aus Selbstliebe und Selbstzerstörung, die sich mit dem Rauchen verbindet, dem Bild entspricht, das sie von sich selbst hat.
»Und was machen Sie beim Bundeskanzler.«
»Ich vertrete ein Unternehmen.«
»Und was wollen Sie? Geld?«
»Ich nicht. Aber Schröder«, sagt er.
Er verträgt es nicht, dass sie raucht, will das aber nicht zugeben. Sie soll sich nicht die Schuld daran geben, dass die Übelkeit zurückkehrt. Um sich abzulenken, konzentriert er sich auf den Anblick unerheblicher Details: die Trinkschale mit den Resten des Kaffees, die weiße Milchglaskugel, die als Deckenleuchte im Brasseriestil an einer Messingstange hängt, Hitler auf dem Spiegel-Cover. Für Hitler und Conti und Brandt und Bouhler wäre er mit seiner Krankheit nicht mehr als eine genetische Fehlerquelle in ihrem wahnhaften Kampf um die »Gesundheit« der Rasse.
Da er nichts mehr sagt, begreift sie, was los ist, und drückt die Zigarette aus.
»Wie idiotisch von mir. Ich wohne hier in diesem Haus. Im dritten Stock. Es gibt einen Fahrstuhl. Irgendetwas gegen Übelkeit habe ich sicher. Vomex oder Ingwertee.«
Kurz darauf stehen sie in ihrer Wohnung. Es ist eine schöne große Altbauwohnung mit hohen Räumen, Stuck, Doppelfenstern mit echten Fensterkreuzen, Dielen- und Parkettfußboden. Eine Wohnung vom Anfang des Jahrhunderts. Aber in den Regalen, auf den Fensterbrettern, in den Ecken auf dem Fischgräten-Eichenparkett liegen und stehen Dinge herum, die in die Gegenwart gehören und nicht in die Vergangenheit: Espressotassen, CDs, Jogging-Schuhe, Taschenbücher, Hanteln, VHS-Kassetten. Dazu kommt eine moderate Unordnung aus geöffneter Post, Zeitungen, Fernbedienungen und Pullovern, die eine etwas faule Kapitulation vor der mischenden Macht des Lebens zum Ausdruck bringt. Man kann mit fünf Kugeln jonglieren, vielleicht auch mit sieben oder neun, aber nicht mit fünfzig oder siebenhundert. So ungefähr ist das Leben: Ordnung halten unmöglich.
Allerdings hat die Vielfalt der Dinge in dem salonartigen Raum ein mächtiges Zentrum: einen schwarz glänzenden, spielbereit dastehenden Konzertflügel. Sogar der geschwungene Korpusdeckel ist aufgestellt.
Sie legt den Schlüssel auf ein Sideboard und zieht ihre Lederjacke aus. Dabei sieht er, dass nicht nur die Vorderseite ihres T-Shirts Träger einer Botschaft ist, sondern auch die Rückseite: LOVE. Fight und Love – das sind die Eckpunkte ihrer T-Shirt-Philosophie. Nicht gerade seine Welt.
Sie streift die Schuhe ab und steht barfuß auf dem alten Eichenparkett. Ihre Zehen sind im selben dunklen Farbton lackiert wie ihre Fingernägel. Sie bittet ihn, einen Moment zu warten, während sie nach dem versprochenen Mittel gegen Übelkeit sucht. Wahrscheinlich keine leichte Aufgabe hier. Es geht ihm inzwischen wieder etwas besser. Die Übelkeit kommt und geht in Wellen, für den Moment hat sie sich gelegt. Vielleicht ist sie nun endgültig vorüber.
Der Konzertflügel ist ein Bösendorfer. Er betrachtet die Tasten, deren schwarz-weiße Abfolge sich im Hochglanzlack widerspiegelt. Das Nebeneinander der schwarzen und weißen Tasten hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ihren lackierten Zehennägeln. Er setzt sich auf den Hocker und legt seine linke Hand auf die Tasten. Auf dem Notenbrett steht ein englischer Songtext mit ein paar flüchtigen Akkordnotizen: E -7, F# -7, später F# -7 b 5, B 7 b 9.
Er hat eine Zeitlang Klavier gespielt – zuerst mit Unterricht, dann frei improvisierend. Nach den ersten Grandmal-Anfällen in der Pubertät hat er damit aufgehört. Musik kann anfallsauslösend wirken. Das war vor mehr als zwanzig Jahren. Jetzt ist er seit zehn Jahren anfallsfrei. Vielleicht könnte er also wieder Klavier spielen, ohne die neurologische Balance in seinem Gehirn zu gefährden. Er weiß es nicht.
Er hat jahrelang Phenobarbital genommen, zuletzt 280 Milligramm pro Tag, was aber nicht zu einer vollständigen Anfallsfreiheit geführt hat, so dass er zunächst auf eine Zusatztherapie mit 200 mg Zonisamid umgestellt wurde, von dem er aber schläfrig wurde und gelegentlich Schwindelanfälle bekam. Erst die Umstellung auf Topamax, 250 Milligramm täglich, hat ihn bis heute anfallsfrei gemacht.
Er schlägt den ersten Akkord an. Der Flügel ist präzise gestimmt, was beweist, dass er mehr ist als nur ein imposantes Möbelstück. Der Akkord verklingt weich und warm. E-7 – e-g-h-d. Er hat sich nie bemühen müssen, Akkorde und ihre Erweiterungen zu verstehen. Beim Anblick der Klaviertastatur waren ihm die Zusammenhänge zwischen den Tönen vom ersten Moment an mehr oder weniger klar.
Er schlägt den zweiten Akkord an, dann wieder den ersten, beide im Wechsel und immer sehr leise. Mit der rechten Hand improvisiert er ein paar Verzierungen auf der von den beiden Akkorden aufgespannten Tonleiter, e-Moll dorisch. Seine Finger haben nichts vergessen.
Er schließt die Augen. Daher bemerkt er nicht, dass sie zurückkommt und zuhört, anstatt nach dem Medikament gegen sein Unwohlsein zu suchen. Er bemerkt es erst, als sie zu singen beginnt. Oder besser zu hauchen, aber nicht tonlos, sondern entlang einer Melodie, die auch die Melodie in seinem Kopf ist. Raindrops on roses, whiskers on kittens …
Ihre Stimme gleitet präzise durch die Harmonien. Im dunklen Timbre ihres Gesangs schwingt etwas Geheimnisvolles mit, als seien die Töne spontane Verdichtung ihrer Empfindungen. Sie singt auch den zweiten Vers des Songs, doch dann nimmt er die Hände von den Tasten, als habe er kein Recht gehabt zu spielen. Sie lehnt im Türrahmen und sieht ihn neugierig und fragend an. Offenbar ist es ihm mit der Musik gelungen, seinem Anzug- und Aktentaschenimage eine neue und unerwartete Facette hinzuzufügen.
Obwohl der Altersunterschied zwischen ihnen nicht erheblich ist, gehören sie offensichtlich unterschiedlichen Welten an. Und auch wenn er allein dadurch, dass er My Favorite Things auf dem Klavier spielen kann, noch kaum zu einem Teil ihrer FIGHT- und LOVE-Kultur wird, haben sie jetzt eine Gemeinsamkeit.
Sie kommen nicht dazu, über ihr kurzes spontanes Duett zu reden, weil die Wohnungstür geöffnet wird. Sie hebt überrascht ihre Augenbrauen. Er hat schon angenommen, dass sie nicht allein hier wohnt, das ist mehr oder weniger offensichtlich. Und obwohl es natürlich auch eine Frau in ihrem Alter sein könnte, die soeben die Wohnung betritt, sagt ihm sein Gefühl, dass es sich um einen Mann handelt – ihren Freund, mit dem sie zusammenlebt.
Er muss den Kopf ein wenig zur Seite neigen, um am aufgeklappten Korpusdeckel des Konzertflügels vorbei in den Wohnungsflur sehen zu können. Dort stellt sich heraus, dass er mit seiner Annahme im Prinzip richtig liegt. Aber das, was er zu sehen bekommt, birgt dennoch eine Überraschung: Der Mann, der neben ihr auftaucht, ist Mitte bis Ende fünfzig, eher sogar Anfang sechzig. Er trägt eine verwaschene, aber wohl doch sehr teure Jeans, ein hellblaues Pilotenhemd und darüber eine Blouson-Jacke aus weichem fuchsfarbenem Wildleder.
Er küsst sie flüchtig und gewohnheitsmäßig auf die Lippen und sagt: »Hier bist du, Zoe. Ich habe mich gewundert, dass du nicht im Café sitzt. Ich habe ein paar Unterlagen vergessen.«
Zoe heißt sie also. Und der Mann, der vor ihr steht – wenn er nicht ihr Vater ist, wofür dem Kuss nach zu urteilen aber nicht viel spricht –, ist ihr Lebensgefährte. Vorerst hinter dem Klavierdeckel verborgen, betrachtet er ihn. Der Mann ist nicht größer als Zoe, vielleicht sogar ein wenig kleiner. Er wirkt auf eine angenehme und unkomplizierte Weise selbstsicher und arriviert. So, wie er dasteht, mit leicht hängenden Schultern, strahlt er eine gewisse Gelassenheit aus und die Fähigkeit, sich selbst, den Menschen, der er ist, mit Distanz und Ironie zu betrachten. Er lächelt. Seine Haare sind hellgrau und noch voll, so dass er es sich leisten kann, sie etwas länger zu tragen, als es in seinem Alter üblich wäre.
Sie lebt also mit jemandem zusammen, der ungefähr doppelt so alt ist wie sie. Das gibt es. Er hätte es nur nicht erwartet.
Sie sagt: »Du hättest anrufen können.«
Er winkt ab: »Aber nein, nein, das ist lieb von dir.«
»Piet … Ich habe nichts vor.«
»Du sollst nicht unter meiner Zerstreutheit leiden.«
Seine – also Piets – Artikulation ist ein wenig nachlässig oder vernuschelt. Aber da man sich seinem Charme nur schwer entziehen kann, verzeiht man ihm diese Masche, die es zweifellos ist. Man erlässt ihm einen Teil der Mühe des Sprechens und bürdet sich diesen als Mühe des Hörens auf.
»Und außerdem«, fährt Piet fort und richtet seinen Blick dabei auf den Flügel, »hast du gearbeitet. Ich habe vor der Tür ein paar Takte gelauscht. Du hast …«
Piet entdeckt ihn, den Fremden am Klavier. Der Ausdruck seines Gesichts verändert sich nur unmerklich, als wäre ihm die zur Schau gestellte Gelassenheit zur zweiten Natur geworden.
»Oh«, sagt er, »du hast Besuch?«
Zoe sagt: »Nein, oder ja …«
Er nimmt die Situation aus zwei Perspektiven wahr. Einerseits sieht er sich als den Fremden, der kaum ein Recht hat, hier zu sein, und sich ganz den Gepflogenheiten des Hauses und den Regeln der Höflichkeit unterwerfen muss. Doch gleichzeitig fahndet er nach einer Spur von Nervosität in Zoes Verhalten, die er als Beleg dafür werten könnte, dass er als Mann einen Eindruck auf sie gemacht hat, der über den des zufällig in ihrem Leben gestrandeten Hilfsbedürftigen hinausgeht.
»Willst du uns nicht vorstellen, Zoe?«, sagt Piet und behält dabei seine altmodische Art bei, die ohne ein sichtbares Zeichen von Feindschaft ist, als wäre er emotional so pflegeleicht wie ein Golden Retriever. Doch gerade dieses künstliche Gehabe der Harmlosigkeit ist auch beunruhigend. Piets Jovialität könnte ein perfektes Versteck für alle möglichen neurotischen Impulse sein. Ein wenig gedehnt fügt er hinzu: »Ich wusste ja gar nicht, dass du einen neuen … Begleiter hast.«
Zoe, im Ton leicht gereizt, sagt: »Habe ich auch nicht.«
»Raindrops on roses«, sagt Piet so melodiös, dass es auch anzüglich sein könnte, und streicht ihr mit der Hand über die Wange.
Sie wendet sich abrupt um. »Lass das … Wir sind uns vor einer halben Stunde zum ersten Mal begegnet.«
»Und schon ein Duo … Das ging aber schnell …«
»Er ist ein Freund von … Cora.«
»Ach ja?«
Sie funkelt Piet wütend an und lässt ihre Hand unwirsch durch die Salonluft sausen. »Allerdings!«
Piet kommt auf ihn zu. »Na, dann. Freut mich.«
Zoe sagt: »Ich weiß nicht einmal, wie er heißt! Er war im Café und hatte Schwindelgefühle und Übelkeit. Ich habe gesagt, wir hätten Vomex.«
Die Schwindelgefühle sind so erfunden wie seine Freundschaft mit Cora. Wer ist Cora? Wieso sagt Zoe nicht einfach, was geschehen ist? Sie ist unschuldig. Lügt sie Piet häufig an?
Sie verschwindet im Flur. Piet sieht ihr nach. Er hat einen kleinen Bauch, der sich unter dem Stoff des Pilotenhemds leicht über den Bund der Jeans wölbt und unterstreicht, dass sich seine Eitelkeit – und eitel ist er zweifellos – bereits in einer abgeklärten Phase befindet. Er ist sich seiner eigenen positiven Wirkung hinreichend bewusst und weiß, dass ein paar kleinere Unvollkommenheiten dem Erscheinungsbild eines erfolgreichen Mannes in seinem Alter keinen Abbruch tun.
Er streckt Piet die Hand hin. »Entschuldigung, ich wollte hier nichts durcheinanderbringen. Roland Ziegler.«
Normalerweise denkt er bei sechzigjährigen Männern nicht darüber nach, ob sie möglicherweise gutaussehend oder sogar sexuell attraktiv sind, aber jetzt tut er es. Kann er sich vorstellen, dass Zoe neben Piet im Bett liegt? Er wischt den Gedanken fort. Es ist das Beste, in der gegebenen Situation so förmlich wie möglich zu bleiben.
»Waren Sie das am Piano?«, sagt Piet und fügt mit der leicht anzüglichen Nuance, die er offenbar perfekt beherrscht, hinzu: »Zoe hat ein gutes Gespür für ihre Begleiter …«
Er ignoriert die Zweideutigkeit. »Ich komme aus Frankfurt und bin für ein paar Tage beruflich in Berlin.«
»Das hier ist ja mehr oder weniger eine Wohnstraße«, sagt Piet und bringt damit zum Ausdruck, dass es in einem Viertel wie diesem beruflich eigentlich nichts zu tun gibt, es sei denn, man wäre Staubsaugervertreter. »Ich dachte, Sie haben Cora besucht.«
Er will Zoe nicht in den Rücken fallen, auch wenn die Lüge unsinnig ist. »Ich habe noch etwas Zeit bis zu meinem Termin.«
»Hoffentlich erholen Sie sich bald wieder«, sagt Piet.
»Erholen?«
»Von Ihrer Übelkeit. Cora sollte sich ein paar Medikamente in den Tresen legen.«
Wenn er sich das jetzt richtig zusammenreimt, dann ist Cora die Betreiberin des Cafés im Erdgeschoss.
»Es geht schon wieder, danke.«
»Zoe ist immer sehr hilfsbereit«, sagt Piet, und auch das klingt, wie alles, was er sagt, zweideutig.
Zoe taucht wieder aus dem Flur auf, in der Hand tatsächlich eine Schachtel Vomex. Betont nüchtern sagt sie: »Ich bringe Sie zur Tür.«
»Gute Besserung«, sagt Piet und lächelt schmal.
Sein Verhalten bleibt undurchschaubar. Er versteckt sich hinter seiner Art und seinem Gestus. So ist es oft, er selbst nimmt sich da nicht aus. Die meisten Männer verdanken ihren Erfolg der Tatsache, dass niemand weiß, wer sie sind – nicht einmal sie selbst.
Er folgt Zoe in den Flur. Sie öffnet die Wohnungstür und gibt ihm die Vomex. Er bedankt sich und würde diesen Dank gerne mit einer Geste unterstützen. Er fragt sich, ob er ein Signal aussenden kann, um ihr zu verstehen zu geben, dass er sie wiedersehen möchte. Doch es ist schwierig, mehr zu sagen als Danke, weil Piet am Ende des Ganges jedes Wort mithört. Sie verabschieden sich. Zoes Blick ist ein wenig verschleiert. Sie sieht durch ihn hindurch. Die Tür schließt sich. Ihre letzte Botschaft ist: FIGHT.
Als er wieder auf der Straße steht, bricht die Sonne durch die Wolken. Grelle Lichtfelder wechseln sich in kurzen nervösen Abständen mit dem vorherigen Grau ab. Der Asphalt wird getönt durch indirekte Einstrahlungen von da und dort aufleuchtenden Fassaden. Er hält immer noch die Medikamentenschachtel in der Hand. Als er sie endlich einstecken will, sieht er, dass eine Nummer darauf notiert ist – eine Telefonnummer mit einer Mobilfunkvorwahl. Zoe hat gekämpft.
ZWEI
ETWA FÜNFZIG METER von dem Café entfernt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, liegt das ehemalige Verwaltungsgebäude der Ziegler-Elektro-AG. Es ist ein breiter, dreistöckiger dunkelroter Backsteinbau, ein recht typisches Bürogebäude aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Ein paar Stellen des Mauerwerks sind mit silbernen Graffiti-Zeichen besprüht. Die Fenster sind modernisiert worden. Er ist noch nie hier gewesen, und das Gebäude ist auch nicht mehr im Besitz der Familie.
Aber er kennt das Eingangsportal von alten Schwarzweißfotos, die es sowohl im Firmenarchiv gibt als auch in den privaten Fotoalben seiner Großmutter. Das Gebäude hat sich in den vergangenen sechzig Jahren nicht wesentlich verändert. Es gehört jetzt der Stadt Berlin, in den achtziger Jahren ist eine Berufsfachschule eingezogen. Vor dem Eingang ist eine Bushaltestelle. Wahrscheinlich hat man sie für die Schüler eingerichtet.
Nichts, kein Hinweis an der Fassade, kein altes Emblem an der Eingangstür, erinnert mehr daran, dass die Räume, in denen jetzt unterrichtet wird, einmal der Sitz einer elektrotechnischen Firma gewesen sind, die sein Großvater, Hermann Ziegler, 1931 im Alter von siebenundzwanzig Jahren unter dem Namen Ziegler Spulen- und Ankerwickelei gegründet hat.
Sein Großvater muss ein umtriebiger junger Ingenieur und Unternehmer gewesen sein. Die Spulenproduktion war damals ein florierender Wirtschaftszweig. Eine Spule ist als elektrotechnisches Bauteil für sich genommen so universell wie ein Nagel oder ein Knopf. Dadurch konnte die Ziegler-Elektro-AG, wie die Firma ab 1936 hieß, allen technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der dreißiger und vierziger Jahre gerecht werden. Spulen kommen in Radioempfängern und Lautsprechern zum Einsatz, in Türklingeln, Fahrraddynamos, Transformatoren, Elektromotoren, Funkgeräten und Bombenzündern.
Das Verwaltungsgebäude, vor dessen Eingangsportal er steht, während ein Bus die Haltestelle anfährt und wieder verlässt, ist 1938 fertig gestellt worden, also relativ kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Die Kriegsvorbereitungen Hitlers hatten begonnen. Aus einem Stapel von Direktiven und Anordnungen, die im Firmenarchiv dokumentiert sind, geht hervor, dass die Ziegler-Elektro-AG im Verlauf der Jahre 1939 und 1940 rechtlich und organisatorisch in die Kriegswirtschaft des nationalsozialistischen Staats eingebunden worden ist. Der Schriftverkehr mit ausländischen Kunden wurde unter Zensur gestellt. Es durften keine Lizenzen mehr vergeben werden, und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften waren nur noch in begrenztem Umfang möglich. Entwicklungs- und Produktionsziele haben sich nicht mehr nach dem Bedarf ziviler Auftragseingänge gerichtet, sondern wurden durch Anordnungen aus dem Reichskriegsministerium und vom Oberkommando der Wehrmacht gesteuert.
Er weiß wenig über diese Zeit. Als Enkel ist er inzwischen im Vorstand der Firma seines Großvaters, aber die Geschichte eines Unternehmens ist für dessen Zukunft nicht von Bedeutung. Eine der Auswirkungen, die der Zweite Weltkrieg für die Firma gehabt hat, ist die, dass ihr Sitz nicht mehr in Berlin ist, sondern in Frankfurt am Main.
Kurz vor der Einkesselung Berlins durch russische und polnische Truppen im April 1945 ließ sein Großvater Teile des Firmenarchivs nach Hessen verlagern – den Unterlagen nach eine heikle Operation, da die Transportkapazitäten beschränkt waren. Die Personalakten und der Schriftverkehr mit dem Reichssicherheitshauptamt, den örtlichen Führern der Gestapo oder der Leitung des Zwangsarbeiterlagers blieben in Berlin. Aber die technischen Unterlagen, die Konstruktionszeichnungen, Spezifikationen und Verfahrensanweisungen wurden vor dem Zugriff der anrückenden Roten Armee in Sicherheit gebracht. Das Ende des Zweiten Weltkriegs war nur noch eine Frage der Zeit, und sein Großvater wollte die Produktion danach möglichst rasch wieder aufnehmen. Mit einundvierzig Jahren hatte er noch nicht vor, sich zur Ruhe zu setzen.
Im Gegensatz zu den Produktionsstätten der Ziegler-Elektro-AG ist das Verwaltungsgebäude im Krieg nur unerheblich beschädigt worden. Das Eingangsfoyer ist dunkel, nachdem sich die Tür hinter ihm geschlossen hat. Die Korridore liegen im grauen Neonlicht da. Es riecht nach Reinigungsmitteln, der übliche unpersönliche Geruch von öffentlichen Gebäuden. Da im Moment unterrichtet wird, ist es still auf den Gängen. Er steht nur da. Es ist sonderbar mit der Vergangenheit: Sie erhält ihre Macht nur, wenn man sie kennt – wenn man sie nicht kennt, ist sie nichts. Das Einzige, was er empfindet, ist das deutliche Gefühl, nicht in dieses Haus zu gehören. Er gehört nicht in die Gegenwart dieses Gebäudes und auch nicht in seine Vergangenheit.
Die Option, mit der Firma an den ursprünglichen Firmensitz zurückzukehren, hat sein Großvater erst zu Beginn der achtziger Jahre endgültig aufgegeben. Damals hatte er sich schon aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, aber als Patriarch hatte er immer noch eine Menge Einfluss. Doch schließlich hat er den Glauben daran verloren, das Ende der Teilung Berlins und den ökonomischen Wiederaufstieg der Stadt noch zu erleben. Er verkaufte das Verwaltungsgebäude an West-Berlin.
Er hat sich schon seit langem vorgenommen, das ehemalige Verwaltungsgebäude einmal zu besuchen, aber jetzt, da er sich umsieht, weiß er eigentlich nicht, was er hier soll. Er ist hergekommen, wie man das Grab von Angehörigen besucht. Man denkt, man sollte es tun, ohne zu wissen, wem damit eigentlich gedient ist.
Solange der Neubau des Bundeskanzleramts in der Nähe des Reichstags noch nicht fertig ist, wird das ehemalige Staatsratsgebäude der DDR als Berliner Dienstsitz des Bundeskanzlers genutzt. Es liegt an einem leeren Asphaltplatz, auf dem einst das Berliner Stadtschloss der Hohenzollern stand. Das Schloss wurde 1950 auf Anordnung der Führung der DDR gesprengt. Die sozialistischen Machthaber betrachteten es als Symbol einer absolutistischen Gesellschaftsordnung und des preußischen Militarismus. Offenbar glaubten sie daran, durch die Sprengung eines Gebäudes die Welt verbessern zu können. Er glaubt das nicht. Einen zehn Meter breiten Teil aus der Schlossfassade hat man bei der Sprengung verschont, weil auf dem Balkon des Portals Karl Liebknecht im November 1918 die sozialistische Republik ausgerufen hat. Das Portal mit dem Balkon hat man in das Staatsratsgebäude integriert.
Vor diesem Portal steigt er aus dem Taxi. Im Sicherheitsbereich des Foyers überprüft man seine Personalien. Er legt den Inhalt seiner Taschen in eine Schale zum Durchleuchten. Dann geht er durch das Geistertor des Metalldetektors, hinter dem die Welt exakt die gleiche und doch eine andere ist, eine gesicherte und gefahrlose – vorausgesetzt, das System funktioniert.
Ein Sicherheitsbeamter führt ihn in den ersten Stock in einen großen Raum mit dunkelblauem Teppichboden und einer breiten Fensterfront. Rechts bilden vier Tische ein Podium, wie man es von Pressekonferenzen kennt. Schilder informieren die Anwesenden, dass vor den Mikrofonen Bundeskanzler Schröder und Graf Lambsdorff, Schröders Sonderbeauftragter für die Entschädigung von NS-Zwangs-und Sklavenarbeitern, Daimler-Benz-Vorstandsmitglied Manfred Gentz für die deutsche Wirtschaft und der von Bill Clinton eingesetzte US-Unterhändler Stuart Eizenstat Platz nehmen werden.
Obwohl das Ende des Zweiten Weltkriegs über ein halbes Jahrhundert zurückliegt, ist die Entschädigung der ehemaligen Zwangsarbeiter des nationalsozialistischen Regimes eine offene außenpolitische Frage. Eine Reihe von deutschen Großunternehmen ist in den USA von ehemaligen NS-Zwangsarbeitern – niemand weiß, wie viele von ihnen noch am Leben sind – auf Schadenersatz verklagt worden. Tatsächlich sind mehr oder weniger alle deutschen Großunternehmen im zurückliegenden Jahr in diesem Zusammenhang verklagt worden: Volkswagen, Siemens, Allianz, Daimler-Benz, Thyssen-Krupp, Henkel, die Deutsche Bank, die Lufthansa.
Das Thema ist juristisch komplex. Seit dem Ersten Weltkrieg gelten Zwangsarbeit und Deportation als völkerrechtswidrig und begründen reparationsrechtliche Ansprüche. Eine reparationsrechtliche Schlussregelung sollte Gegenstand eines Friedensvertrags sein, den es für den Zweiten Weltkrieg bis heute aber nicht gibt. Völkerrechtlich hat sich inzwischen die Position durchgesetzt, dass der 1990 abgeschlossene Zwei-plus-Vier-Vertrag zur Wiedervereinigung Deutschlands eine friedensvertragliche Bedeutung hat, in dem aber keine reparationsrechtlichen Ansprüche verhandelt worden sind. Sie standen nicht mehr auf der weltpolitischen Tagesordnung, was letztlich bedeutet: Mit der Generation der Täter und Opfer verschwinden auch die verhandelbaren Tatbestände, weil weder moralische Schuld noch persönliches Leid vererbbar sind.
Der Konferenzraum bietet etwa achtzig Teilnehmern Platz. Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich um Männer, als wären sowohl das begangene Unrecht als auch seine Wiedergutmachung Männersache.
Sein Platz ist am Rand einer der vorderen Stuhlreihen. Als Schröder, Lambsdorff, Gentz und Eizenstat den Saal betreten, nehmen alle ihre Plätze ein. Die Ruhe, die danach eintritt, ist angespannt. Die Entschädigung der ehemaligen Zwangsarbeiter wird Geld kosten, und die Anwesenden als Vertreter der deutschen Industrie sollen es aufbringen. Nur deswegen sind sie eingeladen worden: um für etwas zu bezahlen, das geschehen ist, als sie noch nicht geboren oder höchstens Kinder waren.
Schröder sieht tatkräftig aus. Er wirkt smart, konzentriert, eloquent, männlich. Er bewegt sich auf einem Terrain, das ihm zumindest formal vertraut ist: Er ist Jurist. Wahrscheinlich sind alle, die hier im Raum sind, Juristen. Deswegen wissen sie, dass die Entschädigungsklagen der ehemaligen Zwangsarbeiter in den Vereinigten Staaten auf wackligen Beinen stehen. Die meisten dieser Klagen werden vermutlich wegen Unzulässigkeit abgewiesen werden wie die gegen Siemens und die Degussa in New Jersey vor einem Monat.
Aber gleichzeitig ist klar, dass der Imageschaden für die deutsche Industrie in den USA beträchtlich wäre, wenn man den wenigen noch lebenden Zwangsarbeitern in großen öffentlichen Prozessen jede finanzielle Wiedergutmachung verweigern würde. Daimler-Benz hat vor einem Jahr Chrysler übernommen, die Deutsche Bank will Bankers-Trust kaufen, und VW bringt gerade den New Beetle auf den amerikanischen Markt. Da macht es sich nicht besonders gut, wenn in den Vereinigten Staaten öffentlich die Tatsache diskutiert wird, dass deutsche Autos einmal mit jüdischen Zwangsarbeitern gebaut worden sind, dass die Degussa in ihrem Frankfurter Werk Zahngold aus den Konzentrationslagern in Goldbarren für die Reichsbank umgeschmolzen hat und dass die Deutsche Bank durch die sogenannte Arisierung gestohlenen jüdischen Vermögens reich geworden ist.
Schröder eröffnet die Konferenz mit ein paar einleitenden Bemerkungen und übergibt das Wort dann an den amerikanischen Unterhändler Stuart Eizenstat, die Stimme Bill Clintons in diesem Raum. Eizenstat unterbricht seine Rede regelmäßig, um sie von einer Dolmetscherin, die neben ihm sitzt, ins Deutsche übersetzen zu lassen. Sie gibt seine Worte mit einer neutralen unbewegten Stimme wieder, weil sie falsche Betonungen und Akzentuierungen vermeiden möchte.
»Lassen Sie mich zuerst über das reden, was vor mehr als fünfzig Jahren vorgefallen ist. Nazideutschland hat während des Zweiten Weltkrieges etwa zehn Millionen Menschen zur Zwangsarbeit in den Fabriken der Rüstungsindustrie, in der Landwirtschaft und beim Straßenbau genötigt. Manche von ihnen wurden nach der Besetzung ihrer Heimat durch die Wehrmacht deportiert, andere wurden in ihrem eigenen Land zwangsweise umgesiedelt, um für deutsche Firmen in den besetzten Territorien zu arbeiten. Diese massive, nach Umfang und Zweck historisch beispiellose Aushebung von Arbeitskräften setzte arbeitsfähige deutsche Männer für den Kampf mit der Waffe frei und hielt zugleich die NS-Rüstungswirtschaft am Laufen. Viele deutsche Firmen und Konzerne haben damals Gewinne geschrieben und sich eine Marktposition geschaffen, die ihnen bis heute geblieben ist. Die Zwangsarbeiter dagegen haben höchstens einen minimalen Lohn erhalten – wenn überhaupt. Die Bedingungen, unter denen sie zur Arbeit gezwungen wurden, waren dabei unterschiedlich. Das Spektrum reicht von relativ erträglich geregelter Arbeit auf dem Land oder in kleineren Unternehmen bis hin zu gezielter und auch im Nazijargon offiziell so genannter Vernichtung durch Arbeit. Den wenigen, die überlebt haben, ist nach dem Krieg nie eine Entschädigung für das erlittene Unrecht oder auch nur für die geleistete Arbeit zugesprochen worden. Mir ist natürlich bewusst, dass man dieses Unrecht nach mehr als fünfzig Jahren nicht mehr aus der Welt schaffen kann. Die Zahl derer, die heute noch leben, liegt bei etwa zweihunderttausend, und es werden täglich weniger. Das Einzige, was heute noch getan werden kann, ist, deren Leiden im nachhinein anzuerkennen und sich moralisch zur Verantwortung für das im deutschen Namen begangene Unrecht zu bekennen. Es ist nicht möglich, Gerechtigkeit zu schaffen, jede Gerechtigkeit wird notwendigerweise unvollkommen bleiben. Es fällt mir schwer, das hinzunehmen, aber gerade deswegen können und dürfen wir die Dimension der Verbrechen nicht ignorieren. Eines der grausigsten Dokumente, das ich jemals zu Gesicht bekommen habe, war eine Denkschrift der SS mit Schätzungen zu den Gewinnen, die sich aus Arbeitssklaven ziehen ließen. Darin hat die SS bei einer angenommenen Überlebensdauer des durchschnittlichen Arbeitssklavens von neun Monaten aus jeder Arbeitskraft einen Gewinn von 1431 Reichsmark errechnet. Hinzugekommen ist noch, was die SS Erträge aus der sinnvollen Verwertung der Leichen nannte – Zahngold, Kleidung, Wertsachen und Bargeld. Als Gesamtgewinn aus jedem durch Arbeit vernichteten Menschen haben sich nach dieser Rechnung 1631 Reichsmark ergeben, wobei die SS auch die Erträge aus der Verwertung von Knochen und Asche hinzugerechnet hat. Ich denke, Sie sollten dieser ungeheuerlichen menschenverachtenden Rechnung etwas entgegensetzen, solange dies noch möglich ist.«
Nach dieser Rede tritt Schweigen ein. Ist das, was Eizenstat fordert, überhaupt möglich? Kann man einer solchen Rechnung etwas entgegensetzen? Die Ökonomie verwandelt Menschen in Zahlen. Vielleicht ist jede Ökonomie auf ihre Weise unmenschlich. Aber man sieht es erst, wenn jedes Maß verloren geht. Wenn auch der letzte Vorhang der Humanität fällt.
Den, der sich schließlich erhebt, kennt er persönlich, er duzt ihn sogar. Es ist Kurt Weyse, Justitiar eines Import-Unternehmens für Buntmetalle, mit dem die Ziegler Group zusammenarbeitet. Kurt ist ein blonder, eloquenter, etwas langweiliger Riese. Auf einmal denkt er: ein Germane.
»Das ist alles unerträglich«, sagt Kurt mit seiner überraschend hohen, etwas gepressten Stimme, »und ich möchte betonen, dass es mich absolut nicht kaltlässt, was vor mehr als fünfzig Jahren in diesem Land geschehen ist. Aber als Vertreter einer Generation, die in den frühen sechziger Jahren geboren wurde, frage ich mich doch, warum wir gerade jetzt hier zusammenkommen und darüber reden.«
»Vielleicht weil vorher niemand darüber geredet hat?«, sagt Schröder und hebt dabei seine markanten Augenbrauen.
»Bei allem Respekt, Herr Bundeskanzler. Ich bin mir der nationalsozialistischen Verbrechen absolut bewusst, und ich habe nicht den Eindruck, dass es bei irgendjemand, der hierzulande auch nur einen Funken Verstand hat, anders ist. Ignoranz und Verdrängung kann ich bei diesem Thema absolut nicht erkennen.«
»Das sehe ich nicht so«, entgegnet ihm Schröder. »Die Zwangsarbeiterproblematik hat in der Diskussion der deutschen Vergangenheit bisher nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Da gibt es definitiv Nachholbedarf.«
»Mag sein, aber was hat das mit uns zu tun? Seien wir ehrlich: Wir wissen doch alle, weswegen wir hier sind: Weil in den USA ein paar gewiefte Anwälte herausgefunden haben, dass es jetzt noch ein paar überlebende Opfer des Naziregimes gibt und in ein paar Jahren nicht mehr und dass jetzt also die letzte Gelegenheit ist, aus dieser Sache etwas herauszuholen. Es geht mir absolut nicht darum, die nationalsozialistischen Verbrechen kleinzureden, aber das, was im Moment vor amerikanischen Gerichten läuft, ist nichts anderes als ein äußerst durchsichtiges Erpressungsmanöver.«
Schröder wiegt den Kopf hin und her. Ganz Politiker und Bundeskanzler, bleibt er gelassen. »Natürlich habe auch ich Sorge, dass unsere Initiative angesichts der unrealistischen finanziellen Forderungen seitens der Klägeranwälte und der offenen Fragen zur Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen vor US-amerikanischen Gerichten noch scheitern könnte. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass wir dieses wohl letzte offene Kapitel der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in diesem Jahrhundert zum Abschluss bringen sollten. Das ist unsere historische Pflicht.«
»Und das heißt: Entweder wir zahlen zehn Milliarden – ich bitte Sie: zehn Milliarden«, wiederholt Weyse noch einmal mit besonders dramatischer Betonung, »oder unsere Geschäfte werden uns in den USA durch verleumderische Klagen und die zwangsläufig folgende negative Medienkampagne unmöglich gemacht. Die Umsatzzahlen würden einbrechen und die deutsche Industrie massiv geschwächt. Wenn das keine Erpressung ist, was dann?«
Die Stimmung im Saal ist gespannt. Er betrachtet abwechselnd Kurt Weyse und den Bundeskanzler. Ganz offensichtlich spricht Kurt das aus, was viele der anwesenden Vertreter der deutschen Industrie denken. Niemand protestiert.
»Nein, es ist keine Erpressung«, sagt er.
Alle Gesichter wenden sich ihm zu. Auch der Bundeskanzler wendet sich ihm zu, mit einem überraschten, aber wohlwollenden Ausdruck in den Augen. Offenbar ist er froh darüber, dass ihm jemand aus dem Plenum beispringt, so dass er die ganze Überzeugungsarbeit nicht selbst leisten muss.
»Sie halten die Forderungen für berechtigt, Herr …?«
»Roland Ziegler«, stellt er sich heute Morgen zum zweiten Mal förmlich vor – zuerst Piet und nun Gerhard Schröder. Die beiden dürften ungefähr im gleichen Alter sein. »Ich spreche für den Vorstand der Ziegler Group«, fährt er fort und wendet sich an Kurt Weyse. »Kurt, ich kann durchaus eine Form von Erpressung erkennen. Aber es sind nicht wir, die erpresst werden.«
»Ach nein?«, sagt Kurt und setzt sich.
»Nein, nicht wir werden von den Zwangsarbeitern erpresst, sondern wir erpressen die Zwangsarbeiter.«
»Wie bitte?« Kurt ist überrascht und wohl auch empört.
»Du hast es gehört: Die SS hat den Wert eines Menschenlebens berechnet, und jetzt tun wir es. Es geht um Geld, damals wie heute. Wir berechnen, welchen Betrag man für jeden noch lebenden Zwangsarbeiter aufbringen muss und wie viel dabei in der Summe herauskommt. Sie, Herr Bundeskanzler, bieten zur Zeit acht Milliarden, Sie, Herr Eizenstat, wollen, soweit mir bekannt ist, zehn. Der Wert der Toten wird von uns berechnet, um die noch Lebenden für ihre Leiden zu entschädigen. Ist es ein Unterschied, dass die Rechnung aus Empörung und dem Willen zur Wiedergutmachung aufgemacht wird und nicht aus Kaltblütigkeit und Menschenverachtung wie bei der SS? So muss man es wohl sehen.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«, sagt Schröder. Er ist misstrauisch geworden, sogar wachsam.
»Ich will auf Folgendes hinaus: Wir machen uns nicht schuldig, aber wir haben eine klare Forderung gegenüber den Klägern. Wenn wir zahlen, dann muss hinterher Ruhe herrschen. Wir wollen unsere dunkle Vergangenheit ein für alle Mal begraben. Wir wollen das Buch der nationalsozialistischen Geschichte schließen. Das letzte Kapitel, wie Sie, Herr Bundeskanzler, sagen, soll jetzt geschrieben werden, damit wir das Buch zuschlagen und ins Regal stellen können. Danach soll niemand mehr daran rühren, weder die Täter noch die Opfer. Das ist es, was wir verlangen, und darin liegt die eigentliche Erpressung: Wir sagen zu den Opfern, ihr bekommt das Geld nur, wenn ihr ab jetzt für immer schweigt. Und wenn ihr dazu nicht bereit seit, dann bekommt ihr keinen Pfennig. Das ist der Punkt. Wir sitzen am längeren Hebel. Wir haben das Geld, die Überlebenden haben nichts. Wir sollten zahlen. Wir müssen zahlen.«
Während er redet, kehrt die Übelkeit zurück. Er spürt sie aufsteigen wie eine Welle, der er nicht entkommen kann und die ihn mit sich reißen wird. Ohne eine Entgegnung abzuwarten, verlässt er seinen Platz und wendet sich zur Tür. Zum Glück braucht er, da er auf der Türseite sitzt, nicht quer durch den Saal zu gehen. Er spürt die fragenden, verärgerten, abweisenden Blicke, die ihm folgen. Aber er hat keine Wahl. Er verlässt den Saal und wendet sich, ohne den auf dem Gang postierten Sicherheitsbeamten zu beachten, zum WC, dessen Eingang er vor der Konferenz im Vorbeigehen gesehen hat. Er schließt sich in eine der Kabinen ein, beugt sich über die Toilettenschüssel und übergibt sich. Er erbricht das Frühstück, und als sein Magen leer ist, erbricht er grünliche Gallenflüssigkeit.
Er riecht die saure Ausdünstung des Erbrochenen in seinem Mund und hört seinen schweren Atem, akustisch gespiegelt von den kühlen weißen Kacheln. Sein Bauch und sein Rachen schmerzen. Er rührt sich nicht. Er hofft, dass sich sein Zustand nach dem Erbrechen bessert. Dass sich sein Magen beruhigt und alles vorbei ist. Aber das tritt nicht ein.
DREI
DAS HITLER-PORTRAIT auf der aktuellen Spiegel-Ausgabe hat ihn an eine Sammlung von Gesetzesblättern der nationalsozialistischen Reichsregierung erinnert, die er sich einmal während seines Jurastudiums in der Universitätsbibliothek hat kommen lassen. Unter den losen einzelnen Seiten befand sich unter anderem das Reichsgesetzblatt Nr. 86 vom 25. Juli 1933 mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Der Text auf dem vergilbten Papier war in Frakturlettern gesetzt. In Paragraph eins hieß es: »Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht (sterilisiert) werden.« Dann wurde der Begriff erbkrank