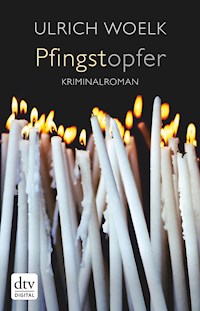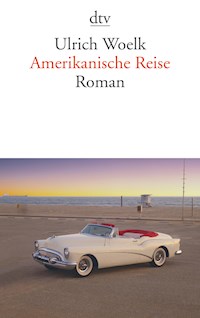8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 1969. Während auf den Straßen gegen den Vietnamkrieg protestiert wird, fiebert der elfjährige Tobias am Stadtrand von Köln der ersten Mondlandung entgegen. Zugleich trübt sich die harmonische Ehe seiner Eltern ein. Seine Mutter fühlt sich eingeengt, und als im Nachbarhaus ein linkes, engagiertes Ehepaar einzieht, beschleunigen sich die Dinge.
Tobias, eher konservative Eltern freunden sich mit den neuen Nachbarn an, und deren dreizehnjährige Tochter, Rosa, eigenwillig und klug, bringt ihm nicht nur Popmusik und Literatur bei, sondern auch Berührungen und Gefühle, die fast so spannend sind wie die Raumfahrt. Auch die Eltern der beiden verbringen viel Zeit miteinander, zwischen den Paaren entwickelt sich eine wechselseitige Anziehung - "Wahlverwandtschaften" am Rhein. Und während Armstrong und Aldrin sich auf das Betreten des Mondes vorbereiten, erleben Tobias und seine Mutter beide eine erotische Initiation…
Ulrich Woelk erzählt spannend, atmosphärisch dicht und herzzerreißend von einem Aufbruch, persönlich und politisch, der tragisch endet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ulrich Woelk
Der Sommer meiner Mutter
Roman
Über das Buch
Sommer 1969. Während auf den Straßen gegen den Vietnamkrieg protestiert wird, fiebert der elfjährige Tobias am Stadtrand von Köln der ersten Mondlandung entgegen. Zugleich trübt sich die harmonische Ehe seiner Eltern ein. Seine Mutter fühlt sich eingeengt, und als im Nachbarhaus ein linkes, engagiertes Ehepaar einzieht, beschleunigen sich die Dinge.
Tobias, eher konservative Eltern freunden sich mit den neuen Nachbarn an, und deren dreizehnjährige Tochter, Rosa, eigenwillig und klug, bringt ihm nicht nur Popmusik und Literatur bei, sondern auch Berührungen und Gefühle, die fast so spannend sind wie die Raumfahrt. Auch die Eltern der beiden verbringen viel Zeit miteinander, zwischen den Paaren entwickelt sich eine wechselseitige Anziehung - «Wahlverwandtschaften» am Rhein. Und während Armstrong und Aldrin sich auf das Betreten des Mondes vorbereiten, erleben Tobias und seine Mutter beide eine erotische Initiation …
Ulrich Woelk erzählt spannend, atmosphärisch dicht und herzzerreißend von einem Aufbruch, persönlich und politisch, der tragisch endet.
Über den Autor
Ulrich Woelk, geboren 1960, studierte Physik und Philosophie in Tübingen. Sein erster Roman, «Freigang», erschien 1990 und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Woelk lebt als freier Schriftsteller und Dramatiker in Berlin. Seine Romane und Erzählungen sind unter anderem ins Englische, Französische, Chinesische und Polnische übersetzt.
Inhalt
1: Am Stadtrand
2: Neue Nachbarn
3: Rosa
4: Housewarming
5: Light My Fire
6: Der Geburtstag meiner Mutter
7: Apollo 10
8: Krocket
9: Make love, not war
10: Mädchen sind so
11: Apollo 11
12: Nach der Landung
13: Rosetta
Fly me to the moon,
Let me play among the stars.
Let me see what spring is like
On Jupiter and Mars.
In other words, hold my hand.
In other words, darling, kiss me.
Bart Howard, gesungen u.a. von Doris Day
1
Am Stadtrand
Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben.
Wir wohnten in einem Ort am Stadtrand von Köln, dessen einst dörfliche, landwirtschaftlich geprägte Struktur damals noch erkennbar war. Um eine kleine romanische Kirche und eine neuere, größere aus Backstein scharten sich zum Rhein hin sieben oder acht enge Gassen mit niedrigen Fachwerkhäusern. Manchmal, wenn der Wind von Westen oder Südwesten wehte, konnte ich in meinem Zimmer die Kähne auf dem Rhein tuckern hören. Dem Flussbett vorgelagert waren zwei schmale Weiher mit unbefestigten Ufern, die sich aus alten Rheinarmen gebildet hatten und im Frühjahr regelmäßig überschwemmt wurden.
In der etwas höheren Ebene, die das Dorf umgab, lagen ein paar Höfe. Im Sommer leuchteten die weiten Felder hellgelb von dem angebauten Getreide. In den Fünfzigerjahren hatte man damit begonnen, die Wege zwischen den Feldern zu verbreitern und die Äcker zu Bauland zu erklären. Sie wurden parzelliert und mit Einfamilienhäusern bebaut. Unseres stammte aus dem Jahr 1964. Es war ein modernes Haus mit angebauter Doppelgarage und einer großen Panorama-Fensterfront zum Garten.
Mein Vater war Ingenieur und hatte ganz auf die neueste Bautechnik gesetzt: große, helle Fenster aus Doppelglas, weiße Schleiflacktüren, grau lackierte Metallzargen und ein vierzig oder fünfzig Zentimeter tiefer Konvektorschacht vor der Glasfront zur Terrasse, der mit begehbaren Messinggittern abgedeckt war.
Es gefiel meinem Vater in den ersten Jahren, die wir dort wohnten, zu Besuch gekommenen Freunden und Gästen die Wirkungsweise des Schachts zu erklären. Der unter den Boden abgesenkte Heizkörper gewährleistete eine optimale Wärmezirkulation im Raum und löste das Problem der Fußkälte durch große Fensterflächen, ohne dabei den Blick in den Garten zu verstellen.
Auch die Küche entsprach den neuesten Standards. Die kratzfeste Arbeitsfläche aus hellblauem Kunststoff wurde von langen Neonröhren unter den Hängeschränken beleuchtet. Und wenn meine Mutter kochte, rauschte über den Töpfen stets die Metallfilter-Abzugshaube mit zusätzlicher UV-Dunstreinigung. Ich fand das bläuliche Schimmern, das von ihr ausging, immer sehr geheimnisvoll, weil ich nicht wusste, wozu es gut war. Wenn meine Mutter kochte, war es immer, als agiere sie in einem Cockpit.
Alles in allem war unser Leben mit Waschbetonterrasse, Zentralheizung und Doppelgaragenanbau wie der Einzug einer neuen Zeit in die Welt der katholischen Bauern mit ihren nach Kuhmist riechenden Höfen, den Weizenfeldern und den verwitterten Holzscheunen, in denen sich im Herbst die Strohballen stapelten.
Wir waren Vorreiter, und am deutlichsten war das beim Einkaufen zu spüren. Was es im Dorf gab, reichte aus, um die elementaren Bedürfnisse zu befriedigen. Brot kauften wir beim Bäcker, Fleisch in der Metzgerei. Für Papier und Schreibzeug gab es einen Gemischtwarenladen, und irgendwann siedelte sich sogar ein Elektrogeschäft mit Toastern und Wasserkochern an. Aber für alles, was darüber hinausging, mussten wir «in die Stadt» fahren, wie wir dann sagten. So war es zum Beispiel völlig unmöglich, im Dorf eine Jeans zu kaufen, aber zu meinem elften Geburtstag im März 1969 bestand ich darauf, eine zu bekommen.
Was Kleidung anging, waren meine Eltern nicht so modern. Meine Mutter trug im Alltag sandfarbene Wollröcke und gestärkte helle Blusen. Für besondere Anlässe wie Einladungen oder Behördengänge hatte sie Jackenkleider in gedeckten Farben, Rosa oder Hellgrün. Gegen den Wind schützte sie die gefestigten Wellen ihrer toupierten Frisur mit seidenen Kopftüchern, und bei Regen trug sie einige Jahre lang ein glänzendes, violettes Nyloncape.
Auch für mich hatte sie immer alle Sachen ausgesucht. Im Sommer trug ich karierte Hemden und kurze Hosen, im Winter Nickis und Stoffhosen mit Bügelfalte. Bei festlichen Gelegenheiten band sie mir eine schmale Krawatte mit Gummizug um. Ich hatte mir nie Gedanken über meine Kleidung gemacht, und es war auch für mich neu, eine ganz bestimmte Hose haben zu wollen. Nie zuvor war ich auf die Idee gekommen, mir zum Geburtstag etwas zum Anziehen zu wünschen. Meine Mutter hatte aber nichts dagegen, dass ich eine Jeans bekam. Also mussten wir «in die Stadt».
In der Schule hatte sich herumgesprochen, dass in der Nähe des Kölner Doms ein Laden aufgemacht hatte, der ausschließlich amerikanische Bluejeans führte und sich auch nicht Laden, sondern Store nannte, was ich noch nie gehört hatte. Auf jeden Fall musste jeder, der in meiner Klasse etwas auf sich hielt, in den Besitz einer Jeans aus diesem Store kommen.
«In die Stadt» fuhren wir immer mit der Straßenbahn. Sie zwängte sich durch die Vororte und stand oft im Stau. Ich vertrieb mir dann die Zeit damit, die großen Werbeplakate an den Straßenrändern und Haltestellen zu betrachten. Am liebsten mochte ich die Zigarettenreklamen, besonders die für Camel-Filter und das HB-Männchen.
Als wir den Store betraten, war ich überwältigt. Es war, als öffnete sich vor mir eine neue Welt. Die Bekleidungsgeschäfte, in denen ich bisher meine Hemden, Hosen und Pullover bekommen hatte, waren sehr eng gewesen. Die Kleidungsstücke wurden aus Pappschachteln genommen und lustlos vor einem ausgebreitet. Beim zweiten oder spätestens dritten Modell musste man sich dann entscheiden.
Wie anders hier! Anstatt von einer strengen Verkäuferin hinter einem Tresen zu dem gewünschten Kleidungsstück und der Konfektionsgröße befragt zu werden, konnte man sich in dem großen, hellen Verkaufsraum frei bewegen. In meterlangen Regalen stapelten sich Jeans in allen nur denkbaren Größen und Schnitten, und vor den Umkleidekabinen mit schwenkbaren Saloontüren herrschte ein aufgeregtes Gewusel.
Auch meine Mutter wirkte sichtlich überrascht. Ich spürte aber auch, dass ihr Staunen mit Skepsis vermischt war, weil sie nicht wusste, wie man sich in dem riesigen Angebot von Hosen zurechtfinden sollte. Sie stand einen Moment lang ratlos da, bis die Chefin oder Chefverkäuferin lächelnd auf uns zukam und uns das Ordnungssystem in den Regalen erklärte. Die Hosen waren nicht nach Konfektionsgrößen, sondern nach Umfang und Länge sortiert. Außerdem standen verschiedene Marken und Schnitte zur Auswahl, entweder mit geradem Bein oder unterhalb des Knies ausgestellt, wie es jetzt Mode sei, sagte sie.
Wir suchten uns ein paar Hosen zusammen und warteten, bis eine der Umkleidekabinen frei wurde. Ich zwängte mich nacheinander in die Jeans. Ich hatte gehört, sie müssten so eng sitzen, als seien sie am Körper getrocknet. Als Marken standen Wrangler und Levi’s zur Auswahl. Die Meinungen darüber, welche von beiden man haben musste, gingen auseinander. Ältere Geschwisterkinder meiner Freunde verbanden bestimmte Jeans mit englischen Sängern oder Bands, aber diese Musik hörten wir noch nicht. Ich zog mal eine Wrangler an, mal eine Levi’s. Ich fand es gar nicht so leicht, sie voneinander zu unterscheiden.
Immer wieder verließ ich die Kabine, um mich in einem der großen Spiegel zu betrachten. Einmal fiel mein Blick dabei auf meine Mutter. Sie stand ein paar Meter von mir entfernt vor einem Regal und dachte über irgendetwas nach. Ich fragte mich, worüber, denn die Hosen dort waren für mich zu groß. Schließlich zog sie eine Jeans aus dem Stapel und kam auf mich zu.
«Was meinst du?», sagte sie. «Ich könnte ja auch einmal eine ausprobieren.»
Ihre Frage verwirrte mich. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir noch nie Gedanken über die Kleidung meiner Mutter gemacht. Ich hatte mir ja noch nicht einmal Gedanken über meine eigene Kleidung gemacht. Noch vor wenigen Monaten hatte ich widerspruchslos alles getragen, was meine Mutter mir gekauft hatte. Auf einmal ihr Ratgeber in Bekleidungsfragen zu sein, passte nicht in unser Verhältnis.
Außerdem gefiel mir die Vorstellung nicht, sie könnte tatsächlich eine Jeans tragen. Ich kannte sie nur in Röcken und Blusen – und nicht nur sie. Genau genommen hatte ich noch nie einen Erwachsenen im familiären Umfeld meiner Eltern oder in ihrem Freundeskreis in Jeans gesehen.
Jeans waren keine Hosen für Erwachsene, wie ich sie kannte – und ich wollte auch, dass das so blieb. Wenn wir, meine Freunde und ich, eine Jeans haben wollten, dann nicht, weil die Erwachsenen sie trugen, sondern weil sie sie nicht trugen.
Von der Frage meiner Mutter überrumpelt, sagte ich nur: «Ja, warum denn nicht.»
Sie nickte und verschwand mit der Hose in der Umkleidekabine. Ich war nicht glücklich über diese Entwicklung. Wir waren hierhergekommen, um eine Hose für mich zu kaufen, nicht für sie. Außerdem konnte ich mir meine Mutter in Jeans nicht vorstellen. Aber es war nichts daran zu ändern, und ich wartete.
Als sie aus der Kabine kam, war der Anblick sonderbar. Die Frau, die vor mir stand, war unzweifelhaft meine Mutter, doch irgendwie war sie es auch nicht. Die Jeans schien aus ihr eine andere Person zu machen. Sie glich auf einmal der Verkäuferin, die so anders war und auftrat als sie.
«Nun? Findest du, dass mir eine Jeans steht?»
Wie hätte ich diese Frage beantworten sollen? Es war so, als hätte sie mich aufgefordert, mich zwischen ihr und einer anderen Person als Mutter zu entscheiden. Doch das wollte ich nicht. Ich wollte, dass sie die war und blieb, die ich kannte, seit ich denken konnte: eine verlässliche Versorgungsinstanz, die immer und zu jeder Zeit bereit war, für mich und mein Wohl alles stehen und liegen zu lassen. Als sie in Jeans vor mir stand, den Stoff der Bluse hochgerafft, damit auch der Bund zu sehen war, ahnte ich zum ersten Mal, dass ihr Wesen Seiten hatte, die mir unbekannt waren.
Offenbar war sie fasziniert von dem Gedanken, eine Jeans zu tragen, und zugleich schien sie davor zurückzuschrecken. Jedenfalls war ihr meine Meinung dazu wichtig, aber ich blieb stumm. Zum Glück war die Ladenbesitzerin oder Chefverkäuferin sogleich zur Stelle. Sie hatte die Situation im Auge behalten und näherte sich meiner Mutter mit einem freudigen Gesichtsausdruck.
«Diese Jeans steht Ihnen ja ganz fantastisch! Sie haben die ideale Figur dafür, wenn ich Ihnen das so direkt sagen darf. Sie sind der perfekte Frauentyp für eine Jeans!»
Ein Lächeln huschte über das Gesicht meiner Mutter. «Meinen Sie wirklich? Bin ich denn dafür nicht viel zu alt?»
«Iwo! Wieso soll eine Frau mit … achtundzwanzig?, neunundzwanzig? … denn keine Jeans tragen dürfen!?»
«Ich werde in diesem Jahr achtunddreißig.»
«Nein!», rief die Ladenbesitzerin aus. «Also das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten! Das ist ja kaum zu glauben, aber ich sage Ihnen etwas: Gerade in dem Fall rate ich Ihnen umso mehr zu der Jeans. Sie betont Ihren jugendlichen Typus! Und im Übrigen bin ich sowieso der Meinung, dass man eine Jeans in jedem Alter tragen kann. Wissen Sie, bei uns hat sich das noch nicht durchgesetzt, aber in Amerika ist das völlig normal.»
Meine Mutter stellte sich noch einmal vor den Spiegel und betrachtete sich von allen Seiten. Verglichen mit vielen anderen Müttern, die ich kannte, war sie wirklich sehr schlank.
Ein paar Sekunden lang rang sie mit sich, und dann sagte sie: «Ich weiß nicht … Ich glaube, so eine Hose ist dann doch nichts für mich. Ich bin ja eigentlich auch mit meinem Jungen hier. Was meinen Sie, haben wir für ihn die richtige Größe gefunden?»
Die Verkäuferin hob ein wenig bedauernd die Augenbrauen und wandte sich dann mir zu. Während meine Mutter sich umzog, half sie mir bei der Entscheidung zwischen den verschiedenen Marken und Schnitten. Ich entschied mich für eine Levi’s, weil ich bemerkt hatte, dass die Verkäuferin eine trug.
Bei der Rückfahrt blickte meine Mutter aus dem Fenster der Straßenbahn. Es kam selten vor, dass wir uns über etwas unterhielten, das sie betraf. Eigentlich kam es gar nicht vor. Sonst hätte ich sie vielleicht gefragt, was sie beschäftigte. Ich sah sie eine Weile an, und nicht einmal das bemerkte sie. Ihre Augen waren ohne Aufmerksamkeit auf die niedrigen Vorortfassaden gerichtet, die im Fenster vorüberzogen. Vielleicht fragte sie sich, ob sie nicht doch eine Jeans hätte kaufen sollen. Wir sprachen nicht mehr darüber.
Abends saß ich mit meinem Vater vor dem Fernseher. Eigentlich durfte ich an Wochentagen nach sechs Uhr abends nicht mehr fernsehen, aber mein Vater verfolgte mit großem Interesse die Sondersendungen über das amerikanische Apollo-Mondlandeprogramm und hatte nichts dagegen, dass ich mich ebenso dafür interessierte. Ich war im Weltraumfieber. Es war etwas, das wir gemeinsam hatten, und das gefiel uns beiden.
Im Winter waren mit Apollo 8 zum ersten Mal Menschen um den Mond geflogen, dessen Rückseite noch niemand zuvor je zu Gesicht bekommen hatte. Ich konnte von den Bildern mit den Kratern und kantigen Höhenzügen gar nicht genug kriegen. Und vor zwei Tagen war Apollo 9 gestartet, um in einer Erdumlaufbahn die Mondfähre zu testen, die im Sommer mit zwei Astronauten an Bord auf dem Mond landen sollte. Die Fähre sah gar nicht wie ein Raumschiff aus, sondern wie der Kopf eines Insekts.
In der Sondersendung wurden die komplizierten Details der Apollo-9-Mission erläutert. Zeichnungen demonstrierten, wie die Mondfähre aus dem Innern der Rakete in den Weltraum schweben würde, und Schautafeln stellten schematisch die schwierigen Steuerungsmanöver dar, um Apollo-Kapsel und Fähre aneinanderzukoppeln. Bei einer Geschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern musste eine millimetergenaue Präzision der Flugbahnen erreicht werden. Aber es sah gut aus. Die Antriebsdüsen der Mondfähre funktionierten perfekt.
«Das Jeansgeschäft, in dem ich heute mit Mama war, ist riesengroß», sagte ich.
«Und hast du eine Hose gefunden, die dir gefällt?», fragte mein Vater, ohne den Blick vom Bildschirm zu wenden.
«Ja, aber ich bekomme sie erst am Geburtstag.»
«Das sind ja nur noch ein paar Tage.»
«Es gibt auch Jeans für Erwachsene», sagte ich.
«Ich weiß. Ursprünglich waren es Arbeiterhosen.»
«Mama hat auch eine angezogen.»
Jetzt wandte mein Vater den Blick vom Bildschirm und sah mich an. «Ach ja? Eine Jeans? Wieso das denn?»
«Die Verkäuferin meinte, sie würde ihr sehr gut stehen», erzählte ich ihm. «Sie kannte sich gut aus.»
Mein Vater dachte kurz über meine Bemerkung nach und sah mich dann so an, wie er es immer tat, wenn er mir etwas Wichtiges beibrachte. «Weißt du, es ist gar nicht überraschend, dass die Verkäuferin das gesagt hat. Es ist ihr Beruf, Hosen zu verkaufen, und deswegen sagt sie jedem, der in ihr Geschäft kommt, wie gut er in ihrer Ware aussieht. Sie sagt es auch, wenn es nicht stimmt oder offensichtlich Unsinn ist wie bei deiner Mutter. Das wirst du eines Tages lernen, auch wenn es keine sehr schöne Lektion ist: Die Menschen sagen einem nicht immer die Wahrheit. Meistens sagen sie einem das, was ihnen nützt.»
Ich nickte. Natürlich hatte ich das nicht bedacht. Wie sollte ich auch – mit zehn, nun ja, in ein paar Tagen mit elf Jahren? Meine Eltern, und ganz besonders mein Vater, hatten mir beigebracht, stets die Wahrheit zu sagen, und deswegen nahm ich an, dass auch Erwachsene das immer taten. Dass er mir nun erklärte, dass sich Erwachsene in manchen Situationen nicht an die Wahrheit hielten, widersprach dem und irritierte mich.
Auf einmal glaubte ich die Verunsicherung meiner Mutter vor dem Spiegel zu verstehen. Sie hatte sich offenbar gefragt, ob die Verkäuferin ihr die Wahrheit sagte. Vielleicht hätte sie das sogar gerne geglaubt, aber dann hatte sie sich gegen den Kauf einer Jeans entschieden.
Es war wie so oft: Durch meine Mutter erlebte ich die Dinge, und mein Vater erklärte sie mir.
Wir wandten uns wieder dem Fernseher zu und den Schwierigkeiten des Kopplungsmanövers zwischen Fähre und Mutterschiff.
2
Neue Nachbarn
Das Haus links neben unserem war das älteste in der Straße. Es war ein Einzelstück aus den Dreißigerjahren, aus der Zeit vor der aktuellen Besiedlungs- und Bebauungswelle. Das Haus wurde von Herrn Fahlheim bewohnt, einem alten Mann mit drahtigen, grauen Haaren, den man fast nie zu Gesicht bekam. Er pflegte keine Beziehungen zur Nachbarschaft, und umgekehrt bemühte sich auch niemand darum. Manchmal sah man ihn im Garten Unkraut zupfen, aber er grüßte nie und suchte auch keinen Blickkontakt. Er war mir unheimlich.
An einem grauen Tag im Herbst ’68 hielt ein Krankenwagen mit laufendem Blaulicht vor seinem Haus. Es dauerte eine Weile, bis die Sanitäter mit einer Bahre wieder herauskamen. Der Körper von Herrn Fahlheim – ein anderer konnte es nicht sein – war mit einem weißen Tuch abgedeckt. Irgendwann hieß es in der Nachbarschaft, er sei schon seit einigen Tagen tot gewesen. Endgültig geklärt wurde die Sache nie, ebenso wenig wie die Frage, wer Herrn Fahlheim eigentlich gefunden und den Rettungswagen alarmiert hatte. Niemand schien sich dafür zu interessieren. Ich hatte sogar das Gefühl, dass viele – auch meine Eltern – erleichtert waren, dass Herr Fahlheim nun nicht mehr da war.
Irgendwann wurden die Möbel aus dem Haus geholt. Meine Eltern nahmen an, dass es verkauft werden würde. Meine Mutter erzählte irgendwann, sie habe drei Personen das Haus betreten sehen, einen älteren Herrn, vielleicht ein Makler, und einen Mann und eine Frau, von denen sie annahm, es könnte sich um ein am Kauf des Hauses interessiertes Ehepaar gehandelt haben. Mehr tat sich bis zu meinem Geburtstag nicht.
Mein Vater kümmerte sich in seiner Freizeit um den Garten. Er ging als Ingenieur an die Sache heran. Letztlich, so hatte er mir schon früh beigebracht, seien auch Pflanzen und Lebewesen nichts als sehr komplizierte Mechanismen, die – wie von Menschenhand erschaffene Maschinen auch – der regelmäßigen Wartung und Pflege bedurften.
Im hinteren Teil unseres Gartens standen ein Apfel- und ein Kirschbaum. Als es Mitte März ungewöhnlich warm wurde, nahm sich mein Vater vor, die Bäume wie jedes Jahr mit einem Pflanzenschutzmittel gegen Schädlingsbefall zu spritzen. Er verwendete dazu eine gelbe Druckflasche, die wie alle Gartengeräte im hinteren Teil der Garage stand. Mein Vater füllte die Flasche mit einer Mischung aus Wasser und E605, schnallte sie sich mit zwei Trageriemen auf den Rücken und schraubte den Zerstäuber an das Spritzrohr.
Wir gingen zusammen in den Garten. Es gefiel mir, ihm dabei zuzusehen, wie er die Bäume gegen die Schädlinge einnebelte, von deren rätselhaften Namen ich mir sogar einige gemerkt hatte: Schild- und Schmierläuse oder Frostspanner, Spinnmilben und Pflaumenwickler.
Mein Vater richtete das lange, dünne Rohr mit dem Pistolengriff am einen und dem Zerstäuber am anderen Ende auf den Apfelbaum und öffnete das Ventil. Er stand mitten in dem leuchtenden Sprühnebel, als nebenan, im ehemaligen Garten von Herrn Fahlheim, eine Frau erschien, die ich noch nie gesehen hatte. Sie näherte sich dem Zaun und blieb auf unserer Höhe stehen.
Sie betrachtete meinen Vater eine Weile, so wie man jemanden ansieht in der Erwartung, dass er den Blick vielleicht bemerkt. Mein Vater war aber zu beschäftigt und konzentriert, und irgendwann entdeckte die Frau mich. Ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht, und sie winkte. Sie war etwas größer als meine Mutter und schien auch etwas jünger zu sein.