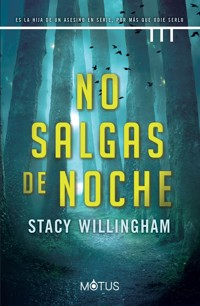9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der neue Thriller der New York Times-Bestsellerautorin: ein packender Pageturner um eine Mutter, der die Suche nach ihrem Sohn den Schlaf und jede Gewissheit raubt. Vor einem Jahr verschwand Isabelle Drakes Sohn Mason nachts aus seinem Kinderbett, und noch immer gibt es keine Spur. Polizei, Presse und auch ihr Mann sind längst zur Tagesordnung übergegangen, doch Isabelle findet seither keinen Schlaf: Ihr ganzes Leben dreht sich darum, Mason zu finden. Gemeinsam mit dem True-Crime-Podcaster Waylon Spencer, der plötzlich in ihr Leben tritt, forscht sie im Fall ihres Sohnes weiter nach, aber Waylon verfolgt seine eigene Agenda. Als längst vergessene Erinnerungen an die Vergangenheit an die Oberfläche drängen und Zweifel ihre schlaflosen Nächte trüben, weiß Isabelle nicht mehr, wem sie trauen kann. Sich selbst eingeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stacy Willingham
Was verborgen ist
Thriller
Über dieses Buch
Was geschah mit Mason Drake?
Heute ist Tag 364.
364 Tage, seit ich zuletzt richtig schlafen konnte.
364 Tage, seit mein Sohn Mason aus seinem Bett entführt wurde.
Die Polizei hat die Suche eingestellt. Mein Mann will, dass ich so weitermache wie vorher.
Aber ich muss Masons Geschichte am Leben erhalten.
Irgendjemand weiß, was mit meinem Sohn passiert ist.
Und ich werde ihn finden.
«Temporeich und unheimlich, hat WAS VERBORGEN IST eine greifbare Spannung, die die Seiten zum Umblättern bringt.»
Karin Slaughter
Vita
Stacy Willingham studierte Journalismus an der University of Georgia, erwarb einen MFA am Savannah College of Art & Design und arbeitete als Werbetexterin und Markenstrategin, bevor sie beschloss, sich ganz dem Schreiben zu widmen. Ihr Debütroman «Das siebte Mädchen» erscheint in über 30 Ländern und wurde sofort ein New-York-Times-Bestseller. Die Filmrechte erwarb die Produktionsfirma von Oscar-Preisträgerin Emma Stone, die auch die Hauptrolle in der geplanten HBO-Serie spielen wird. Stacy Willingham lebt mit ihrem Mann in Charleston, South Carolina.
Alice Jakubeit übersetzt Romane, Sachbücher und Reportagen aus dem Englischen und Spanischen, u. a. von Alexander McCall Smith, Greer Hendricks & Sarah Pekkanen, Brian McGilloway und Eva García Sáenz.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel «All the Dangerous Things» bei Minotaur Books/St. Martin’s Publishing Group, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«All the Dangerous Things» Copyright © 2023 by Stacy Willingham
Redaktion Peter Hammans
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg,
nach dem Original von St. Martin’s Press
Coverabbildung Shutterstock; iStock; Arcangel
ISBN 978-3-644-01034-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine große Schwester Mallory
«Schlaf, dieser Tod in Scheibchen. Wie ich ihn verabscheue.»
– Anonym
PROLOG
Heute ist der dreihundertvierundsechzigste Tag.
Dreihundertvierundsechzig Tage, seit ich zuletzt eine Nacht geschlafen habe. Das sind beinahe neuntausend Stunden. Fünfhundertvierundzwanzigtausend Minuten. Mehr als einunddreißig Millionen Sekunden.
Oder, wenn man in die andere Richtung gehen möchte, zweiundfünfzig Wochen. Zwölf Monate.
Ein ganzes Jahr ohne eine einzige durchschlafene Nacht.
Ein Jahr, in dem ich in einem halbbewussten Traumzustand durchs Leben gestolpert bin. Ein Jahr, in dem ich mich manchmal in einem anderen Raum, einem anderen Gebäude wiederfand, wenn ich die Augen öffnete, ohne zu wissen, wann oder wie ich dorthin gelangt war.
Ein Jahr der Schlaftabletten, Augentropfen und literweisen Koffeinzufuhr. Der zittrigen Finger und schweren Lider. Ein Jahr, in dem mir die Nacht aufs Innigste vertraut wurde.
Ein ganzes Jahr, seit mir Mason genommen wurde, und noch immer bin ich der Wahrheit kein Stück näher gekommen.
KAPITEL EINS
JETZT
«Isabelle, noch fünf Minuten.»
Mein Blick bohrt sich in den Teppich. In eine Stelle ohne besondere Bedeutung, außer dass es meinem Blick dort zu gefallen scheint. Meine Umgebung verschwimmt, während diese eine Stelle – meine Stelle – schärfer, klarer umrissen wird. Wie beim Tunnelblick.
«Isabelle.»
Ich wünschte, ich könnte immer einen Tunnelblick haben, mich gezielt nur auf eine Sache konzentrieren. Alles andere zu Störgeräuschen werden lassen. Zu weißem Rauschen.
«Isabelle.»
Schnipp, schnipp.
Jetzt befindet sich vor meinem Gesicht eine Hand und winkt. Finger schnippen, und ich muss blinzeln.
«Tut mir leid», sage ich und schüttle den Kopf, als könnte ich so den Nebel vor meinen Augen vertreiben wie Scheibenwischer den Regen von der Windschutzscheibe. Ich blinzle noch mehrmals, dann versuche ich, meine Stelle im Teppich wiederzufinden, aber die ist jetzt fort. Das war ja klar. Sie ist wieder mit dem Teppich verschmolzen, in Vergessenheit geraten, wie ich es auch gern täte. «Tut mir leid, ja. Noch fünf Minuten.»
Ich hebe den Styroporbecher und trinke einen Schluck Kaffee – stark, schwarz –, und der Becher quietscht, als ich mit den rissigen Lippen am Rand hängen bleibe. Früher habe ich den Geschmack der morgendlichen Tasse Kaffee genossen. Für diesen Duft, der die Küche durchzog, habe ich gelebt, für die Wärme eines Bechers Kaffee in meinen kalten, steifen Händen, wenn ich auf der hinteren Veranda stand und den Sonnenaufgang beobachtete, während Tautropfen meine Haut benetzten.
Doch es war nicht Kaffee, was ich brauchte, das weiß ich jetzt. Es war der vertraute, geordnete Tagesablauf. Wohlgefühl in der Tasse, wie diese Nudeln im Becher, die man mit Wasser übergießt, in die Mikrowelle schiebt und als Mahlzeit bezeichnet. Aber das interessiert mich nicht mehr: Wohlgefühl, geordneter Tagesablauf. Wohlgefühl ist ein Luxus, den ich mir nicht mehr leisten kann, und einen geordneten Tagesablauf … nun, den gibt es bei mir ebenfalls schon lange nicht mehr.
Jetzt brauche ich nur noch Koffein. Ich muss wach bleiben.
«Noch zwei Minuten.»
Ich sehe den Mann an, der vor mir steht und ein Klemmbrett auf die Hüfte gestemmt hat, nicke, leere den Becher und koste den gallebitteren Geschmack aus. Der Kaffee schmeckt beschissen, aber das ist mir egal. Er erfüllt seinen Zweck. Ich hole ein Fläschchen Augentropfen – gegen die roten Augen – aus der Handtasche und träufle mit routinierter Präzision je drei Tropfen in beide Augen. Das gehört jetzt wohl zu meinem Tagesablauf. Dann stehe ich auf, streiche die Hose glatt und klopfe mir mit den flachen Händen auf die Oberschenkel, um ihm zu signalisieren, dass ich bereit bin.
«Wenn Sie mir bitte folgen.»
Ich strecke den Arm aus und bedeute dem Mann vorauszugehen. Und dann folge ich ihm. Ich folge ihm durch die Tür und einen dämmrigen Flur, wo das Summen der Neonröhren in meinen Ohren klingt wie ein elektrischer Stuhl, der zum Leben erwacht, dann durch eine weitere Tür, und gleich darauf ertönt Applaus. Ich gehe an ihm vorbei zum Rand der Bühne und stelle mich hinter einen schwarzen Vorhang. Gleich dahinter wartet mein Publikum.
Heute ist ein großer Auftritt. Mein größter bisher.
Ich blicke hinab auf meine Hände, in denen ich früher Karteikarten mit Stichpunkten hielt, mit Bleistift notiert. Kurze, mit Gliederungsstrichen versehene Hinweise auf das, was ich sagen wollte und was nicht. Wie ich die Geschichte strukturieren wollte, als folgte ich einem Rezept, nach dem ich akribisch und sorgfältig an den richtigen Stellen Details einstreute. Doch diese Karten brauche ich nicht mehr. Ich habe das schon zu oft getan.
Außerdem gibt es nichts Neues zu sagen.
«Und jetzt freuen wir uns, Ihnen die Frau zu präsentieren, wegen der Sie alle hier sind.»
Ich beobachte den Mann, der da drei Meter von mir entfernt auf der Bühne steht. Seine Stimme dröhnt aus den Lautsprechern, sie scheint überall zu sein – vor mir, hinter mir. In mir, irgendwie. Irgendwo tief drin in meiner Brust. Wieder jubelt das Publikum, und ich räuspere mich und rufe mir in Erinnerung, weshalb ich hier bin.
«Meine Damen und Herren hier auf der TrueCrimeCon, es ist mir eine Ehre, Ihnen unsere Hauptrednerin zu präsentieren … Isabelle Drake!»
Als der Moderator mich zu sich winkt, trete ich ins Licht und gehe zielstrebig auf ihn zu. Die Zuschauer rufen laut, einige stehen auf und klatschen, und die kleinen Knopfaugen ihrer iPhones deuten unverwandt in meine Richtung, nehmen mich ins Visier. Ich wende mich dem Publikum zu und kneife die Augen ein bisschen zusammen, bis sie sich an das grelle Licht gewöhnen, dann winke ich und lächle matt. In der Mitte der Bühne bleibe ich stehen.
Der Moderator reicht mir ein Mikrofon, ich nehme es entgegen und nicke.
«Danke», sage ich, und meine Stimme klingt wie ein Echo. «Ich danke Ihnen allen, dass Sie an diesem Wochenende hierhergekommen sind. Was für tolle Redner.»
Wieder bricht Beifall aus, und ich nutze diese Sekunden, um das Gesichtermeer abzusuchen, wie ich es immer mache. Es sind hauptsächlich Frauen. Wie immer. Ältere Frauen in Fünfer- oder Zehnergruppen, die diese alljährliche Tradition genießen, diese Gelegenheit, sich eine Auszeit von ihrem Leben und ihren Aufgaben zu nehmen und ganz in eine Fantasie abzutauchen. Jüngere Frauen zwischen zwanzig und dreißig, die nervös und ein wenig verlegen wirken, so als wären sie gerade beim Anschauen eines Pornos erwischt worden. Aber da sind auch Männer. Ehemänner und Freunde, die gegen ihren Willen mitgeschleift wurden; der Typ Mann mit Metallrahmenbrille, Fusselbart und Ellbogen wie Astknoten. Dann sind da die Einzelgänger, die sich am Rand halten und einen gerade lange genug ansehen, um einem Unbehagen einzuflößen, und die Polizisten, die durch die Gänge streifen und das Gähnen unterdrücken.
Mit einem Mal fällt mir die Kleidung auf.
Eine junge Frau trägt ein T-Shirt mit dem Spruch Rotwein und True Crime, und das T von True hat die Form einer Pistole; eine andere trägt ein weißes T-Shirt mit roten Sprenkeln – die sollen wohl Blut darstellen. Auf einem weiteren T-Shirt lese ich: Bundy. Dahmer. Gacy. Berkowitz und erinnere mich, es vorhin im Souvenir-Shop an einer Schaufensterpuppe gesehen zu haben. Die Art der Präsentation erinnerte an die auf Merchandising-Ständen bei Konzerten – Memorabilien für glühende Fans.
Ich spüre die Galle in mir aufsteigen, ein wohlvertrautes Gefühl, warm und scharf, und zwinge mich, den Blick abzuwenden.
«Wie Sie sicher alle wissen, heiße ich Isabelle Drake, und mein Sohn Mason wurde vor einem Jahr entführt», sage ich. «Sein Fall ist noch immer nicht aufgeklärt.»
Stühle knarren; Leute räuspern sich. Eine farblose Frau in der ersten Reihe schüttelt sanft den Kopf und hat Tränen in den Augen. Sie genießt das hier jetzt, das weiß ich. Es ist, als schaute sie ihren Lieblingsfilm an und kaute dabei geistesabwesend Popcorn. Ihre Lippen bewegen sich sanft, sie spricht jedes Wort mit. Sie hat meinen Vortrag schon einmal gehört; sie weiß, was passiert ist. Sie weiß es, aber sie kann trotzdem gar nicht genug davon bekommen. Keiner von ihnen kann genug davon bekommen. Die Mörder auf den T-Shirts sind die Schurken; die uniformierten Männer hinten sind die Helden. Mason ist das Opfer … und ich weiß nicht genau, welche Rolle mir dabei zufällt.
Die der einsamen Überlebenden vielleicht. Derjenigen, die eine Geschichte zu erzählen hat.
KAPITEL ZWEI
Ich nehme meinen Platz ein. Den Platz am Gang. Eigentlich sitze ich lieber am Fenster, wo ich den Kopf anlehnen und die Augen schließen kann. Nicht um zu schlafen, nicht direkt. Aber um für eine Weile wegzudriften. Sekundenschlaf nennt mein Arzt das. Wir haben das alle schon einmal gesehen, vor allem im Flugzeug: die zuckenden Lider, den nach vorn fallenden Kopf. Zwischen zwei und zwanzig Sekunden Bewusstlosigkeit, bevor der Kopf mit erstaunlicher Kraft wieder in die Höhe fährt wie der Abzug eines Gewehrs, der gespannt wird, handlungsbereit.
Ich sehe nach rechts: Der Platz neben mir ist frei. Ich hoffe, das bleibt so. Der Start ist in zwanzig Minuten. Das Gate wird gleich geschlossen, dann kann ich hinüberrücken. Die Augen schließen.
Versuchen, endlich ein wenig Schlaf zu finden, wie ich es jetzt seit einem Jahr versuche.
«Verzeihung.»
Ich fahre zusammen und blicke hoch. Eine Flugbegleiterin steht vor mir. Sie klopft auf meine Rückenlehne und blickt mich missbilligend an.
«Die Rückenlehne Ihres Sitzes muss sich in senkrechter Position befinden.»
Ich blicke nach unten, drücke den kleinen silbernen Knopf an meiner Armlehne und spüre, wie mein Rücken nach vorn und mein Bauch zusammengedrückt wird. Die Flugbegleiterin wendet sich ab, schließt ein Gepäckfach und will weitergehen, doch ich halte sie am Arm fest.
«Dürfte ich Sie um ein Mineralwasser bitten?»
«Wir servieren Getränke, sobald wir gestartet sind.»
«Bitte», füge ich hinzu, als sie sich abwenden will, und umklammere ihren Arm fester. «Falls es nicht zu viel Umstände macht. Ich habe den ganzen Tag geredet.»
Zum Nachdruck fasse ich mir an die Kehle, und sie blickt den Gang entlang, wo weitere Passagiere unbehaglich hin und her rutschen und ihre Sicherheitsgurte justieren. In ihren Rucksäcken nach den Kopfhörern suchen.
«Na gut», sagt sie und presst die Lippen aufeinander. «Einen Moment.»
Ich lächle, nicke und lehne mich zurück. Dann sehe ich mich im Flugzeug um und betrachte die anderen Passagiere, mit denen ich in den nächsten vier Stunden die aufbereitete Luft teilen werde, während wir von Los Angeles nach Atlanta fliegen. Es ist ein Spiel, das ich spiele: Ich überlege, was sie hier wohl tun. Welche Lebensumstände sie zu genau diesem Augenblick geführt haben, in genau diese Gruppe von Fremden. Ich frage mich, was sie tun oder vorhaben.
Verreisen sie, oder sind sie auf dem Heimweg?
Zuerst fällt mein Blick auf einen Jungen, der ganz allein sitzt. Riesige Kopfhörer haben seine Ohren verschluckt. Ich stelle mir vor, er sei ein Scheidungskind und werde einmal im Monat von einem Ende des Landes ans andere verfrachtet wie Ware. Unwillkürlich male ich mir sofort aus, wie Mason in diesem Alter aussehen könnte – seine grünen Augen könnten noch grüner geworden sein, zwei Zwillingssmaragde, die wie die seines Vaters funkeln. Oder seine babyglatte Haut könnte meinen Olivton angenommen haben, eine natürliche Bräune, ohne einen Fuß in die Sonne setzen zu müssen.
Ich schlucke schwer und zwinge mich, den Blick abzuwenden, drehe mich nach links und betrachte andere Fluggäste.
Da sind ältere Männer mit Laptops vor sich und Frauen mit Büchern; Teenager mit Smartphones haben sich so tief auf ihren Sitzen hinabrutschen lassen, dass sich die Knie ihrer schlaksigen Beine in die Rückenlehnen vor ihnen bohren. Einige dieser Menschen reisen zu Hochzeiten oder Beerdigungen; andere unternehmen eine Geschäftsreise oder einen heimlichen, bar bezahlten Kurzurlaub. Und manche dieser Menschen haben Geheimnisse. Eigentlich alle. Aber bei manchen sind es die echten Geheimnisse, die schmutzigen. Die dunklen, zwielichtigen Geheimnisse, die gleich unter der Haut lauern, durch ihre Adern wandern und sich ausbreiten wie Krankheitserreger.
Sich teilen, vermehren, erneut teilen.
Ich frage mich, wer sie sind, die mit den dunklen Geheimnissen, die jedes Organ, das sie berühren, verderben. Die mit den Geheimnissen, die sie von innen her auffressen werden.
Niemand hier drin würde je darauf kommen, womit ich gerade meinen Tag verbracht habe: mit der Schilderung des schmerzlichsten Augenblicks in meinem Leben, zur Unterhaltung Fremder. Ich habe jetzt einen Vortrag. Einen Vortrag, den ich völlig distanziert und perfekt halte. Er besteht aus Statements, von denen ich weiß, dass sie sich gut lesen, wenn man sie mir aus dem Mund nimmt und in Zeitungen abdruckt, und aus wohlüberlegt gesetzten Pausen, damit ein besonders wichtiger Punkt Wirkung entfalten kann. Dazu glückliche Erinnerungen an Mason als Gegengewicht zu besonders beklemmenden Passagen, wenn ich spüre, dass ein befreiendes Lachen vonnöten ist: Mitten in der eindringlichen Schilderung seines Verschwindens – gerade habe ich entdeckt, dass das Fenster in seinem Zimmer offen steht und eine warme, feuchte Brise hereinweht, die das kleine Mobile mit den Stoffdinosauriern über seinem Bettchen sanft tanzen lässt – halte ich inne und schlucke. Dann erzähle ich, dass Mason gerade zu sprechen angefangen hatte. Tyrannosaurus rex sprach er «Tyrannosauus» aus. Daraufhin quiekte mein Mann jedes Mal übertrieben, wenn Mason auf die kleinen Stofftiere über sich zeigte, und Mason kicherte vergnügt, bis er schließlich einschlief. Und dann gestatteten die Zuschauer sich ein Lächeln, vielleicht gar ein Lachen. Die Schultern entspannten sich sichtlich, die Leute lehnten sich wieder zurück, atmeten kollektiv auf. Denn mit dem Publikum, das habe ich rasch begriffen, verhält es sich so: Die Leute wollen sich nicht zu unbehaglich fühlen. Sie wollen das, was ich durchgemacht habe, nicht in allen hässlichen Details tatsächlich durchleben. Sie wollen lediglich eine Kostprobe. Nur so viel, dass ihre Neugier befriedigt wird – aber wenn es zu bitter, zu salzig oder zu real wird, dann schmatzen sie prüfend und gehen unzufrieden davon.
Und das wollen wir nicht.
In Wahrheit lieben die Menschen Gewalt – jedenfalls aus sicherer Entfernung. Wer da widerspricht, der verschließt entweder die Augen vor der Realität oder hat etwas zu verbergen.
«Ihr Mineralwasser.»
Ich blicke hoch. Die Flugbegleiterin reicht mir einen kleinen Becher mit einer klaren Flüssigkeit, in der Bläschen aufsteigen, die mit einem befriedigenden Prickeln zerplatzen.
«Danke.» Ich nehme den Becher und stelle ihn auf meinem Schoß ab.
«Ihr Tisch muss aber hochgestellt bleiben», fügt sie hinzu. «Wir sind bald in der Luft.»
Ich lächle und trinke einen kleinen Schluck, um ihr zu bedeuten, dass ich verstanden habe. Als sie davongeht, bücke ich mich zu meiner Handtasche hinunter und ziehe ein Minifläschchen aus einem Fach an der Seite. Als ich gerade unauffällig den Deckel abschrauben will, spüre ich jemanden neben mir.
«Hier bin ich.»
Mein Kopf fährt in die Höhe, und ich rechne halb damit, jemanden zu erblicken, den ich kenne. Die Stimme klingt vage vertraut, wie die eines entfernten Bekannten, aber der Mann neben mir auf dem Gang ist ein Fremder. Er trägt eine TrueCrimeCon-Stofftasche und deutet auf den Sitz neben mir.
Den Fenstersitz.
Dann entdeckt er das Minifläschchen in meiner Hand und grinst. «Ich sage nichts.»
«Danke.» Ich stehe auf, um ihn durchzulassen.
Ich versuche, mir meine Verärgerung über die Aussicht, auf dem Heimflug neben einem Teilnehmer der True-Crime-Tagung festzusitzen, nicht anmerken zu lassen. Meine Haltung zu diesen Fans ist wirklich kompliziert: Ich verabscheue sie, aber ich brauche sie auch, ihre Augen, ihre Ohren. Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie sind ein notwendiges Übel. Denn wenn der Rest der Welt vergisst, erinnern sie sich noch. Sie lesen weiterhin jeden Artikel und erörtern ihre jeweiligen Theorien in Amateurdetektivforen, so als ob mein Leben nur ein spannendes Rätsel wäre, das gelöst werden muss. Sie machen es sich weiterhin abends mit einem Glas Merlot auf der Couch gemütlich und lassen sich von der Kriminalnachrichtensendung Dateline einlullen. Versuchen, es zu erleben, ohne es wirklich zu erleben. Und deshalb gibt es Veranstaltungen wie die TrueCrimeCon. Deshalb geben Menschen Hunderte von Dollars für Flugtickets, Hotelzimmer und Eintrittskarten aus. Sie kaufen sich einen geschützten Raum, wo sie wenigstens ein paar Tage lang im blutigen Glanz der Gewalt baden können, indem sie die Ermordung eines anderen Menschen zu ihrer Unterhaltung nutzen.
Aber was sie nicht verstehen, was sie nicht verstehen können, ist dies: Auch sie könnten eines Tages aufwachen und feststellen, dass die Gewalt aus ihrem Fernseher gekrochen kommt und sich in ihrem Haus, ihrem Leben einnistet wie ein Parasit, der ihnen die Fänge ins Fleisch schlägt. Der sich tief in sie hineinwindet und es sich gemütlich macht. Der ihnen das Blut aussaugt und sie sein Zuhause nennt.
Die Leute denken nie daran, dass so etwas auch ihnen passieren kann.
Mein Sitznachbar schiebt sich an mir vorbei auf seinen Platz und verstaut seine Tasche unter dem Vordersitz. Nachdem ich mich wieder gesetzt habe, mache ich da weiter, wo ich unterbrochen wurde: Ich öffne mit einem leisen Knacken den Verschluss und lasse den Wodka in mein Wasser gluckern. Dann rühre ich mit dem Finger um und trinke einen großen Schluck.
«Ich habe Ihren Vortrag gehört.»
Mein Sitznachbar sieht mich an, das spüre ich. Ich versuche, ihn zu ignorieren, schließe die Augen und lehne den Kopf an. Warte darauf, dass der Wodka meine Lider gerade so schwer macht, dass sie ein Weilchen geschlossen bleiben.
«Es tut mir sehr leid», fügt er hinzu.
«Danke», sage ich mit geschlossenen Augen. Auch wenn ich nicht richtig schlafen kann, kann ich doch wenigstens so tun, als ob.
«Aber Sie machen das gut», fährt er fort. Ich spüre seinen Atem an meiner Wange, rieche sein Pfefferminzkaugummi. «Wie Sie Ihre Geschichte erzählen, meine ich.»
«Es ist keine Geschichte», entgegne ich. «Das ist mein Leben.»
Er schweigt eine Weile, und ich glaube schon, das hätte gewirkt. Normalerweise versuche ich, den Leuten kein Unbehagen einzuflößen – ich bemühe mich, liebenswürdig zu sein, die Rolle der trauernden Mutter zu spielen. Schüttle Hände und nicke mit einem dankbaren Lächeln, das ich mir wie Lippenstift aus dem Gesicht wische, sobald ich mich abwende. Aber jetzt sind wir nicht mehr auf der Tagung. Sie ist vorbei. Ich habe Feierabend. Ich fliege nach Hause. Ich will nicht mehr darüber sprechen.
Über uns erwacht der Lautsprecher zum Leben, kratzig und mit viel Hall.
«Flight attendants, prepare doors for departure and cross-check.»
«Ich bin Waylon», sagt der Mann, und ich spüre, dass er mir die Hand reicht. «Waylon Spencer. Ich habe einen Podcast …»
Da öffne ich die Augen und sehe ihn an. Ich hätte es wissen müssen. Diese vertraute Stimme. Der kleine V-Ausschnitt und die enge Darkwash-Jeans. Mit seinem glänzenden, zum Nacken hin immer kürzer ausrasierten Undercut sieht er nicht wie der typische Tagungsteilnehmer aus. Er beschäftigt sich nicht zum Vergnügen mit Mord; er macht das beruflich.
Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
«Waylon», wiederhole ich seinen Namen. Ich betrachte seine ausgestreckte Hand, seine erwartungsvolle Miene. Dann blicke ich wieder nach vorn und schließe die Augen. «Ich will ja nicht unhöflich wirken, Waylon, aber ich bin nicht interessiert.»
«Er gewinnt immer mehr an Zugkraft.» Waylon lässt nicht locker. «Nummer fünf im App Store.»
«Schön für Sie.»
«Wir haben sogar einen alten Fall aufgeklärt.»
Ob es die unvermittelte Bewegung des Flugzeugs ist – ein sanfter Ruck, bei dem sich mir der Magen hebt – oder ob es an seinen Worten liegt, kann ich nicht sagen, aber plötzlich habe ich ein mulmiges Gefühl. Ich drücke mich tief in den Sitz, während wir über die Rollbahn rumpeln und die riesige Metallkiste, in der wir alle eingeschlossen sind, immer schneller wird, bis ich Druck auf den Ohren habe.
Ich atme tief durch und grabe die Fingernägel in die Armlehne.
«Nervös beim Fliegen?»
«Können Sie damit aufhören?», fauche ich und wende ihm ruckartig den Kopf zu. Er hebt die Augenbrauen, meine plötzliche Unhöflichkeit hat ihn überrumpelt.
«Tut mir leid.» Er wirkt verlegen. «Es ist nur – ich dachte, Sie wären vielleicht interessiert. Daran, die Geschichte zu erzählen. Ihre Geschichte. Im Podcast.»
«Danke.» Ich bemühe mich um einen milderen Ton. Wir lehnen beide den Kopf an, als das Flugzeug zu steigen beginnt, während der Boden unter unseren Füßen heftig vibriert. «Aber ich verzichte.»
«Okay», sagt er und holt seine Brieftasche hervor. Ich verfolge, wie er das ausgeblichene Lederding aufklappt, eine Visitenkarte herauszieht und sie mir sanft aufs Bein legt. «Falls Sie Ihre Meinung ändern.»
Ich schließe die Augen wieder und lasse seine Karte unangetastet auf meinem Bein liegen. Wir sind jetzt in der Luft, durchbrechen wasserschwere Wolken. Hin und wieder findet ein Sonnenstrahl den Weg durch den halb herabgezogenen Sichtschutz und fällt hell auf meine geschlossenen Lider.
«Ich meine, ich habe einfach gedacht, dass Sie es deshalb machen», fügt er leise hinzu. Ich versuche, ihn zu ignorieren, aber meine Neugier behält die Oberhand, und es gelingt mir nicht.
«Dass ich was mache?»
«Sie wissen schon, Ihre Vorträge. Das ist bestimmt nicht leicht, es immer wieder zu durchleben. Aber das müssen Sie, wenn Sie den Fall am Leben erhalten wollen. Wenn Sie wollen, dass er irgendwann doch noch aufgeklärt wird.»
Ich kneife die Augen fest zusammen und konzentriere mich auf die rot leuchtenden Äderchen in meinen Lidern.
«Aber mit einem Podcast müssten Sie nicht mit all diesen Menschen reden. Jedenfalls nicht direkt. Sie müssten nur mit mir sprechen.»
Ich schlucke und nicke knapp, um ihm zu bedeuten, dass ich ihn zwar höre, diese Unterhaltung aber trotzdem beendet ist.
«Wie auch immer, denken Sie einfach drüber nach», schickt er noch hinterher und senkt seine Rückenlehne ab.
Ich höre den Stoff seiner Jeans rascheln, als er eine bequemere Sitzposition sucht, und weiß, dass er innerhalb von Minuten ganz mühelos das tun wird, was mir seit über einem Jahr nicht gelingt. Verstohlen öffne ich ein Auge und sehe in seine Richtung. Er hat sich kabellose Kopfhörer in die Ohren gesteckt und hört irgendetwas mit gleichförmigen Bässen, die so laut dröhnen, dass ich sie hören kann. Bald kann ich beobachten, wie mit seinem Körper die übliche Verwandlung vorgeht, vorhersehbar, aber mir trotzdem so fremd: Seine Atmung wird ruhiger und tiefer, seine Finger zucken im Schoß, sein Mund steht offen wie eine quietschende Schranktür, in einem Mundwinkel bebt ein einzelner Speicheltropfen. Fünf Minuten später dringt ein sanftes Schnarchen aus seinem Rachen, und ich beiße die Zähne zusammen.
Dann schließe ich die Augen und stelle mir für einen flüchtigen Augenblick vor, wie das sein muss.
KAPITEL DREI
Ich schließe die Haustür auf.
Es ist fast zwei Uhr morgens, und ich habe nur eine verschwommene Erinnerung an die Heimfahrt vom Flughafen. Sie ähnelt einem dieser im Dunkeln aufgenommenen Fotos mit langer Belichtungszeit, auf denen eilige Pendler farbige Schweife durch den Bahnhof hinter sich herziehen. Nach der Landung auf dem Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson steckte ich Waylons Visitenkarte in mein Portemonnaie, sammelte meine Sachen ein und drängte zum Ausgang, ohne mich auch nur zu verabschieden. Ich rannte zu meinem Gate, stieg in mein Anschlussflugzeug und benötigte eine weitere Dreiviertelstunde bis zum Savannah/Hilton Head International Airport, und die ganze Zeit bohrte sich mein Blick in den Vordersitz. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie ich durch die Gepäckausgabe wankte und draußen vor dem Terminal ein Taxi heranwinkte. Mich vom Auto für weitere vierzig Minuten in eine Art Trance lullen ließ, bis ich in meiner Einfahrt abgesetzt wurde und die Treppe zu meiner Haustür hinaufstolperte.
Sobald sich der Schlüssel im Schloss dreht, höre ich meinen Hund winseln. Ich weiß schon, wo ich ihn finden werde: Er sitzt direkt vor der Haustür, und sein Schwanz fegt wie ein Staubwedel über den Holzboden. Er war immer schon vorlaut, mein Roscoe, schon als Welpe. Ich beneide ihn um seine Fähigkeit, an dem festzuhalten, was ihn zu ihm macht, unverändert.
Ich hingegen erkenne mich manchmal nicht wieder, wenn ich in den Spiegel sehe. Weiß gar nicht mehr, wer ich bin.
«Na du», flüstere ich und kraule ihm die Ohren. «Ich hab dich vermisst.»
Roscoe gibt ein tiefes Stöhnen von sich, das von ganz hinten in seiner Kehle kommt, und klopft mir mit der Pfote aufs Bein. Wenn ich verreise, kümmert sich meine Nachbarin um ihn, eine ältere Dame, die Mitleid mit mir hat, glaube ich – entweder das, oder sie braucht die zwanzig Dollar pro Tag wirklich, die ich für sie auf der Arbeitsplatte liegen lasse. Sie lässt ihn hinaus und füllt seinen Napf. Hinterlässt mir detaillierte Aufzeichnungen über seinen Toilettenrhythmus und seine Fressgewohnheiten. Offen gesagt, habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich ihn allein lasse, denn bei ihr hat er einen regelmäßigeren Tagesablauf als bei mir.
Ich lasse die Handtasche auf die Arbeitsplatte fallen und sichte die Post, die sie dort gestapelt hat, hauptsächlich Werbung und Rechnungen. Mit einem Mal schnürt sich mir die Kehle zu. Ich nehme einen Briefumschlag, der in einer vertrauten Handschrift beschriftet ist und in der linken oberen Ecke den Absender meiner Eltern aufweist, drehe ihn um, reiße ihn mit dem Daumen auf und ziehe eine kleine Karte mit Blumenmotiv heraus. Als ich sie aufklappe, fällt ein Scheck heraus und schwebt zu Boden.
Die Karte lasse ich auf die Theke fallen, dann atme ich langsam aus. Ich kann mich nicht überwinden, den Scheck aufzuheben und nachzusehen, auf welchen Betrag er ausgestellt ist. Jedenfalls noch nicht.
«Bereit für einen Spaziergang?», frage ich Roscoe stattdessen. Er dreht sich im Kreis, ein unmissverständliches Ja, und da lächle ich. Das ist das Schöne an Tieren – sie passen sich an.
Seit ich nachtaktiv geworden bin, ist Roscoe es auch.
Ich weiß noch, wie ich Dr. Harris ansah, vor neun Monaten bei unserem ersten Termin. Dem ersten von vielen. Ich konnte meine Augen zwar nicht sehen, aber ich spürte sie. Sie waren überanstrengt und brannten. Ich wusste, dass sie blutunterlaufen waren, die Äderchen, die eigentlich unsichtbar sein sollten, verzweigten sich auf meiner Lederhaut wie blutige Risse auf einer Windschutzscheibe nach einem Autounfall. Irreparabel. Egal, wie oft ich blinzelte, es wurde nicht besser. Es fühlte sich beinahe so an, als bestünden meine Lider aus Schleifpapier, das bei jedem Blinzeln über meine Pupillen rieb.
«Wann haben Sie zuletzt eine ganze Nacht durchgeschlafen?», erkundigte er sich. «Können Sie sich daran erinnern?»
Natürlich konnte ich das. Natürlich konnte ich mich erinnern. An dieses Datum würde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern, auch wenn ich noch so sehr versuchte, es zu verdrängen. Auch wenn ich noch so wünschte, es wäre nur ein Albtraum. Ein schrecklicher, grauenhafter Albtraum, aus dem ich jede Minute erwachen konnte. Jede Sekunde.
«Am Sonntag, den sechsten März.»
«Das ist lange her», sagte er und blickte auf das Klemmbrett auf seinem Schreibtisch. «Drei Monate.»
Ich nickte. Eine Auswirkung dieses ewigen Wachseins war, wie mir allmählich auffiel, dass Kleinigkeiten von Tag zu Tag größer zu werden schienen. Lauter, schwerer zu ignorieren. Das Ticken der Uhr in der Ecke war ohrenbetäubend laut, so als klopfte jemand mit einem langen Nagel stetig an Glas. Der Staub in der Luft war ungewöhnlich deutlich zu erkennen, lauter kleine Körnchen, die langsam durch mein Blickfeld schwebten, so als hätte jemand an meinen Voreinstellungen herumgespielt und Zeitlupe und die höchste Auflösung eingestellt. Ich konnte die Überreste von Dr. Harris’ Mittagessen riechen, winzige Thunfischpartikel, die durch sein Sprechzimmer und mir fischig-salzig in die Nase schwebten. Mein Magen zog sich zusammen.
«Ist in dieser Nacht damals etwas Ungewöhnliches passiert?»
Ungewöhnlich.
Bis ich am nächsten Morgen wach wurde, war nichts Ungewöhnliches an dieser Nacht gewesen. Tatsächlich war sie sogar quälend normal gewesen. Ich zog meinen Lieblingsschlafanzug an, hielt mein Haar mit einem Stirnband aus dem Gesicht und entfernte das Make-up. Und dann brachte ich natürlich Mason ins Bett. Ich las ihm eine Geschichte vor, aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, welche es war. Ich weiß noch, wie ich Tage später in seinem Zimmer stand, nachdem das gelbe Absperrband der Polizei vor der Tür entfernt worden war. Die Stille, die im Kinderzimmer herrschte, schien den Raum auf die dreifache Größe auszudehnen. Ich stand da und betrachtete sein Bücherregal – Gute Nacht, lieber Mond, Die kleine Raupe Nimmersatt,Wo die wilden Kerle wohnen –, während ich verzweifelt überlegte, welche Geschichte es gewesen war. Was meine letzten Worte an meinen Sohn gewesen waren.
Aber ich konnte es nicht. Ich konnte mich nicht erinnern. So normal war diese Nacht gewesen.
«Unser Sohn», warf Ben ein und legte mir die Hand aufs Knie. Ich sah meinen Ehemann an, erinnerte mich erst jetzt wieder an seine Gegenwart. «Er wurde in dieser Nacht aus seinem Kinderzimmer entführt. Während wir schliefen.»
Das muss Dr. Harris natürlich bereits gewusst haben. Der gesamte Bundesstaat Georgia wusste davon – ganz Amerika sogar. Der Arzt neigte den Kopf, wie es anscheinend die meisten Menschen tun, wenn sie ihren Fehler erkennen und nicht wissen, was sie sonst sagen sollen. Es war, als würde er einen Deckel zuklappen. Unterhaltung beendet.
«Aber Izzy hatte schon immer … Probleme», fuhr Ben fort. Mit einem Mal fühlte ich mich, als müsste ich nachsitzen. «Mit dem Schlaf. Schon vor der Schlaflosigkeit. Genau genommen sozusagen das gegenteilige Problem.»
Dr. Harris musterte mich, als wäre ich ein Rätsel, das gelöst werden musste.
«In etwa fünfzig Prozent der Fälle besteht ein Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und Angst, Depression oder irgendeiner Form von psychosozialen Problemen. Insofern ergibt das Sinn angesichts dessen, was Sie durchgemacht haben», sagte er und ließ seinen Kugelschreiber klicken. «Schlaflosigkeit ist da keine Ausnahme.»
Ich weiß noch, dass ich aus dem Fenster sah und die Sonne hoch am Himmel stand. Meine Lider wurden sekündlich schwerer, und mein Hirn umwölkte sich, als hüllte mich Nebel ein wie eine Decke. Der Kugelschreiber klickte noch immer, in meinen Ohren so laut wie eine tickende Zeitbombe, die gleich explodieren würde.
«Wir machen ein paar Untersuchungen», sagte er schließlich. «Möglicherweise verschreibe ich Ihnen was. Das bekommen wir in null Komma nichts wieder hin.»
Als ich jetzt nach Roscoes Leine greife, sehe ich mich kurz im Flurspiegel und zucke zusammen. Es ist eine unwillkürliche Reaktion, so wie man die Finger von der heißen Herdplatte wegreißt. Ich sollte mitfühlender mir selbst gegenüber sein, ich weiß. Ich habe viel durchgemacht. Aber der Schlafmangel zeichnet sich so deutlich in meinem Gesicht ab, dass er kaum zu übersehen ist. Ich scheine in den letzten Monaten um Jahre gealtert zu sein. Ich habe dicke Ringe unter den Augen, und die schmalen Hautstreifen unter meinen Tränenkanälen haben sich von einem warmen Olivton zu einem dunklen Violett verfärbt. Es sieht aus wie Veilchen, während der Rest meines Gesichts aschgrau ist wie ein Hühnchen, das schon zu lange im Kühlschrank liegt. Ich habe in zehn Monaten neun Kilo abgenommen. Das klingt nicht nach so viel, aber wenn man sowieso groß und dünn ist, macht es sich bemerkbar. Es zeigt sich an meinen Wangen, am Hals. An meiner Taille – oder vielmehr daran, dass ich keine habe. Auch mein früher glänzendes dunkelbraunes Haar sieht aus, als ob es abstirbt; die Spitzen sind gespalten wie ein Baum, in den der Blitz eingeschlagen hat, und die Farbe wird von Tag zu Tag matter.
Ich zwinge mich, mich umzudrehen und Roscoe die Leine anzulegen, dann verlassen wir das Haus. Die kühle Nachtluft prickelt auf meiner Haut. Ich schließe hinter uns ab, wende mich nach rechts, und wir machen uns auf den üblichen Weg.
Isle of Hope ist ein winziges Fleckchen Land, gerade einmal sechs Quadratkilometer groß. Ich habe es schon Hunderte Male durchmessen und mir eingeprägt, wie der Skidaway River sich über den Ostteil schlängelt wie eine glänzende Wassermokassinotter. Wie die Eichen über dem Bluff Drive einen gewaltigen Bogen bilden, die knorrigen Glieder mit der Zeit ineinander verschlungen haben wie arthritische Finger. Doch es ist erstaunlich, wie vollständig ein Ort sich im Dunkeln verwandelt: Straßen, an denen man sein gesamtes Erwachsenenleben verbracht hat, sehen völlig anders aus, sodass man den Eindruck hat, anstatt über glattes Pflaster liefe man direkt in den trüben Fluss. Mit einem Mal fallen einem Straßenlaternen auf, die man sonst immer übersehen hat und deren Licht, das heller und wieder dunkler wird, während man von einer zur nächsten geht, die einzige Möglichkeit darstellt, um Entfernungen und Abstände zu schätzen. Schatten werden zu Gestalten; jede kleine Bewegung zieht den Blick auf sich – trockenes Laub, das über den Boden tanzt, oder eine Schaukel, die, angetrieben von Phantomkinderbeinen, im Wind quietscht. Die Fenster sind dunkel, die Vorhänge zugezogen. Bei jedem Haus, an dem ich vorbeigehe, versuche ich, mir vorzustellen, was drinnen vorgeht – ein Kind regt sich sachte im Schlaf, ein Nachtlicht wirft übernatürlich wirkende Schatten an die Wand. Eheleute im Bett, Haut an Haut, eng ineinander verschlungene Leiber unter der Bettdecke – oder vielleicht auch so weit wie irgend möglich voneinander entfernt liegend, getrennt durch eine unsichtbare, kalte Grenze in der Mitte.
Was mich betrifft, mir ist beides vertraut.
Und dann sind da die Geschöpfe der Nacht. Die Lebewesen, die wie ich in Abwesenheit der anderen aus ihren Verstecken kriechen und lebendig werden. Waschbären huschen durch die Schatten und durchwühlen den Müll. In der Ferne schreit eine Eule. Schlangen gleiten aus ihrem schattigen Unterschlupf und lassen nichts als ihre eigene vertrocknete Haut zurück. Der Gesang der Grillen, Zikaden und anderer unsichtbarer Wesen ein stetiger Pulsschlag im Gras, wie der, der das Blut durch die Adern pumpt.
Ich gehe bis an das Sumpfgebiet am Rande meines Wohnviertels, bleibe stehen und starre hinaus auf das tintenschwarze Wasser, das ich ans Ufer plätschern höre. Ich bin in Beaufort geboren, gerade einmal eine gute Stunde von hier entfernt. Ich wohne schon mein ganzes Leben lang am Wasser. Als ich schwimmen lernte, kitzelten mich kleine Fische an den Füßen, und ich hörte die Garnelen bei Ebbe dicht unter der Wasseroberfläche dahinhuschen. Ich band Hühnerköpfe an eine Schnur und hängte sie stundenlang ins Wasser, wartete geduldig, bis ich voller Aufregung diese vertraute Bewegung am Ende der Leine spürte, beobachtete zahllose Tiere, die sich in ihr eigenes Verderben nagten – ein krankes Vergnügen, was mir damals aber gar nicht klar war.
Jetzt atme ich den Geruch des Sumpfs ein. Schon ein einziger Hauch versetzt mich zurück nach Hause. Erinnert mich an die Luft dort, die von Salz durchdrungen und dick wie Buttermilch ist. An den vertrauten Fäulnisgestank des Schlicks, der dem eines verfaulten Zahns ähnelt. Denn das ist es ja auch. Es ist der Gestank der Fäulnis; der flüssige Kuss von Leben und Tod.
Millionen von Lebewesen, die zusammen sterben, und Millionen andere Lebewesen, die das ihr Zuhause nennen.
Ich starre in die Ferne und betaste instinktiv die zarte Haut hinter meinem Ohr. Die Stelle, zu der es mich immer zieht, wenn ich in einer Erinnerung feststecke. In dieser Erinnerung. Ich versuche zu ignorieren, dass sich mein Magen anfühlt, als steckte jemand seine Hand hinein, packte zu und ließe nicht mehr los.
Schließlich sehe ich Roscoe an, der direkt am Wasser steht. Auch er starrt in die Dunkelheit, hat den Blick auf etwas in der Ferne gerichtet.
«Na komm», sage ich und ziehe an der Leine. «Ab nach Hause.»
Wir machen uns auf den Heimweg. Als wir wieder zu Hause sind, schließe ich die Tür ab und fülle erst einmal Roscoes Wassernapf auf, bevor ich die diversen Essensreste im Kühlschrank hin und her schiebe. Schließlich nehme ich eine Tupperdose Spaghetti heraus, öffne den Deckel und schnuppere daran. Die feuchten Nudeln klumpen zusammen. Ich lasse sie in eine Schüssel plumpsen und stelle sie in die Mikrowelle. Während mein Abendessen sich darin dreht, starre ich auf die Uhr, deren kleine digitale Ziffern im Dunkeln leuchten.
3:14 Uhr.
Als die Mikrowelle piept, nehme ich die Schüssel heraus, trage sie ins Esszimmer und schiebe die verschiedenen Papiere und Mappen sowie die Haftnotizen auf dem Tisch beiseite, die ich mit mitternächtlichen Gedanken gefüllt habe. Als ich einen Stuhl vom Tisch abrücke, scharrt er über den Boden, und da trottet Roscoe zu mir herüber und legt sich zu meinen Füßen hin, während ich die Gabel in die Pasta stecke und drehe.
Dann betrachte ich die Wand, und meine Haut kribbelt, als die Wand meinen Blick erwidert.
Ich sehe in die lächelnden Gesichter meiner Nachbarn, deren Fotos ich aus Gemeindeverzeichnissen und Schuljahrbüchern ausgeschnitten habe; auch ihre Aussagen und Alibis, ihre Hobbys und Tagesabläufe hängen dort an der Wand. Ich analysiere die toten Augen auf erkennungsdienstlichen Fotos, den Gesichtsausdruck von Fremden, deren Bilder ich den Dienstbüchern der Polizei entnommen oder aus Zeitungsartikeln herausgerissen habe. All das ziert jetzt eine Wand meines Esszimmers wie die Collage einer Schülerin auf der Highschool – es ist eine Obsession, von der ich nicht weiß, wie ich sie in den Griff bekommen soll. Also betrachte ich stattdessen diese Wand. Überlege. Versuche, durch das Papier hindurch in die Köpfe dieser Menschen zu schauen, ihre Gedanken zu lesen. Denn wie schon die Passagiere im Flugzeug hat auch da draußen jemand ein Geheimnis.
Irgendjemand irgendwo kennt die Wahrheit.
KAPITEL VIER
DAMALS
Mit einem Ruck werde ich wach. Es ist die Sorte panisches Hochschrecken, die von einer zuknallenden Tür oder zersplitterndem Glas ausgelöst wird: Man taucht nicht sanft aus dem Schlaf auf, sondern wird grob herausgerissen. Sofort weiß ich, dass ich nicht allein bin. Ein anderer Körper schmiegt sich an mich, warm und ein bisschen feucht wie eine undichte Heizung. Heiße Atemzüge an meinem Hals.
Ich drehe mich um und blinzle rasch, als mein Blick auf zwei große Augen fällt.
«Du hast es schon wieder getan.»
Mit den Handrücken reibe ich mir die Augen und mustere meine Schwester, deren feuchtes Haar ihr am Kopf klebt wie Fäden aus geschmolzenem Karamell. Den Daumen sanft in den Mund gesteckt, blickt sie mich erwartungsvoll an. Ich versuche, mich daran zu erinnern, wann sie gestern Abend in mein Zimmer kam, meinen schweren Arm anhob, sich mit ihrem kleinen Körper an mich schmiegte und sich meinen Arm dann wie einen Sicherheitsgurt über den Bauch legte.
Ich versuche es, aber ich erinnere mich nicht.
«Tut mir leid», sage ich.
«Es macht mir Angst, wenn du das tust.»
«Schon gut.» Ich befeuchte meine Finger und streiche eine besonders dicke Strähne auf ihrer Stirn glatt wie eine Katze, die ein Neugeborenes ableckt. «Es ist nur Schlafwandeln.»
«Ja, aber ich mag es nicht.»
«Ich kann nichts dagegen tun», fauche ich. Eine Sekunde lang bin ich genervt. Ich bin morgens immer wie benommen, immer ein bisschen reizbar, so als wäre mein Hirn verstört darüber, dass es gezwungen wird, aufzuwachen und sich an die Arbeit zu machen. Aber dann fällt mir wieder ein, dass auch sie nichts dagegen tun kann. Sie ist erst sechs.
Also zwinge ich mich, tief durchzuatmen.
«Was habe ich gemacht?»
«Einfach dagestanden.» Sie liegt auf der Seite, den Kopf ins Kissen gedrückt, sodass die Wange ein bisschen gequetscht wird. «Deine Augen waren offen.»
Ich drehe mich auf den Rücken, sehe an die Decke und folge mit dem Blick dem Riss, der am Kronleuchter beginnt und sich auswärts verzweigt wie ein kleines Flussdelta. Ein Verkehrsknotenpunkt. Ich habe schon immer einen sehr tiefen Schlaf gehabt, schon so lange ich zurückdenken kann. Sobald mein Kopf das Kissen berührt, falle ich in einen tiefen Schlaf, und nichts kann mich wecken. Nichts. Vor einigen Monaten habe ich weitergeschlafen, obwohl der Rauchmelder gleich vor meinem Zimmer laut piepte. Später wurde ich von selbst wach und stand draußen vor dem Haus, im Nachthemd. Es stank penetrant nach Rauch. Ich erinnere mich noch an das Gefühl des taufeuchten Rasens an meinen nackten Füßen, während mein Vater im Dunkeln meine Hand drückte. Offenbar war ich mit ihm nach draußen gegangen, meine Hand fest in seiner. Eine halbe Stunde lang hatte ich so dagestanden, steif und aufrecht und vollständig bewusstlos, während die Feuerwehrleute die Flammen löschten, die unsere Küche erfasst hatten und an den Wänden emporzüngelten.
«Wo war ich?», frage ich.
«In meinem Zimmer.» Margarets Blick wandert noch immer kreuz und quer über mein Gesicht. «Du hast mich geweckt.»
Mir wird heiß vor Scham bei der Vorstellung, dass meine kleine Schwester sich meinetwegen im Schlaf beobachtet gefühlt hat. Dass sie die Augen aufschlug, ein paarmal blinzelte, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, und sie mich schließlich reglos dort stehen sah.
«Hast du versucht, mich zu wecken?»
«Nein. Mom hat gesagt, das soll ich nicht. Das ist gefährlich.»
«Es ist nicht gefährlich. Das ist ein Ammenmärchen.»
Margaret schiebt sich tiefer unter meine Bettdecke, und ich versuche mit aller Macht, es mir vorzustellen: wie meine Augen aufklappen und leblos vor sich hinstarren. Wie mein Oberkörper sich aufrichtet und zur Seite dreht, wie meine mageren Beine sich aus dem Bett schwingen und herabbaumeln, als säße ich am Ende des Stegs und ließe die Zehen ins Wasser hängen, blind für das Leben, das direkt unter der Oberfläche lauert; wie ich über den weichen Shaggy-Teppich durch mein Kinderzimmer gehe, die Tür öffne und den Flur entlangtappe.
Ich versuche, es mir vorzustellen, aber ich kann es nicht.
«Was hast du getan?»
«Einfach dagelegen und gewartet, bist du wieder gehst», sagt sie. «Dann bin ich dir in dein Zimmer hinterhergegangen.»
«Warum bist du zu mir ins Bett geklettert?»
«Weiß nicht.» Sie zuckt die Achseln. «Ich konnte nicht schlafen. Das mache ich immer, wenn ich Angst habe.»
Ich sehe meine Schwester an, lege ihr die Hand an die Wange und lächle. Margaret, mein kleiner Schatten. Sie folgt mir überallhin. Kommt immer zu mir gelaufen, wenn sie Angst hat – offenbar sogar dann, wenn sie vor mir Angst hat.
«Wie lange machst du das denn noch?», fragt sie.
«Weiß nicht», sage ich seufzend. Und das stimmt auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie oft es passiert, aber gemessen daran, wie oft ich in den letzten Monaten an seltsamen Orten wach geworden bin, kommt es wohl nicht selten vor. Mal stand ich stocksteif in unserem Wohnzimmer, während der Fernseher lautlos ein blaues Licht verströmte. Ein andermal saß ich mit einer Schale Müsli im Dunkeln am Küchentisch. In meinem weißen Nachthemd spuke ich, beleuchtet vom Mondlicht, durchs Haus wie der Geist irgendeines verirrten, einsamen Mädchens. Der Arzt sagt, es ist harmlos – bei Kindern in meinem Alter kommt es sogar oft vor –, aber dass mein Körper unabhängig von meinem Kopf handelt, ist einfach ein bisschen unheimlich. Als es zum ersten Mal passiert ist, wurde ich in Margarets Zimmer auf dem Fußboden wach; Margaret saß direkt neben mir und spielte mit Puppen. Sie hatte nicht einmal gemerkt, dass ich schlief. «Dad hat gesagt, das wächst sich aus.»
«Aber wann?»
«Ich weiß es nicht, Margaret.» Ich beiße mir in die Wange, ganz fest, damit ich nicht irgendetwas Gemeines sage. Etwas, das ich bereuen würde. «Aber es tut mir leid, okay? Ich werde dir nichts tun. Versprochen.»
Sie sieht mich an und denkt über meine Worte nach, dann nickt sie.
«Jetzt lass uns nach unten gehen», sage ich und schlage die Bettdecke zurück.
Ich schwinge die Beine aus dem Bett, um aufzustehen, aber dann erstarre ich. Ich bekomme einen Kloß im Hals und spüre eine Angst tief in meinem Inneren, an die ich nicht herankomme. Auf dem Teppich sind Fußabdrücke – nur schwach sichtbar, aber trotzdem –, eine kleine Schmutzspur von der Zimmertür zu meinem Bett. Ich schlucke, und mein Blick zuckt zum Fenster. Zu dem zweitausend Quadratmeter großen Rasen, der sanft zum Sumpf hin abfällt.
Verstohlen reibe ich mit dem Fuß über einen der Abdrücke, ganz fest, versuche, ihn verschwinden zu lassen.
«Na komm», sage ich schließlich und hoffe, Margaret sieht die Spuren nicht. «Lass uns frühstücken.»
KAPITEL FÜNF
JETZT
Die Mittagsnachrichten raunen im Hintergrund, während ich durchs Haus schlurfe und mir die dritte Tasse Kaffee mache. Mittlerweile habe ich geduscht und mich umgezogen. Beim ersten Licht, das durchs Fenster hereinsickerte, quälte ich mich von der Couch hoch und ging ins Bad, stellte mich unter die Dusche, hob den Kopf und ließ mir das Wasser aufs Gesicht prasseln.
Dann schloss ich die Augen, hielt den Atem an. Stellte mir wie so oft schon vor, wie es sich anfühlen könnte zu ertrinken.
Erschöpfung hat eigenartige Auswirkungen auf das Gehirn, denen mit Vernunft nur schwer beizukommen ist. Die schwer zu erklären sind. Seit ich nicht mehr schlafe, denke ich viel über Folter nach – und zwar nicht über die offen gewaltsame, wenn etwa jemandem mit einer rostigen Klinge ins Fleisch geschnitten oder ein ausgestreckter Finger mit einer alten Kneifzange bearbeitet wird. Ich denke über die Art Folter nach, die mit ausgesucht normalen Dingen arbeitet. Über die Sorte, die bei lebensnotwendigen Bedürfnissen ansetzt, um unsere schlimmsten Seiten zum Vorschein zu bringen: Schlafentzug, Hunger, Isolation, sensorische Deprivation, Waterboarding.
Ich weiß mittlerweile, wie das ist. Ich weiß, dass es einen in den Wahnsinn treibt, mitten in der Nacht wach zu liegen ohne andere Gesellschaft als die eigenen Gedanken.
Natürlich habe ich im vergangenen Jahr ein wenig Schlaf bekommen. Sonst wäre ich tot. Ich bin in Warteräumen oder Taxis eingedöst, blinzelte irgendwann, sah auf die Uhr und erkannte, dass ich nicht wusste, wo die letzte Stunde geblieben war. Dazu, immer wieder über den Tag verteilt, Sekundenschlaf: wenige Augenblicke intensiver, tiefer, verwirrender Bewusstlosigkeit, die aus dem Nichts zu kommen scheint und fast ebenso schnell wieder verflogen ist. Unruhige Nickerchen auf der Couch, bei denen ich jede Viertelstunde wach werde. Anfangs verschrieb Dr. Harris mir Schlaftabletten, von denen ich jeden Abend bei Sonnenuntergang eine nehmen sollte. Ich habe es ein paarmal versucht, aber die Dosis war nicht stark genug, deshalb begann ich, sie zu horten, und nahm drei oder vier auf einmal. Davon wurden mir die Lider tatsächlich schwer, doch ich wurde trotzdem jedes Mal nach wenigen Stunden wieder wach und war dann erschöpft und langsam, unfähig zu denken. Unfähig, irgendetwas zu tun.
Manchmal ist der Verstand einfach stärker als unsere Versuche, ihn auszuschalten.
Jetzt sitze ich am Küchentisch, die Hände um den Kaffeebecher gelegt, und starre auf den zugeklebten Briefumschlag vor mir, den ich dem Mann mit dem Klemmbrett gestern Abend verlegen aus der Hand riss. Verlegen deshalb, weil ich mir vorkam wie eine Nutte, die ihr Geld kassiert – schließlich habe ich mich gegen Bezahlung vor diesen Leuten entblößt.
Zwar nicht körperlich, aber doch seelisch, und das fühlt sich irgendwie noch schlimmer an.
Ich trinke einen Schluck Kaffee und drehe den Umschlag um, öffne ihn und lasse den Inhalt auf den Tisch gleiten. Dies ist mein Honorar: die vollständige Teilnehmerliste – Namen und E-Mail-Adressen sämtlicher Personen, die eine Eintrittskarte erworben haben. Der Detective, der die Ermittlungen in Masons Fall leitet, sagte mir einmal, dass Verbrecher häufig bei öffentlichen Veranstaltungen wie Pressekonferenzen und Gedenkfeiern auftauchen, um den Rausch erneut zu durchleben, indem sie noch ein bisschen mehr riskieren – oder um sich über den neuesten Stand der Ermittlungen zu informieren. Diesem Argument folgend, verlange ich seither bei jeder Tagung, auf der ich spreche, die Teilnehmerliste und hoffe, dass jemand aus der Masse heraussticht. Anfangs sperren sich die Organisatoren immer gegen diese Forderung. Sie behaupten, das verstoße gegen den Datenschutz, bis ich sie darauf hinweise, dass die Teilnehmer bereits mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen in die Weitergabe ihrer Daten eingewilligt haben.
Es stand im Kleingedruckten. Es steht immer im Kleingedruckten.
Am Ende willigen sie jedes Mal ein. Schließlich könnte eine Rednerin wie ich durchaus Tausende von Dollars pro Auftritt verlangen – ein öffentlichkeitswirksamer Fall, unaufgeklärt, aber noch nicht zu den Akten gelegt. Doch stattdessen verlange ich nur dies: Informationen. Zugang zu etwas, irgendetwas, das mir möglicherweise weiterhilft.
Ich überfliege die nach Vornamen alphabetisch sortierte Liste.
Aaron Pierce, Abigail Fisher, Abraham Clark, Adam Shrader.
Es läuft immer gleich ab: Ich gebe den Namen bei Facebook ein, sichte die Profile und versuche herauszufinden, wo die Leute leben. Achte insbesondere auf kinderlose Frauen. Auf einsame Seelen mit zu vielen Katzen und zu viel Freizeit. Oder auch auf Männer, bei denen die Alarmsirenen schrillen, die irgendwie in unser Hirn eingebaut sind. Auf die Typen mit Augen wie Eiswürfeln, kalt und hart, bei denen sich uns die feinen Härchen im Nacken aufstellen, ohne dass wir den Finger darauf legen könnten, warum.
Alexander Woodward, Alicia Bryan, Allan Byers, Bailey Deane.
Als Nächstes sehe ich im Register für Sexualstraftäter nach. Wenn mir irgendetwas Ungewöhnliches an jemandem auffällt, markiere ich den Namen, wende mich dem nächsten zu, und alles beginnt von vorn.
Es ist eine ermüdende, todlangweilige Arbeit, aber ohne Verdächtige und ohne Spuren ist das alles, was ich tun kann. Etwas anderes habe ich nicht.
Einige dieser Namen kommen mir vage vertraut vor, und dann weiß ich, ich habe sie schon einmal überprüft. Nach einer Weile begegnet man denselben Menschen immer wieder. Es gibt Stammgäste bei diesen Veranstaltungen, und sie finden mich immer irgendwie, stellen sich noch einmal vor oder gehen einfach davon aus, dass ich sie wiedererkenne. Erwarten, dass ich auf ihre Fragen und ihr Geplauder eingehe, als wäre ich irgendeine Autorin, die sie in ihrem Lesekreis behandeln.
Als müsste ich sie fragen, was sie von meiner Geschichte halten, von dem offenen Ende. Was sie ganz allgemein von alledem halten.
Es sind die Kleinigkeiten, die mich am meisten stören: wie sie mir behutsam die Hand auf den Arm legen, als hätten sie Angst, ich könnte zerbrechen. Dass sie den Kopf schräg legen wie neugierige Welpen und immer ein bisschen zu leise sprechen, sodass ich mich vorbeugen muss, um sie zu verstehen. Von dem blumigen Parfüm, das sie sich hinter die Ohren getupft haben, und ihrem warmen, schalen Atem dreht sich mir der Magen um.
«Nicht auszudenken», sagen sie am Ende, «was Sie durchgemacht haben.»
Und da haben sie recht. Sie können es sich nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen, bis man selbst mittendrin steckt, es selbst erlebt, und dann ist es zu spät.
Dann ist die Gewalt schon bei einem angekommen.
Roscoe schnarcht zu meinen Füßen, er atmet regelmäßig und friedlich. Mit einem Mal klirren die Anhänger an seinem Halsband, weil er den Kopf hebt und zur Haustür sieht. Beklommen verfolge ich, wie er aufsteht, ans Fenster trottet und sich geduldig hinsetzt, als draußen der Schatten eines Mannes erscheint. Ich kneife die Augen zu, atme tief durch, lege die Hand auf die Brust und reibe über die Halskette, die unter meinem T-Shirt verborgen ist. Dann gehe ich zur Tür.
Noch bevor ich das Klopfen höre, weiß ich, wer es ist.
«Guten Morgen», sage ich, während ich die Tür öffne, und sehe meinen Ehemann an. Zu spät wird mir klar, dass es schon Nachmittag ist. «Was für eine Überraschung.»
«Hey», sagt Ben und blickt überallhin, nur nicht mir in die Augen. «Darf ich reinkommen?»
Ich mache die Tür weiter auf und winke ihn herein. Sein Auftreten ist so steif und höflich, als wären wir Fremde. Als hätten wir nicht einmal zusammen in ebendiesem Haus gewohnt; als hätten seine Lippen nicht schon jeden Zentimeter meiner Haut berührt, als hätten seine Finger nicht schon jedes Muttermal, jede Hautunreinheit und jede Narbe erkundet. Er bückt sich, streichelt Roscoe und flüstert immer wieder «Braver Junge». Ich beobachte ihren natürlichen, unaufgeregten Umgang und wünschte, Roscoe würde die Zähne fletschen. Würde meinen Mann drohend anknurren, weil er ihn – uns – verlassen hat.
Stattdessen leckt er Ben die Finger.
«Was kann ich für dich tun?», frage ich und verschränke die Arme vor der Brust.
«Wollte nur nach euch sehen. Heute, du weißt schon.»
«Klar. Ich weiß.»
Heute. Der dreihundertfünfundsechzigste Tag. Ein volles Jahr seit unserem letzten Tag mit Mason. Ein Jahr, seit ich ihm die letzte Geschichte vorlas und ihn gut zudeckte; seit ich mich neben Ben ins Bett legte und die Augen schloss, mühelos in einen langen, ruhigen Schlaf hinüberglitt, in seliger Unwissenheit um die Hölle, die uns am Morgen erwarten würde.
«Kannst immer noch nicht schlafen, hm?»
Ich versuche, nicht gekränkt zu sein – ich weiß, er meint es nicht so –, aber trotzdem ist es mir unangenehm, wenn er mich so sieht.
«Woher weißt du das?»
Ich versuche zu lächeln, um ihm zu zeigen, dass das ein Witz war, aber ich bin mir nicht sicher, wie dieses Lächeln ausfällt. Vielleicht ein bisschen irre, denn er erwidert es nicht.
Es begann als das verzweifelte Bedürfnis, wach zu bleiben für den Fall, dass Mason zurückkäme. Irgendjemand hatte mir meinen kleinen Liebling schließlich genommen. Irgendjemand hatte ihn mir weggenommen, und ich hatte es verschlafen. Welche Mutter tut so etwas? Welche Mutter wird davon nicht wach? Ich hatte das Gefühl, ich hätte es wissen sollen. Irgendein Urinstinkt hätte mir sagen müssen, dass etwas passierte, dass da etwas nicht stimmte. Aber da war nichts. Ich spürte nichts. Daher nahm ich mir an den ersten Abenden danach vor, wach zu bleiben, vorsichtshalber. Vielleicht würde er ja in seinem Zimmer sein, wenn ich mitten in der Nacht nachsah, würde aufrecht in seinem Kinderbettchen sitzen, als wäre er nie fort gewesen. Würde strahlend lächeln, wenn er mich erblickte. Würde die Hände nach mir ausstrecken, in einer Hand sein Lieblingsstofftier, und sich endlich sicher fühlen.
Dafür wollte ich wach sein – nein, dafür musste ich wach sein.
Doch aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen Monate, und Mason war noch immer nicht wieder zu Hause. Mittlerweile war ich anders verdrahtet. Ich war verändert. Irgendetwas in meinem Hirn hatte nachgegeben wie ein überdehntes Gummiband. Anfangs redete Ben auf mich ein, versuchte, mich vom Fenster wegzuziehen, wo ich wie angewurzelt stand und in die Dunkelheit starrte.
«Das nützt doch niemandem», sagte er dann. «Izzy, du brauchst Schlaf.»
Und ich wusste, dass er recht hatte – ich wusste, dass es niemandem nützte –, aber ich konnte es nicht ändern. Ich konnte nicht schlafen.
«Wie läuft die Arbeit?», fragt Ben jetzt, bemüht, ein Gespräch anzufangen.
«Zäh», sage ich und streiche mir eine Haarsträhne hinters Ohr. Ich habe das Haar an der Luft trocknen lassen, und jetzt ist meine Stirn von einem kitzelnden Kranz feiner Härchen umgeben. «Ich bekomme im Moment nicht gerade haufenweise Anfragen.»
«Ich hätte gedacht, dass es besser als sonst läuft», bemerkt er, geht zur Couch und setzt sich. Es ärgert mich, dass er mich nicht um Erlaubnis fragt, andererseits: Er hat sie ja bezahlt. «Du weißt schon, in Anbetracht der öffentlichen Aufmerksamkeit.»
«Ich möchte das nicht ausschlachten.»
«Und mit dem, was du im Augenblick machst, tust du das nicht? Inwiefern?»
Ich starre Ben an, und er starrt zurück. Deshalb ist er hier – deshalb ist er wirklich hier. Er muss irgendwie davon erfahren haben, von meinem Vortrag. Mir war klar, dass er irgendwann davon erfahren würde, bloß nicht so schnell.
«Warum rückst du nicht einfach mit der Sprache raus? Komm schon, Ben. Sag’s einfach.»
«Na gut, ich sag’s. Was tust du da, verdammt noch mal?»
«Ich sorge dafür, dass die Ermittlungen weiterlaufen.»
«Die laufen doch weiter», erwidert er entnervt. Wir haben diese Unterhaltung schon so oft geführt. «Isabelle, die Polizei arbeitet daran.»
Isabelle. Er nennt mich nicht mehr Izzy.
«Du musst damit aufhören. Mit alldem», sagt er und deutet zum Esszimmer. Mir ist nicht entgangen, dass er eben, als er um die Ecke bog, einen Blick hineingeworfen und sich unwillkürlich geduckt hat, als rechnete er mit einem Schlag. Dann ließ er den Blick über die ganzen Fotos wandern, die den Platz einnehmen, wo früher ein Ölgemälde von unserer Hochzeit hing. «Das ist nicht gesund. Außerdem wirkt es …»
«Wie wirkt es denn?», unterbreche ich ihn, und Wut steigt in mir auf. «Bitte, sag’s mir.»
«Es wirkt falsch.» Er ringt die Hände. «Dass du dich da vor diese durchgeknallten Leute stellst, am Tag vor dem Jahrestag. Es wirkt nicht normal.»
«Und was genau würde besser wirken, Ben? Was würde normal wirken? Nichts zu tun?»
Ich sehe ihn an, und meine Fingernägel bohren sich in die Handfläche.
«Sie haben nichts», fahre ich fort. «Sie haben niemanden, Ben. Wer das auch getan hat, er läuft immer noch da draußen rum. Der, der ihn entführt hat …» Ich breche ab und beiße mir auf die Lippe, damit ich nicht in Tränen ausbreche. Dann atme ich tief durch und unternehme einen neuen Anlauf. «Ich verstehe nicht, warum dir das nicht wichtig ist. Warum du ihn nicht finden willst.»
Ben springt auf, mit einem Mal hochrot im Gesicht, und da weiß ich, dass ich zu weit gegangen bin.
«Sag das niemals», schreit er und zeigt mit dem Finger auf mich. Auf seiner Lippe zittert ein Speicheltröpfchen. «Wirf mir gefälligst nicht vor, es wäre mir nicht wichtig. Du hast keine Ahnung, wie das für mich ist. Er war auch mein Sohn.»