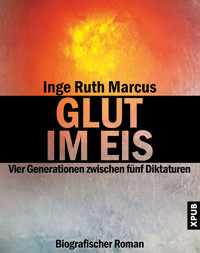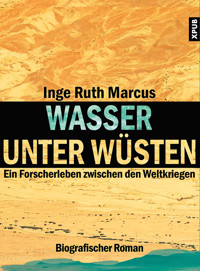
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XPUB GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beim Ausbruch des 1. Weltkriegs ist Helmut Westphal 12 Jahre alt. Als sein Bruder eingezogen wird, will er mit an die Front, um den Misshandlungen durch seinen Vater zu entkommen. Um seine Familie zu ernähren und Geld für sein Studium zu verdienen, verdingt er sich in der Landwirtschaft. Nach Studienabschluss bekommt er Aufträge, landwirtschaftliche Betriebe im Ausland zu modernisieren, zunächst eine Kooperative deutscher Auswanderer im Regenwald in Paraguay, danach ein Meiereiprojekt in der mongolischen Steppe. Aber er reist vergeblich um die halbe Welt, beide Unternehmen stehen vor dem Ruin. Er bekommt Aufträge als Kara-wanenführer, Dolmetscher und Forscher in der Mongolei und in Tibet. Mehrfach wird er gebeten, verschollene Deutsche und Schweden in Xinjiang zu suchen. Dabei gerät er in Gefangenschaft und Lebensgefahr. Schließlich bekommt er eine Anstellung als Ostasienreferent in Mandschukuo. Dort lernt er seine Frau kennen. Als das NS-Regime an die Macht kommt, schließt er sich dem Widerstand um Admiral Canaris an. 1945 überfällt und zerstört die Sowjetunion Mandschukuo. Helmut Westphal wird in Gulags verschleppt. Seine Frau flieht mit ihren Kindern nach Harbin zu ihrer sibirischen Mutter. In der Nachkriegszeit versucht die Familie, ihre Überlebenden wiederzufinden. Dieser Band ist die Fortsetzung von `Glut im Eis – vier Generationen in fünf Diktaturen´.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 888
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inge Ruth Marcus
Wasser unter Wüsten
Inge Ruth Marcus
Wasser unter Wüsten
Ein Forscherleben zwischen den Weltkriegen
Biografischer Roman
© 2023 Anthea Verlag
Hubertusstraße 14, 10365 Berlin
Tel.: 030 / 993 93 16
e-Mail: [email protected]
Verlagsleitung: Margarita Stein
www.anthea-verlag.de
Ein Verlag in der Anthea Verlagsgruppe
Satz: Daniel Aldridge
Umschlaggestaltung: Imanuel Marcus
Portraitfotografie: © Dieter Düvelmeyer
ISBN 978-3-89998-411-8 eISBN 978-3-91142-204-8
Diesen Familienroman widme ich meinem Sohn, meinen Enkeln und meinem Bruder
Vorbemerkungen
Der Roman folgt dem Lebenslauf meines Vaters, der in dieser biografischdokumentarischen Erzählung Helmut Westphal genannt wird. Über Helmut Westphal als Mensch kursierten unterschiedliche Darstellungen. Auch bei der Befragung von Verwandten, darunter seiner jüngsten Schwester, kamen Widersprüche zutage. Dabei zeigten alle Befragten eine Regung: Die Erinnerung an ihn ließ sie freudig schmunzeln.
Jahrelang folgte ich seinen Spuren, von seinen Veröffentlichungen über seine Korrespondenz mit Familie, Freunden, Verlagen und Behörden, in Akten des Bundesarchivs bis zu Berichten anderer Autoren über ihn, wie dem Asienforscher Sven Hedin. Zwar war dieser das Idol seiner Jugend und auch später eine wichtige Orientierung, aber als Sven Hedin ihn für Expeditionen engagierte, war er bereits ein anerkannter Asienforscher. Außerdem nahm er zunehmend und bedauernd Abstand von Sven Hedin, der ein glühender Verehrer des Nationalsozialismus geworden war. Die Summe der Quellen festigte das hier gezeichnete Bild von ihm und eine Gewissheit: Er war ein Rebell.
Von den zehn Expeditionen in China, der Mongolei und Tibet, an denen Helmut Westphal in verantwortlichen Funktionen beteiligt war, schildere ich acht, zu denen ich Informationen hatte. Sie unterscheiden sich in den Forschungsthemen sowie ihrem Umfang und Verlauf.
Die Erzählung beginnt mit den Hintergründen seines Lebenslaufs, der in sozialen Gegensätzen verstrickten Familie, der autoritätsfixierten und kriegerischen deutschen Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dazu gehörten unerschütterliche Freundschaften, die ihn begleiteten, und wegweisende Begegnungen, die sein Leben und seine Arbeit entscheidend beeinflussten. Über allem stand seine Persönlichkeit, die von Neugier, Humor, Freiheitsdrang und Streitbarkeit geprägt war.
Im Anhang befinden sich eine Liste der handelnden Personen, ein Sachregister, ein Medien- und Literaturverzeichnis, eine Landkarte mit Orten der Handlung sowie eine Landkarte mit den Gefängnissen und Gulags, in denen sich Helmut Westphal aufhielt.
Inge Ruth Marcus, März 2023
Deutschland 1895 – 1921
Die Eltern – Johanna und Waldemar Westphal
Man schrieb das Jahr 1895 als sich Johanna Mailand in seine Stimme verliebte. Es geschah während eines Besuch bei Verwandten in Bielefeld, die sie zu einem konzertanten Bittgottesdienst in die Nicolaikirche begleitete. Sie war gerade 21 Jahre alt geworden und von jugendlicher, schlanker Gestalt. In ihrem bodenlangen, hellblauen Taillenkleid bewegte sie sich leichtfüßig und elegant. Ihr lockiges Blondhaar war vom Scheitel an zu einem dicken Zopf geflochten, der bei jeder Bewegung über ihren Rücken pendelte. Mit großen blauen Augen beobachtete sie neugierig das Leben und Treiben ihrer Umgebung. Dabei achtete sie sorgfältig auf standesgemäßes Wohlverhalten, wie es sich gehörte setzte ihre Füße auswärts und trug außer Haus einen blumenreichen Hut und einen farblich abgestimmten Sonnenschirm, der sie vor unschicklicher Gesichtsbräune schützte.
Da sie in ihrer Heimatstadt Hannover selbst als Pianistin und Sängerin auf Festen ihrer namhaften Familie sowie in Kultursalons auftrat, hatte sie in musikalischer Hinsicht nichts Außergewöhnliches erwartet. Als die ersten Takte einer Arie der Oper ‘Xerxes’ von Händel erklangen, in der ein unglücklich Liebender sein Leid besingt, hatte sie sich entspannt zurückgelehnt. Sie kannte die vertonte Geschichte: Xerxes, ein persischer Herrscher hatte sich unsterblich in eine Platane verliebt, sie mit Schmuck behängt und von Wärtern bewachen lassen. Was dann folgte, hatte ihr den Atem genommen: Ein warmer, weicher Bariton hatte die Arie so zurückhaltend und gleichzeitig inbrünstig gesungen, als wäre der Sänger selbst der scheue unglücklich Verliebte.
Das starke Bedürfnis, diesen Mann näher kennenzulernen, hatte sie durch den ganzen Gottesdienst begleitet, dessen Ende sie kaum hatte abwarten können. Auf ihre Frage nach ihm hatten ihre Verwandten berichtet, dass es sich um Waldemar Westphal, ein Naturtalent, handelte, der im Kirchenchor sänge und gelegentlich Solopartien übernähme. Es war ihr gelungen, die Verwandten zu bewegen, ihn einzuladen.
Bei dem aufwändig vorbereiteten Abendessen waren sich die beiden zum ersten Mal begegnet. Waldemar Westphal, hochgewachsen, ansehnlich, rotblond, hatte nur gesprochen, wenn er dazu aufgefordert worden war, was ihren Eindruck verstärkt hatte, dass er ein besonnener Mann war, der sogar zu bescheiden war, seine Befindlichkeit beim Gesang der Xerxes-Arie zu beschreiben. Johanna Mailand hatte dafür gesorgt, dass sie nach ihrer Rückreise nach Hannover in Verbindung blieben. Auch in seinen zurückhaltenden Briefen hatte sie ihr Bild von ihm bestätigt gesehen. Ein Jahr später hatte das Paar in Bielefeld geheiratet. Johanna Mailand, nun Frau Westphal, hatte nicht ahnen können, dass sie in Zukunft selbst als fest verwurzelte Platane ihres Mannes weiterleben würde.
Waldemar Westphals Elternhaus war ein Bauernhof vor den Toren Bielefelds gewesen. Im elterlichen Umgang mit ihm und seinen sieben Geschwistern hatte Strenge und Unnahbarkeit geherrscht. Die Mutter Annemarie Westphal hatte das Prinzip vertreten, man dürfe Kindern nicht zeigen, dass man sie liebe. Ihren Vater Traugott Westphal hatten die drei Söhne wegen seiner Unberechenbarkeit und Gewaltausbrüche gefürchtet. Waldemar Westphals Einfühlungsvermögen und Fähigkeit zu liebevoller Zuwendung hatten in diesem Umfeld wenig Chancen, sich zu entwickeln.
Auch hatte er in seiner streng gläubigen, schlichten Familie die Umgangsformen der städtischen Mittelschicht nicht kennenlernen können. Zwar hatte er sich bei Besuchen der Verwandtschaft in der Stadt und während seiner späteren Kaufmannsausbildung angepasste Verhaltensweisen angewöhnt, aber die wirkten meistens aufgesetzt. Durch seine Heirat mit Johanna Mailand war er in einen gehobeneren gesellschaftlichen Stand aufgestiegen. Wenn er unter den Erwartungsdruck geriet, sich standesgerecht äußern und verhalten zu müssen, drängten Leitmarken seiner väterlichen Prägung in sein Fühlen, Denken und Handeln. Dann versuchte er, seine Schwächen durch Härte auszugleichen, um seine Autorität als Familienoberhaupt zu wahren.
Johanna Westphal war sich sicher, dass es tief im Inneren ihres Mannes einen weichen Kern gab. Auch nach Jahren unglücklicher Erfahrungen war seine Gesangsstimme für sie ein untrügliches Zeichen dafür. Er nahm ihre sehnlichen Wünsche nach einem kulturell und geistig anspruchsvollen Zusammenleben, moderner Glaubensorientierung sowie angemessenen Umgangsformen in ihrer Familie und ihrem gesellschaftlichen Umfeld weder wahr, noch hätte er ihnen gerecht werden können. Sie litt still unter seinen Grobheiten, sowohl den körperlichen gegen ihre Söhne als auch im Umgang mit Freunden und Bekannten aus ihren Kreisen. Johannas entsprechende Bitten, sich zurückzuhalten, perlten an ihm ab, er hielt sie für Überempfindlichkeiten seiner zart besaiteten Frau.
Johanna Westphals Zuflucht aus ihrer Bedrängnis war die Musik. Schon bald nach Eheschließung und Umzug hatte sie sich dafür eine Nische geschaffen, indem sie sich der Förderung des Musiklebens in ihrem neuen, weiten Familienkreis widmete. Später spielte jedes ihrer eigenen Kinder mindestens ein Instrument. Dank ihrer Hingabe war die Pflege der Musik in der Westphalschen Großfamilie eine verbindliche Pflicht geworden. Ihre Hausmusik zu Gedenk- und Feiertagen erreichte Konzertniveau, zu den Einladungen strömten Freunde aus der Stadt, Verwandte reisten aus der Ferne an. Ihr musikalischer Einsatz wurde von ihrer Hoffnung gespeist, er verringere die Spannungen in der Familie.
Sang Waldemar Westphal bei einem Hauskonzert ein Baritonsolo, waren die Anwesenden von seiner Stimme berührt, während Johanna am Klavier Tränen über das Gesicht rannen. Bis zum Applaus hatte sie sich wieder gefangen. Sangen sie ein Duett, war es voller Leidenschaft beiderseitiger, unterschiedlicher Hoffnungen.
Johanna und Waldemar Westphal bekamen sechs Kinder, Helmut war ihr zweiter Sohn. Wie sein Vater überließ er die Erziehung seiner drei Töchter ganz und gar seiner Frau und bestrafte sie niemals. Im Jahr 1913 waren die Töchter Selma, Helene und Erna siebzehn, dreizehn und sieben Jahre alt. Sie waren sanft wie Lämmer, in der vor Respekt und Furcht vibrierenden Atmosphäre ihrer Familie war ihnen gegenüber kein strenges Wort erforderlich.
Bei den Söhnen, Georg und Helmut, damals sechzehn und elf Jahre alt, verhielt es sich anders, Waldemar Westphal verprügelte sie beliebig, mit und ohne Anlass. Niemand kreidete es Johanna Westphal an, dass sie ihm nicht in den Arm fiel und ihre Söhne nicht wirksamer in Schutz nahm. Sie versuchte es mit Worten, aber ihre wohldurchdachte Sprache erreichte seinen impulsiven Antrieb nicht. Manchmal bat sie im Gebet um Vergebung dafür, dass sie trauernd dachte ‘Wenigstens das ist unserem kleinen Engel Egon erspart geblieben.’
Egon war mit sechs Jahren aufgrund eines Blinddarmdurchbruchs gestorben. Es geschah während eines Wochenendausflugs aufs Land zu einem Bauernhof von Verwandten. Waldemar hatte den vor Schmerzen wimmernden Jungen gedrängt, sich zusammenzureißen, sonst würde aus ihm nie ein richtiger Mann werden.
Johanna zweifelte zunehmend an seinen Beteuerungen, die Ertüchtigungsrituale mit ihren Söhnen würden diese zu starken Männern, guten Christen und mutigen Heimatverteidigern erziehen. Wenn sie im Schlafzimmer allein waren und sie darüber weinte, erklärte er es ihr ein ums andere Mal, aus ihm sei schließlich dank seines Vaters Strenge ein guter Christenmensch geworden. Bei diesen Worten weinte sie noch heftiger, und er tröstete sie noch inniger.
Von seinen seelischen Belastungen erholte sich Waldemar Westphal im sonntäglichen Gottesdienst in der Nicolaikirche und dessen vorgegebenem Verlauf im Kreise seiner schweigenden oder Gleiches singenden Lieben. Unter der schützenden Decke des Jahrhunderte alten Kirchenschiffs fühlte er sich dazugehörig und sicher aufgehoben.
Im weiteren Umfeld galten Johanna und Waldemar als gottgesegnetes Traumpaar und mit ihren sechs Kindern als Vorzeigefamilie. Sie waren nicht nur außergewöhnlich schöne Menschen – ihr Portrait hing im Schaufenster der Ateliers des Stadtfotografen Münch –, sie waren in vorbildlicher Weise standesbewusst, die Pflege des Rufes der Familie und die Erfüllung gesellschaftlicher und christlicher Pflichten standen an erster Stelle ihres Denkens, Fühlens und Handelns.
Die Großeltern – Annemarie und Traugott Westphal
Waldemar und Johanna Westphal wohnten mit ihren Kindern in einem der fünf stilvollen benachbarten Bürgerhäuser der Großfamilie in Bielefeld, die in lockerem Abstand um ein weites Gartengelände gruppiert waren. Ihre Geschichte ging auf den früheren Hof seiner Vorfahren und ihr über zweihundert Jahre altes riesiges Bauernhaus zurück. Nach langer Generationenfolge hatte Traugott Westphal dort mit seiner Familie ein gottesfürchtiges Leben geführt und den Hof als Landwirt und als Geschäftsmann erfolgreich bewirtschaftet. Dank seines organisatorischen Geschicks hatte er dafür gesorgt, dass seine drei Lebensbereiche Kirche, Landwirtschaft und Familie wie Zahnräder ineinandergriffen, in gleicher Reihenfolge hatte er jeweils seine Gewinne verteilt. In der Kirche war er als großzügiger Spender für Kinder in Afrika bekannt und saß immer im Vorstand.
In der Familie hatte er seine Ordnung mit eiserner Strenge und harten Strafen aufrechterhalten und seine Söhne verprügelt, wann immer es ihn – seiner Überzeugung nach ‘im Namen des Herrn’ – überkam. Seines Sohnes Waldemar Westphals Gefühl, zu ertrinken, wenn er sich die Haare wusch, ging darauf zurück, dass sein Vater seinen Kopf wiederholt – auch im Winter – zur Strafe in der Wassertonne unter dem Hausdach untergetaucht hatte. Immer wieder waren seine Frau oder sogar Nachbarn laut eingeschritten, um zu verhindern, dass er die Jungen krankenhausreif oder tot schlug. Der zarteste Sohn, Ludwig, hatte in ständiger Angst vor ihm gelebt und gezittert, wenn auch nur eine Tür aufging. Dessen Rettung war sein jüngerer Bruder Rudolf gewesen, der größer und stärker war als er, ihn beschützt hatte und ihrem Peiniger selbstbewusster begegnet war, wofür er Blutergüsse und Prellungen erlitten hatte. Keiner von ihnen hatte ahnen können, dass sich diese brüderliche Symbiose in der nächsten Generation fortsetzen würde: bei den Söhnen ihres Bruders Waldemar: Helmut und Georg.
Traugott Westphal hatte daran geglaubt, dass seine Autorität die Familie zusammenhalten würde. Mit seinen Kindern hatte er Größeres vorgehabt, sie sollten einen zukunftsweisenden Musterhof aufbauen. Aber die beiden ältesten Söhne, Rudolf und Ludwig, hatten das Weite gesucht, sobald sie das Elternhaus nach Volks- und Berufsschule verlassen konnten, um im aufblühenden Ostpreußen gut bezahlte Arbeit und ein selbstbestimmtes Leben zu suchen. Es hatte laute Auseinandersetzungen und die Drohung gegeben, sie zu enterben. Vergeblich! Traugott Westphal war mit seiner Familienpolitik gescheitert. Sein jüngster und schwächster Sohn Waldemar war als einzige männliche Arbeitskraft der Familie Vater und Hof verbunden geblieben. Traugott Westphal hatte es als Schande empfunden, auf Landarbeiter von außen angewiesen zu sein. Eine zusätzliche Belastung war ihm aus der Tradition erwachsen, die weiblichen Familienmitglieder versorgen sowie seine fünf Töchter verheiraten zu müssen, und die waren bedrohlich nah am heiratsfähigen Alter gewesen. Er hatte um Unterstützung bei dieser Herausforderung gebetet.
Tatsächlich hatte ihm – wie er glaubte – Gott aus dieser Bedrängnis geholfen: Traugott Westphal hatte entdeckt, dass sich die Stadt in Richtung seines Hofes ausdehnte, der stand den Bauplänen der Stadtverwaltung im Wege. Daraufhin hatte er sein Anwesen mit Gewinn verkauft und auf dem verbleibenden umfangreichen Grund und Boden fünf Bürgerhäuser für sich und die in Bielefeld verbliebenen Kinder bauen lassen. Es war ihm bewusst, dass dieses Gebiet wenige Jahre später zum Stadtkern gehören und sein Wert weiter steigen würde. Zu seinem größten Ärger und aufgrund der Drohung seiner Frau, seinen Freund, den Propst, um Rat zu bitten, hatte er seine beiden älteren Söhne ausbezahlen müssen. Er hatte sich damit getröstet, dass sein strategischer Plan aufgegangen war: Die reiche Mitgift seiner Töchter, ihre Häuser in zentraler Lage, hatte seriöse, finanzstarke Männer angezogen, die hatten in die bürgerliche Gesellschaft eingeheiratet.
Nach dem Verkauf ihres Hofes hatte Waldemar Westphal für sich einen neuen Tätigkeitsbereich in der Stadt gesucht und gefunden. Da Bielefeld das Zentrum der Textilindustrie Deutschlands war, hatte er auf Rat seines Vaters eine Kaufmannslehre in einem Tuchunternehmen der Stadt und Fortbildungskurse der städtischen Textilfachschule absolviert, eine Stellung in einem renommieren Tuchgeschäft bekommen und sich dort durch Verkaufsgeschick einen Namen als Fachhändler erworben. Nach zwei Jahren hatte er – unterstützt durch Familienkapital – selbst ein Geschäft für feine englische Tuche eröffnet, mit dem er Erfolg hatte. Als Johanna Westphal ihn kennenlernte, hatten sein beruflicher Erfolg ihr Vertrauen in ihn gestärkt. Ihr eigener Großvater und ihr Vater waren Leiter der Hofschneiderei für Uniformen gewesen und so zu Ansehen und Reichtum gekommen. Deren Karriere hatte 1840 unter König Ernst August I. von Hannover begonnen. Da Johanna Westphal ihre Eltern aufgrund eines Unfalls früh verloren hatte und bei freundlichen Verwandten aufgewachsen war, hatte sie den beruflichen Hintergrund von Waldemar Westphal verklärt und als vertraute Verbindung gedeutet.
Für Traugott Westphal war der Umstand, dass Waldemar eine Frau aus gehobener Abstammung und dazu in der Kirche gefunden hatte, eine göttliche Fügung sowie Lohn für seine Mühen um die Familie.
Er starb im Jahr 1913. Auf seiner Beerdigung sagte sein bester Freund, der Propst, Traugott Westphal hätte über seine Hingabe an Gott und seine Großzügigkeit gegenüber Kirche und Armen sein eigenes Haus und seine Familie hintangestellt. Waldemar hielt diese kritischen Worte für ein Zeugnis christlicher Selbstlosigkeit, Bescheidenheit und Opferbereitschaft seines Vaters.
Die Brüder – Helmut und Georg Westphal
Hinter dieser makellosen Fassade war die Welt gespalten. Eine Hälfte war leise, friedlich, umgänglich für alle, die andere laut und gewalttätig, verbarg sich hinter verschlossenen Türen, durch die Lärm und Geschrei bis in Küche und Keller drangen. Alle Hausbewohner hörten sie und litten mit: die Mutter, die Schwestern und die jeweiligen Haustöchter1.
In Waldemar Westphals Gegenwart war die Grundstimmung im Haus gedämpft, laute Fröhlichkeit gab es von seiner Seite nur bei Familientreffen oder Festen. Er lachte selten, um nicht durch Enthemmung Schwäche zu zeigen. Außergewöhnliche Situationskomik konnte ihn zum Lachen bringen. Einmal sorgte Helmut dafür, als der – damals acht Jahre alt – seinen Weihnachtswunschzettel ausgefüllt und in die bewusste Schachtel gelegt hatte. Darauf stand nur sein Name. Von der Mutter am Mittagstisch danach befragt, krähte er altklug
– Ich bin bescheiden, ich wünsche mir gar nichts. Pfarrer Fischer hat gesagt, wer bescheiden ist, kriegt das Allermeiste.
Seine Mutter und seine Schwestern hielten zunächst erschrocken den Atem an, entspannten sich aber, als der Vater laut loslachte. Der Kleine wollte Gott austricksen, das war zu komisch, um ihn dafür zu verprügeln. Die Geschichte blieb im Familiengedächtnis haften.
Ihre Söhne waren sehr verschieden: der stürmische jüngere Helmut, inzwischen zwölf Jahre alt, störte die vordergründige Idylle durch seine ‘Wildheit’. Waldemar war sich sicher, dass er nach ihm kam und auch ihm der schlechte Charakter ausgetrieben werden musste. Georg, der fünf Jahre ältere Bruder, kam nach der Mutter, war eine zarte Erscheinung und interessierte sich seit der Kindheit für Bücher. Für Waldemar war er zu brav, um bestraft zu werden, aber ihm ging es um mehr: stramme Männlichkeitserziehung. Georg war ihm für einen deutschen Mann zu weich. Dagegen war Härte ein probates Mittel, und dazu gehörten Schläge.
Helmut, der Aufmüpfige, war an allem und jedem interessiert, schon im zarten Alter an Mädchen, denen er heimlich originelle Avancen machte. Dafür gab es ein großes Übungsfeld: seine vielen Cousinen ersten, zweiten und dritten Grades. Bei allen familiären Festlichkeiten, von denen es unzählige gab, war ihm deren Aufmerksamkeit sicher. Er unterhielt sie mit Zaubertricks und Imitationen von Marotten der Verwandten, allen voran seines Vaters. Den Mädchen machte es Spaß, nach außen dem Abenteurer gegenüber gleichgültig zu erscheinen. Schließlich wussten sie, was ihrem Schwarm blühte, wenn ruchbar würde, was er neben den gleichförmigen Festprogrammen trieb.
Er selbst verband mit diesen Auftritten dreierlei: sie verringerten seine Langeweile, waren ein Ventil für seine angestaute Wut und beflügelten den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Unter den Hofierten gab es keine Eifersucht, im Bewusstsein, ihn vor seinem Vater zu schützen, hielten sie zusammen, standen in devoter Verlässlichkeit abwechselnd für ihn Schmiere und schickten ihm Kassiber, um ihn zu warnen. Er dankte es ihnen mit seinem Markenzeichen, der ‘Schirmschraube’: Dafür warf er seine Schirmmütze mit kräftigem Dreh vor sich hoch in die Luft, rannte hinter ihr her und ließ sie auf seinem Kopf landen. Niemand anderer aus der Familie beherrschte diese Akrobatik.
Trotz der regelmäßigen Strafen – oder gerade ihretwegen – wurde es mit ihm nicht ‘besser’. Helmut hatte zwei Ohren, eins zum Zuhören, eines zum Durchlassen des Gehörten. Zur Vermeidung von Schlägen erfand er immer raffiniertere Tricks. Einmal hatte er Helene gebeten, für den Fall, dass er nicht pünktlich vom Geigenunterricht zurückkäme, zu einer bestimmten Zeit auf dem Grammophon eine Schallplatte mit Sologeigenstücken aufzulegen. Der Trick flog auf: Prügel. Ein anderes Mal kletterte er in Aussparung des Hausflurs, wo der Vater mit der Rute wartete – an der Regenrinne in den zweiten Stock hoch und stellte sich im Bett schlafend. Helene hatte ihn per Kurbeltaschenlampe gewarnt. Der Vater zog sich zurück.
Bei einem der Ablenkungsmanöver spielte die Haustochter mit: Sie ließ in der Küche ‘aus Versehen’ einen Eimer mit heißem Wasser fallen. Dabei kamen keine Personen zu Schaden, aber das Geschrei war so groß, dass der Vater vor Ort erschien. In der Zeit huschte Helmut über das Dach des Hauseingangs durch das Elternschlafzimmer in das Jungenzimmer im ersten Stock, wo ihn Georg empfing.
– Wenn das rauskommt, bekomme ich genauso viele Prügel wie du, findest du das gerecht?
– Ich nehme alle Schuld auf mich und dich in Schutz!
– Was für ein Blödsinn!
– Gut, ich übernehme auch deine Portion Prügel!
Sie lachten. Nach dem Schlafengehen gab es bei den Jungen ein Dauerthema: wie sie ihrem Peiniger entkommen könnten, sie schmiedeten abenteuerliche Pläne bis zum Einschlafen. Helmut erfand unermüdlich neue Fluchtmöglichkeiten, Georg deckte ihre Schwächen auf. Helmut konnte nicht ahnen, dass ihm diese Übung später in lebensgefährlichen Situationen einen Erfahrungsvorsprung geben würde.
Seine große Leidenschaft war die Musik. Er schien eine außerordentliche Begabung zu haben: Welches Instrument auch immer in seine Hände geriet, er schaffte in kurzer Zeit, ihm Melodien zu entlocken. Er spielte nach Gehör. Zwar beherrschte er auch die Noten, aber er mochte sie nicht, sie nahmen ihm die Freiheit, zu improvisieren, und waren für ihn Notfallkrücken. Mit zwölf spielte er Orgel in der Kirche, was für ihn weniger langweilig war, als in der Sitzreihe mit den Seinen ausharren zu müssen. Wenn er die Melodien zu lange oder zu dröhnend variierte, räusperte sich Pastor Fischer. Der mochte den jungen Künstler, der kreative Frische in die festgefahrenen Abläufe der Gottesdienste brachte. Zu Hause dämpfte er häufig seine Wut gegen den Vater, indem er Stücke wie Chopins Militär-Polonaise A-Dur in rasantem Tempo in den Flügel donnerte. Auf solche Energiestürme folgte jeweils auf allen Etagen des Hauses Applaus der Mädchen und Frauen, die in den Treppenflur geeilt waren, um ihm zuzuhören.
In der Schule glänzte Helmut nicht, weil er nicht aufpasste und seinen Fantasien nachging. Während Georg das altsprachliche Gymnasium problemlos absolvierte, kam er im neusprachlichen, das als das leichtere galt, mit Hängen, Würgen und großfamiliärem Nachhilfeeinsatz in die jeweils nächste Klasse. Es gab Fächer, in denen er abhob: Musik, Englisch und Französisch. Da musste er nichts tun, die Kenntnisse flogen ihm zu, er merkte sich alles, was er einmal gehört hatte, so auch in Deutscher Literatur. Über zu lesende Bücher – er ließ sich von Selma die Inhalte zusammenfassen – schüttelte er kleine Vorträge aus dem Ärmel. Sein Lieblingsfach war Turnen. Der Grund war, dass man von der Turnhalle für Jungen aus über den Hof in die der Mädchen sehen konnte. Er bewunderte ihre elegante Leichtigkeit beim tänzerischen Laufen, beim Schwingen von Keulen und dem Kreisen, Werfen und Fangen von Gymnastikreifen.
Seine Schulleistungen waren Anlass zu noch mehr Schlägen. Georg erhielt Prügel dafür, dass er seinen kleinen Bruder nicht erfolgreicher zum Lernen anhielt und damit den Ruf der Familie schädigte. Die Tatsache, dass sie gemeinsam bestraft wurden, war für die Brüder eine Art Trost. Der jüngere hörte vom älteren, warum Prügelattacken unchristlich waren. Für den Zartbesaiteten war die ungebrochene Selbstsicherheit Helmuts ein Vorbild, die körperlichen Misshandlungen nicht zu sehr auf sein Gemüt schlagen zu lassen. Der tröstete ihn
– Wozu haben wir inzwischen Leder auf dem Hintern? Er prügelt immer weiter und merkt gar nicht, dass das nichts nützt.
Als Georg im Jahr 1913 nach der zehnten Klasse mit der Obersekundarreife sein Gymnasium verließ, war Helmut gerade dreizehn geworden und überragte den Bruder bereits an Größe. Der Schulabschluss berechtigte Georg zur Ausbildung zum Buchhändler und Verlagswirt, seinem lang gehegten Berufswunsch. Er wollte Bielefeld verlassen und bekam einen Studienplatz in Göttingen. Nur eines fiel ihm schwer: Helmut allein dem Vater auszuliefern.
– Helmut, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören?
– Die gute!
– Ich habe den Studienplatz in Göttingen bekommen!
Helmut erschrocken
– Dann kenne ich schon die schlechte!
Er stürmte die Treppe zum Dachboden hinauf, Georg hinterher. Es war ihr Zufluchtsraum, wenn es mit dem Vater allzu schlimm zuging. Helmut weigerte sich zunächst, mit Georg zu sprechen, der bestand darauf.
– Dich zu verlassen, ist das einzige Problem am Plan! Aber verstehst du, dass ich anfangen muss, mein Berufsleben vorzubereiten?
– Sicher doch! Aber wen habe ich dann noch, der auf meiner Seite ist?
– Na, Mutter und unsere Schwestern!
– Die können mir doch nicht helfen!
– Du wirst dir selbst helfen müssen, Helmut! Du bist sowieso größer und mutiger als ich.
– Kommst du zu meiner Beerdigung, wenn er mich totschlägt?
– Das wird er schon deshalb nicht tun, weil er das treueste Mitglied der Gemeinde ist und du dort Orgel spielst! Er achtet ja jetzt schon darauf, dass wir an sichtbaren Stellen keine blauen Flecken haben!
Sie lachten.
Tatsächlich baute sich Helmut später einmal in voller Größe vor seinem Vater auf, hielt ihm die berüchtigte Lederrute hin und sagte in aller Ruhe
– Schlag’ mich einfach so lange du willst, den ganzen Tag, die ganze Nacht! Schlag mich tot! Der Herr im Himmel schaut ja zu, wie du immer sagst, und sieht, was für ein gläubiger Mensch du wirklich bist. Schlag zu!
Waldemar schaute ihn erst wütend an, sein Arm und seine rechte Hand zuckten. Beide Männer verharrten in ihren Positionen, bis Waldemar sich wegdrehte und davonging. Er schlug seine Söhne nie wieder und redete lange nicht mit ihnen. Die Brüder machten sich über ihn lustig und schrieben Witzgedichte über ihn, die in der Verwandtschaft kursierten. Später, als sie das Haus verlassen hatten und mit der Familie korrespondierten, widmeten sie ihm kein Wort in ihren Briefen und ließen ihn nicht grüßen. Auch er blieb ihnen gegenüber stumm, bis er Jahre später – durch leichtsinnige Kaisertreue mittellos geworden – von ihnen Geld forderte. Sie verweigerten es ihm – und unterstützten stattdessen Mutter und Schwestern. Schließlich bat Waldemar seine Kirchengemeinde um Hilfe und bekam sie dort.
Georg begann sein Studium zielgerichtet, er wollte es so schnell wie möglich beenden und ein selbständiges Leben anfangen. Helmut wollte es ihm gleich tun und legte in der Schule zu. Doch dann geschah etwas, was das Leben aller änderte: Ein Krieg brach aus.
Leben im Krieg
Helmut und seine Freunde sahen Aufmärsche von Soldaten in den Straßen. Seine Begeisterung hielt sich im Gegensatz zu der seiner Freunde in Grenzen, schon weil sein Vater mit lautem Enthusiasmus eine neue deutsche Ära ausrief, in der Recht und Ordnung herrschen würden. Der stand sonntags nach dem Kirchgang am Straßenrand und feuerte das Spektakel entfesselter Kriegseuphorie in freudiger Erregung an.
– Kämpft für Vaterland und Kaiser!
– Des Kaisers Wohl ist unser Wohl!
– Nieder mit den gottlosen Angreifern!
Zuschauer sangen Heldenlieder, Jungen in Helmuts Alter marschierten begeistert neben den Soldaten, wobei sie ihre Holzdegen in der Haltung ihrer Idole hielten. Für Helmut war deren Anblick peinlich und beunruhigte ihn wegen dem zur Schau getragenen Ernst und fanatischen Ausdruck in den Gesichtern von Jungen und Männern.
Im August 1916 war er auf einmal da, der Einschreibebrief mit Georgs Einberufung. Der Abschluss der mittleren Reife berechtigte ihn zum ‘Einjährigen’, dem verkürzten Wehrdienst gegenüber dem dreijährigen und ermöglichte ihm, nach Abschluss der Grundausbildung Offizier der Reserve zu werden. Bis auf den Vater verfiel die Familie in Schockstarre. Georg wurde eingezogen und an die Ostfront geschickt. Waldemar sah im militärischen Einsatz seines Sohnes eine Bewährungsprobe für seine Männlichkeitserziehung und verabschiedete ihn stolz.
– Zu Weihnachten bist du wieder da, mein Junge. Dann ist der Krieg gewonnen, das hat uns der Kaiser versprochen. Jetzt wirst du für seine hehren Ziele kämpfen.
Georg schüttelte traurig den Kopf und verabschiedete sich von Mutter und Geschwistern, Verwandten und Freunden. Helmut übergab ihm ein Buchpäckchen, Georg freute sich, der Vater schüttelte den Kopf.
– Diese Flausen wird dir das Militär austreiben!
Aber der Krieg blieb und dauerte an, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Die anfängliche allgemeine Kriegseuphorie, Siegesgewissheit und die leichtfertigen Versprechen Wilhelms II. hatten Waldemar gegen den Rat männlicher Familienangehöriger dazu bewogen, das Privatkapital der Familie einschließlich Erbanteilen seiner Frau zwei Mal in Kriegsanleihen zu stecken. Er verlor ihr Vermögen. Die wirtschaftliche Situation der Familie verschlechterte sich von Tag zu Tag. Auch das Elend in Stadt, Landkreis und ganz Deutschland verbreitete sich rasch, verschlimmert durch die britische Handelsblockade2, die den Nachschub aus dem Ausland abschnitt. Der jahrelange Russlandkrieg blutete das Land zusätzlich aus.
Die Tuchhandlung von Waldemar Westphal warf bald keine Gewinne mehr ab. Die wenigen Schneider, die noch Kontakt zu ihm hielten, waren mehr mit dem Ändern und Wenden alter Kleidungsstücke beschäftigt, als Neues zu nähen, und kauften keine teuren Stoffe mehr für Herrenanzüge. Auch deren Import brach zusammen. Waldemars Betrieb rutschte unaufhaltsam in den Bankrott.
Helmut trug mit Musik- und Nachhilfeunterricht zum Einkommen der Familie bei, wollte die Schule aber auf keinen Fall vor dem Abitur abbrechen. Nachdem viele Lehrer seines Gymnasiums eingezogen worden waren, wurden Schüler der oberen Klassen als Aushilfslehrer verpflichtet, darunter Helmut, er gab Musik und Englisch. Aber auch er musste den Schulbesuch mit sechzehn Jahren mitten in der zehnten Klasse abbrechen, weil sein Verdienst für den Unterhalt der Familie nicht ausreichte. An seinen Traum von einem Musikstudium brauchte er nicht einmal mehr zu denken. Sein Anreiz, so viel wie möglich zu verdienen und dafür auch Nachtschichten einzulegen, waren die Feldpakete für Georg, die alle vierzehn Tage gepackt und verschickt wurden. Georg bat in seinen Briefen um Bücher, warme Unterkleidung, Rasiermesser, Hygieneartikel und anderes. Die Mutter schickte ihm auch Lebensmittel, obwohl die in der Familie zunehmend knapp wurden, sie traute der Versorgung im Feld nicht. Gleichzeitig verlor das Geld kontinuierlich an Wert.
Auch in der Kriegszeit gab es Freizeit und Vergnügen. In einem Fall sorgte Charlotte, eine hübsche Schulkameradin von Helmut mit schöner Singstimme, für einen gewissen Härteausgleich. In der Schule war sie durch gute Laune und Einfallsreichtum beim Improvisieren von Lösungen für jeden Mangel aufgefallen. Zur Abschiedsfeier unter Schulfreunden am Ufer der Lutter hatte sie zur Begeisterung aller selbstgegorenen Wein aus Holunderblüten mitgebracht. Man aß, trank, sang erst flotte, dann romantische Lieder, tanzte und geriet in Hochstimmung. Von Beschwingtheit und Entspannung getragen ließen sich Pärchen im Gras nieder, so auch Helmut mit Charlotte, zum Abschied küssten sie sich auf die Wangen. Für ihn war es ein vergnüglicher Abend.
Von da an meldete sich Charlotte täglich bei ihm und lud ihn zu Gemeinsamkeiten ein, denen er sich mit Ausreden entzog. Allmählich überkam ihn der Verdacht, dass sie ihre Begegnung bei der Abschlussfeier falsch deuten könnte. Er fand sie nett und mochte sie, war aber nicht in sie verliebt, hatte jedoch Hemmungen, es ihr gegenüber anzusprechen, Frauen zu verletzen war in Anbetracht der Empfindlichkeitenseiner Mutter ein Tabu. Er hielt Charlotte hin und hoffte, diese Botschaft würde ausreichen, sie in die Distanz einer Freundschaft zu bringen. Sie ließ sich nicht abwimmeln, er wich ihr aus. Mit seiner Hinhaltetaktik verschlimmerte er die Lage und erlebte mit Charlotte noch einige Überraschungen.
Georg verbrachte schließlich drei Jahre 1916 – 1918 als Soldat an der Ostfront. Helmut wartete sehnsüchtig auf jeden Brief von ihm und verfolgte seine Schilderungen, für ihn hatten sie Züge eines Unabhängigkeitskampfes gegen die häuslichen Verhältnisse. Georg befand sich die meiste Zeit an Orten der Grenzlinien zum Regentschaftskönigreich Polen und der Ukrainischen Volksrepublik, die bereits vor dem Eintreffen seiner Truppe als Besatzungsgrenzen gefestigt und mit Schützengräben gesichert waren. Ab 1917 verschlechterte sich die Versorgungslage in der Heimat und damit auch an der Ostfront dramatisch. Georg hatte mit seinen Stationierungen weiterhin Glück, wurde in wenige militärische Auseinandersetzungen verstrickt und genoss als Besatzungsangehöriger einige Freiheiten. So beteiligte er sich an Ausflügen zu Pferde, Pferderennen, Sport und lokalen Tanzveranstaltungen. Helmut war von dieser Unabhängigkeit so begeistert, dass er einen freiwilligen Einsatz bei Georg erwog, der ihn auch der väterlichen Prügelei enthoben hätte. Nicht unbeteiligt an dem Plan war Waldemar mit seinem Vorwurf
– Du bist groß und stark und zu nichts nütze. Nimm dir ein Beispiel an den Freiwilligen!
Und das, obwohl Helmut im Gegensatz zu seinem Vater Geld nach Hause brachte, der besorgte lediglich städtische Zuwendungen für seine Familie. Als Georg schrieb, dass er zu allen ‘freundlichen oder feindlichen Anrainern’ Kontakt aufnahm, lebte Helmut das in seiner Phantasie nach. Ein andermal berichtete Georg, er und ein paar Kameraden aus seiner Kompanie hätten sich über Tage auf der Grenzlinie mit russischen Soldaten aus dem gegenüber liegenden Schützengraben getroffen. Man hätte Sachen getauscht und die ‘feindlichen’ alkoholischen Getränke probiert. Sie seien von einem Kameraden verraten worden, hätten aber Glück gehabt, der Oberkommandierende hätte darin keine Befehlsverweigerung gesehen, ihnen nur laut und deutlich den Kopf gewaschen und ihren Sold gekürzt. Im heimischen Wohnzimmer, wo Georgs Briefe vorgelesen wurden, meine Helmut mit vom Stimmbruch begleiteter Überzeugung
– Ihr Fehler war, dass sie ihre Treffen nicht gut genug getarnt haben!
Die Mutter und die Schwestern, die sich in der Sofaecke unterschiedlichen Handarbeiten widmeten, parierten in gespieltem Ernst
– Unbedingt!
– Zweifellos!
– Ganz sicher!
– Du sagst es!
Er fuhr unbeirrt fort.
– Eigentlich müssten die Soldaten beider Seiten nur das Schießen aufeinander beenden, dabei müssten sie Verbündete suchen und zusammen beide Völker überzeugen, dass Frieden für ihr Volk besser ist.
Dieses Mal folgte keine ironische Bestätigung, zu sehr rührten seine Worte an ihre eigenen Hoffnungen. Die Mutter kämpfte mit den Tränen.
Georg knüpfte nahezu freundschaftliche Beziehungen mit Einwohnern an Besatzungsorten und schnappte in diesen Begegnungen etwas Russisch auf. Systematisch lernen durfte er die ‘feindliche’ Sprache nicht. Als kulturell Interessierter ging er – meistens allein, wie er bedauerte – in Theater, Konzerte, sogar ins Kino, auch wenn er zunächst kein Wort verstand, war aber froh, immer mehr erfassen zu können. Er beschrieb seine Erlebnisse minutiös. Helmut
– Der hat sicher eigene Geschichten zu den Filmen erfunden. Das würde ich genauso machen!
Und wieder echote es aus der Frauenrunde
– Unbedingt!
– Zweifellos!
– Ganz sicher!
– Du sagst es!
– Ihr nehmt nichts ernst! Das macht Georgs Lage nicht besser!
Als Helene zu ihrem ‘Unbedingt!’ Luft holte, legte die Mutter den Zeigefinger an den Mund.
Man schrieb Januar 1918. Die Familie war beunruhigt, lange war kein Lebenszeichen von Georg angekommen. Als nach Wochen ein Brief aus einem Lazarett in der eingenommenen Stadt Cholm an der russischen Westgrenze kam, war die Aufregung groß. Eine Schwester Sophie schrieb, Georg sei mit schwerer Lungenentzündung eingeliefert worden, hätte das Schlimmste überstanden und sei aus der Bewusstlosigkeit erwacht, wenn auch geschwächt. Nach Wochen konnte er selbst berichten, dass er bei einem winterlichen Gefecht etliche Tage in Kälte und Schlamm im Schützengraben hätte aushalten müssen. Dort sei er irgendwann bewusstlos umgefallen.
Während seiner Erholungszeit hätte er Kulturstätten von Cholm besucht und schrieb angetan von der verbreiteten jüdischen Hochkultur ‘Ich fand viele angenehme, vornehme Gestalten und Gesichter … Die Juden sind das bildende Element im Beieinander dieser Völker, außerdem sprechen sie alle Deutsch.’3 Zwar sei er von den meisten seiner Kameraden dafür verspottet worden, hätte sich aber nicht entmutigen lassen. Helmut wollte ein kleines deutsch-russisches Wörterbuch in ein Paket für Georg schmuggeln, für das er sein ganzes Angespartes ausgegeben hatte. Er hatte seine Mutter weder vorher noch hinterher je so zornig erlebt wie bei der Entdeckung dieses leichtsinnigen Vorhabens. Dem Vater sagte die nichts davon, um dessen gewalttätige Bestrafung dieser Dummheit zu verhindern.
Im Mai 1918 beschrieb Georg, wie sein ganzer Zug beim Einzug in einen Ort im Kosaken-Gebiet von Bürgermeister und Bürgern mit Salz und Brot willkommen geheißen und Unterkünften in Häusern von Bewohnern zugeordnet wurde. Im Gegenzug hätten die Soldaten deren Anordnungen sorgfältig befolgt, zum Beispiel, was den Umgang mit den Ikonen anbetraf, die in jedem Wohnzimmer als Altar aufgestellt waren. So durften sie – als sie in der Stube auf dem Boden schliefen – nicht mit den Füßen in deren Richtung liegen, und ihr Altarlicht durfte nicht für die Telefonwache oder zum Anzünden von Zigaretten benutzt werden. Waldemar war über Georgs Bericht von dieser ‘Kollaboration mit dem Feind’ erbost. Tatsächlich verbrüderte sich Georgs Kompanie mit den Kosaken, die als ‘Weiße’4 und Anhänger des Zaren ebenfalls gegen die ‘Roten’, die Bolschewiken, kämpften. Schließlich räumte seine Kompanie sogar das Gebiet, weil die Kosaken es selbst zuverlässig hielten. Helmut verteidigte diese Strategie gegenüber dem Vater energisch. Der rief erbost
– Werde du erst einmal ein Mann!
Während der zwei Heimaturlaube von Georg kam es zu ersten lautstarken Auseinandersetzungen zwischen ihm und seinem Vater. Einmal ging es darum, dass der ihn drängte, Offizier zu werden, was ihm längst zugestanden hätte, er solle die unmännliche Buchhändlerei lassen. Frauen und Mädchen verließen das Wohnzimmer jeweils zu Beginn der Streitereien. Helmut blieb und bewunderte Georgs neuen Mut. Die Diskutanten verharrten auf ihren Positionen. Beim zweiten Urlaub ging es um die Kriegsgegner, die Waldemar Westphal in Bausch und Bogen als Untermenschen beschimpfte, die Deutschland, Volk und Kaiserreich sowie seinen Fortschritt bedrohten. Es wurde ein lauter Disput.
Georg entschuldigte sich nach seiner Rückkehr ins Feld im jeweils nächsten Brief bei seiner Mutter für seine wenig diplomatischen Auftritte, bat sie um Verständnis und schrieb zum letzten Streit, wofür er wegen Zersetzung der Wehrkraft mit dem Tode hätte bestraft werden können:
In den Jahren im Feld ist mir zu Bewusstsein gekommen, dass Hass gegen einen Feind Wahnsinn ist. … Das Erleben all dieser Menschen in Freud, Leid und Leben lässt einen allen Hass vergessen und das Morden als schrecklichen Irrtum erkennen.
Waldemar Westphal, der zugehört hatte, schrie
– Schande über unseren Sohn! Er kollaboriert mit dem Feind, schwächt unser Land und bringt unsere Familie und alle Deutschen in Lebensgefahr!
Dieses Mal war es Helene, die mutig dagegen hielt.
– Er meint und tut, was Jesus und Pastor Fischer sagen!
Waldemar stand abrupt auf, sein Stuhl fiel laut zu Boden, er stürmte aus dem Haus und schlug die Tür zu. Die Mutter und die drei Schwestern waren sitzengeblieben. Helmut bewunderte Helene aus tiefem Herzen.
Die Lebensmittelversorgung wurde immer schlechter. Die offiziellen Begründungen dafür in den Zeitungen lauteten zunächst, der Krieg dauere länger als gedacht, weil ein Zweifrontenkrieg geplant war, sich aber Frankreich, England und Russland in der Entente gegen Deutschland zusammengeschlossen hätten. Später wurde mitgeteilt, dass die militärischen Auseinandersetzungen sich zu einem Siebenfrontenkrieg ausgeweitet hätten, die Schuld dafür wurde den Feinden zugeschrieben. Die deutsche Bevölkerung müsse die Versorgung ihrer Soldaten gewährleisten, das sei Ehrensache. Ein wesentlicher Grund wurde kaum erwähnt: Die britische Seeblockade versetzte Deutschland in eine wirtschaftliche Katastrophe und seine Bevölkerung in eine bedrohliche Hungersnot, Hunderttausende starben an den Folgen.
Untereinander konnte kaum etwas gespendet werden, man hatte nichts übrig. Bereits ab 1916 waren die Lebensmittel rationiert worden, es gab Vorschriften, wie viel man der Armee abgeben müsste. Die Lebensmittelzuteilung für die Zivilbevölkerung aber auch für das Militär wurde minutiös kontrolliert. Dazu kam 1916/17 ein langer, sehr kalter Winter, der die Not drastisch verstärkte, überall starben Menschen an Mangelernährung.
In der Familie herrschte seit langem Hunger. Helmut aß so wenig wie möglich, damit seine Schwestern genug bekämen, die das Gleiche taten. Hunger begleitete Helmut durch Tage und Nächte. Dazu schickte die Mutter Georg weiterhin Lebensmittelpäckchen an die Front wie alle Mütter seiner Cousins, die einberufen worden waren. Die Verwandten, die keine Söhne in dem Alter hatten, unterstützten sie. Ihre üppigen Pakete aus den ersten zwei Kriegsjahren waren Geschichte.
Helmuts Lehrtätigkeit war seit langem versiegt, stattdessen schleppte er im Bahnhof Kisten zu Güterwagen für die Front. Der Umstand, dass Postsendungen an die Fronten darunter waren, gab ihm zusätzliche Energie. Es waren auch die Erschöpfung und Kriegsmüdigkeit von Bevölkerung und Armee, die ein Jahr später zum Ende des Krieges führten.
Georg hatte während seines ersten Heimaturlaubs 1917 die Hungersnot nicht bewusst wahrgenommen, in seiner Familie galt die unausgesprochene Regel, dass er sich satt essen sollte, dafür schnallten alle wortlos den Gürtel enger. In lang vermisste Begegnungen und Gespräche verwickelt, hatte Georg nicht auf die Versorgung seiner Umgebung geachtet und war erholt zu seiner Kompanie zurückgefahren.
Nachdem der Informationsaustausch danach monatelang wie gewohnt verlaufen war, meldete sich Georg im Herbst wieder wochenlang nicht und antwortete weder auf Briefe noch auf Päckchen der Familie. Die war in großer Sorge, zumal zwei Cousins von Georg kurz zuvor an der Westfront gefallen waren. Endlich kam ein Brief – wieder aus einem Lazarett.
Die Mutter erleichtert
– Das kann nur Gutes bedeuten!
Dem folgte Erschrecken, nach den ersten zwei Sätzen musste Selma den Brief weiterlesen. Dieses Mal war er vom Feldarzt Dr. Wolf verfasst, der berichtete, dass Georg sich eine Mittelohrentzündung zugezogen hätte. Da seine Widerstandskraft geschwächt gewesen sei, hätte die sich zu einer Meningitis ausgeweitet, an der er beinahe gestorben wäre. Dr. Wolf schrieb, dass der Oberarzt ihn mithilfe von Drainagen gerettet hätte. Er würde zur häuslichen Rekonvaleszenz beurlaubt, müsse aber im Hospital bleiben, bis er reisefähig sei.
Einen Monat später kam Georg in einem Lazarettzug nach Bielefeld zurück. Vater, Mutter und Selma warteten gespannt auf dem Bahnsteig. Eine Bahre nach der anderen mit Verletzten wurde herausgetragen, danach stiegen verbundene und amputierte Soldaten – unterstützt von Krankenschwestern – hinkend aus. Ein Soldat verließ den Zug aufrecht, mit etwas unsicherem Gang, aber leichtfüßig: Georg, ausgestattet mit einem dicken Winterpelz und einer Pelzmütze. Er war stark abgemagert, hatte eine Narbe in der rechten Gesichtshälfte zwischen Ohr und Wange und lachte etwas schief aber herzlich. Sie umarmten und küssten sich, die Mutter konnte Georg kaum loslassen. Selma
– Mutter, erdrück ihn nicht, er hat gerade knapp überlebt!
Die Mutter
– Entschuldige! Ich habe mich wie früher an dir festgehalten!
Georg
– Kommt alles wieder, du musst nur auf dein Gewicht achten!
- Überführt! Beginne sofort mit dem Abnehmen!
Alle lachten, Johanna Westphal hatte zu der Zeit die Statur eines wenig gepolsterten Skeletts. Der Vater
– Du siehst gesund aus! Wann geht es wieder an die Front, mein Sohn?
Georg lachend
– Wenn ich dich so höre, gleich morgen!
Der Vater, ihn von oben bis unten betrachtend
– Du siehst aus wie ein Russe!
Georg
– Richtig, es sind die Sachen eines im Lazarett verstorbenen Kosaken.
Die Frauen waren bestürzt, der Vater
– Wenigstens dazu sind sie nütze!
Darauf schüttelten die Frauen und Georg den Kopf und sagten nichts mehr. Dieses Mal erschrak Georg, als er die häusliche Versorgungssituation erlebte. Wegen Kohlemangels verbrachte man die meiste Zeit in der Küche. Das Gas zum Kochen war rationiert, man hatte keine Lebensmittelvorräte mehr und aß ‘aus der Volksküche’. Nun begleitete Georg Helmut, der dort jeden Tag mit einem großen Topf ihre Familienration gegen Essenskarten abholte und fragte entsetzt
– Das ist für uns alle?
– Jetzt haben wir mehr, weil du da bist und wir dir …
Er stockte, Georg ergänzte.
– … mir keine Päckchen schicken! Das hättest du mir sagen müssen!
– Du hast doch unsere Freiheit verteidigt!
– Du hast keine Ahnung, wen oder was wir in Wirklichkeit verteidigt haben!
Georg reiste wieder an die Front. Zwei Wochen später kam von ihm ein Paket mit Lebensmitteln und Winterkleidung, darin ‘ausgerechnet Socken von sowjetischen Soldaten’ für den Vater, die Familie schmunzelte versteckt. Wie erwartet weigerte der sich, sie anzuziehen. Sie passten auch Helmut. Seinen letzten Brief von der Front schrieb Georg am 10. August 1918, auch der kam wie gewohnt an, einen guten Monat später erklärte Ludendorff die Niederlage Deutschlands. Georg hatte überlebt und kam zurück.
Als die Währung rapide verfiel und seine Wirtschaftslage aussichtlos wurde, erinnerte sich Waldemar Westphal immer häufiger an das Landleben seiner Kindheit und Jugend, in der es keine Entbehrungen gegeben hatte. Er entschied, sein Haus zu verkaufen, auf das Land zurückzukehren und einen Hof zu erwerben. Verwalter des Gutes sollte Helmut werden, Georg sei an den Buchhandel verloren. Helmut war diesem Plan gegenüber nicht abgeneigt, in den letzten Jahren hatte der Hunger auch seine Zukunftswünsche verändert. Die Landwirtschaft war eine Quelle für Lebensmittel, verbunden mit der Hoffnung, nicht mehr hungern zu müssen. Da es für Helmut sowieso keine Alternative gab, suchte er einen Ausbildungsplatz zum Landwirt.
Auf dem Gut Meyer zu Lenzinghausen
Es gab noch Familienkontakte zu Höfen im Umfeld der Stadt, darunter zu dem altehrwürdigen ehemaligen Herrengut der Familie Meyer zu Lenzinghausen in Lenzinghausen. Helmut wurde dort als Lehrling, genannt ‘Eleve’, angenommen und sah seiner Lehre mit Freude entgegen, er glaubte, dort keinen Hunger mehr leiden zu müssen und etwas für seine Familie abzweigen zu können. Doch danach sah es zunächst nicht aus.
Im August 1919 in Lenzinghausen angekommen, umfing ihn eine unbekannte Welt. Von ländlichem Überfluss keine Spur. Auch die Vorräte des Hofes waren erschöpft, Pferde, Zugtiere und Traktoren waren staatlichen Konfiszierungen zum Opfer gefallen, die Landmaschinen waren veraltet, zum großen Teil defekt, und es gab keine Ersatzteile, die Maschinenfabriken waren in Rüstungsproduktionsstätten umgewandelt worden. Der größte Teil der Arbeit auf dem Hof wurde wieder von Hand erledigt, Scharen von Arbeitslosen und Jugendlichen, die ihre Schulbildung abgebrochen hatten, arbeiteten auf dem Land gegen Mahlzeiten. Aufgrund der Bekanntschaft der Familien war Helmut nicht in den Helferbaracken sondern im Haupthaus in einer Dachbodenkammer untergebracht, aus deren kleinem Giebelfenster er über Hof, Äcker und alte Weiden am Bach in die Ferne schauen konnte. Dieser Anblick bestärkte ihn in der Gewissheit, den Weg in ein besseres Leben für sich in der Ferne suchen zu müssen. Er konnte nicht ahnen, wie vielfältig sich dieser Wunsch erfüllen würde.
Kriegsbedingt wurde der Hof von den Frauen der Familie Meyer zu Lenzinghausen geführt. Für Helmut eine neue Erfahrung, selbstsichere, ja autoritäre Frauen sagten an, was er zu tun hatte. Die alte ‘Meyersche’, wie die Bediensteten sie nannten, wenn sie unbeobachtet waren, hatte das Oberkommando. Sie war eine etwa achtzig Jahre alte, streng gläubige Frau mit glatt nach hinten gekämmtem weißem Haar, stechendem Blick aus stahlblauen Augen und stoischem Ausdruck in ihrem faltenreichen Gesicht. Helmut fragte sich, was die zurzeit abwesenden Männer neben ihr für eine Rolle gespielt haben könnten. Oder waren sie Diktatoren wie sein Vater? Er hatte noch nie ohne väterlichen Druck gelebt, gedacht, sich bewegt. Das Umfeld der selbstbewussten Bäuerinnen verunsicherte ihn zunächst, er fühlte sich wie ein Fisch auf dem Trockenen. Auch die Natürlichkeit und Fröhlichkeit der Jüngeren war ein starker Gegensatz zum Verhalten seiner feinen, hoch gebildeten Mutter, deren Leben um die Etikette kreiste. Die einzige Frau auf dem Hof, mit der er bald unbefangen umgehen konnte, war doch die alte ‘Meyersche’. Sie hatte väterliche Züge, war aber nicht unberechenbar und ungerecht wie sein Vater, sie wurde nur laut, wenn es ihrer Meinung nach von der Sache her notwendig war. Ihr Credo lautete Unser Ziel ist, den Hof durch die schweren Zeiten am Laufen zu halten.
Darüber hinaus ging sie auf Helmuts einfallsreichen Humor ein. Mit zunehmendem Vergnügen genoss er ihre scharfsinnige Spitzfindigkeit und Schlagfertigkeit. Als Helmut einmal witzelte...
– Dieses Jahr gewinnen wir beim Verkauf unserer Überschüsse viel Geld und können damit das Gut bis zum Überfluss sanieren!
…schmetterte sie seine Phantasie in ruhigen Worten ab
– Von dem Geldsegen stellen wir Landarbeiter ein, die nicht wie Gänse schnattern, sondern arbeiten, um etwas zu beißen zu haben!
Diese Antwort war für Helmut ein Schlag vor die Stirn. Er lächelte trotzdem, sie sollte denken, er hätte ihren Satz als Witz aufgefasst.
Von einer geordneten landwirtschaftlichen Lehre konnte keine Rede sein. Helmut merkte bald, dass er eine solche im Wesentlichen selbst organisieren musste, was er auszunutzen gedachte. Da er mit dem Kommando der Frauen allmählich gut zurechtkam und zunehmend ohne Scham und Scheu mit ihnen sprach, gelang es ihm rasch, Kenntnisse über die Vorgänge und ihre Hintergründe in allen Bereichen zu erwerben. Das schloss veterinärmedizinische Grundkenntnisse und die Gutsverwaltung ein. Da niemand sonst einen vergleichbaren Bildungsstand hatte, wollten die Damen Helmut am Schreibtisch festnageln, die Buchhaltung war verwaist, Abrechnungen und Zahlungen wurden nur erledigt, wenn es unvermeidlich geworden war. Helmut weigerte sich. Gewöhnlich erreichte er mit entwaffnender Freundlichkeit seinen Willen. Eines Tages meinte die Meyersche bei einem Frühstück am meterlangen Holztisch in Gegenwart von zwanzig Familienmitgliedern und Helfern nüchtern
– Ohne diesen Teil deiner Ausbildung können wir dir kein vollständiges Zeugnis ausstellen.
Er biss in den sauren Apfel. Sobald er die Verwaltungsprozeduren in Wort und Zahl erfasst hatte, begann er, junge Frauen in die ‘spannenden Geheimnisse’ der Buchhaltung einzuführen. Es fanden sich mehr als nötig, die gewillt waren, mit ihm zusammenzuarbeiten, sie konnten ihn bald ‘vertreten’. Die Meyersche schmunzelte und nahm seine Bitte an, sich wieder mit Tieren beschäftigen oder im Freien arbeiten zu können.
Einem weiteren ‘Lernbereich’ wäre er gern aus dem Weg gegangen, der ‘Theorie’, er war sich sicher, nichts und niemand auf dem Anwesen könnte ihn etwas Neues lehren. Aber es gab ‘Theorie-Pflichtstunden’, die zum ‘Ausbildungskanon’ für Eleven gehörten. Helmut fand beides lächerlich, er konnte beim besten Willen keines von beiden erkennen. Die alte Meyersche hatte auch dafür eine Lösung: Es gab ein Regal mit verstaubten Büchern, die sich die Eleven dreimal pro Woche in je zwei Lesestunden unter ihrer Kontrolle zu Gemüte führen mussten. Helmut interessierten die alten Bücher höchstens ihres Aussehens wegen: kunstvoll gestaltete Einbände, naturgetreue Zeichnungen und bunte Bilder mit Seidenpapierschutz, nach denen er die Bücher ‘Die Sprache der Hoftiere’, ‘Hoftiere heilen’ und ‘Wenn kein Tierarzt kommt’ durchblätterte. Ohne dass es ihm bewusst wurde, schwand dabei sein Schulverdruss. Er verschlang die drei Bücher, während die Meyersche dafür sorgte, dass ihn in der Zeit niemand ablenkte. Danach entwickelte er den Ehrgeiz, Äußerungen von Tieren möglichst weitgehend zu verstehen, und beschloss, seine neuen Kenntnisse aus dem Kapitel ‘Beruhigung ängstlicher und nervöser Pferde’ zu überprüfen. Dafür gab es auf dem Hof einen Kandidaten, den Wallach Harras, der zum Pflügen, Ziehen von Wagen wie auch zum Reiten zu wild war und auch Helmut bei Befriedungsversuchen mehrfach abgeworfen hatte. Er sollte an den Schlachthof verkauft werden. Helmut war sicher, dass Harras sich aus Panik so verhielt und nicht aus Böswilligkeit, wie ihm unterstellt wurde. Mit Geduld, leisem Gesang und langem Sitzen auf ihm im Stall gelang es. Harras schien das Therapieprogramm auf die Dauer langweilig zu werden, sein Gemüt gesundete, und er wurde ein nützliches Tier.
Zum anderen erweckte Helmut das eingerostete kulturelle Leben des Anwesens zu neuem Leben. Besonders beliebt waren sein Harmoniumspiel, lebhafte Gespräche nach Feierabend und das Lesen von heiteren Theaterstücken in verteilten Rollen, zu dem er die Anwesenden ermutigte. Mit solchen Angeboten rettete er sich selbst vor der Langweile und davor – wie er befürchtete –, mangels Anregung geistig und kulturell zu verkümmern. Wie von ihm beabsichtigt, hellte es die Stimmung der Familie zu Lenzinghausen, aber auch der Hilfsarbeiter aus den Baracken auf. Das war ihm wichtig, inzwischen hatte er von ihnen grausame Kriegsgeschichten gehört.
Als die weibliche Kommandantur Helmut aufforderte, den Gottesdienst in der verwaisten Kapelle zu übernehmen, zog er einen Schlussstrich. Er sagte zu, einen Ersatz für den Pastor zu suchen, der früher an Sonn- und Feiertagen von Hof zu Hof gezogen, aber im Feld geblieben war. Helmuts Cousin Meinhard, der vor dem Krieg angefangen hatte, Theologie zu studieren, übernahm dankbar die Aufgabe, blühte auf, fügte sich rasch in die Gemeinschaft ein und arbeitete in der Landwirtschaft mit, wenn eine Hand fehlte. Er blieb im Ort und heiratete später eine Enkelin der Meyerschen, die auch mit Helmut geliebäugelt hatte.
Der fühlte sich von den jungen Frauen auf dem Hof bedrängt, es wurde ihm zunehmend unangenehm, der Hahn im Korb zu sein. Gewarnt von seinen Erfahrungen mit Charlotte wechselte er in distanziertere Freundlichkeit. Einige der Hoffenden versorgten ihn trotzdem heimlich mit Schinken, Speck, Butter und Eingemachtem mit der Auflage, Gläser und Gefäße wieder mitzubringen und nur ihnen auszuhändigen. Er ließ sie alle im Unklaren über die Zuwendungen der anderen. So konnte er seine Familie an den monatlichen freien Wochenenden mit Köstlichkeiten beglücken.
Was den ‘Altershof’ für seinen Vater anging, glaubte außer dem selbst schon lange niemand mehr an das Projekt. Der klammerte sich in illusionärer Verkennung an seinen Traum, der ihm die trügerische Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft gab. Demgegenüber wurde Helmut zunehmend ungeduldig. Statt eines geplanten Jahres hatte er mangels Alternativen schon achtzehn Monate auf dem Landgut der Meyers zu Lenzinghausen zugebracht, ihm ging alles zu langsam voran, es drängte ihn, die praktische Ausbildung so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, um Wichtigeres, Eigenes zu tun. Sein Ziel war, nach Abschluss seiner Lehre in Halle Landwirtschaft zu studieren. Die dortige Hochschule hatte internationalen Ruf. Seine ungelösten Probleme bestanden darin, dass er noch kein Abitur absolviert hatte, kein Geld zurücklegen konnte und seine Familie nicht in der Lage war, ihn zu unterstützen. Als Übergang zum Studium hatte er sich für Kurse an der renommierten ‘Landwirtschaftlichen Volkshochschule Lindenhof’ von Bethel beworben. Zuletzt hatte er monatelang sehnsüchtig auf eine Antwort vom Lindenhof gewartet. Die Familie schickte ihm deren Brief nach: Er war angenommen worden.
An der Landwirtschaftlichen Volkshochschule Lindenhof
Ein offener, lang gestreckter Pferdewagen holte Helmut und andere Reisende vom Bahnhof ab, ihr Ziel war ‘Bethel’. Helmut kannte die Betheler Anstalten, sein Großvater war ein Mitbegründer und Förderer der Einrichtungen gewesen. Beim Betrachten der Kutsche stellte Helmut mit Freude fest, dass die Tiere gesund waren und ihr Gefährt heil. Er dachte ‘Der Krieg ist endgültig vorbei, es geht wieder aufwärts’. An der Haltestelle ‘Lindenhof’ wurden er und die beiden anderen bis zur Endstation verbliebenen jungen Männer von einem gut gelaunten Pastor begrüßt, Helmut schätzte ihn auf etwa fünfunddreißig Jahre.
– Stukkart, Jens Stukkart, Pastor am Lindenhof.
Der Anblick des Lindenhofes ließ Helmuts Herz höher schlagen: Ein uralter Bauernhof, fast so groß wie der seiner Vorfahren, mit ebenso weitem Hoftor. Dahinter ragte ein neueres Gebäude hervor. Vor dem Gehöft stand eine alte Linde, die nach Helmuts Schätzung einige Hundert Jahre alt war und viele Kriege gesehen haben musste. Ihr dicker Stamm war von einer Sitzbank umgeben. Helmut war in eine Idylle geraten und entspannte sich erleichtert.
Zwei junge Männer mit Kriegsverletzungen gesellten sich zu ihnen. Sie stiegen über eine knarrende Holztreppe zum ehemaligen Heuboden im Scheunendach hoch, in den beidseitig fünf Kammern eingepasst worden waren. Der Pastor wies auf die Tür mit dem Schild ‘Schlesien’ und verabschiedete sich mit den Worten
– Um 18 Uhr treffen wir uns in der Kapelle, danach zum Abendbrot im Speiseraum und zwanzig Minuten später im Seminarraum. Bis gleich also! Und: Wir sprechen Sie beim Vornamen an, wenn Sie nichts dagegen haben.
Das hatten sie nicht und lachten zufrieden.
Die Kammer ‘Schlesien’ war mit drei Etagenbetten und sechs Spinden ausgestattet. Dort befanden sich bereits zwei junge Männer, die ihre Beine von zwei der Etagenbetten schaukeln ließen. Helmut sprang rasch auf das obere Bett neben der Tür. Die älteren Neuen begrüßten die Neuankömmlinge, ein großer Blonder mit Kurzhaarschnitt lachte.
– Auch genug Hühnerstall gereinigt und Kuhmist geschippt? Bereit für Philosophie? Was ist ein Huhn wirklich? Es kann sich nur um ein Versehen der göttlichen Schöpfung handeln!
Alle lachten, er fuhr fort.
– Ich bin Leuthardt von Kehl aus Walsrode und übernehme bald unser Familiengut. Seid gegrüßt!
Ein rothaarig Gelockter
– Das ist nichts im Vergleich zum Schweinestall! Ich wollte schon als Kind den unerträglichsten aller Gerüche analysieren, um ihn neutralisieren zu können. Das wird meine Doktorarbeit! - Lachen in der Runde
– Übrigens: Ich bin Nils Anderson aus Jönköping.
Leuthardt
– Aha! Russland? Island? Südamerika?
– Schlimmer! Schweden, südöstlich von Stockholm.
Leuthardt
– Ein reiches Land! Womit hast du das verdient? Sicher hübsche Mädchen dort.
Helmut dachte ‘Daher also ‘Nils’ und sein lispelnder Akzent. Er konnte nicht ahnen, wie schicksalhaft sich seine Begegnung mit Nils Anderson entwickeln würde. Er ergriff das Wort
– Mich interessieren schwierige Tiere, besonders störrische auf vier oder auf zwei Beinen. Helmut. Ich komme gerade von einem Hof in Lenzinghausen!
Leuthardt
– Ach, der Hof der Meyers von und zu Lenzinghausen. Wo? In Lenzinghausen!
– Du kennst ihn?
– Vor dem Krieg war er berühmt wegen seiner genossenschaftlichen Hofanlage.
Helmut
– Das war einmal! Jetzt kämpft das Gut um sein Überleben.
Peter aus Husum
– Wie unser Hof. Ich kam vor drei Jahren aus dem Krieg zurück und fand nichts mehr so wie es war. Wir kommen gerade aus der größten Not heraus. Meine Familie schickt mich hierher, damit wir modernisieren und sparen können. Ich hoffe, es lohnt sich, ich werde dort gebraucht.
Paul Ringer aus Breslau
– Ich hatte dort angefangen, Landwirtschaft zu studieren, kam aber bald an die Front, Ihr seht die Folgen. Nun soll ich an unserer Uni Kurse übernehmen, ich lehnte das ab, ich weiß nicht genug. Die Fakultät schickt mich hierher, danach wäre ich so weit. Daran habe ich meine Zweifel!
Dem folgte ein Chor von Stimmen.
– Warte ab!
– Wer weiß, vielleicht reicht es!
– Sieh es als einen Anfang!
Der letzte Neue war Arno Kreisler aus einem Dorf bei Kassel. Auch dieses Aufeinandertreffen hatte lebenslange Folgen für beide jungen Männer.
– Da unser Vater im Krieg geblieben ist, hat mein ältester Bruder den Hof geerbt, so hat es mein Vater festgelegt, damit der Hof nicht kleingeteilt wird. Wir sind sieben Geschwister. Ich möchte nicht unter seiner Fuchtel leben und arbeiten, sondern Landwirtschaft studieren. Dazu fehlt mir nur eine Kleinigkeit…
Ein Chor junger Männerstimmen unterbrach ihn.
– Die Groschen!
Alle lachten. Arno
– Ich nehme einen Intensivkurs im Zaubern!
Nils
– Bei uns wird tatsächlich gezaubert, das erledigen unsere Trolle!
Arno
– Das probiere ich bestimmt aus!
Helmut konnte nicht ahnen, dass auch er mit schwedischen Kobolden zu tun haben würde. Zusammen besichtigten sie kurz die gedrungene großbäuerliche Anlage, einige Türen trugen Schilder mit medizinischen Aufschriften. Das Anwesen lag in einer weitläufigen Hügellandschaft, in seiner Obstbaumplantage standen alte, knorrige Bäume. Die Ställe waren hell, luftig und sauber, die Tiere hatten Auslauf. Ein Geflügelhof grenzte an einen länglichen Teich, der von dichtem Schilfrohr umgeben war.
In der Kapelle hatten sich etwa zwölf junge Frauen und fünfzehn junge Männer in Gruppen versammelt. Die sechs ‘Schlesier’ gesellten sich zu ihnen. In der dritten Reihe saß eine junge, hübsche Frau mit modisch kurz geschnittenem Blondhaar, sie bemühte sich, drei Kinder, etwa drei, fünf und sieben Jahre alt, zu beruhigen. Neben ihr unterhielten sich ein paar würdig aussehende Herren, dahinter saß schweigend das Hauspersonal. Der Gottesdienst war schlicht und kurz, Pastor Stukkart dankte Gott für das Ende des Krieges und äußerte die Hoffnung, dass nie wieder Krieg von deutschem Boden ausginge. Helmut horchte auf, es war derzeit nicht überall geraten, über deutsche Anteile am Krieg zu sprechen. Stukkart erbat den Segen für die neue Volkshochschule, die jetzt den Vorkriegsgeist des Hauses ‘Frieden und Freundschaft’ wieder aufnähme. Während des Krieges wären auch Bildungs- und Kulturstätten umgestaltet worden, der Lindenhof glücklicherweise in ein politisch neutrales Lazarett. Nichts rechtfertige die Opfer von Menschenleben für den Zuwachs an Macht, Ruhm, Land oder Reichtum. Das Christentum sei dem Frieden verpflichtet, was auch das Leitmotiv für diesen Kurs darstelle. Mit jeder beruflichen Spezialisierung sei unweigerlich der Dienst am Menschen verbunden, so auch hier. Helmut atmete durch. Das würde er seinem Vater nicht erzählen, dem traute er zu, ihn aus dem Grunde wieder abzumelden. Ihm fehlten noch zwei Jahre bis zur Volljährigkeit.
Der Speisesaal war niedrig, Decke und Fußboden bestanden aus alten, dunklen Holzdielen. Helle Wandfarbe und blütenförmige Wandlampen gaben dem Raum eine warme Ausstrahlung. Eine freundliche, runde Hauswirtschaftlerin und eine Schar junger Frauen aus ihrem Bereich boten den Studenten an einem Tresen reichhaltige Kost an: Kartoffelsuppe mit Speckstücken, dicke Brotscheiben, Salat. Helmut aß zu viel, sein Magen hatte sich noch nicht wieder an das Vorkriegsmaß gewöhnt, ihm wurde übel. Er schmunzelte über sich selbst, ‘Keine Panik, Junge! Hier gibt es genug zu essen!’
Der Seminarraum war in der ehemaligen Wohnstube untergebracht, alte Bauerngemälde veranschaulichten die Jahrhunderte alte Geschichte des Gutes. Man saß in weiter Runde. Der Pastor stellte sich als Schulleiter vor. Helmut tuschelte Nils, seinem Sitznachbarn zu
– Wie der rangeht, unterrichtet er alle Fächer selbst!
– Warum nicht!
Pastor Stukkart berichtete, dass dieses Kursmodell aus Dänemark stamme und zum Ziel habe, Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiteten, ein Fenster zu Kultur, Wissenschaft und der Welt zu öffnen. Helmuts Herz schlug schneller: ein kleines Universalstudium? Und was war mit der Landwirtschaft?
Der Studienplan, den ihnen Pastor Stukkart am nächsten Tag vorstellte, beantwortete seine Fragen. Ein Drittel landwirtschaftliche Themen, dazu Verwaltung und Mathematik, ein Drittel Gesellschaftskunde mit Geschichte und Politik, einschließlich der ‘Neuen Republik’, und ein Drittel Kultur und Religionen. Dazwischen gab es Praxiseinheiten, im Winter in Ställen, Verarbeitungsbetrieben und in der Lagerhaltung. Die Studenten sollten sich in entsprechende Listen eintragen und sich einen ‘Studien-Plan’ nach bestimmten Kriterien zusammenstellen. Dazu gab es eine Informations- und Fragestunde. Stukkart einleitend
– Gebildete Landwirte orientieren ihre Arbeit nicht nur an Tradition und Markt, sondern auch an modernen Kenntnissen. Das macht sich in leichterer Planung, weniger Arbeit, besseren Ernten und damit höheren Einkommen bemerkbar. Landwirtschaft steht nicht im luftleeren Raum, sie ist Teil von Natur und Gesellschaft, ihrer Geschichte und der jeweiligen Politik...
Leuthardt unterbrach.
– Von unserer neuen Chaos-Politik lass ich mir nichts vorschreiben!
Stukkart
– Gerade, damit Sie klaren Urteils handeln können, erfahren Sie hier, welche politischen Interessen hinter der Landwirtschaft stehen, von den wirtschaftlichen der Erzeugerfirmen ganz zu schweigen, zum Beispiel beim chemischen Dünger! All das sollten Sie durchschauen können. Warten Sie ab und halten Sie das halbe Jahr durch!
Leuthardt saß nachdenklich da. Ein anderer Student meldete sich.
– Und wozu Religionen, wir sind evangelisch, unsere Kirche zeigt uns den Weg.
– Genau das ist es: Weltreligionen zu kennen, macht deutlich, dass wir einer von mehreren großen Religionen folgen. Jede von ihnen hat andere Schwerpunkte, zum Beispiel orientieren sich Naturreligionen an irdischen und himmlischen Naturgesetzen, Erde, Wasser, Luft und Sonnenlicht sind ihnen heilig, und sich selbst verstehen sie als Bestandteile der Natur.
Unruhe im Saal.
– Wieso andere! Das Christentum ist die einzig richtige!
– Wir sind auf dem richtigen Weg zu und mit Gott!
Stukkart
– Das glauben wir, aber auf der Welt gibt es viele Wege und andere Götter, die wir respektieren müssen, wenn wir es mit dem Weltfrieden ernst meinen. Wenn Sie im Osmanischen Reich geboren wären, wären Sie Moslems5 und würden nach den Regeln des Islam leben.
Unruhe im Saal. Helmut, war begeistert. Über Religionen wollte er alles wissen und fragte
– Können Religionen die Landwirtschaft beeinflussen?
– Oh ja, Moslems und Juden essen kein Schweinefleisch, Hindus dürfen keine Kühe schlachten, in Asien werden vor allem Reis und Hirse, angebaut, Kartoffeln sind unbekannt oder Gemüsebeilage.
Ein Mann kam herein, etwas untersetzt, Glatze, runde Brille. Er schüttelte Pastor Stukkart die Hand und meinte trocken
– Hast du wieder alle mit exotischen Geschichten erschreckt und gegen uns aufgebracht?
– Ich habe mein Bestes gegeben! Das ist Herr Beyer, Ihr Dozent für Landwirtschaft.
Beyer stellte sich als Direktor der landwirtschaftlichen Betriebe von Bethel vor. Der nächste, der hereinkam war ein schmaler Mann in kariertem Anzug, nach Helmuts Schätzung war er um die Vierzig, hatte rote Haare und abstehende Ohren. Er begrüßte seine Kollegen und die Studenten, führte sich als ihr Lehrer für Gesellschaftskunde ein und nahm neben Stukkart und Beyer Platz. Wieder ging die Tür auf, Helmut war gespannt, wer im letzten Drittel ‘Kultur’ geben würde. Ihm stockte der Atmen: Herein kam die attraktive junge Frau, die Mutter der drei Kinder. Stukkart stand auf, ging ihr entgegen und küsste sie auf beide Wangen. Helmut durchlief eine Hitzewelle, er merkte es und versuchte, sich zu beruhigen. Sie war seine Dozentin? Gab es solche Frauen? Und dann solch einen Engel! Stukkart
– Von meiner Frau erfahren Sie alles, was Sie zu Kultur wissen wollen bis auf Religionen und Grundlagen der Theologie, das ist natürlich mein Ressort. Ich spreche auch über Familienfragen, darin habe ich Erfahrung.
Zwischenruf von Frau Stukkart
– Er neigt zu Übertreibungen.
Pastor Stukkart lachend
– Stimmt begrenzt. Dazu fällt mir ein: Unser Sport. Wir treffen uns jeden Morgen um 6.30 Uhr an der Linde zum Lauf! Astrid, stell dich vor, und wenn es gar nicht anders geht, auch deine Fächer.