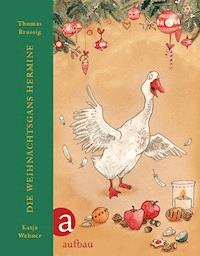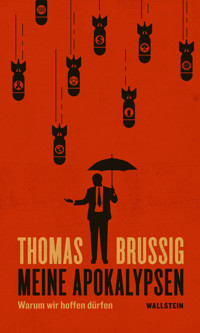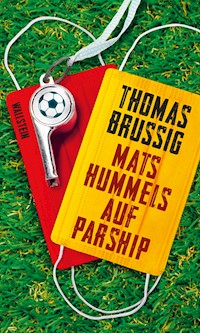9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Herrlich, schräg, bissig und pointenreich." Der Tagesspiegel.
Genau dieses Buch habe ihm damals gefehlt, als er um die zwanzig war, deshalb mußte er es selbst schreiben, sagt Thomas Brussig über seinen ersten Roman „Wasserfarben“. Die Geschichte einer Jugend in der DDR der achtziger Jahre wird mit einer wärmeren, stilleren Ironie erzählt als einige seiner späteren Bücher. Es ist die ein wenig trotzige, ein wenig traurige, ein wenig komische Geschichte eines Abiturienten, der nicht so recht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Ein Buch über das Erwachsenwerden, in dem der Held wie schon Generationen vor ihm bei Salinger, Kerouac oder Plenzdorf lässig-ironisch die großen Sinnfragen stellt, aber mit seinen Problemen ziemlich allein dasteht.
Bevor Thomas Brussig mit „Helden wie wir“ und „Sonnenallee“ große Erfolge feierte, war unter einem Pseudonym sein erster Roman „Wasserfarben“ erschienen: Ein Buch über das Erwachsenwerden, in dem die großen Sinnfragen bereits so lässig-ironisch gestellt werden, wie man das von seinen späteren Büchern kennt.
„Hätte ich ein zweites Leben, würde ich Brussigs Romane ins Englische übertragen. Nur um zweifelnden Amerikanern zu zeigen, wie unglaublich komisch deutsche Literatur sein kann.“ Jonathan Franzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
»Herrlich, schräg, bissig und pointenreich.« Der Tagesspiegel
Bevor Thomas Brussig mit »Helden wie wir« und »Sonnenallee« überwältigende Erfolge feierte, war unter einem Pseudonym sein erster Roman »Wasserfarben« erschienen: Ein Buch über das Erwachsenwerden, in dem die großen Sinnfragen bereits so lässig-ironisch gestellt werden, wie man das von seinen späteren Büchern kennt.
»Hätte ich ein zweites Leben, würde ich Brussigs Romane ins Englische übertragen. Nur um zweifelnden Amerikanern zu zeigen, wie unglaublich komisch deutsche Literatur sein kann.« Jonathan Franzen
Genau dieses Buch habe ihm damals gefehlt, als er um die zwanzig war, deshalb mußte er es selbst schreiben, sagt Thomas Brussig über seinen ersten Roman »Wasserfarben«. Die Geschichte einer Jugend in der DDR der achtziger Jahre wird mit einer wärmeren, stilleren Ironie erzählt als einige seiner späteren Bücher.
Es ist die ein wenig trotzige, ein wenig traurige, ein wenig komische Geschichte eines Abiturienten, der nicht so recht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Ein Buch über das Erwachsenwerden, in dem der Held wie schon Generationen vor ihm bei Salinger, Kerouac oder Plenzdorf lässig-ironisch die großen Sinnfragen stellt, aber mit seinen Problemen ziemlich allein dasteht.
Thomas Brussig
Wasserfarben
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Buch lesen
Über Thomas Brussig
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Mit den Widmungen ist das so eine Sache; immer wieder muß man affiges Zeug lesen.(»Meinem Lehrer Sowieso, der mich lehrte, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind« bzw. »nicht so zu nehmen, wie sie sind.«)
Es ereignete sich nach einem Konzert in Potsdam, kurz nach meiner Armeezeit. Das Licht im Saal war wieder an, die Leute waren fast alle raus, und wir bauten ab. Noch auf der Bühne, aber nicht mehr im Spot. Am Ende des Saales lehnte im Türrahmen ein Typ, der älter war als die anderen hier. Ungefähr vierzig. Barfuß, ein Weinglas in der Hand. Er war der Mann, der nach keiner Pfeife tanzt. Er war halbwegs besoffen. Unsere Blicke trafen sich. Ich war neunzehn, ich war groggy, und ich sah wieder mal überhaupt nicht durch. Wir waren beide heruntergekommen, jeder auf seine Art. Erst grinste er, dann hörte er auf zu grinsen und nickte mir langsam zu. Es ging mir gleich besser. Ich packte die Snare noch mal aus, setzte mich und trommelte einen Wirbel. Er lachte, prostete mir zu, trank aus und ging.
Ich möchte mein Buch dem Mann widmen, der mir einmal und für immer klarmachte: Alle, die je Gewalt über mich wollten, konnten noch nicht mal den nächsten Sommer verhindern.
Wenn Sie je versucht haben, ein Buch zu schreiben, dann wissen Sie, daß das eine verrückte Angelegenheit ist. Besonders der Anfang. Man sitzt da und weiß genau, daß man eine Menge aufschreiben könnte, aber man bringt kein Wort aufs Papier. Weil man den Anfang nicht findet. Das ist ungefähr so wie bei diesen beknackten Briefen. Da muß man sich auch immer elend abmühen, und trotzdem schreibt man im ersten Satz garantiert nur Stuß. Ehrlich. Erst Eric, ein achtjähriger Knirps, der einen Viertelliter Milch in fünf Sekunden aussoff, hat die richtigen Ideen gehabt. Das war im letzten Sommer. Eric schrieb nur an seine Großmutter. Ganz verschärfte Sachen. »Liebe Oma! Seit heute hat mein Kopf wieder eine Beule.« Tatsache, nur solche Dinger.
Ich wollte mich aber nicht großartig darüber auslassen, wie man vielleicht Briefe anfängt. Es hat genaugenommen nichts mit der Sache zu tun. Ich könnte ebensogut über Eric schreiben, wie er jeden Morgen seine Milch um die Wette soff und wie er immer laut lachte, wenn er gewonnen hatte, so daß man seine riesige Zahnlücke sah, und wie er immer die Augen aufriß, wenn er schluckte – aber das hat auch herzlich wenig mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Eine »eigentliche Geschichte« gibt es auch nicht. Es geht um die Monate vor dem Abi, genaugenommen um November bis Juni. Ich bin jetzt runter von der Schule und weiß nicht, was ich anfangen soll.
Im übrigen ist es jetzt halb vier morgens. Ich weiß nicht, zu welcher Zeit so ein Schriftsteller sein Buch anfängt, aber halb vier morgens dürfte wohl kaum allgemein üblich sein. Ich will damit nur sagen, daß ich nicht nur nicht richtig wußte, wie ich im ersten Satz anfangen sollte, sondern, zweitens, auch nicht um zehn Uhr vormittags, ausgeschlafen und gut gefrühstückt, zu schreiben beginne. Halb vier – das ist eine undurchsichtige Tageszeit. Ich kann nicht mal sagen, ob das jetzt noch der alte oder schon der neue Tag ist. Solange ich noch nicht geschlafen habe, denke ich, es ist immer noch der alte Tag. Aber draußen ist es nicht mehr richtig dunkel, der Morgen graut, und man kann sogar schon ahnen, was für ein Tag es wird. Man weiß, wie das Wetter wird und so, aber es ist eben noch nicht so weit. Vielleicht, weil die Sonne noch nicht scheint.
Genau. Erst muß die Sonne scheinen.
Die Schule war eine ziemlich durchschnittliche EOS. Nichts Außergewöhnliches. Ein paar Lehrer, allen voran der Direktor, glänzten trotzdem mit Sprüchen der Preislage, daß wir zur Elite der Nation, der Führungsgarde von morgen herangezogen werden und blablabla. Die bekämen wahrscheinlich die schlimmsten Minderwertigkeitskomplexe, wenn sie nicht die Illusion hätten, die Elite heranzuziehen. Das war mir von der ersten Sekunde an klar. Eine ganze Menge Schüler steht aber auf solche Sprüche. Die fühlen sich sonstwie bei diesen Aussichten. Die Schule hatte wirklich nichts Außergewöhnliches, aber alle machten tierisch einen auf Kaderschmiede. Die Zeugnisausgabe – in ein paar Tagen ist Zeugnisausgabe – wird im Marx-Engels-Auditorium sein. Falls es Ihnen nichts sagt, das ist der größte Hörsaal der Humboldt-Universität. Offenbar der geeignete Platz für die Zeugnisausgabe an die nachrückende hoffnungsvolle Wissenschaftlergeneration. Das Ganze wird natürlich als Höhepunkt unseres Lebens begangen. Da drunter machen sie’s schon nicht mehr. Oh, Mann, wird das peinlich. Die Mütter werden zusammengeknüllte Taschentücher in den Händen halten, die Väter werden den Sprößlingen auf die Schultern klopfen, und die Lehrer werden mit bedeutender Miene kundtun, daß sie uns mit gutem Gewissen ins weitere Leben entlassen. Alles nur fauler Zauber. Die ganze Schule war ein einziger fauler Zauber. Wirklich. Die Lehrer haben uns ständig versichert, daß sie sooo viel Vertrauen in uns haben und uns für sooo erwachsen halten, aber trotzdem haben sie andauernd unserer Evelin Zahn zugesetzt, ob denn der Kai Wenner wirklich der richtige Freund für sie sei. Sie kamen so auf die Tour mit Partnerschaftsberatung von wegen mehr Lebenserfahrung, aber in Wirklichkeit paßte es ihnen nicht, daß es bei Evelin ausgerechnet der sein mußte. Kai war nämlich bekannt dafür, daß er sich jeden Tag sein Bier mitbrachte, und wenn er sah, daß der Direktor – er heißt Schneider – am Hoftor wartete, um ihn zu filzen, dann machte er sein Bier vor der Schule auf und prostete Schneider zu. So ein Typ war Kai. Außerdem wußte jeder, daß er in einer Punkband mitmischt und daß er außerhalb der Heizperiode in einer Wohngemeinschaft wohnt. Nur unser Klassenlehrer wußte es nicht. Wir haben uns bepißt vor Lachen, als Kai erzählte, daß unser Klassenlehrer mal einen Hausbesuch bei ihm machen wollte und dabei in seine Punk-WG geriet.
Ich kriegte zum Glück ziemlich schnell mit, daß diese ganze Schule eine Nummer zu affig für mich ist. Das war schon zu Beginn der Elften, kurz vor den GOL-Wahlen. Da gabs einen unglaublichen Zirkus um Mario Fechner. Er war auch in unserer Klasse. Sie hatten Fechner dran, weil er den Diskussionsbeitrag »Warum ich nicht RIAS II höre« nicht halten wollte. Er hatte mal fallenlassen, daß er prinzipiell kein RIAS II hört, und nun wollten sie, daß er der ideologischen Diversion offensiv begegnet. Fechner hatte im Sommer in einer Möbelfabrik drei Wochen neben einem Kollegen gearbeitet, der jeden Tag von früh bis spät RIAS II drin hatte. Fechner sagte zwar immer, daß er diesen RIAS-II-Sound einfach nicht mehr hören kann, aber sie redeten andauernd was von dürftigen Beweggründen, und daß es für einen politisch denkenden Menschen nicht nur eine Geschmacksfrage sein kann, kein RIAS II zu hören. Er hatte ein paar ätzende Aussprachen mit unserem Klassenlehrer, unserer Stabülehrerin und der stellvertretenden Direktorin a. T. All diese Leute eben. Sie wollten allesamt nicht gelten lassen, daß Fechner nur aus Geschmacksgründen kein RIAS II hört.
Jedenfalls hat mir diese eine Geschichte gezeigt, wo’s hier langging. Die Lehrer erzählten zwar ständig, daß sie um Verständnis bemüht sind und daß wir ruhig Vertrauen haben sollen, aber wer sich diesen Quatsch aufs Brot schmierte, dem ging es immer nur so wie damals Fechner. Sie wollten uns eben nur hinbiegen, aber geholfen haben sie uns nie.
Einmal habe ich an der Klotür eine Zeichnung gesehen. Es war so eine Karikatur von unserem Klassenlehrer. Er war bekannt dafür, daß er andauernd beteuerte, daß er ein großes Herz für uns hat. Er steht einem Schüler gegenüber, und der Schüler fragt ihn: »Warum hast du so ein großes Herz?«, und er sagt: »Damit ich dich besser fressen kann.« Genau so war es auch. Genau so eine Schule war das.
Die meisten Schüler kommen mit der S-Bahn. In der Nähe sind ein paar Cafés, und nach dem Unterricht konferieren da immer ein paar Schüler. Es dreht sich schätzungsweise um Selbstmord, Gandhi und Free Jazz. Das sind meistens die Lateiner. Wir haben nämlich ein paar Lateinklassen an der Schule, und die halten sich für furchtbar humanistisch gebildet. Als wir unsere Werkstattwoche hatten, hat eine Lateinklasse ein antikes Stück im Originaltext gespielt. Kein Schwein hat die verstanden, und die wußten das. Wir saßen da und mußten diesen Käse über uns ergehen lassen. Ich hatte schon nach einer halben Minute genug davon, aber das dauerte zwei Stunden. Also wenn ich in so eine Lateinklasse geraten wäre, dann wäre ich spätestens nach drei Tagen aus dem zwanzigsten Stockwerk gesprungen. Hätte sicher Gesprächsstoff fürs Café gegeben.
Wie dem auch sei, ich beginne mal über den November letzten Jahres zu erzählen, und zwar mit dieser Woche, in der alles danebenging. Es war sozusagen ein Einbruch auf der ganzen Linie. Es macht mir auch keinen besonderen Spaß, das alles zu erzählen, aber ich komme eben nicht drum herum.
Es ging damit los, daß ich am Montag beim Direktor antanzen mußte. Es war belastend, total belastend. Ich hatte danach überhaupt keine Lust mehr, noch länger an dieser verklemmten Schule zu bleiben. Wenn ich was Besseres gewußt hätte und wenn meine Eltern nicht gewesen wären, dann wäre ich sofort und für immer von der Schule abgehauen, ich schwörs. Zwei Tage danach ist André von der Schule geflogen. Zwar noch nicht richtig offiziell, aber es war klar, daß er fliegen wird. André war mein Banknachbar und fast der einzigste in der Klasse, mit dem ich vernünftig reden konnte. An den übrigen Mitschülern hatte ich nicht viel. Sie langweilten mich irgendwie, weil sie diese ganze Schule so wichtig nahmen. Nicht alle, aber doch fast alle. Und die, mit denen ich gern etwas zu tun gehabt hätte, die sprangen total nicht an. Ich bin wahrscheinlich ein ziemlich unauffälliger Typ. Immer wenn ich Fotos von Klassenfahrten oder so durchsehe, finde ich kaum ein Bild, auf dem ich zu sehen bin, weiß der Kuckuck. Ich reiß mir nicht gerade ein Bein aus, um als toll zu gelten, aber es ist nicht eben schön, immer vergessen zu werden. André war nun der einzigste, der auch mal auf mich zukam. Und ausgerechnet er mußte von der Schule fliegen.
In dieser Woche hatte übrigens auch meine Mutter Geburtstag. Ganze Heerscharen ihrer Freundinnen fielen bei uns ein und kreischten und lachten und brüllten durcheinander. Als sie dazu übergingen, sich besser zu benehmen, suchten sie ein ernsthaftes Gesprächsthema und landeten schließlich bei mir und meiner weiteren Entwicklung. Das mußte ja kommen. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr es mich nervt, wenn mir irgendwelche halbfremden Frauen einen Lebensweg zurechtbasteln.
Zu allem Überfluß wandte sich auch noch Silke von mir ab. Um ehrlich zu sein, das war eigentlich das allerschlimmste in dieser beknackten Woche. Und den will ich erst mal sehen, dem so was egal ist.
Silke war meine Freundin, und was soll ich da groß sagen: Das Mädchen war einfach ein Engel. Manchmal fragte ich mich, was sie an mir fand, aber da war wohl wirklich was. Wir lernten uns vor dem Deutschen Theater kennen. Sie hatte eine Karte übrig, und ich brauchte noch eine. Sie hat mir ihre Karte gegeben. Nicht verkauft. Geschenkt. Im Theater saßen wir nebeneinander. Das Stück fand ich unmöglich, es war alles so düster und viel zu theatralisch, aber als wir uns in der Pause darüber unterhielten, erklärte sie mir, warum das Stück gut ist. So was war wirklich typisch für sie. Ihr entging wahrscheinlich nie etwas Gutes. Nach dem Stück lud ich sie noch auf ein Glas Wein ein. Mir fiel nichts Besseres ein, um mich für die Theaterkarte zu revanchieren. Ich weiß, es grenzt an Wahnsinn, nach dem Theater noch irgendwo zwei Plätze in einem Restaurant zu suchen, aber es machte ihr zum Glück nichts aus, auch in einer Kneipe Wein zu trinken. Da saßen wir dann und haben uns jedenfalls ganz schön lange unterhalten. Nein, da gibts nicht viel zu sagen: Es hat mich gleich voll erwischt. Es hat mich regelrecht umgehaun.
Doch sie war eben ein Engel, und ich kam mir dagegen vor wie so’n dahergelaufener Lümmel, der für ausverkaufte Theaterstücke noch eine Karte ergattern will und dann das Stück nicht versteht, Sie wissen schon. Außerdem war sie ein Jahr älter, und sie wollte im September ein Germanistikstudium anfangen, und so hatte ich ganz einfach Angst, sie würde mich nicht für voll nehmen. Junge, sie war ein Jahr älter! Ich brachte sie aber trotzdem noch nach Hause, und als wir aus der S-Bahn stiegen, hing sie plötzlich an meinem Hals und an meinem Mund und so. Ich war völlig hin. So was kannte ich noch gar nicht. Ich war wirklich völlig hin.
Silke wohnte bei ihren Eltern in einem Einfamilienhaus in Grünau. Ihre Eltern waren von Anfang an ein Problem. Eltern von kleinen Engeln sind immer ein Problem. Das liegt wohl in der Natur der Sache. Und so kam es dann auch, daß ich mich schließlich mit den Eltern anlegte, aber ich will der Reihe nach erzählen.
Es war also der Montagvormittag dieser deprimierenden Woche, und ich kam von der Hofpause, als mir im Treppenhaus mein Klassenlehrer begegnete. Er heißt Kohnert und gab bei uns Englisch. Er hielt in der einen Hand das Klassenbuch, und in der anderen Hand hielt er auch irgendwas, ich weiß nicht mehr, was. Er hat nie eine Hand frei, wenn man ihm begegnet. Nie. Wenn er einen Klassenraum aufschließen will, muß immer einer neben ihm stehen, der erst mal seinen ganzen Krempel hält.
»Anton« sagte er, »der Direktor möchte mal mit Ihnen sprechen. Er erwartet Sie.«
Er ließ diesen boshaften Unterton weg, mit dem er manchmal sprach, und deshalb fragte ich: »Wissen Sie, worum es geht?«
»Na, das wird er Ihnen schon selbst sagen.«
Lehrer halten zusammen. Das hätte ich eigentlich wissen müssen.
Ich holte meine Tasche aus dem Raum, in dem wir zuletzt Unterricht hatten, und ging ins Erdgeschoß. Der Schulhof war leer, mein Kopf war leer, und ich hatte kalte Finger, richtige Totenfinger. Das lag an diesen ungemütlichen Temperaturen. In der Schule ist es immer kalt, sogar im Sommer. Als ich den Gang zum Sekretariat runterging, überlegte ich, wie man zum Teufel noch mal geschliffene Betonfußböden nennt. Das Wort, das ich suchte, war irgendwie italienisch, aber es fiel mir nicht ein.
Die Tür zum Sekretariat stand offen. Die Sekretärin blickte mich kurz an und nickte rüber zur Tür des Direktorzimmers. Komischerweise fragte sie mich nicht, wer ich sei, oder zumindest, ob ich Anton Glienicke sei. Ich kann mich an absolut nichts erinnern, woher sie mich kennen könnte.
Die Tür zum Direktorzimmer stand ebenfalls offen. Der Direktor saß an seinem Schreibtisch und war in irgendwelche Unterlagen vertieft. Ich klopfte an die offene Tür, und er winkte mich kurz herein, ohne von seinen Blättern aufzusehen. Ich ging zwei Schritte in sein Zimmer und wartete. Im Sekretariat wurde getippt. Nach einer Weile murmelte er: »Machen Sie mal die Tür zu!«
Ich machte die Tür zu und stellte mich wieder dorthin, wo ich eben schon gestanden hatte, und wartete wieder. Ich war vorher noch nie im Direktorzimmer. Es sah aus wie jedes andere Direktorzimmer auch, mit Beratungstisch, Strohblumen und so. Auf einem Schrankunterteil stand ein Fernseher. Weiß der Geier, wozu da ein Fernseher stehen mußte.
Nach einer Weile entspannten sich die Gesichtszüge des Direktors, er schob seine Blätter von sich weg, faltete die Hände vor dem Bauch, streckte die Beine aus und kreuzte sie vor den Füßen. Das hielt er wahrscheinlich für die Pose, in der er mit mir sprechen sollte.
»Was meinen Sie«, fragte er hämisch, »weshalb wir Sie Ihr Abitur machen lassen?«
Mit solchen Fragen kann man mich plattwalzen. Ich weiß nie, was ich dazu sagen soll. Ich sagte nichts. Er dachte, daß ich etwas sage, aber ich sagte nichts.
»Als Sie sich um einen Abiturplatz beworben haben, mußten Sie einen ersten und einen zweiten Studienwunsch benennen. Wissen Sie noch, welche Wünsche Sie angegeben haben?«
»Ja.«
»Und?«
»Journalistik oder Außenwirtschaft.«
Das ist wahr. Ich wollte wirklich mal Journalist werden. Außenwirtschaft habe ich einfach nur so dazugesetzt. Es war in der alphabetischen Aufzählung der Studienrichtungen das erste Fach, das man mir vielleicht geglaubt hätte. Aber Journalist war echt. Natürlich gings mir nicht um die Ernteberichte in der »Aktuellen Kamera«.
Dem Direktor gefiel offenbar meine Antwort. Er rekelte sich in seinem Sessel und verschränkte die Arme vor dem Bauch. Ich stand immer noch.
»Hm. Und wieso haben Sie sich jetzt weder für diese Studienrichtungen noch für ein anderes Studium beworben? Sie hatten doch klare Vorstellungen, als Sie an diese Schule kamen.«
»Es hätte wenig Sinn gehabt, wenn ich mich beworben hätte. Es hätte genaugenommen überhaupt keinen Sinn. Ich habe Westverwandte, und dadurch ist für mich weder Journalistik noch Außenwirtschaft drin.«
Das stimmt leider. »Kaderpolitische Voraussetzungen« heißt mein wunder Punkt. Konkret ist es die Schwester meiner Mutter. Meine Mutter war mit mir bei der Studienberatung. Wir haben händeringend beschworen, daß wir bereit sind, den Kontakt abzubrechen, aber das fiel nicht ins Gewicht. Ich kann nicht Journalist werden. Und ein paar andere Sachen kommen auch nicht in Frage. Meine Mutter hat sich bei der Studienberatung gleich sagen lassen, was ich mir ebenfalls abschminken kann. Wir haben dann zu dritt dagesessen – die Studienberaterin, meine Mutter und ich – und haben den Katalog zusammengestrichen. Die meisten gestrichenen Richtungen haben mich nicht weiter interessiert, aber ein doofes Gefühl war es trotzdem, das können Sie mir glauben. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich das vorzustellen.
»Passen Sie mal auf«, fing der Direktor wieder an. »In den acht Klassen an meiner Schule, die jetzt Termin zur Studienbewerbung hatten, waren Sie« – das letzte Wort sprach er etwas lauter – »einer der ganz wenigen, die sich nicht für ein Studium beworben haben. Was glauben Sie denn? Glauben Sie denn, außer Ihnen hat keiner sonst an dieser Schule Verwandte im kapitalistischen Ausland? Und die haben alle ein Fachgebiet gefunden, das sie interessiert.«
Er rekelte sich schon wieder in seinem Sessel und spielte mit einem Bleistift zwischen den Fingern. Während er weitersprach, stierte er auf den Bleistift. Im übrigen sprach er sehr langsam. Es sollte nach »mit Bedacht gesprochen« klingen.
»Ich beobachte bei Ihnen eine gewisse Gleichgültigkeit. Gut, aus kaderpolitischen Gründen können Sie das Studium Ihrer Träume nicht aufnehmen. Aber warum bewerben Sie sich nicht um ein anderes Studium? Warum haben Sie sich in dieser Angelegenheit nicht vertrauensvoll an Ihren Klassenlehrer oder an mich gewandt? Wir hätten alles Erdenkliche getan, um Ihnen zu einer fristgemäßen Bewerbung zu verhelfen.«
Ich hörte, daß die Sekretärin nicht mehr tippte und daß sie den Bogen aus der Schreibmaschine zog. Schneider redete, und wir hatten nicht mal Nebengeräusche.
»Ich will Ihnen mal was sagen. Ihnen liegt gar nicht an solch einer Hilfestellung. Sie wollen sich treiben lassen. Ich warne Sie. Sollten wir weiterhin diese Tendenzen bei Ihnen beobachten, werden wir deutliche Konsequenzen ziehen. Einem Luftikus werden wir kein Reifezeugnis aushändigen, und wer weltfremden Illusionen nachjagt, der hat so manches noch zu lernen, und diesen Lernprozeß haben wir hier schon immer mit Nachdruck gefördert.«
Plötzlich fiel mir dieses italienische Wort ein. Es fiel mir in dem Moment ein, als er »der hat so« sagte. Er sprach das mit so einer eigentümlichen Betonung. Dadurch erinnerte ich mich wieder. Das Wort, das ich suchte, war Terrazzo. Es war ein irrsinniger Zufall, aber jetzt wußte ich es wieder.
Schneider lehnte sich etwas nach vorn. »Die Gesellschaft stellt Erwartungen, hohe Erwartungen an Abiturienten. Eine grundsätzliche Erwartung ist, daß er seinem Abitur einen Sinn gibt und ein Studium aufnimmt. Eine andere grundsätzliche Erwartung ist« – und jetzt ließ er den Bleistift ruhen und sah mich direkt an –, »daß er in der Frage des persönlichen Beitrages zur Landesverteidigung Partei für den Staat ergreift, der ihm diese hohe und kostspielige Ausbildung gewährte, daß er Partei ergreift, indem er sich für einen längeren Dienst entscheidet. Soweit ich informiert bin, ist in dieser Angelegenheit in Ihrer Klasse alles klar. Daß wiederum Sie zu der Ausnahme gehören, äh, wissen Sie, so langsam gewinne ich ein klares Bild von Ihnen. Ich gebe Ihnen jetzt Gelegenheit, zu Ihrer Trägheit und Bequemlichkeit Stellung zu nehmen.«
Ich konnte nichts dazu sagen. Ich fing an zu reden, aber ich hätte lieber meinen Mund halten sollen. Ich sagte bloß deshalb etwas, weil es ziemlich peinlich gewesen wäre, wenn ich wieder nichts gesagt hätte.
»Herr Schneider, ich bin ja selbst nicht glücklich darüber, daß ich nicht weiß, was ich studieren könnte. Ich war auf Journalistik geeicht, und in den Sommerferien platzte dann die ganze Geschichte. Ich habe vorher nicht gewußt, daß mir Westverwandte durch ihre bloße Existenz die Tour vermasseln. Naja, und von den Sommerferien bis zum Bewerbungstermin war auch nicht mehr viel Zeit, und von dieser Entscheidung hängt doch allerhand ab. Ich will mich jedenfalls nicht um ein Studium bewerben, das ich hinterher zurückgebe oder einfach schmeiße. Und was den Wehrdienst angeht …«
Hier geriet ich ins Stocken, aber er hatte ohnehin schon Luft geholt, um mich zu unterbrechen. Ich wollte sowieso nicht weitersprechen. Ich kannte diese Gespräche schon. Es hatte keinen Sinn. Er wäre mir nur mit seiner erwartungsvollen Gesellschaft gekommen, von der man nicht immer nur nehmen kann, sondern der man auch geben muß.
»Ja, was den Wehrdienst angeht«, fing er wieder an, »so hat Ihre FDJ-Gruppe den Beschluß gefaßt, daß alle Jungs der Klasse länger dienen. Sie setzen sich also noch obendrein über Beschlüsse der FDJ-Gruppe hinweg.«
»Ich habe dagegen ge…«
»Augenblick, noch rede ich! – Unter uns: Ich habe ja Verständnis dafür, daß Sie nicht gerade erwartungsfroh Ihrer Einberufung entgegensehen. Und wir haben auch deutlich gemacht, daß das Soldatenleben hart, entbehrungsreich und nicht immer angenehm ist. Aber wir haben genauso deutlich gemacht, daß dieser Dienst notwendig ist. Und gerade den Abiturienten, die morgen führend in unserer Gesellschaft sein werden, sollte – ach was heißt hier sollte –, muß diese Notwendigkeit einleuchten. Hier ist ganz konkret die Tat jedes einzelnen gefragt, und jeder einzelne muß sich auch gefallen lassen, danach beurteilt zu werden.«
Er schüttelte den Kopf. »Sie wollten Journalist werden, Sie wollten die komplizierten Kämpfe unserer Zeit schildern?« Er schüttelte noch mal den Kopf. Dann lehnte er sich wieder zurück, drückte sein Kinn an die Brust und warf mir diesen Blick zu, mit dem man als Schüler immer begutachtet wird.
»Und um noch einmal auf Ihre Bewerbung oder vielmehr Ihre Nicht-Bewerbung zurückzukommen: Ich habe die ganze Zeit über den Eindruck, daß Sie sich in Ihrer laxen Haltung sehr gefallen. Ich soll im Ernst glauben, daß ein junger Mensch in seinem zwölften Schuljahr noch keine fest umrissenen Vorstellungen davon hat, wo er seinen Platz in unserer Gesellschaft einnehmen soll? Das ist doch nicht normal! Allein schon Ihr schnoddriges – äh – Vokabular ist nicht normal: ›Studium schmeißen‹, ›die Tour vermasseln‹, ›die Geschichte platzte‹. Wenn Sie nirgendwo Verantwortung zu übernehmen bereit sind, dann müssen Sie sich …«
Es klopfte. Er rief zwar »Nein!« aber er setzte sich sicherheitshalber doch etwas ordentlicher hin. »… dann müssen Sie sich erst mal über Grundsätzliches klarwerden. Ich jedenfalls kann das so nicht hinnehmen. Was wollten Sie noch sagen?«
Ich wollte gar nichts sagen. Ich schwieg. Ich könnte allem, allem widersprechen, aber wozu? Es entstand schon wieder so eine Schweigepause. Sie war mir kein bißchen peinlich. Meinetwegen konnten wir uns bis zum Schuljahresende anschweigen. Er soll mich in Ruhe lassen. Mehr wollte ich nicht. Aber er soll mich in Ruhe lassen.
Er ließ mich nicht in Ruhe. »Wenn Ihnen dazu nichts einfällt, wird es Zeit, daß Sie sich darüber endlich mal Gedanken machen. Ich erwarte morgen von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme zu dem Problem. Die geben Sie bitte im Sekretariat ab. Ich gebe Ihnen den guten Rat, es nicht zu vergessen. Wir haben uns verstanden?«
Ich nickte. Mir blieb nichts anderes übrig.
»Gut. Dann können Sie jetzt wieder in Ihre Klasse gehen.«
Ich sagte auf Wiedersehen und ging. Draußen auf dem Gang holte ich erst mal Luft. So läuft das also ab an unserer Schule. Jetzt wußte ich es.
Ich stellte mich ans Fenster und kühlte mir die Nase und die Stirn an der Fensterscheibe. Der Schulhof war vollkommen tot. Ein paar Fetzen Papier lagen rum und nasse Blätter. Nasse, faulige Blätter.
Man muß sich höllisch vorsehen, daß sie einen nicht politisch drankriegen. Wie Obermüller. Obermüller haben sie drangekriegt. Obwohl da im Grunde gar nichts war. Aber sie haben es hochgespielt. Eine miese Geschichte. Und nun sind die bei mir. Schneider kam mir andauernd politisch. Ich habe aber nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, was er gegen mich verwenden kann. Das ist es nämlich. Erst machen sie einen auf vertraulichen Gesprächspartner, und dann drehen sie einem daraus ’nen Strick. Oder jedenfalls so ähnlich.
Das Dumme war nur, daß ich nicht wußte, wie heiß es überhaupt war. Diese Leute sind unberechenbar. Man weiß nie, ob sie einen echt drankriegen wollen oder ob sie nur einschüchtern. Oder ob sie vielleicht immer so mit einem reden. Das ist es ja. Man weiß überhaupt nicht, was man davon zu halten hat.
Außerdem sagte Schneider immer »wir«. »Einem Luftikus werden wir kein Reifezeugnis aushändigen« und so. Leider ist dieses »wir« nicht so dahingesagt. Diese »Wir«-Typen gibt es wirklich. Spätestens, wenn mal irgendwas ist, kriegt man schon mit, daß es sie gibt. Sie sitzen in allen möglichen Positionen und können so allerhand entscheiden. Und wenn man diesen Laden erst mal am Hals hat, kann man einpacken. Man wird dann meistens vor ein Gremium geladen. Alles Leute, die man nicht kennt. Im Grunde nur ein Schwindel. Diese Gremien haben Vorurteile bis dorthinaus. Da hatte bis jetzt noch keiner eine Chance. Das ist es eben. Man muß immer vorsichtig sein, damit man gar nicht erst in was verwickelt wird. Besonders politisch. Man muß sich höllisch vorsehen, daß sie einen nicht politisch drankriegen.
Als ich zurück in die Klasse kam, mußte ich mich erst mal von allen anglotzen lassen. André kippelte mit seinem Stuhl wie immer. Ich sitze neben ihm, in der letzten Reihe in der Fensterabteilung. Anderswo wäre es nicht auszuhalten.
Ich bin in der siebenten Klasse darauf gekommen, daß ich am Fenster sitzen muß. Und zwar hatte ich mich in ein Mädchen aus der Parallelklasse verknallt. Sie hieß Andrea Pawlowski, und sie hatte schwarze Haare, mit einem Blauschimmer – zumindest redete ich mir das mit dem Blauschimmer irgendwie ein. Außerdem war sie rank und schlank. Sie war haargenau der Typ, in den man sich in der siebenten Klasse verknallt. In jener Zeit hatte ich in den Hofpausen nichts anderes zu tun, als sie aus dem unbedingt entferntesten Winkel des Schulhofes zu beobachten. Ich wollte um alles in der Welt inkognito bleiben. Und wenn sie auf dem Schulhof Sportunterricht hatte, beobachtete ich sie auch. Zum Beispiel beim Weitsprung. Es war nun wirklich nicht das Erlebnis, sie springen zu sehen, aber wenn sie nach dem Sprung wieder zurück zu den anderen Mädels ging und sich dort unterhielt und lachte und mit ihren Armen und Beinen irgendwelche verrückten Bewegungen machte, um eine komische Geschichte zu erzählen – das mußte ich einfach sehen. Oder beim Ausdauerlauf. Sie trottete ihre Runden und schnatterte pausenlos mit ihrer Freundin, die nebenher trottete. Sie sah immer gut aus, die Andrea.
Ich habe ihr irgendwann mal einen Liebesbrief oder so was geschrieben. Sie hat sich schätzungsweise kaputtgelacht. Ich bin ein Rindvieh, und ich bin ein Rindvieh, solange ich mich kenne. Obwohl Andrea auch nicht viel besser war. Sie hat mich immer nur angekichert, und ich kriege heute noch Zustände, wenn ich sie sehe.
Als ich an die EOS kam, wollte ich unbedingt einen Fensterplatz. Ich war am ersten Schultag schon eine halbe Stunde früher in der Schule und machte den Raum ausfindig, in dem wir Unterricht haben sollten. Ich war wirklich der allererste im Klassenraum. Ich hängte meine Jacke über den Stuhl und sah mich ein wenig um. Es war das Russischkabinett. An der hinteren Wand war ein Spruchband ausgerollt.
EINE FREMDE SPRACHE IST EINE WAFFE IM KAMPF DES LEBENS!
KARL MARX (1818–1883)
Das Spruchband sah aus wie von 1882, und daneben war ein Bild von Karl Marx. Solange ich allein war, studierte ich noch die Inschriften auf den Bänken. Es war größtenteils recht amüsant. Ein paar Porträts waren auch dabei, natürlich alles irrsinnige Karikaturen. Vielleicht ist so ’ne EOS doch eine Art Zentrum der witzigsten, geistreichsten, universellsten und genialsten Menschen zwischen sechzehn und achtzehn. An der alten Schule stand auf den Tischen nur »FC Bayern München« oder »EISERN UNION« oder »The Cure«.
Als nächstes ging es darum, zu verhindern, daß sich Marco Czybulla neben mich setzt. Wir waren zusammen in der alten Klasse gewesen und nun an dieselbe EOS gekommen. Unterm Strich ist er ein unausstehlicher Typ, der ständig um Zensuren diskutiert und der schon in der Achten als einziger beim Klassenschwänzen nicht mitmachte, weil er pausenlos an seinen Abiturplatz dachte. Und dann, als er den Abiturplatz hatte, dachte er pausenlos an seinen Medizinstudienplatz. Neben so einem wollte ich auf keinen Fall sitzen. Leider bin ich nicht der Typ, der einem anderen sagen kann, daß er lästig wird. Selbst wenn so einer wie Czybulla aufdringlich wird, bringe ich es kaum fertig. Er hatte mich jedenfalls noch vor den Sommerferien gebeten, daß ich meinen Nebenplatz für ihn freihalte, und das in einem Ton, als ob wir nie etwas anderes als die dicksten Kumpels gewesen wären.
Wie gesagt, ich wollte auf keinen Fall neben ihm sitzen. Deshalb ging ich wieder aus der Klasse, ließ aber meine Jacke über dem Stuhl hängen. Als ich kurz vor Unterrichtsbeginn wiederkam, hatte sich André schon auf meinen Nebenplatz gesetzt. Czybulla saß irgendwo in der Wandreihe und hielt seinen Nebenplatz frei. Für mich. Es war kaum zu fassen. Ich konnte ihm sagen, daß ich schon ’nen guten Platz gefunden hatte, von dem ich nicht mehr weg wollte. Und mit André als Nachbarn hatte ich wirklich Glück. Wir verstanden uns. Wir redeten nicht übermäßig viel, aber wir verstanden uns. Zum Beispiel, wenn wir im Sportunterricht Fußball spielten und ein Ball ins Aus ging, den Czybulla vorher noch berührt hatte, was der in seinem ehrenhaften Ton bestritt, daß einem nur das Kotzen kam, dann sah ich zu André, und er sah zu mir, und wir grinsten uns an, weil wir wußten, daß wir dasselbe über Czybulla dachten, ohne daß wir nur ein einziges Mal über ihn gesprochen hatten. So meine ich das.
André wollte übrigens Schauspieler werden. Ich glaube, er hat wirklich das Zeug dazu. Er hat bei unserer Werkstattwoche sein eigenes Ein-Personen-Stück aufgeführt. Es heißt »Freiheitsberaubung (II)«. Es gibt schon ein Stück, das »Freiheitsberaubung« heißt. Es ist im Grunde auch ein Ein-Personen-Stück. Man sollte es kennen. Da hat ’ne Frau einen Waschlappen von verheiratetem Liebhaber in ihrer Wohnung eingeschlossen und dann den Schlüssel weggeschmissen. Sie will nämlich einen Skandal. In dem Stück erzählt sie einfach nur von sich. Was sie so denkt und all das. Das ist im Prinzip schon das ganze Stück. Ein einziger Monolog mit ein paar Liedern zwischendurch.
André hat sich dem Waschlappen gewidmet. Er hat sich ausgedacht, wie dessen Monolog aussieht, wenn er in der abgeschlossenen Wohnung hockt. Wir haben uns bepißt vor Lachen. Allein schon, daß er den ganzen Monolog durch gesächselt hat. André war der absolute Star der Werkstattwoche. Aber sie haben ihm den Preis nicht gegeben. Sie wollten eine kollektive Leistung sehen. Außerdem machte sich André damit bei manchen Lehrern unbeliebt. Einen Tag nach der Aufführung hatten wir gleich eine Klassenleiterstunde, und Kohnert, unser Klassenlehrer, sagte uns, daß viele Lehrer unangenehm berührt seien, weil sich unsere Klasse für ein Stück entschieden habe, dessen einziger Inhalt Spott und Satire für ein Mitglied der Partei der Arbeiterklasse sei. André hatte sich bei der Aufführung tatsächlich ein Parteiabzeichen ans Revers gesteckt. Kohnert sagte weiterhin, daß wir das Nötige tun sollen, um Spekulationen über ideologische Ungereimtheiten in unserer Klasse ein Ende zu machen. Die FDJ-Leitung solle erst mal eine Stellungnahme verfassen, die wir alle unterschreiben und die am Schwarzen Brett ausgehängt wird. Ansonsten sei das Stück eine Provokation, die die Parteigruppe der Schule nicht hinnehmen werde. Und so weiter. Mir war klar, daß Schneider die Sache eingerührt hatte. All diese beschissenen Formulierungen. So redet nur Schneider. Außerdem kannte Kohnert das Stück schon vor unserer Werkstattwoche. André hatte es uns mal vorgespielt. Damals stieß sich Kohnert nicht daran. Und dann so was. Wahrscheinlich war Kohnert froh, daß er wegen der Werkstatt weiter keine Arbeit mit uns hatte.
Unser FDJ-Sekretär – er heißt Martin Krawczewski – sagte okay, er werde mit seiner Leitung eine solche Stellungnahme verfassen. Er kam aber noch in der nächsten Pause zu André und sagte, er solle sich keine Sorgen machen. Die Stellungnahme werde nicht darauf hinauslaufen, daß man sich von André distanziert, sondern es solle vielmehr kundgetan werden, wie das Stück zu verstehen sei und wie man es auf keinen Fall verstehen darf. Damit, so hoffe er, ist die Angelegenheit erledigt. So was ist typisch für Martin. Er rettet, was noch zu retten ist. Er ist ein sehr guter Vermittler. Sie hätten diese Stellungnahme mal lesen sollen. Ein unangreifbares Plädoyer für André und sein Stück, gehalten in Schneiders Jargon. Martin hat wirklich Übersicht in solchen Dingen. Er kann alle möglichen peinlichen Geschichten sauber aus der Welt schaffen. Und damit war diese Geschichte aus der Welt.
André fragte mich leise, ob ich wirklich beim Direktor war. Ich nickte. Dann wollte er wissen, weshalb. Ich sagte nur, wegen Studium und Armee. Ich hatte überhaupt keine Lust, ausführlich zu erzählen.
»Hat er auch von mir gesprochen?« fragte er. Ich verstand die Frage nicht. Die Werkstatt war längst verjährt. Sie lag ein halbes Jahr zurück.
Nach der Stunde sagte André: »Ich muß dir was erzählen.« Er schleppte mich aufs Klo. Das ist der einzige Ort, wo man nicht gleich aufgescheucht wird. Er wollte mir offensichtlich eine umfangreichere Geschichte erzählen, aber wir hatten als nächstes ohnehin nur Physik. In Physik geht es immer drunter und drüber.
»Ich war am Samstag im Theater …«
»Was hast’n gesehen?« Er ist laufend im Theater.
»Ach – Romulus der Große. Von Dürrenmatt.«
»Und wie wars?«
»Reichlich dürre, reichlich matt. – Also, ich war …«
»Wie? Reichlich dürre, reichlich matt?« Von ihm kommen ständig solche Dinger.
»Naja, ist nicht von mir. – Also, ich war am …«
»Wie war denn schnell noch mal dieser Brecht-Spruch?«
»Hör mir mal zu!«
»Nee, sag doch mal!«
»Mensch! Irgendwie so: Brecht nicht auf die Bühne! Brecht aus dem Fenster!«
»Genau den meine ich! Brecht nicht auf die …«
»Wunderbar. Also, ich war am Samstag im Theater, bis dreiviertel zehn. Danach wollte ich noch bei Kette auf Arbeit anrufen; Kette kennst du doch?«
Ich nickte. Kette heißt eigentlich Jürgen Kettner. André hatte mich mal zu Kette mitgeschleift, zu einer Frikassee-Fete. Es waren fünfundzwanzig Leute eingeplant, und ganze sieben kamen. Kette hatte einen Eimer Frikassee gekocht, und wir mußten damit fertig werden. Wir schafften es auch, aber Kette fraß allein schon einen halben Eimer. Ich hatte damals den Eindruck, daß er auch den ganzen geschafft hätte, wenn es darauf angekommen wäre. Kette sah schlimm aus. Er schwitzte wie ein Tier, das Kinn war dermaßen vollgekleckert, daß die Soße schon den Hals runterlief, und auch aus den Mundwinkeln quoll ständig dieses dicke Zeug. Aber er schaufelte sein Frikassee rein wie nichts, und wenn er eine Pause machte, dann fragte er uns immer nur, ob wir nicht auch finden, daß es etwas weniger Muskat auch getan hätte. Sogar, als es ihm eigentlich schon aus den Ohren hätte rauskommen müssen, fragte er uns alle naselang, ob es etwas weniger Muskat nicht auch getan hätte. Als wir endlich den Eimer leer gekriegt hatten, fragte André: »Kette, findest du nicht auch, daß es etwas weniger Frikassee auch getan hätte?« – Das war im wesentlichen mein Erlebnis mit Kette.
»Also, Kette hatte am Samstag Spätdienst bis um zehn. Bis dahin mußte ich ihn anrufen. Ich hatte ihn nämlich gefragt, ob er mir am Sonntag mal sein Motorrad borgen kann. Er mußte aber noch was dran bauen, und deshalb sind wir so verblieben, daß ich ihn am Samstagabend noch mal auf Arbeit anrufe.«
Es klingelte. André sprach erst weiter, als es aufgehört hatte zu klingeln. Er sprach etwas gedämpft.