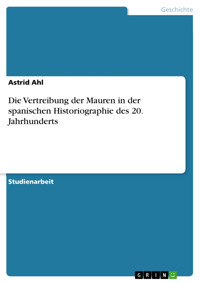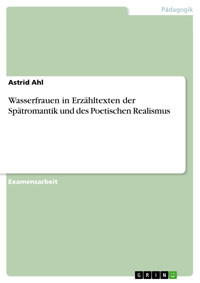
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Literaturgeschichte, Epochen, Note: 2,0, Georg-August-Universität Göttingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Wasserfrauen weckten seit jeher das Interesse der Dichter und Schriftsteller. In vielen Kulturen und Zeiten lassen sich Erzählungen über sie ausfindig machen: In den antiken Mythen faszinierten die noch namenlosen Nymphen und Sirenen, im Mittelalter wurde mit dem Mythos um Melusine und Undine die Grundlage einer langen literarischen Tradition geschaffen, die ihren Höhepunkt in der Romantik finden sollte und bis in die Gegenwart reicht. Die Wasserfrau inspirierte jedoch nicht allein in der Literatur zu Nachbildung und Ausformung, sondern auch in den Bereichen Kunst und Musik. Diese Examensarbeit hat die Analyse von „Wasserfrauen“ in der Erzählliteratur der Spätromantik und des Poetischen Realismus zum Ziel. Inspiriert wurde die Themenstellung durch Theodor Fontanes Roman Effi Briest, der zur Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau im ausgehenden 19. Jahrhundert anregte. Auffallend bei Effi ist ihre Affinität zum Element Wasser, die sie mit den gesellschaftlichen Konventionen jener Zeit in Konflikt bringt. Gleich Effi imaginiert Fontane in seinen Werken zahlreiche Frauengestalten als Naturwesen, als Wasserfrauen. Diese Verknüpfung von Wasser und Weiblichkeit ist in den Werken der Romantik und des Realismus zu finden. Dabei ist auffallend, dass die von Männern imaginierte Wasserweiblichkeit als männermordende Dämonin, verführerische Kindfrau oder morbide Frau nicht mit der sozialen Rolle der Frau in der Gesellschaft übereinstimmte. Dieser Divergenz soll in der vorliegenden Untersuchung der Wasserfrau mit Blick auf die geschlechtlichen Disparitäten im 19. Jahrhundert nachgegangen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 3
1. Einleitung
Wasserfrauen weckten seit jeher das Interesse der Dichter und Schriftsteller. In vielen Kulturen und Zeiten lassen sich Erzählungen über sie ausfindig machen: In den antiken Mythen faszinierten die noch namenlosen Nymphen und Sirenen, im Mittelalter wurde mit dem Mythos um Melusine und Undine die Grundlage einer langen literarischen Tradition geschaffen, die ihren Höhepunkt in der Romantik finden sollte und bis in die Gegenwart reicht. Die Wasserfrau inspirierte jedoch nicht allein in der Literatur zu Nachbildung und Ausformung, sondern auch in den Bereichen Kunst und Musik.
Diese Examensarbeit hat die Analyse von „Wasserfrauen“1in der Erzählliteratur der Spätromantik und des Poetischen Realismus zum Ziel. Inspiriert wurde die Themenstellung durch Theodor Fontanes RomanEffi Briest,der zur Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau im ausgehenden 19. Jahrhundert anregte. Auffallend bei Effi ist ihre Affinität zum Element Wasser, die sie mit den gesellschaftlichen Konventionen jener Zeit in Konflikt bringt. Gleich Effi imaginiert Fontane in seinen Werken zahlreiche Frauengestalten als Naturwesen, als Wasserfrauen. Diese Verknüpfung von Wasser und Weiblichkeit ist in den Werken der Romantik und des Realismus zu finden. Dabei ist auffallend, dass die von Männern imaginierte Wasserweiblichkeit als männermordende Dämonin, verführerische Kindfrau oder morbide Frau nicht mit der sozialen Rolle der Frau in der Gesellschaft übereinstimmte. Dieser Divergenz soll in der vorliegenden Untersuchung der Wasserfrau mit Blick auf die geschlechtlichen Disparitäten im 19. Jahrhundert nachgegangen werden. Bisherige Untersuchungen zu Wasserfrauen beschäftigten sich hauptsächlich mit der Liebesbeziehung zwischen Menschenmann und Wasserfrau, beschrieben einzelne aquatische Frauengestalten oder untersuchten motivgeschichtlich die Undine- und Melusine-Figur in verschiedenen Werken. Eine übergreifende Analyse der Wasserfrau der Spätromantik und des Poetischen Realismus, die auf die Determiniertheit der literarischen Konzeptionen durch männliche Imaginationen des Weiblichen eingeht, fehlte bis jetzt und soll in dieser Arbeit geleistet werden.
Dabei gilt es zu beachten, dass nicht vonderWasserfrau gesprochen werden kann, obschon sich in den Texten Merkmale eines übergreifenden Wasserfraukonzeptes finden lassen. Die
1Unter dem Oberbegriff Wasserfrau lassen sich viele weibliche Wasserwesen wie Nixen, Najaden, Okeaniden,
Sirenen, Undinen, Melusinen oder die Figur der Loreley subsumieren. Um einer Verwirrung des Lesers vorzu-
beugen, wird der Verständlichkeit halber der Terminus Wasserfrau verwendet, es sei denn, ein bestimmter Typus
der Wasserfrau ist Gegenstand der Darstellung. Viele Attribute der Wasserfrau aus Mythen, Sagen und Märchen
sind nicht übertragbar auf Frauengestalten des Realismus, beispielsweise das Leben im Wasser, der Fisch-schwanz, die Seelenlosigkeit. Daher kann von der Wasserfrau im Realismus nur im übertragenen Sinn ge-sprochen werden. Angemessener wäre wahrscheinlich die Bezeichnung „Frauengestalten mit einer Affinität zum
Element Wasser“. Um einer einheitlichen Terminologie willen wird jedoch auch im Realismus von „Wasser-frauen“ gesprochen. Die zur Kennzeichnung der übertragenen Bedeutung notwendigen Anführungszeichen wer-den der Einfachheit halber im Folgenden weggelassen.
Page 4
Untersuchung verschiedener aquatischer Frauengestalten aus Romantik und Realismus sowie die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden sollen darüber Aufschluss bringen.
In den ersten beiden Teilen wird ein allgemeiner Überblick über die Forschung zu den Themen Wasser, Weiblichkeit und Wasserfrau gegeben. Der Antagonismus des Wassers als lebensspendend und lebensbedrohend ist dabei konstitutiv für die Frage, warum Wasser und Weiblichkeit zueinander in Beziehung gesetzt wurden. Anschließend wird die Motivgeschichte der Wasserfrau von der Antike bis zum Beginn der Romantik nachgezeichnet. Eine ausführlichere Darstellung erfährt dabei die Elementargeisterlehre des Paracelsus, die grundlegend für die Romantiker wurde. Die Wasserfrau der Romantik ist sowohl in Gedichten und Kunstmärchen als auch in Volksmärchen zu finden. Den MärchenDie WassernixeundDie Nixe im Teichvon Jacob und Wilhelm Grimm widmet sich ein kurzer Exkurs. Im dritten Teil wird die Wasserfrau in den romantischen Kunstmärchen am Beispiel derUndine(1811) von Friedrich de la Motte Fouqué,Der kleinen Meerfrau2(1837) von Hans Christian Andersen und Eduard MörikesHistorie von der schönen Lau(1853) betrachtet. Ein Blick auf die Forschungsliteratur zeigt, dass sich kaum eine Studie zum Thema Wasserfrau nicht auf Fouqué oder Andersen bezieht.3Ihre Märchen werden so zu Klassikern unter den Bearbeitungen aquatischer Frauengestalten. Aus diesem Grund liegt das besondere Augenmerk auf Mörike, dessen Wasserfrau Lau bisher weniger Beachtung in der Forschung fand. Fouqués Kunstmärchen wurde dennoch bewusst mit in die Textauswahl hineingenommen, da seine Undine als „die Verkörperung romantischer Liebe“4gilt. Darüber hinaus versucht die Analyse von Andersen bislang weitestgehend unbeachtete Interpretationsansätze der Forschung zur Camouflage von Andersens homoerotischer Neigung aufzuzeigen.
2Abhängig von der jeweiligen Übersetzung finden sich in der Forschungsliteratur die Termini Meerfrau (nach
der für diese Arbeit gewählten Übersetzung von Heinrich Detering), Seejungfrau und Meerjungfrau.
3Helga Trüpel-Rüdel: Undine - eine motivgeschichtliche Untersuchung, phil. Diss. Bremen 1987. Matthias Vo-
gel: „Melusine ... das lässt aber tief blicken“. Studien zur Gestalt der Wasserfrau in dichterischen und künstle-
rischen Zeugnissen des 19. Jahrhunderts. Bern/Frankfurt am Main/New York/Paris 1989 (Europäische Hoch-
schulschriften: Reihe 28, Kunstgeschichte; Bd. 101). Irmgard Roebling (Hrsg.): Sehnsucht und Sirene: vierzehn
Abhandlungen zu Wasserphantasien. Pfaffenweiler 1991 (Thetis 1). Anna Maria Stuby: Liebe, Tod und Wasser-
frau. Mythen des Weiblichen in der Literatur. Opladen 1992 (Kulturwissenschaftliche Studien zur deutschen
Literatur). Ruth Fassbind-Eigenheer: Undine oder Die nasse Grenze zwischen mir und mir. Ursprung und litera-
rische Bearbeitungen eines Wasserfrauenmythos. Von Paracelsus über Friedrich de la Motte Fouqué zu Ingeborg
Bachmann. Stuttgart 1994 (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik 291). Gerlinde Roth: Hydropsie des
Imaginären. Mythos Undine. Pfaffenweiler 1996 (Frauen in der Literaturgeschichte 5). Isabel Gutiérrez Koester:
„Ich geh nun unter in dem Reich der Kühle, daraus ich geboren war...“. Zum Motiv der Wasserfrau im 19.
Jahrhundert. Berlin 2001. Helena Malzew: Menschenmann und Wasserfrau. Ihre Beziehung in der Literatur der
deutschen Romantik. Berlin 2004. Inge Stephan: Weiblichkeit, Wasser und Tod. Undinen, Melusinen und
Wasserfrauen bei Eichendorff und Fouqué. In: Inszenierte Weiblichkeit. Codierung der Geschlechter in der
Literatur des 18. Jahrhunderts, hrsg. von ders. Köln/Weimar/Wien 2004 (Literatur-Kultur-Geschlecht. Studien
zur Literatur- und Kulturgeschichte 20), S. 207-230.
4Fassbind-Eigenheer: Undine, S. 64.
Page 5
Im Gegensatz zur Romantik überrascht das Auftauchen der Wasserfrau im Poetischen Realismus, der sich per definitionem mit der Darstellung der Wirklichkeit befasst. Damit setzt sich der vierte Teil der Arbeit auseinander. Da die Forschung sich nahezu erschöpfend mit den Romanen Theodor Fontanes sowie bezüglich des Motives der Wasserfrau in einigen seiner Werke beschäftigt hat, liegt der Schwerpunkt hier auf den Melusine-FragmentenMelusine. An der Kieler-Bucht(1877),Oceane von Parceval(1882) sowieMelusine von Cadoudal(1895). Vergleichend werden andere seiner Werke herangezogen, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht erschöpfend behandelt werden können. Daher müssen an einigen Stellen Hinweise auf weitere Ansätze oder Probleme der Forschung genügen. Da unter den realistischen Autoren nicht allein Fontane Wasserfrauen in seinem Werk ausformte, werden zudem Wilhelm RaabesDie Innerste(1874) und Theodor Storms NovelleAuf der Universität(1863) betrachtet. Abgesehen von den Fragmenten Fontanes wurde mit Storm ein Text in die Analyse hineingenommen, der, bislang noch weitgehend unbeachtet von der Forschung, Raum zur Interpretation bietet.
Im fünften Teil bleibt zu fragen, inwiefern die literarischen Konzeptionen der Wasserfrau im 19. Jahrhundert von den jeweiligen zeitgenössischen Weiblichkeitsbildern bedingt waren. Diese von Wünschen und Ängsten der Männer geprägten Imaginationen des Weiblichen werden anhand der Figur derfemme fatalein den Blick genommen. Doch auch diefemme fragilesoll an dieser Stelle nicht vernachlässigt werden. Dabei fällt die Diskrepanz von vorgestellter und real existierender Weiblichkeit auf: die Überlegenheit derfemme fataleüber den Mann im Gegensatz zur gesellschaftlichen Machtlosigkeit der Frau.
In der abschließenden Auswertung der Ergebnisse kann schließlich eine Minimaldefinition der Wasserfrau entworfen werden, die auf den in dieser Arbeit analysierten literarischen Varianten beruht.
Page 6
1.1 Zum Stand der Forschung
Die Wasserfrau ist Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten, deren Anzahl jedes Jahr durch neue Publikationen steigt und kaum noch überschaubar ist.5Ein besonderes Interesse gilt dabei den literarischen Epochen der Romantik und des Realismus sowie den Figuren der Melusine und Undine. Innerhalb der Epochen lassen sich die Forschungsschwerpunkte jeweils an bestimmten Autoren festmachen und so gibt es für die Romantik kaum eine Studie, die sich nicht mit FouquésUndineals „klassischer“ Wasserfrau-Erzählung auseinandersetzt. Für die Analyse der Wasserfrau im Realismus hingegen wird immer wieder Theodor Fontane herangezogen. Die Untersuchungen zum Melusinischen in seinem Werk sind dabei kaum noch zu überblicken.6Am ausführlichsten wurdeEffi Briestin diesem Zusammenhang analysiert. Dabei wurde immer wieder hingewiesen auf die Bedeutung des Wassers. Von literarischen Epochen unabhängige Forschungsarbeiten beschäftigen sich größtenteils mit der Figur der Undine (bei Fouqué, Bachmann, Giraudoux), ob diese nun motivgeschichtlich untersucht wird wie von Helga Trüpel-Rüdel oder in ihrer Eigenschaft als Grenzgängerin, so bei Ruth Fassbind-Eigenheer in ihrer StudieUndine oder Die nasse Grenze zwischen mir und mir.Eine ähnliche Faszination wie Undine übt die Figur der Melusine auf die Forscher und Forscherinnen aus. Das neueste Werk ist erst vor wenigen Wochen im Buchhandel erschienen.7Schon Virginia Woolf (ARoom of One´s Own,1928) und Simone de Beauvoir (Daszweite Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau,1949) wiesen auf die Unterschiedlichkeit von konstruierter und real existierender Weiblichkeit hin. In der Historiographie stets unterrepräsentiert, ist die Frau in der Literatur- und Kulturgeschichte immerzu gegenwärtig. Jedoch überwiegend als beschriebene denn als schreibende Frauen. Wasserfrauen finden sich daher hauptsächlich in von Männern verfassten Texten, in denen die Frau als das ‚Andere’ imaginiert wird.8Doch
5Vgl. Malzew: Menschenmann, S. 24.
6Genannt seien an dieser Stelle nur die in dieser Arbeit verwendeten Forschungsbeiträge: Norbert Frei: Theodor
Fontane, die Frau als Paradigma des Humanen. Königstein/Ts. 1980 (Literatur in der Geschichte, Geschichte in
der Literatur 3); Bettine Menke: Fontanes Melusinen. Bild, Arabeske, Allegorie. In: Das verortete Geschlecht.
Literarische Räume sexueller und kultureller Differenz, hrsg. von Petra Leutner und Ulrike Erichsen. Tübingen
2003, S. 101-125; Hubert Ohl: Melusine als Mythos bei Theodor Fontane. In: Mythos und Mythologie in der
Literatur des 19. Jahrhunderts, hrsg. von Helmut Koopmann. Frankfurt am Main 1979 (Studien zur Philosophie
und Literatur des neunzehnten Jahrhunderts 36), S. 289-305; Ders.: Melusine als Mythologem bei Theodor Fon-
tane. In: Fontane Blätter 42 (1986), S. 426-440; Wolfgang Paulsen: Im Banne der Melusine. Theodor Fontane
und sein Werk. Bern/Frankfurt am Main/New York/Paris 1988; Irmgard Roebling: Nixe als Sohnphantasie. Zum
Wasserfrauenmotiv bei Heyse, Raabe und Fontane. In: Sehnsucht und Sirene. Vierzehn Abhandlungen zu Was-
serphantasien, hrsg. von ders. Pfaffenweiler 1991 (Thetis 1), S. 145-203; Renate Schäfer: Fontanes Melusine-
Motiv. In: Euphorion 56 (1962), S. 69-104.
7Claudia SteinkämpersMelusine - vom Schlangenweib zur „Beauté mit dem Fischschwanz“. Praktiken und
Strategien der literarischen Aneignung.Göttingen 2007 (Veröffentlichungen des Max-Plancks-Instituts für Ge-
schichte 233).
8Vgl. Stuby: Liebe, S. 59; Silvia Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu
kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen. Frankfurt am Main 1979, S. 10-12,
23; Dies.: Frauen aus dem Meer, S. 365; Walter Erhardt und Britta Herrmann: Feministische Zugänge - ‚Gender
Page 7
wie auch immer die einzelnen Wasserfrauen literarisch ausgestaltet sind, allen Vorstellungen gemein ist „das Wunsch- und Schreckensbild einer elementaren Weiblichkeit, oder anders formuliert, der Mythos vom Naturwesen Frau.“9Einzelne Wasserfrau-Erzählungen werden in der Forschung aus feministischer Perspektive analysiert, jedoch sollte eine vorschnelle Kontrastierung von ‚guten’ Frauen und ‚bösen’ Männer vermieden werden. Die Dichotomie ‚Opfer Frau’ und ‚Täter Mann’ ist in den Texten keineswegs immer eindeutig zu finden. Gerade in den Werken Theodor Fontanes und Wilhelm RaabesDie Innerstesind die Männer eher halbe Helden denn starke Kerle.10
1.2 Zur Symbolik des Wassers
Die Determinativkomposita zur Bezeichnung weiblicher Wasserwesen als Wasserfrau, Wasserweib, Meerjungfrau, Seejungfrau oder Meerweibchen zeichnen sich alle durch das Grund-wort Frau bzw. Weib aus, dem ein Bestimmungswort aus dem Bereich ‚Wasser‘ hinzugefügt ist. Dabei weist das Determinans nicht nur auf einen bevorzugten Aufenthaltsort der Frauen hin, sondern deutet eine Analogie von Weiblichkeit und Wasser an. Um diese Ähnlichkeit, ob nun real oder fiktiv, aufzugreifen, muss zunächst bestimmt werden, welchen Symbolgehalt Wasser haben kann.11Ausführlich befasste sich damit Sibylle Selbmann in ihrer Arbeit über denMythos Wasser12, in der sie folgende Aspekte herausarbeitet: Dem Element Wasser kommt in nahezu allen Schöpfungsmythen und Legenden eine wichtige Bedeutung zu. Häufig wird die Entstehung der Welt oder der jeweiligen Kultur aus dem Wasser beschrieben. Als Ursprung des Lebens von vielen Kulturen des Altertums verehrt, gelten Quellen und andere Gewässer als Heiligtümer.13
Wasser kann in verschiedenen Formen erscheinen, so zum Beispiel als Regen, Eis, Nebel oder Hagel. In literarischen Werken nicht immer mit Symbolgehalt aufgeladen, dient es manchmal einfach nur dem Ambiente; als Symbol jedoch hat es viele Bedeutungen. Die wichtigsten dabei sind seine lebensspendende und zerstörerische Kraft: Menschen, Tiere und Pflanzen wachsen und gedeihen erst durch Wasser, sie sind von ihm abhängig. Ohne das kühle Nass wäre kein Leben möglich. Daher wird es auch mit Fruchtbarkeit assoziiert. Flüssen, die das Land fruchtbar hielten, wurde bereits im Altertum als Gottheiten gehuldigt. Die lebensspendende Kraft des Wassers wird im Glauben an einen Jungbrunnen zur lebensverlängernden er-Studies’.In: Grundzüge der Literaturwissenschaft, hrsg. von Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering.
München 2005, S. 498-515, hier S. 499-501.
9Stephan: Weiblichkeit, S. 220.
10Darauf wird später noch einzugehen sein.
11Vgl. Vogel: Melusine, S. 10.
12Sibylle Selbmann: Mythos Wasser: Symbolik und Kulturgeschichte. Karlsruhe 1995.
13Vgl. Selbmann: Mythos Wasser, S. 6-15; Gutiérrez Koester: Wasserfrau, S. 18.
Page 8
höht. Seine zerstörerische Macht offenbart das Element in Form von Sturmfluten, Überschwemmungen, starken Regenfällen, Strudeln und Hagelschlägen. Seit jeher betrachtet der Mensch das nasse Element mit gemischten Gefühlen: In den Kulturen der Griechen, Römer, Azteken und Inder wurden die Meeres-, Fluss- und Regengötter verehrt und mit Opfern besänftigt. In den Überlieferungen vieler Völker ist Wasser indes auch die Heimat von Meeresungeheuern und Wasserwesen wie Nixen, Nymphen oder Undinen.14Leben und Tod, Werden und Vergehen verdeutlichen sich auch in den unterschiedlichen Er-scheinungsformen des Wassers. Brunnen, Quelle, Regen oder Wasserfall stehen als Sinnbild für den Kreislauf des Lebens. Aber auch Ebbe und Flut sind Ausdruck von Vergänglichkeit und Erneuerung. Im ewigen Kreislauf von Leben und Tod offenbart sich die Erneuerung auch im Wiederaufleben der Natur nach einem Gewitter. Die durch das Wasser symbolisierte Vergänglichkeit des Lebens wird insbesondere in Form des fließenden Stromes, des Wasserfalles, der Wellen und der Wolken deutlich. Doch Wasser ist nicht nur Zeichen von Flüchtigkeit, sondern versinnbildlicht im Meer durch seine scheinbar unendliche Tiefe und Weite auch die Ewigkeit.15
In Form des Meeres kann Wasser nicht nur die Ewigkeit symbolisieren, sondern ist auch Zeichen von Liebe, Leidenschaft und Fruchtbarkeit. Sinnbild dieser Leidenschaft sind die sich überschlagenden und aufschäumenden Wogen, die zudem aus dem Unterbewussten aufsteigende sexuelle Begierde und Leidenschaft symbolisieren. Das Auf und Ab der Wellen kann aber auch menschliches Leben und Schicksal versinnbildlichen, wobei die Wellenbewegung dem Auf und Ab des Lebens entspricht, dem der Mensch ausgesetzt ist. Das bewegte, aufgewühlte Meer allegorisiert, im Gegensatz zu Brunnen und Quellen als Zeichen erwachender Hinneigung, die Macht und die Gefahr der Sexualität, die im Bild der Überschwemmung kulminiert. Bereits in der Antike galt Wasser als Symbol der Liebe: Aphrodite, die griechische Göttin der Liebe und der Schönheit, wurde aus Meerschaum geboren. Als Sitz von Fruchtbarkeitsgöttinnen wurden Quellen schon im antiken Griechenland verehrt. Auch Regen, der sich über der Erde ergießt und diese zum Grünen bringt, gilt in vielen Mythen als Sinnbild von Sexualität und Fruchtbarkeit. Während Quellen als Sinnbild weiblicher Sexualität gelten, werden Regen, Gewitter, Wasserfall und Springbrunnen gemeinhin als Bild männlicher Sexualität angesehen.16
14Vgl. Vogel: Melusine, S. 13; Selbmann: Mythos Wasser, S. 20f., 28, 32-40.
15Vgl. Selbmann: Mythos Wasser, S. 48, 74-78, 82-86; Vogel: Melusine, S. 13; Gutierréz Koester: Wasserfrau,
S. 20; Annette Kaufmann: Zur Symbolik der vier Elemente in den späten Romanen Fontanes. Marburg 1996, S.
73.
16Vgl. Selbmann: Mythos Wasser, S. 88f., 117-125; Vogel: Melusine, S. 14, 16; Kaufmann: Symbolik, S. 73;
Gutiérrez Koester: Wasserfrau, S. 18-20.
Page 9
In vielen Sagen und Religionen gilt Wasser als Symbol der Reinigung und Erlösung, so etwa im Christentum in Form der Taufe. Aber dem Wasser werden auch heilende Kräfte zugesprochen, die beispielsweise in Heilbädern oder in der Thalassotherapie genutzt werden. Neben dieser Heilkraft besitzt Wasser in zahlreichen Mythen auch die Gabe der Prophetie: Oftmals bilden Quellen und Grotten Orte der Weissagung, so wurde etwa das Orakel von Delphi über einer Grotte errichtet. Die Vorstellung, Wasser sei ein Quell des Wissens, zeigt sich auch in dem Brauch, Opfergaben zur Befragung der Zukunft ins Wasser zu werfen.17Der reichhaltige Symbolgehalt des Wassers faszinierte viele Künstler und regte sie zu zahlreichen Werken in Kunst, Musik und Literatur an. Heutzutage allerdings wird Wasser nüchtern als Rohstoff betrachtet. Es hat seinen symbolischen Status weitestgehend, aber im Hinblick auf Taufe und Weihwasser nicht völlig verloren.18
1.3 Wasser und Weiblichkeit: Die Frau als Wasser
Die Menschen versuchten seit jeher, sich eine Vorstellung von der sie umgebenden ambigen Natur zu machen, einer Natur, die Nahrung und Schutz spenden, zugleich aber Leben vernichten kann. Um diese Natur begreifen zu können, sie fassbar zu machen, stellte der Mensch sie sich in menschlicher Gestalt vor.19So sahen die Griechen der Antike in einer Überschwemmung das Wirken des Meeresgottes Poseidon, die Römer das des Neptun, den es mit Opfergaben zu besänftigen galt.
Solche Personifikationen der Natur fanden auch Eingang in die europäische Literatur. Insbesondere über Wasserfrauen verfassten Dichter und Schriftsteller zahlreiche Werke. All diesen Erzählungen gemein ist die Bedeutsamkeit des Elementes Wasser für die Gestaltung der Protagonistin. Diese erschöpft sich jedoch nicht in der Herkunft der Frau aus dem Wasser, sondern die Frau wird in Analogie zu dem Element gesetzt.20
Die lebensspendende Kraft, die das kühle Nass auszeichnet, ist auch der Frau zu eigen: Wie das Wasser die Erde zum Grünen und die Pflanzen zum Wachsen bringt, spendet die Frau als Gebärende21neues Leben und zieht in den Kindern eine neue Generation auf. Ohne Nach-
17Vgl.Selbmann: Mythos Wasser, S. 58, 65, 71f., 131-135; Vogel: Melusine, S. 16; Kaufmann: Symbolik, S.
73; Trüpel-Rüdel: Undine, S. 5; Beate Otto: Unterwasser-Literatur. Von Wasserfrauen und Wassermännern.
Würzburg 2001 (Epistemata 348), S. 157.
18Vgl. Selbmann: Mythos Wasser, S. 73, 143-157; Otto: Unterwasser-Literatur, S. 157.
19Vgl. Volker Klotz: Das europäische Kunstmärchen. Fünfundzwanzig Kapitel seiner Geschichte von der Re-
naissance bis zur Moderne. München 2002, S. 162; Trüpel-Rüdel: Undine, S. 4; Otto: Unterwasser-Literatur, S.
58.
20Vgl. Sabine Wilke: Die Zähmung der grausamen Frau: Seelenlose Wasserkreaturen und ihre Welt des Imagi-
nären. In: Text & Kontext 21 (1998). S. 145-171, hier S. 145; Vogel: Melusine, S. 10.
21Die Frau soll hier nicht auf eine Gebärfunktion reduziert werden. In Bezug auf die angesprochene lebensspen-
dende Funktion ist jedoch die Möglichkeit der Frau zur Schwangerschaft allein von Interesse.
Page 10
wuchs würde die Menschheit aussterben, so wie die vom Wasser abhängigen Pflanzen und Lebewesen ohne die lebensspendende Feuchte nicht überleben könnten. Doch es sind nicht nur die Frauen, die neues Leben gebären, sondern auch Frauen, die als Hebammen das neue Leben holen und die Neugeborenen nach der Geburt waschen. Diesem Brauch der postnatalen Reinigung entspricht in vielen Kulturen der Brauch der Totenwaschung, der ebenso meist Frauen oblag. Daneben sind es in vielen Kulturen Frauen, die sich um die Toten kümmern und um diese trauern. Dieser eher passiven Rolle im Umgang mit dem Tod steht in vielen Mythologien die Frau als todbringende Göttin oder Dämonin gegenüber. Die Frau wird also gleich dem Wasser sowohl mit Leben als auch mit Tod in Verbindung gebracht. Leben und Tod, Werden und Vergehen sind Bestandteile eines Kreislaufs, der in der Natur durch die Jahreszeiten, durch Ab- und Zunahme des Mondes sowie auf das Wasser bezogen durch Ebbe und Flut gekennzeichnet ist. Wie die Natur ist auch der Körper der Frau einem Kreislauf unterworfen, der sich in der monatlichen Menstruation offenbart.22Doch wie dem nassen Element nicht nur die Eigenschaften von Erneuerung und Vergänglichkeit zu eigen sind, erschöpft sich die Analogie von Wasser und Weiblichkeit nicht in den Aspekten Leben und Tod. Gleich dem Wasser wird den sogenannten ‚weisen Frauen‘ durch die Kenntnis von Kräutern Weisheit und Heilkraft zugesprochen. Als Symbol der Reinigung wird Wasser im Christentum mit Unschuld verknüpft und so in Bezug zu Maria gesetzt. Die Antike dagegen sah in der Verschlingungsfunktion des Wassers ein Sinnbild von Erotik und Leidenschaft. Anziehungskraft und Faszination des Wassers wurden so mit der Verlockung der Frau gleichgesetzt. Die dem Element inhärenten Sinnbilder von Unschuld und Erotik entsprechen der Dichotomisierung des Weiblichkeitsbildes: Der Mann verehrt die Frau als Heilige und verteufelt sie als Hure.23
Des weiteren gleichen die als nachgiebig und passiv beschriebenen Frauen auch in diesen Eigenschaften dem Wasser.24Wie sich der Flusslauf der Landschaft angleicht, ist Wasser, das nur in festem Zustand als Eis oder Schnee formbar ist, in flüssigem Zustand vollkommen anpassungsfähig. Es kann jede erdenkliche Form annehmen, in die es hineingefüllt wird. Auf die Analogie von Wasser und Weiblichkeit bezogen erscheint der Mann dabei als feste Form, an die sich die Frau anpassen soll.
22Vgl. Selbmann: Mythos Wasser, S. 62, 76; Roth: Hydropsie, S. 18; Vogel: Melusine, S. 13f.
23Vgl. Selbmann: Mythos Wasser, S. 39f., 65; Vogel: Melusine, S. 13, 16; Otto: Unterwasser-Literatur, S. 157.
24Vgl. Selbmann: Mythos Wasser, S. 140.
Page 11
2. Die Wasserfrau in der Literatur: Von der Antike bis zur Romantik
In zahlreichen Werken jeglicher literarischer Gattung sind Nymphen, Sirenen und Nixen sowie Melusinen und Undinen zu finden.25Dabei reicht die literarische Auseinandersetzung mit diesen Wesen, die in der Romantik ihren Höhepunkt fand, von der Antike bis in die Gegenwart.
Bereits bei Völkern der vorchristlichen Zeit findet sich die Vorstellung von mächtigen, übernatürlichen Frauen, denen eine Verbundenheit zu den Elementen eigen ist. Doch handelt es sich dabei noch um Mischwesen, die mehreren Bereichen, meist Erde, Wasser und Luft, zuzu-ordnen sind. Reine Ausprägungen von Wasserfrauen entstanden erst durch Bedeutungswandel im Laufe der Jahrhunderte. So symbolisierten die antiken Sirenen in der griechischen Mythologie ursprünglich die Seelen Verstorbener oder geleiteten diese ins Totenreich. Sie wurden als Mischwesen mit dem Körper eines Vogels und dem Kopf einer Frau, in der Nähe des Wassers lebend, dargestellt. Doch schon bei Homer verloren sie ihre ursprüngliche Bedeutung. Im 12. Gesang seinerOdyssee(etwa 8. Jh. v. Chr.) stilisierte er sie - als durch ihren verführerischen Gesang Vorbeifahrende in den Tod lockende Frauen - zur weiblichen Bedrohung. Damit griff er möglicherweise die etymologische Bedeutung des Wortes auf, das sich aus dem griechischen ‚seirenes’ ableitet mit der Bedeutung „die Bestrickende, Fesselnde“26. Die im Homerischen Epos geschilderte jahrelange Irrfahrt des Odysseus führt ihn auch an der Insel der Sirenen vorbei, doch kann er auf Kirkes Rat hin den Gesang der Sirenen dank Vorkehrungen unbeschadet vernehmen. Dieser Ausgang der Sirenenepisode, der weder für Odysseus noch für die Sirenen negative Konsequenzen hatte, wurde in der nachhomerischen Zeit als unbefriedigend empfunden, weshalb es zu Umdichtungen dieser Episode kam: Aus Verzweiflung, dass ein Mann ihnen widerstehen konnte, stürzen sich die Sirenen ins Meer; in einer anderen Version versinkt die Insel mit ihnen. Bereits hier wird eine Festlegung der Machtpositionen von Mann und Frau versucht, doch sowohl bei Homer als auch in den späteren Bearbeitungen ist die Frau dem Mann unterlegen. Trüpel-Rüdel und Gutiérrez Koester verstehen den Untergang der Sirenen als Untergang der alten weiblichen Gottheiten und damit als Sieg des Patriarchats, in welchem weibliche Gottheiten fortan marginalisiert wurden.27
25Vgl. Wilke: Zähmung, S. 145.
26Stuby: Liebe, S. 36. Vgl. dazu auch Malzew: Menschenmann, S. 36 Anm. 68; Gutiérrez Koester: Wasserfrau,
S. 32; Trüpel-Rüdel: Undine, S. 11. Die Herleitung des Wortes Sirene durch Alfons Rosenberg, der ‚sir’ als
semitische Wortwurzel mit der Bedeutung ‚Gesang’ auffasst, stieß dagegen in der Forschung auf Widerspruch.
Vgl. ebd., S. 11.
27Vgl. Trüpel-Rüdel: Undine, S. 11-13; Malzew: Menschenmann, S. 35f.; Stuby: Liebe, S. 11-16, 21; Gutiérrez
Koester: Wasserfrau, S. 25, 32-34; Wilke: Zähmung, S. 145.
Page 12
Domestizierungsversuche der Sirenen sind schon in der Antike erkennbar. Sie verlieren ihren bedrohlichen Aspekt und werden beispielsweise bei Plato zu Musen, bei Sophokles gleich ihrer ursprünglichen Rolle zu Trauervögeln. Doch die nachhomerische Ausgestaltung der Sirenen als in den Tod lockende Verführerinnen bleibt trotz dieser Domestizierungsversuche bis ins christliche Mittelalter bestehen und wird in der christlichen Ikonographie zahlreich gestaltet. Obwohl bereits in den ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderten vereinzelt mit Fisch- oder Schlangenschwanz abgebildet, wurde erst im Mittelalter aus dem Vogelwesen die fischschwänzige Frau im Wasser. Oft wurde die Sirene mit einem gespaltenen Fischschwanz dargestellt, den sie dem Betrachter unverhohlen präsentiert. Damit zeigt sie offen ihre Dysfunktionalität als Frau im Patriarchat, indem sie auf ihre Unfähigkeit zu gebären verweist. Als „Monstra“28wird sie daher Theophrast von Hohenheim, genannt Paracelsus, in seiner Ele-mentargeisterabhandlung bezeichnen. Immer häufiger jedoch wird der geteilte Fischschwanz der Sirene in der Ikonographie als einschwänzig geschuppt dargestellt und damit bildlich immer mehr der Schlange im Paradies angeglichen. Mit der veränderten Darstellung der Sirenen im Mittelalter wandelt sich auch ihre Bewertung: Die antiken Gottheiten werden von der christlichen Lehre zu Dämonen stilisiert und damit dem Bereich des Bösen und Teuflischen zugerechnet. Als Sinnbild weltlicher Verlockung und Unkeuschheit wird die den (See-)Mann vom Kurs abbringende Sirene von den Kirchenvätern verbal bekämpft. Neben anderen übernatürlichen Frauen stellt auch die Sirene im Sinne der christlichen Lehre eine Bedrohung für die Seele des Mannes sowie für die christlichen Sitten dar. Sie wird zur Verkörperung des Trugbildes, zeigt doch der obere, aus dem Wasser emporragende Teil einen schönen Frauenkörper, während die Wasseroberfläche die untere gefährliche Tierhälfte verborgen hält. Doch entgegen der christlichen Dämonisierung konnte die Sirene zusammen mit anderen übernatürlichen Wesen im Volksglauben überleben.29
Eine Variante der verlockenden Sirene bildet im deutschen Sprachraum die als Nixe in den Volksglauben eingegangene Wasserfrau. Durch die häufige mittelalterliche Darstellung der Sirene mit nur einem Fischschwanz ließ sie sich kaum noch von der einschwänzigen Nixe unterscheiden. Einzig durch den Aufenthaltsort konnte zwischen beiden noch differenziert werden, da die Sirene im Meer lebt und die Nixe in Teichen oder Seen. Gerade diese stehenden Gewässer sind es, die im Volksglauben aufgrund ihrer trügerisch glatten Oberfläche als
28Theophrast von Hohenheim, genannt Paracelsus: Das Buch von den Nymphen, Sylphen, Pygmaeen,
Salamandern und den übrigen Geistern. Marburg a.d. Lahn 1996 (Basilisken-Druck 10). [Faksimile der Ausgabe
Basel 1590. Übertragen und mit einem Nachwort versehen von Gunhild Pörksen], S. 48. Vgl. Gutiérrez Koester:
Wasserfrau, S. 38.
29Vgl. Trüpel-Rüdel: Undine, S. 15-19, 25; Gutiérrez Koester: Wasserfrau, S. 36-43; Stuby: Liebe, S. 11, 37f.;
Malzew: Menschenmann, S. 36, 125