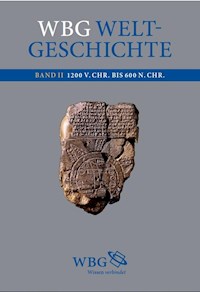
wbg Weltgeschichte Bd. II E-Book
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: wbg Academic
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die ›WBG Weltgeschichte‹ betrachtet – im Gegensatz zu bisherigen weltgeschichtlichen Darstellungen – die gesamte Menschheitsgeschichte erstmals unter dem Aspekt der globalen Zusammenhänge und Abhängigkeiten und bietet so einen modernen und zeitgemäßen Gesamtüberblick. Wer etwas über die Geschichte der Menschen auf dem Planeten Erde unter Berücksichtigung aller Zeiten und Kulturen erfahren möchte, kommt an diesem Werk, an dem bedeutende deutsche Fachvertreter der Geschichtswissenschaften mitgewirkt haben, nicht vorbei: »Sowohl ein universitärer Leserkreis als auch ein breiteres Publikum finden hier wichtige lesenswerte Darstellungen zu großen welthistorischen Themen des 19. und 20. Jahrhunderts« Historische Zeitschrift
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 954
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
WBG WELTGESCHICHTE
EINE GLOBALE GESCHICHTEVON DEN ANFÄNGEN BIS INS 21. JAHRHUNDERT
Herausgegeben vonWalter Demel, Johannes Fried, Ernst-Dieter Hehl,Albrecht Jockenhövel, Gustav Adolf Lehmann,Helwig Schmidt-Glintzer und Hans-Ulrich Thamer
In Verbindung mit derAkademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
WBG WELTGESCHICHTE
EINE GLOBALE GESCHICHTEVON DEN ANFÄNGEN BIS INS 21. JAHRHUNDERT
Band IIAntike Welten und neue Reiche1200 v. Chr. bis 600 n. Chr.
Herausgegeben vonGustav Adolf LehmannundHelwig Schmidt-Glintzer
Impressum
Redaktion: Britta Henning
Abbildungsnachweis:S. 103, 159, 167, 223, 275, 310, 333, 375, 381, 443 akg-images;S. 399 Bridgeman Art Library;S. 23, 107, 119, 125, 127, 135, 137, 139, 141, 143, 144 Stephan Eckardt, Archäologisches Institut Göttingen;S. 42, 169, 377, 413, 459, 467 picture-alliance;S. 255 Michael Sommer;S. 27 The Art Archive;S. 57, 65 Josef Wiesehöfer;S. 421, 429 aus: Christoph Baumer: Geisterstädte der Südlichen Seidenstraße. Entdeckungen in der Wüste Takla-Makan, Stuttgart/Zürich 1996;Karten: Peter Palm, Berlin.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in
und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Sonderausgabe 2015
© 2015, 2., durchgesehene Auflage
1. Auflage 2009/2010
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder
der WBG ermöglicht.
Satz: SatzWeise GmbH, Trier
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Umschlagmotiv:
Babylonische Keilschrifttafel mit Landkarte.
Ca. 700 bis 500 v. Chr. Britisches Museum, London
Foto: akg-images, Berlin
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-26749-1
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): 978-3-534-74036-9
eBook (epub): 978-3-534-74037-6
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zu den Autoren
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Einleitung(Gustav Adolf Lehmann)
Ägäiswelt und östlicher Mittelmeerraum
Die phönizische Siedlungskolonisation im westlichen Mittelmeerraum
Antike Staaten und Kulturen
Aufstieg und Fall des Neuassyrischen Reiches(Kai Lämmerhirt)
Einführung
Bestandsaufnahme nach einer „Jahrtausendwende“
Indirekte Herrschaft (883 bis 745 v. Chr.)
Das Imperium (744 bis 631 v. Chr.)
Das Finale (631 bis 610 v. Chr.)
Die iranischen Großreiche(Josef Wiesehöfer)
Einleitung
Das Reich der Achaimeniden und seine Nachbarn
Das antike Israel(Reinhard Gregor Kratz)
Von den Anfängen bis zur Entstehung der Monarchie
Saul, David und Salomo
Das Reich Israel und das Reich Juda
Die Provinzen Samaria und Jehud
Das hasmonäisch-herodianische Königtum
Die griechische Staatenwelt bis zum Ausgang der Perserkriege(Gustav Adolf Lehmann)
Die Epoche der „Älteren Tyrannis“
Sparta im 7./6. Jahrhundert
Athen im 6. Jahrhundert bis zum Reformwerk des Kleisthenes
Die Perserkriege und der Dualismus Athen – Sparta
Das Zeitalter des Perikles und die Vollendung der athenischen Demokratie
Die Kunst der attischen Komödie und Tragödie(Meike Rühl)
Theater und Gesellschaft
Politische und gesellschaftliche Voraussetzungen
Art und Struktur des attischen Dramas
Nachwirkung in der Antike
Die Vollendung der klassischen griechischen Kunst(Balbina Bäbler)
Eingrenzung der Epoche
Überlieferung und Material
Künstler und Kunstwerke
Die Krise des Peloponnesischen Krieges(Gustav Adolf Lehmann)
Das Zeitalter der Hegemonialkriege im 4. Jahrhundert v. Chr.
Die Welt des Hellenismus
Mittelmeerraum und Vorderasien(Gustav Adolf Lehmann)
Makedoniens Aufstieg und die Ära Philipps II.
Asienzug und Weltreich Alexanders des Großen
Die Epoche der Diadochenkämpfe
Blüte und Krise der hellenistischen Großmächte und Staaten
Iran nach dem Alexanderzug(Josef Wiesehöfer)
Iran zur Zeit Alexanders und der Seleukiden
Das Reich der Parther und seine Nachbarn
Das Ptolemäerreich(Heinz Heinen)
Chronologischer Überblick
Die Struktur des Landes
Die Multikulturalität des hellenistischen Ägypten
Naturwissenschaft und Technik(Dorit Engster)
Anfänge der Geowissenschaften
Biologie und Medizin
Kriegstechnik und Mechanik
Ausblick in die Kaiserzeit
Die antike Oikumene
Das Imperium Romanum(Bruno Bleckmann)
Einleitung
Von der italischen Großmacht zur Herrschaft über die Oikumene
Innere Konflikte und äußere Expansion: Von den Gracchen bis zum Prinzipat Die römischen Kaiser und das Imperium Romanum
Rom und die Jüdischen Kriege(Ernst Baltrusch)
Die Zeit der Makkabäer und der Hasmonäer
Das Zeitalter der Bürgerkriege und Herodes
Judäa als „Anhang Syriens“ unter einem Präfekten
Juden in der Diaspora
Die drei großen Jüdischen Kriege von 66 bis 135 n. Chr.
Der römische Blick auf die Juden
Das Reich der Sasaniden und seine Nachbarn(Josef Wiesehöfer)
Ereignisgeschichte
Strukturen des Sasanidenreiches
Sasanidische Weltbilder
Religion und Spätantike(Bruno Bleckmann)
Der Sieg des Christentums
Der Zerfall des Römischen Reiches (378 bis 640)
Asiatische Großreiche und Kulturtransfer
Die Geschichte Indiens(Helwig Schmidt-Glintzer)
Die Nanda-Dynastie von Magadha
Das Maurya-Reich und Ashokas Herrschaft (321–185 v. Chr.)
Neue Staatsbildungsprozesse in der Peripherie (200 v. Chr.–300 n. Chr.)
Das Kushana-Reich
Die Gupta-Dynastie im Norden (4. bis 6. Jahrhundert n. Chr.)
China bis zum Ende der Han-Zeit(Reinhard Emmerich)
Die Zhou-Dynastie (ca. 1045 bis 221 v. Chr)
Die Qin-Dynastie
Die Han-Dynastie (206 v. Chr bis 220 n. Chr)
Das Ende der Han-Dynastie
Die Religionen der Seidenstraße (Helwig Schmidt-Glintzer)
Die Oasen und die Häfen der Seidenstraße
Mönche, Krieger und Händler
Militär und Expansion
Die Westlande im Weltbild des chinesischen Kaiserhofs
Das religiöse Leben in den Oasen des Tarimbeckens
Tibet als neue Regionalmacht
Das China der Nach-Han-Zeit (Thomas Jansen)
Die Drei Reiche und die wiedervereinigte Jin-Dynastie
Nicht-chinesische Staaten im Norden – Exil-Dynastien im Süden
Das geistige Leben der Nach-Han-Zeit
Chinas globale Beziehungen in der Zeit der Reichsteilung
Das neue Verhältnis zwischen Kaiserreich und Religion
Die Vereinigung des Reiches unter der Dynastie Sui
Ausblick (Helwig Schmidt-Glintzer)
Literaturverzeichnis
Chronologie
Register
Einleitung
Gustav Adolf Lehmann
Zwei große Geschichtsräume
In diesem Band unserer Weltgeschichte kann es nicht mehr darum gehen, kaleidoskopartig Überblicke über die Entfaltungen menschlicher Populationen und Kulturen rund um den Erdball zusammenzustellen, die sich nach archäologisch-chronologischen Kriterien mit einiger Sicherheit als gleichzeitig mit der Epoche des europäisch-asiatischen Altertums erweisen lassen. Die Berichte und Darstellungen dieses Bandes konzentrieren sich vielmehr auf die Ereignisse und Entwicklungen in zwei großen Geschichtsräumen, die annähernd gleichzeitig, aber voneinander weithin unabhängig, jeweils eine in festen politischen und kulturellen Zusammenhängen bestehende Oikumene (von griech. oikuméne gē: „bewohnte und erschlossene Erde/Kulturzone“) ausgebildet haben: die antike vorderasiatisch-mediterrane und die ostasiatisch-chinesische Hochkulturwelt. Diese beiden antiken Kulturzentren haben weit über ihre unmittelbaren Nachbarregionen sowie über die Randvölkerzonen, die jeweils dauerhaft unter ihrem Einfluss standen, hinaus auf große Teile Asiens, des nördlichen Afrikas und Europas ausstrahlen können. Im Hinblick auf den afrikanischen Kontinent ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass es phönizischen Seeleuten um 600 v. Chr. im Auftrag des Pharaos Necho II. (26. Dynastie) gelungen ist, vom Roten Meer aus durch den Indischen Ozean und den Atlantik die Küsten Afrikas insgesamt zu umsegeln; eine in den 480er Jahren vom persischen Großkönig Xerxes angeordnete Wiederholung dieser Expedition in der Gegenrichtung, vom Mittelmeer aus, musste dagegen an der afrikanischen Atlantikküste abgebrochen werden. Möglicherweise ist dieses Projekt damals auch an der Sabotage der Karthager gescheitert, die ihre Kontrolle über die Meerenge von Gibraltar und die Westküste Afrikas uneingeschränkt behaupten wollten. In der Folgezeit haben karthagische Schiffe, nach Ausweis archäologischer Funde und eines Expeditionsberichts aus dem 5./4. Jahrhundert v. Chr., in weiten Handels- und Erkundungsfahrten die Westküste Afrikas für sich erschlossen – wahrscheinlich bis zu den Vulkanbergen an der Küste Kameruns. Schließlich hat Alexander der Große in seiner letzten Lebensphase nicht nur das Projekt einer Erkundung und Eroberung Südarabiens auf dem Seewege mit großem Einsatz vorangetrieben, sondern sich auch mit Plänen zu einer erneuten Umsegelung Afrikas beschäftigt. Unter diesem Aspekt kann somit der ganze Kontinent, über den Nordteil Afrikas hinaus, noch dem antiken Geschichtsraum der Mittelmeerwelt und Vorderasiens zugeordnet werden. Dagegen gibt es keinerlei seriöse Indizien oder Belege für Kontakte und Einflussnahmen, die zwischen der mediterran-vorderasiatischen oder auch der chinesisch-ostasiatischen Oikumene und den altamerikanischen Kulturen dieser Zeitstellung in der „Neuen Welt“ stattgefunden haben könnten.
Handels- und Warenaustausch
Demgegenüber hat es zwischen der antiken Oikumene des mediterran-vorderasiatischen Raumes und dem zeitgenössischen „Reich der Mitte“ in Ostasien über die Jahrhunderte hin einen erkennbaren, gelegentlich sogar sehr beachtlichen Handelsund Warenaustausch gegeben – zu Lande über die Verbindungswege und Oasenregionen der zentralasiatischen Seidenstraße und, zumindest in der römischen Kaiserzeit, auch zur See über einige von beiden Seiten her erreichbare Häfen und Handelsplätze in Vorderindien. Vom Bengalischen Golf aus sind über See in östlicher Richtung kostbare Fundobjekte dieser Zeitstufe aus beiden Hochkulturzonen als Exportgut bis zur thailändischen Küste hin nachweisbar. Und gegen Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. gelangten auf dem Seeweg über Alexandrien – durch Kaufleute, die offenbar bis nach China vorgedrungen waren – erstmals genaue Informationen über die Herstellung chinesischer Seide in die römische Welt. Insgesamt blieben jedoch auch in dieser Blütezeit die unmittelbaren Kontakte auf beiden Seiten eher spärlich. Von einem Neben- oder gar Miteinander, das sich auf wirklich zentrale kulturelle oder politische Lebensbereiche auszuwirken vermochte, kann im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den beiden Hemisphären wohl nicht die Rede sein.
Periodisierung des Zeitraumes
Nunmehr ein Wort zur historischen Periodisierung des Zeitraumes (zwischen ca. 600 v. Chr. und ca. 600 n. Chr.), der hier im Zentrum der Darstellung stehen soll: Diese keineswegs starr und einseitig, sondern offen praktizierte Grenzziehung orientiert sich an Ereignissen und Entwicklungen, die für die Geschichte des antiken Vorderasiens und des Mittelmeerraumes von entscheidender Bedeutung gewesen sind: So kann hier für die Zeitstufe um 600 v. Chr. – im Hinblick auf die gegebenen machtpolitischen Konstellationen – sicherlich auf das Phänomen der Herausbildung einer Hegemonie Karthagos im äußersten Westen der Mittelmeerwelt verwiesen werden, während gleichzeitig die mit den Phöniziern konkurrierende griechische West-Kolonisation ihrem Höhepunkt zustrebte. Unzweifelhaft stellte jedoch auch der Zusammenbruch der Assyrermacht (Zerstörung Ninives 612 v. Chr.) für alle Länder Vorderasiens – einschließlich des zeitweilig von den Assyrern besetzten Ägyptens – eine wichtige historische Zäsur dar. Das Großmächtesystem, das sich im frühen 6. Jahrhundert v. Chr. auf den Trümmern des Assyrerreiches herausbildete – mit wechselseitigen Bündnissen zwischen dem iranischen Mederreich, dem Neubabylonischen Reich (mit Syrien und großen Teilen Mesopotamiens) sowie dem Lyderreich in Kleinasien und dem Pharaonenreich der 26. Dynastie –, hatte allerdings nur wenige Jahrzehnte Bestand. Von wirklich welthistorischer Bedeutung erwies sich dagegen der von Kyros II., dem Vasallenkönig der Persis-Region, betriebene Umsturz im Mederreich (um 550 v. Chr.), der zwischen 546 und 539 v. Chr. zur Aufrichtung einer neuen Oikumene-Herrschaft führte, deren Machtbereich sich von Ost-Iran bis zur Ägäisküste erstreckte (s. Beitrag „Die iranischen Großreiche“). Nach der Unterwerfung Ägyptens durch Kyros’ Sohn und Nachfolger Kambyses (525/524 v. Chr.) griff das Perserreich schließlich auch weit nach Europa aus – vom östlichen Balkanraum bis nach Nordgriechenland.
Wirft man ferner, über die macht- und geopolitische Perspektive hinaus, einen Blick auf große, in die Zukunft weisende Entwicklungen im geistig-kulturellen Leben während des frühen 6. Jahrhunderts v. Chr., so ist vor allem der Beginn der ionischgriechischen Naturphilosophie und -forschung hervorzuheben. Anregungen aus der – räumlich wie politisch-ökonomisch relativ nahen – altorientalischen Kultur- und Geisteswelt haben dabei in Ionien nachweislich eine wichtige Rolle gespielt. Mit ihren epochemachenden Versuchen, ein ausschließlich auf rationalen Überlegungen und mathematisch-naturwissenschaftlicher Forschung basierendes Weltbild zu begründen, haben der Philosoph Thales von Milet und sein Schülerkreis bald auch beträchtlichen Einfluss auf die breitere Öffentlichkeit, zumindest im kleinasiatischen Ionien, gewinnen können. Für ein halbes Jahrhundert wurde Milet zum Zentrum einer sich mehr und mehr entfaltenden empirischen Wissenschaft und Philosophie. Darüber hinaus verbindet sich mit der Zeitstufe des frühen 6. Jahrhunderts v. Chr. überall in der griechischen Staatenwelt die großartige Entfaltung einer monumentalen Steinarchitektur und bildenden Kunst, die sich von den – über längere Zeit maßgeblich gewesenen – altorientalischen und ägyptischen Vorbildern immer weiter zu emanzipieren vermochte.
Im Herzen Vorderasiens aber bildete sich, nach der Zerstörung des salomonischen Tempels in Jerusalem (587 v. Chr. durch den König Nebukadnezar II. von Babylon), mit den Deportierten aus dem vernichteten Königreich Juda eine starke jüdische Diaspora in Mesopotamien und Babylonien heraus, die dem Assimilierungsdruck ihrer heidnischen Umgebung zu widerstehen vermochte. Das babylonische Exil-Judentum, das später unter den persischen Großkönigen zu erheblichem Wohlstand und Einfluss, auch in der Reichsverwaltung, gelangte, machte es sich zur Aufgabe, in gemeindemäßig organisierter Lebenspraxis und theologischer Vertiefung das religiöse Erbe des alten Israels zu bewahren. Damit war die Zielsetzung verbunden, den Tempel in Jerusalem wiedererstehen zu lassen und dort erneut einen exklusiven Jahwe-Kult einzurichten.
Wendet man sich dagegen der Frage einer angemessenen Periodisierung für das Ende des vorderasiatisch-mediterranen Altertums zu, so dürfte in der Forschungsdiskussion inzwischen weitgehend Konsens darüber bestehen, dass die große Krise der römischen „Soldatenkaiser“-Zeit im 3. Jahrhundert n. Chr. zu tiefgreifenden Veränderungen in der Binnengliederung und Administration des Reiches (in der Reformära Kaiser Diokletians) und generell im ökonomischen und soziokulturellen Leben der Mittelmeerwelt geführt hat. Gleichwohl hat sich das Imperium Romanum auch danach noch lange in seinen Grenzen und Grundstrukturen behaupten können – gegen die anhaltende Bedrohung durch Germanen-Einfälle und das Neupersische Reich der Sasaniden-Dynastie (seit 224 n. Chr.). Mit der im Verlauf des 4. Jahrhunderts n. Chr. vollzogenen Christianisierung des Reiches setzte zwar die Epoche der „Spätantike“ ein, doch blieb diese in vielerlei Hinsicht eng mit der hohen Kaiserzeit des 2. Jahrhunderts n. Chr. verbunden. Selbst die Ausbreitung germanischer Stammesgruppen unter eigenen Heerkönigen im westlichen Reichsteil (im 5. und 6. Jh. n. Chr.) hat die prinzipielle Zugehörigkeit des lateinischen Westens zum römischen Imperium und zu seinem legitimen Regierungszentrum in Konstantinopel zunächst nicht gänzlich außer Kraft setzen können. So konnte es der Reichsführung unter Kaiser Justinian (527–565 n. Chr.) gelingen, militärisch sowohl den vorderasiatischen Raum (gegenüber dem Neupersischen Reich) zu behaupten, als auch, über Italien hinaus, alle Küstenräume des westlichen Mittelmeeres wieder unter direkte römische Herrschaft zu bringen.
Tiefe Zäsur
Die tiefste Zäsur zwischen der (eindeutig noch zum Altertum zu rechnenden) Epoche der Spätantike und dem frühen Mittelalter ist tatsächlich erst gegen Mitte des 7. Jahrhunderts n. Chr. zu verzeichnen: Dieser Datierungsansatz zielt weniger auf die im frühen 7. Jahrhundert n. Chr. beginnende Einwanderung und Landnahme slawischer Volksstämme im gesamten Balkanraum, wodurch die Landverbindung zwischen der oströmischen Kaisermacht und dem weitgehend von germanischen Königsherrschaften besetzten Westen des Reiches empfindlich gestört wurde. Eine weitaus größere und zweifellos welthistorische Bedeutung muss vielmehr dem Siegeszug der muslimischen Araber zuerkannt werden, die ab 638 n. Chr. unter den ersten Kalifen in kürzester Zeit nahezu ganz Vorderasien und große Teile der Mittelmeerwelt in ihre Hand gebracht haben: Rom und das Neupersische Reich, schon seit Jahrhunderten erbitterte Großmachtrivalen, hatten zuvor ihre Kräfte in jahrzehntelangem unablässigen Kampf gegeneinander erschöpft und konnten den neuen, von festem Siegeswillen erfüllten Invasoren nichts mehr entgegensetzen. Nach zwei schweren Niederlagen brach das Neupersische Reich auch in seinem iranischen Kerngebiet vollständig zusammen, während dem römischen Kaiserreich mit Syrien, Ägypten und bald danach ganz Nordafrika Kernländer des alten Imperium Romanum auf Dauer verloren gingen, die in religiöser und ethnischkultureller Hinsicht rasch und vollständig umgestaltet worden sind. Diese Zäsur, die Aufsprengung des über ein Zeitalter von mehr als einem Jahrtausend mit Vorderasien zusammengewachsenen und allmählich vereinheitlichten Mittelmeerraumes, markiert daher nicht nur die definitive Trennlinie zwischen der Epoche der Spätantike und den dramatisch veränderten äußeren Rahmenbedingungen der frühmittelalterlichen Welt, sondern hat bis zum heutigen Tage nichts von ihrer elementaren politischen und religiös-kulturellen Bedeutung verloren.
China
In methodischer Hinsicht mag es bedenklich erscheinen, bei dem Versuch, eine möglichst sachgerechte Periodisierung für die ostasiatisch-chinesische Geschichte festzulegen, auf Termini wie „Altertum“, „Mittelalter“ und „Neuzeit“ zurückzugreifen, die bekanntlich der historischen Perspektive des frühneuzeitlichen Europas entstammen. Andererseits aber ist unbestritten, dass die politisch-herrschaftliche und soziokulturelle Entwicklung in China vom Ausgang der Epoche der „Streitenden Reiche“ (Zhanguo-Zeit 403–221 v. Chr.) und sodann nach der Reichseinigung unter den Qin- und Han-Dynastien (bis 220 n. Chr.) historisch als ein den gesamten ostasiatischen Geschichtsraum prägendes Zeitalter gelten kann und somit durchaus als Analogie zum „klassischen Altertum“ der westlichen Welt in Betracht kommt. War doch mit der „Reichseinigung“ unter der Qin- und frühen Han-Dynastie (ab 221 v. Chr.) im Herzen Ostasiens ein imperiales Machtzentrum entstanden, das als „Reich der Mitte“ über den direkt kontrollierten und institutionell erfassten Herrschaftsbereich hinaus auf den eigenen Weltkreis, das heißt auf „alles unter dem Himmel“, tief einzuwirken vermochte. Weltbild und offizielles Selbstverständnis kamen der politisch-historischen Realität tatsächlich sehr nahe: Die politisch-zivilisatorische Ausstrahlung erreichte nicht nur die Randvölkerzone der „Barbaren“ im Norden und Nordwesten, sondern auch die Nachbarregionen an der Ostflanke des Reiches und nicht zuletzt den damals noch nicht sinisierten Süden und Südwesten Chinas. Für eine ernsthaft und langfristig rivalisierende Gegenmacht, die dafür aber, neben Bodenschätzen und agrarischen Ressourcen, auch über eine eigenständige ethnisch-kulturelle Basis und eine vergleichbar starke herrschaftliche Konsolidierung hätte verfügen müssen, hat es hier offensichtlich keinen ausreichenden Platz mehr gegeben. Freilich ließ sich auch während der Blütezeit des chinesischen „Altertums“ unter der Han-Dynastie grundsätzlich die Gefahr nicht beseitigen, dass sich in Phasen einer strukturellen Schwäche der Zentralmacht Teilreiche herausbildeten, die einander heftig befehdeten. Gleichzeitig konnten Fremdherrschaften aus der Randvölkerzone des Nordens von der Peripherie aus tief in das „Reich der Mitte“ ausgreifen.
So folgte auf die glanzvolle Epoche der Han-Dynastien bereits im 3. Jahrhundert n. Chr. unter der Einwirkung von Fremdvölker-Invasionen eine längere Phase der politisch-herrschaftlichen Zersplitterung, verbunden mit regionalen Sonderentwicklungen, die erst im 7. Jahrhundert n. Chr. mit der Konsolidierung der Reichseinheit unter der Tang-Dynastie (ab 618) beendet werden konnten. Diese Übergangsperiode (vom 3.–7. Jh. n. Chr.) ist wiederholt auch als ein chinesisches „Frühmittelalter“ angesprochen worden. Insgesamt wird man jedenfalls feststellen dürfen, dass die zuvor im „Altertum“ geschaffenen Grundlagen eines kohärenten ostasiatisch-chinesischen Kultur- und Geschichtsraumes dieser lang währenden Belastungsprobe standgehalten haben – nicht zuletzt dank der Integrationskraft der inzwischen von der konfuzianischen Weltanschauung geprägten bürokratischen Strukturen in den verschiedenen Reichsteilen. Bezeichnenderweise orientierte sich die Herausbildung eines konsolidierten japanischen Kaiserstaates seit dem späten 7. Jahrhundert n. Chr. von Anfang an in allen wesentlichen Punkten an den administrativen und zivilisatorischen Errungenschaften des chinesischen Kontinentalreiches.
Demgegenüber stellt sich das allmähliche Zusammenwachsen des antiken Mittelmeerraumes mit den Kulturländern des Alten Orients in Vorderasien (seit dem 6./5. Jh. v. Chr.) eher als ein wechselvoller Prozess dar, der sich nur mühsam, über langfristige Konfrontationen und mit tiefen politischen Umbrüchen sowie ethnischkulturellen Verlagerungen, seinen Weg bahnen konnte. Dabei hat dieser Prozess, zumindest in militärisch-machtpolitischer Perspektive, sein propagiertes Ziel, nämlich die Unterwerfung der gesamten mediterranen und vorderasiatischen Hochkulturwelt unter ein einheitliches Herrschaftssystem, niemals erreicht – sooft davon auch politisch-programmatisch die Rede gewesen ist. Dabei stellte sich für die römische Öffentlichkeit in der Zeit Ciceros (um die Mitte des 1. Jhs. v. Chr.) der eigene, von Rom aus äußerstenfalls erreichbare und dementsprechend als politisch und verkehrsmäßig zugänglich eingeschätzte Oikumene-Raum als eine insgesamt eher kleine, von nahezu unüberwindlichen Grenzbarrieren umschlossene Klima- und Kulturzone dar. Auf der Oberfläche des großen Erdballs war diese Oikumene jedenfalls nur ein schmaler, klimatisch begünstigter Kulturland-Streifen, der sich zwischen dem eurasischen Steppengürtel des Nordens und den unbewohnbaren Wüsten des Südens erstreckte – vom Atlantischen Ozean im Westen bis zum Gangesstrom Vorderindiens im Osten.
Geopolitischer Horizont
In der hohen römischen Kaiserzeit (1./2. Jh. n. Chr.) hat sich allerdings dieser geopolitische Horizont für die antike, in drei Kontinente ausgreifende Oikumene erheblich erweitert und nach Nordwesten und Norden hin über die Britischen Inseln, Südskandinavien, das Baltikum und den Karpatenbogen ausgedehnt – und zwar sowohl durch ökonomisch-kulturelle Kontakte als auch durch militärische Eroberungen und partielle Okkupationen. Im Süden des Imperium Romanum aber reichte der in der Zwischenzeit erkundete und auch in politischer Hinsicht näher in den Blick genommene Raum vom Sahara-Limes aus bis an den Rand des äquatorialen Afrikas und über Ägypten nilaufwärts bis zum äthiopischen Reich von Aksum. Überdies wurden von den ägyptischen Häfen am Roten Meer aus alljährlich Handelsexpeditionen nach Südindien und Sri Lanka (Tabropane) unternommen; dabei nutzte man jetzt konsequent den regelmäßigen Wechsel der Monsunwinde zwischen Ostafrika und Vorderindien. Schon in der Zeit des Augustus fuhren, nach den Angaben eines zeitgenössischen Geographen und Augenzeugen, regelmäßig mehr als 120 ägyptische Handelsschiffe im Jahr vom Südausgang des Roten Meeres auf direktem Wege nach Indien; manche gelangten hier bis in das Mündungsgebiet des Ganges. Diese kontinuierlich unterhaltenen Seeverbindungen setzten zweifellos eine starke logistische Basis in den Ausgangshäfen und auch seepolizeiliche Absicherungen im Bereich der Fahrtroute voraus. Die Intensität des primär vom Römischen Reich aus betriebenen und weit in den Indischen Ozean ausgreifenden Schiffsverkehrs wurde nicht zuletzt von der Notwendigkeit bestimmt, das ausgedehnte Machtgebiet des parthischen Großreiches, das, ungeachtet aller beiderseitigen diplomatischen Kontakte, dauerhaft mit Rom rivalisierte, möglichst zu umgehen. Es handelte sich hierbei um eine Landbarriere, die sich von Armenien über Mesopotamien und Babylonien bis zu den Kerngebieten Irans und den Ländern am Persischen Golf erstreckte und sich auch in kultureller und religiöser Hinsicht deutlich von der römischen Mittelmeerwelt abhob.
Erdapfel-Globus
Als Symbol für den eigenen Oikumene-Weltkreis und auch als offizielles Herrschaftszeichen für ein Oikumene-Königtum (mit universellen Ansprüchen) setzte sich gleichwohl – und zwar spätestens unter den Diadochen Alexanders des Großen – der Erdapfel-Globus durch. Denn schon im frühen 4. Jahrhundert v. Chr. war von der griechischen Philosophie und Naturforschung die Kugelgestalt der Erde erkannt worden, während man im hellenistischen Ägypten (um 200 v. Chr.) durch methodisch vorgenommene Messungen sogar den tatsächlichen Erdumfang annähernd richtig ermittelt hat. Gleichwohl blieb für die Oikumene in der allgemeinen Vorstellung das Bild einer „Weltinsel“ bestimmend, die durch den Ozean und objektive Bewohnbarkeitsgrenzen auf die gemäßigte Klimazone der nördlichen Erdhalbkugel eingeschränkt werde und durch Wüstenregionen und Meere von immenser Ausdehnung von ihren „Nachbarn“, insbesondere aber von dem „Pendant“ auf der südlichen Halbkugel, den Oikumenen der Antipoden (griech. „Gegenfüßler“), dauerhaft abgetrennt sei. Dieses Erd-Bild einer großen, auf allen Seiten letztlich vom Ozeanstrom umgebenen „Weltinsel“-Scheibe, das zunächst auch im archaischen Hellas rezipiert worden ist, geht in seinem Ursprung auf Vorstellungen in der mesopotamisch-altorientalischen Hochkulturwelt des späten 3. Jahrtausends v. Chr. zurück. Hier ist auch, aus leidvollen Erfahrungen mit Invasionen aus den Randvölkerbereichen im Nordosten und Südwesten, die Konzeption entwickelt worden, dass eine wirkliche Friedensordnung für den eigenen, ungeschützten Kulturraum des Fruchtbaren Halbmondes (vom äußersten Süden der Levanteküste bis nach Südost-Babylonien) ein weit ausgreifendes imperiales Königtum zur Voraussetzung habe. Nur ein einheitliches Herrschaftssystem bis an „die vier Weltuferränder“ über den gesamten Bereich zwischen dem „Oberen Meer“ (Mittelmeer) und dem „Unteren Meer“ (Persischer Golf) konnte dann auch eine ausreichende Versorgung der Kulturzone mit wertvollen Rohstoffen – Zedernholz, Silber, Zinn und kostbaren Steinen – sicherstellen.
Auf dem politisch-militärischen Feld endeten jedoch alle Anläufe, von Babylonien und Mesopotamien aus ein universelles Königtum über das Kerngebiet Vorderasiens – von Zentralanatolien und Westiran bis nach Ägypten und an die Küste des Persischen Golfes – aufzurichten, nach Anfangserfolgen unter den jeweiligen Reichsgründern, schon bald in wachsender Desintegration und schließlich in katastrophalen Zusammenbrüchen. Ausschlaggebend waren dabei in allen Fällen eine territoriale Überdehnung des unmittelbaren Herrschaftsbereichs und fortschreitende Überanstrengungen der im jeweiligen Kerngebiet der Reichsmacht nur begrenzt vorhandenen Kräfte. Dies gilt für das Reich von Akkade (ab 2300 v. Chr.) ebenso wie für das Regime der südbabylonischen Dynastie von Ur III (um 2000 v. Chr.) oder auch für das Großreich, das König Hammurapi von Babylon (1728–1686 v. Chr.) in unablässigem Expansionsstreben über das Gebiet des Fruchtbaren Halbmondes aufzurichten vermochte.
Weithin kohärente Oikumene
In kultureller und ökonomischer Hinsicht ist allerdings in diesen Jahrhunderten eine weithin kohärente Oikumene entstanden, die an ihrer Westflanke auch mit dem pharaonischen Ägypten des „Mittleren Reiches“ (20.–17./16. Jh. v. Chr.) und den großen Mittelmeerinseln Zypern (Alašija) und Kreta in wirtschaftlichem Austausch und wechselseitigen Kontakten stand. Von den diplomatischen und ökonomischen Verbindungen des minoischen Kretas (der „Alten Paläste“) mit dem Pharaonenreich und der syrisch-mesopotamischen Hochkulturzone sind offenbar auch Impulse zur Entwicklung einer eigenen kretisch-ägäischen Schriftkultur (Hieroglyphensysteme und Linear-A-Silbenschrift) ausgegangen. Das griechische Festland verblieb dagegen noch außerhalb des Horizonts der uns zur Verfügung stehenden ägyptischen und altorientalischen Schriftzeugnisse. Hier war in den ersten Jahrhunderten nach 2000 v. Chr. der Prozess einer frühgriechischen Ethnogenese in sein entscheidendes Stadium getreten: Es ging um einen großen sprachlich-kulturellen Austausch zwischen einem offensichtlich starken Element indogermanischer Zuwanderer, die wichtige Teile des späteren griechischen Sprachsystems mitgebracht hatten, und einem zivilisatorisch – und sehr wahrscheinlich auch zahlenmäßig – überlegenen ägäischen Bevölkerungssubstrat.
Stabiles Großmächtesystem
Seit dem 15. Jahrhundert v. Chr. hat sich in Vorderasien auf der zuvor in den ersten Jahrhunderten nach 2000 v. Chr. geschaffenen kulturellen Basis ein über lange Zeit stabiles Großmächtesystem herausgebildet, dem neben den Königreichen von Assur und Babylon vor allem das in Zentralanatolien beheimatete Hethiterreich, mit dem großköniglichen Zentrum in Hattusa/Boğazköy, und das militärisch expansive „Neue Reich“ Ägyptens der 18. und 19. Dynastie das Gepräge gaben – bis zu der großen Krise um und nach 1200 v. Chr. In den Bilddokumenten und Schriftzeugnissen aus Ägypten und den Archiven des hethitischen Machtbereichs lassen sich für diesen Zeitraum auch die politischen Entwicklungen und Machtverhältnisse in der Ägäiswelt etwas deutlicher erfassen: So hat sich im geographisch-politischen Gesichtskreis des pharaonischen Ägyptens spätestens um die Mitte des 15. Jahrhunderts v. Chr. neben dem altbekannten minoischen Kreta – mit dem Zentrum in Knossos – ein frühgriechisches Königreich von Danaia etabliert, das von seinem Zentralort Mykene aus zumindest zeitweilig größere Teile der Peloponnes – und vielleicht auch Mittelgriechenlands – umfasst hat. In ägyptischen Bilddokumenten lassen sich sogar Hinweise auf die um die Mitte des 15. Jahrhunderts v. Chr. in Knossos auf Kreta vollzogene Machtergreifung einer mykenisch-festländisch geprägten Dynastie und Herrenschicht finden.
Auch von den archäologischen Befunden her wird man den großen, befestigten Königsburgen von Mykene – und Tiryns – in der Argolis (seit dem 16./15. Jh. v. Chr.) sowohl in kultureller als auch in politisch-herrschaftlicher Hinsicht einen Primat auf dem griechischen Festland zuerkennen müssen; im 15./14. Jahrhundert v. Chr. haben sich jedoch auch in Messenien (Pylos), Lakonien (Sparta und Amyklai), Boiotien (Theben und Orchomenos), in Attika (Athen/Akropolis und Eleusis) sowie in Aitolien (Kalydon) und Thessalien (Iolkos) machtvolle Palast- und Herrschaftszentren erhoben, die, auf der Peloponnes wie in Mittelgriechenland, im Rahmen einer erstaunlich einheitlichen, bürokratisch organisierten Verwaltungsstruktur auch das jüngere System der kretischen Linear-Silbenschrift (Linear B) übernommen haben. Alle genannten frühgriechischen Königsburgen treten bezeichnenderweise auch als Zentren eigenständiger Sagenkreise innerhalb der später als authentisch anerkannten Traditionen in Erscheinung.
„Seevölker“
In den leider sehr fragmentierten Textdokumenten des hethitischen Reichsarchivs aus dem 14. und 13. Jahrhundert v. Chr. finden sich ferner Zeugnisse und Belege für eine andere, aber ebenfalls mit Sicherheit im Ägäisraum zu lokalisierende Macht, die vornehmlich an der Westküste Kleinasiens als ein politisch-militärisch aktiver Gegenspieler des hethitischen Großkönigs aufgetreten ist – das vom hethitischen Großreich und dessen Vasallen unabhängige und mit seinem Zentrum jenseits der kleinasiatischen Küstenregionen beheimatete Reich von Achijawa. Der Name dieses Königreichs lässt auf einen Zusammenhang mit dem später in den homerischen Epen – synonym mit Danaoi und Argeioi – als Gesamtbezeichnung für das frühgriechische Aufgebot des Herrschers und Oberkönigs von Mykene verwendeten Stammes- beziehungsweise Volksnamen Achai(w)oi schließen, der im Übrigen, unabhängig vom Epos, sowohl in Mittelgriechenland als auch auf den Inseln Kreta (in Linear-B-Texten: Akhawia) und Rhodos bereits für die frühgriechische Zeit bezeugt ist. Mit Achaiwoi/Akhawia aber wird man in den zeitgenössischen ägyptischen Dokumenten auch das „Fremdland des Meeres“ Aqaiwasa verbinden dürfen, das um 1209 v. Chr. mit beachtlicher Seemacht und einem starken Heereskontingent sowie mit Verbänden von „Seevölker“-Kriegergruppen – ferner in Absprache mit libyschen Wandervölkern – einen Großangriff auf das westliche Unterägypten unternommen hat. Tatsächlich haben die Heerfahrten der schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts v. Chr. im östlichen Mittelmeerraum sehr gefürchteten „Seevölker“-Invasoren wesentlich dazu beigetragen, dass sich aus den katastrophalen Zusammenbrüchen und Umwälzungen im Bereich der frühgriechischen Palastzentren des Festlands sowie auf Kreta eine allgemeine politisch-militärische Krise entwickelt hat, die in den ersten beiden Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts v. Chr. weite Teile des östlichen Mittelmeerraumes und Vorderasiens erfasste.
Träger dieser „Seevölker“-Bewegung waren primär zur See operierende Krieger-Stammesgruppen, deren Ethnonyme (Schardana/Sarden, Sikal/Sikalaiu/Sikeler, Turscha/Tyrrhener/Etrusker), in Verbindung mit charakteristischen Tracht- und Ausrüstungsgegenständen, auf eine Herkunft aus küstennahen Gebieten jenseits des frühgriechisch-mykenischen Festlandsbereichs, im Norden und Westen des zentralen Mittelmeerraumes, hindeuten. Die Angehörigen dieser Krieger-Stammesgruppen haben sich allerdings als Söldner und bewaffnete Zuwanderer offenbar schon in den Jahrzehnten um und vor 1300 v. Chr. feste Stützpunkte sowie aktive Bundesgenossen im Ägäisraum verschaffen können.
Dem archäologisch auf die Zeitstufe um 1200 v. Chr. zu datierenden großen Zerstörungshorizont auf dem griechischen Festland sowie in Kreta und auch in Siedlungsplätzen an der Westküste Kleinasiens (Troia VIIa, Milet) entspricht im Osten zwischen ca. 1190 und 1180 v. Chr. eine Abfolge von verheerenden Katastrophen, denen das hethitische Großreich, auch in seinem anatolischen Kerngebiet, und zahlreiche Siedlungszentren – von Zypern und Kilikien bis nach Nord- und Mittelsyrien hinein – erlegen sind. Zur gleichen Zeit stand Ägypten unter dem Druck libyscher Wandervölker und Kriegerscharen, die sich schließlich im westlichen Nildelta festsetzen konnten. Daher konnte das Pharaonenreich unter Ramses III. (ca. 1188–1155 v. Chr.) sich nur mit Mühe gegen die Invasionsversuche einer großen „Seevölker“-Koalition zu Lande und zur See behaupten und seinen Machtbereich in Südsyrien sowie die Fortexistenz einiger wichtiger kanaanäisch-phönizischer Zentren – von Byblos bis Sidon-Tyros – dauerhaft absichern.
Dies gelang tatsächlich auch nur um den Preis einer massiven Ansiedlung von „Seevölker“-Stammesgruppen (namentlich der *Palaister/Philister sowie Sikeler und Sarden) in Gemeinwesen und Stadtzentren von Kanaan/Palaistina. Schon gegen Ende des 12. Jahrhunderts v. Chr. war diese mächtige Kriegerschicht imstande, von ihren Garnisonen aus, die zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr unter ägyptischem Oberbefehl standen, ein eigenständiges Herrschaftssystem aufzubauen, das von der Küste aus weit in das kanaanäische Hinterland expandierte. Hier ist bereits für das ausgehende 13. Jahrhundert v. Chr., in der Ära des Pharaos Merneptah (1213–1203 v. Chr.), die Präsenz einer Stammesgruppe bezeugt, die den Namen „Israel“ getragen hat (s. Beitrag „Das antike Israel“). Der „Seevölker“-Sturm, der im frühen 12. Jahrhundert v. Chr. im Levanteraum seinen Höhepunkt erreichte, hat offenbar dazu beigetragen, dass die bis dahin mühsam bewahrte Balance zwischen den syrisch-kanaanäischen – und mesopotamischen – Stadtstaaten und den nomadisierenden, vom Wüstenrand her vordringenden Aramäer-Stämmen (Achlamu) verlorenging. Vielfach konnten Aramäergruppen nun auch größere lokale Zentren in ihre Gewalt bringen und von dort aus eigene Staatswesen im Kulturland begründen. Sowohl in Syrien als auch in Mesopotamien, wo das zentrale Königtum von Babylon nach dem Sturz der Kassiten-Dynastie (um 1150 v. Chr.) weitgehend machtlos geworden war, kam dieser Prozess rasch voran. Erst im ausgehenden 10. Jahrhundert v. Chr. setzte hier eine anhaltende Gegenoffensive des Neuassyrischen Reiches ein – vor allem in Nordmesopotamien und Syrien.
Neue Horizonte und Freiräume
Andererseits eröffneten sich für manche einheimische Gemeinwesen nach den Schrecknissen der Katastrophenzeit – mit dem Zusammenbruch des hethitischen Großreiches und dem machtpolitischen Niedergang, von dem ein halbes Jahrhundert später, nach dem gewaltsamen Tod Ramses’ III., auch das Pharaonenreich erfasst wurde – völlig neue Horizonte und Freiräume. Dies galt vor allem für die kanaanäisch-phönizischen Seestädte; für sie stellte zudem die dauerhafte Niederlassung von „Seevölker“-Kriegergruppen an der Levanteküste, deren ursprüngliche Heimat- und Ausgangsbereiche teilweise in fernen, bislang unbekannten Regionen des zentralen oder gar westlichen Mittelmeeres lagen, eine besondere Herausforderung dar: Aus den Auseinandersetzungen mit diesen ebenso seemächtigen wie kampfstarken Nachbarn hat die in den Hafenplätzen dominierende kanaanäisch-phönizische Aristokratie offenbar richtungsweisende Impulse zu bisher kaum vorstellbaren eigenen Aktivitäten empfangen.
Vor allem das Stadtkönigreich von Sidon-Tyros hat sich hier hervorgetan; die schon früh, im 11. Jahrhundert v. Chr., für den äußersten Westen des Mittelmeerraumes bezeugte Exploration durch kühne phönizische Seefahrer auf der Suche nach wertvollen Rohstoffen und Handelsgütern ist ohne diesen historischen Hintergrund kaum zu erklären. Insofern erweist sich die Epoche des katastrophalen „Seevölker“-Sturms, zumindest mit diesen weit in die Zukunft weisenden Auswirkungen, auch als eine im positiven Sinne bedeutsame Etappe – in dem nur langsam, über Jahrhunderte hin voranschreitenden Prozess einer wechselseitigen Erschließung und Vereinheitlichung des antiken Mittelmeerraumes, bis dieser schließlich mit dem vorderasiatischen Kulturkreis fest zusammenwachsen konnte.
Ägäiswelt und östlicher Mittelmeerraum
Die zunächst ausschließlich destruktiven Konsequenzen des „Seevölker“-Sturms zeichnen sich für den Ägäisraum in einem umfassenden Zerstörungshorizont aus der Zeit um 1200 v. Chr. ab: Nahezu alle frühgriechischen Herrschaftszentren haben damals in einer akuten Krise – mitsamt ihrer hochorganisierten und weiträumig vernetzten Palastbürokratie – ein gewaltsames Ende gefunden. Der generelle Verlust der hochspezialisierten Linear-B-Schriftkultur kennzeichnet die Tiefe dieser historischen Zäsur; bezeichnenderweise ging auch der größte Teil der in den Linear-B-Texten bezeugten und mit der herrschaftlich-administrativen Organisation der Palastzentren verbundenen Begriffe verloren. Andererseits haben Ausdrücke wie damos/demos („Gemeinde“), gerusia („Rat der Alten“), aber auch p(t)olis („Burgfestung“), wastu/asty („Unterburgsiedlung“) oder la(w)ós („Heervolk“) überlebt. Und zur Bezeichnung des erbmonarchischen Lokal- oder Stammesfürsten avancierte im späteren Griechenland der Amtstitel eines mykenischen, mit seinem Aufgabenbereich freilich außerhalb der engeren Palastordnung stehenden Funktionärs qa-si-rle-u (*gwasileus/basileus) („König“). Der klangvolle Herrschertitel des einstmals auch kultisch verehrten Palastkönigs, wa-na-ka/(w)anaks, wurde dagegen später weithin nur als respektvolle Anredeform gegenüber Fürsten und herausgehobenen Machthabern verwendet.
Wandel in der Sachkultur
Für die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts v. Chr. sind im archäologischen Kontext – vom Südwesten der Peloponnes bis hinauf nach Thessalien – unübersehbare Spuren von kriegerischen Unruhen und Zerstörungen sowie Fluchtbewegungen in zuvor wenig besiedelte Randgebiete nachweisbar. Darüber hinaus belegen Bildzeugnisse dieser Zeitstufe aus der Argolis sowie aus Mittelgriechenland und von der Westküste Kleinasiens die Präsenz von Kriegerscharen, die sich in ihrer Tracht und Bewaffnung deutlich von den Kriegerdarstellungen der mykenischen Palastzeit unterscheiden; dafür zeigen sich Übereinstimmungen mit der Typologie der „Seevölker“-Krieger in den einschlägigen ägyptischen und vorderasiatischen Bilddokumenten. Ferner zeichnet sich auf dem griechischen Festland wie im Ägäisraum ein bemerkenswerter Wandel in der Sachkultur ab: An die Stelle einer bislang erstaunlich einheitlichen mykenischen „Reichszivilisation“ trat nun eine größere Vielfalt kleinerer „Produktions- und Kulturgemeinschaften“ in eigenständigen Regionen und Gemeinwesen. Grundsätzlich ist also festzuhalten, dass im frühgriechischen Bereich ebenso wie an der vorderasiatischen Levanteküste mit den Umwälzungen in der Zeit um 1200 v. Chr. eine Entwicklung eingesetzt hat, die auf längere Sicht neue Entfaltungsmöglichkeiten für kleinräumige Machtbildungen und bescheidenere Gemeinwesen eröffnete.
So konnte sich über mehr als ein Jahrhundert hin in Siedlungen und an Residenzen, die – wie unter anderem in Tiryns – in die Trümmer der niedergebrannten alten Palastburgen hineingebaut wurden, eine Spätblüte der mykenischen Kultur erhalten, wobei freilich der Niedergang in allen höheren Kunstfertigkeiten nicht zu übersehen ist. Gleichwohl wird man dieser postpalatialen Epoche (bis zur Mitte des 11.Jhs. v. Chr.) einen beträchtlichen Anteil an der Ausbildung der epischen Sagentradition mit ihrer „Rückerinnerung“ an die frühgriechisch-mykenische Blütezeit beizumessen haben, die für das Griechentum des 1. Jahrtausends zur „Memoria“- und Identitätsbasis werden sollte.
Einfache Organisationsebene
Die konkreten geschichtlichen Ereignisse dieser (schriftlosen) Epoche sind dagegen zum größten Teil verschollen; nur in Umrissen lassen sich für die archäologisch fassbaren Zeitstufen vor und nach 1000 v. Chr. einige elementare Entwicklungen und politisch-soziale Rahmenbedingungen erfassen: Der Reduktion in den äußeren Dimensionen und Machtmitteln eines eng umgrenzten Königtums entsprach die Herausbildung von Gesellschaftsstrukturen, in denen an die Stelle der bürokratischzentral kontrollierten Ordnung der Zeit der Paläste und Linear-B-Tafelarchive kleinere, auch in ihrer sozialen Stratifikation überschaubare Lebens- (und Überlebens-)Gemeinschaften traten. Zu dem schon in der mykenischen Palastzeit recht aktiven und handlungsfähigen Damos-Gemeindekollektiv gesellten sich gentilizische, unter Führung mächtiger Krieger-Herren stehende „Geschlechter-Verbände“ (genos) oder „Verwandtschafts-Gruppen“ (Phratrien), die sich ihrerseits auch zu größeren, weit verzweigten „Abstammungsgemeinschaften“ (Phylen) zusammenschließen konnten.
Diese relativ einfache Organisationsebene dürfte gerade auch bei den erkennbaren Wanderungsbewegungen eine wichtige Rolle gespielt haben: So ist noch in der spätmykenischen Phase des 12./11. Jahrhunderts v. Chr. die Gräzisierung Zyperns durch massive Abwanderungen aus den einstigen Kernlandschaften der frühgriechisch-mykenischen Peloponnes, vornehmlich aus der Argolis und Lakonien, in Gang gesetzt worden, ohne dass sich hierzu Aussagen über konkrete Beweggründe und Wirkfaktoren machen ließen. Im Verlauf des 11. Jahrhunderts hat sich an diese Entwicklung eine immer stärker werdende Zuwanderung nordwestgriechischer Bevölkerungselemente – aus bisherigen Randbereichen des mykenischen Kulturraumes – in sämtliche Küstenlandschaften der Peloponnes angeschlossen. Allein auf Zypern und im Rückzugsgebiet des arkadischen Berglandes im Inneren der Peloponnes konnte sich gegenüber dem Nordwestgriechischen der ältere Dialekt behaupten, der besonders enge Übereinstimmungen mit der erloschenen Linear-B-Kanzleisprache der mykenischen Palastzeit aufweist.
Doriertum
An lokalen Umbrüchen und vereinzelten Katastrophen hat es in den betroffenen Küstenregionen im Zuge einer tiefgreifenden ethnisch-sprachlichen Umschichtung gewiss nicht gefehlt, doch haben diese Vorgänge, die in der älteren Forschung vielfach noch als die große „Dorische Wanderung“ interpretiert wurden, mit dem umfassenden Zerstörungshorizont in den mykenischen Palastzentren am Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. nichts zu tun. Tatsächlich hat sich hier erst vom Ende des 11. Jahrhunderts an – und gerade in den ehemaligen Kerngebieten der mykenischfrühgriechischen Kultur auf der Peloponnes (in der Argolis, im Isthmosraum und in Lakonien) – das spezifische Doriertum herausgebildet. Diesem postpalatialen Doriertum gelang es relativ leicht, Anschluss an die Sagentraditionen der frühgriechischen „Rückerinnerung“ zu finden; darüber hinaus zeichnete sich dieser neue Verband innerhalb der Peloponnes durch eine erstaunlich einheitliche Binnenstruktur aus: Wie in einer großen „Stämmeföderation“ standen bei den Doriern einer einheimisch-frühgriechischen Bevölkerungsschicht nordwestgriechische Zuwanderer gegenüber. Das vornehmste Element aber war die dritte Phyle der – vom mythischen Gott-Mensch Herakles sich herleitenden – Hylleer, die tatsächlich jedoch einen an der adriatisch-illyrischen Küste mehrfach bezeugten Volksnamen trugen.
In allen später gegründeten dorischen Gemeinwesen Griechenlands gehörten die Königsgeschlechter und vornehmsten Adelshäuser stets der Phyle der Hylleer an und teilten mit ihr den Anspruch auf „heraklidische“ Abstammung. In den Hylleern wird man daher eine in der Peloponnes bereits seit längerer Zeit etablierte Krieger-Herrenschicht zu sehen haben, deren Ursprünge bis in die Zeit der „Seevölker“-Invasionen zurückreichten. Von diesen, vornehmlich in der Argolis und in Lakonien ausgebildeten Phylenverbänden haben dann in der Phase zwischen 1000 und 800 v. Chr. die Ansiedlungen der „in drei Abteilungen gegliederten Dorier“ auf der Insel Kreta und später in der Dodekanes an der südwestkleinasiatischen Küste ihren Ausgang genommen.
Schon vor der Ausbreitung des auf der Peloponnes konstituierten Doriertums im südlichen Ägäisbereich hatte im 11. Jahrhundert von Mittelgriechenland aus eine rasch anwachsende Kolonisationsbewegung, die sogenannte Ionische Wanderung, eingesetzt, die über die Kykladeninseln hinweg bis an die Westküste Kleinasiens ausgriff. Die „Ionische Wanderung“ erreichte damit einen Raum, der im 2. Jahrtausend v. Chr. zeitweilig bereits unter kretisch-minoischem und später unter frühgriechischmykenischem Einfluss gestanden hatte; politisch-historisch und kulturell bedeutende Gemeinden entstanden nun in Milet, Ephesos, Kyme, Kolophon und auf den vorgelagerten Inseln Chios und Samos. In ihren befestigten, unmittelbar an der Küste gelegenen Siedlungsstätten hatten die Kolonisten – nach dem Zusammenbruch des hethitischen Großreiches – vom kleinasiatischen Hinterland aus keine starke Gegenwehr mehr zu befürchten. Innerhalb der „Ionischen Wanderung“ hat, der späteren Überlieferung zufolge, das Gemeinwesen von Athen/Attika eine wichtige Rolle gespielt. Tatsächlich war das athenisch-attische Herrschaftszentrum, der befestigte mykenische Königssitz auf der Akropolis, auch weitaus weniger von den Zerstörungen und Katastrophen des 13./12. Jahrhunderts heimgesucht worden als die großen Palastburgen im benachbarten Boiotien und auf der Peloponnes.
Die griechische Staatenwelt des 5. Jahrhunderts und ihre Nachbarn.
Im ionischen Siedlungsgebiet lässt sich, ebenso wie bald darauf im Prozess der „Dorisierung“ Kretas, beobachten, wie sehr die gentilizischen Phylenverbände, die sich in der spätmykenischen Phase auf dem griechischen Festland herausgebildet hatten, an den Kolonisationsbewegungen beteiligt waren: So ergibt sich aus späteren dokumentarischen Zeugnissen, dass von den auch hier eingerichteten Untergliederungen des jeweiligen Siedlerverbandes in der Regel mindestens eine den Namen einer der alt-athenischen Phylen getragen hat. Daher lässt sich gerade für die Anfangsphase dieser neuen Gemeinwesen mit einiger Sicherheit eine koordinierende Beteiligung Athens erschließen; markante Übereinstimmungen zwischen Athen und den Polisgemeinden Ioniens haben darüber hinaus auch in Sprache, Kalender und Kultwesen bestanden.
Kolonisationsbewegung der Aioler
Nördlich des ionischen Siedlungsraumes hat erst im 9./8. Jahrhundert v. Chr. eine weitere – vornehmlich von Thessalien ausgehende – Kolonisationsbewegung, die der Aioler, Fuß fassen können, wobei sowohl die große Insel Lesbos als auch die Nordwestküste Kleinasiens (einschließlich der Troas) besiedelt wurde: Mit Smyrna, Phokaia, Assos und Mytilene auf Lesbos entstanden auch hier Gemeinwesen, die in der späteren Geschichte der griechischen Staatenwelt eine eigenständige Rolle spielen konnten. Wie Ausgrabungen (u.a. in Alt-Smyrna/Bairakli) gezeigt haben, bildete sich zuerst in den – durch immer wieder verstärkte Befestigungsanlagen gegenüber der Bevölkerung des Hinterlandes abgeschirmten – Siedlungen am kleinasiatischen Küstensaum der Typus der autonomen, jeweils auf die eigenen Kräfte angewiesenen Polisgemeinde heraus – mit einem stark entwickelten Selbstbehauptungswillen. In diesen dauerhaft auf ihren befestigten Zentralort ausgerichteten Siedlergemeinschaften konnten sich daher schon bald nach der ersten Konsolidierungsphase – neben dem traditionellen Stadtkönigtum und einem mehr oder weniger großen Adelsrat an seiner Seite – auch Institutionen für die gesamte Gemeinde herausbilden und in ihrem Rahmen ein allgemeines öffentliches Mitspracherecht durchsetzen.
Angesichts der „Ionischen Wanderung“ und der ebenfalls über See erfolgten Expansion des peloponnesischen Doriertums wird man im Hinblick auf die spät- und nachmykenischen Phasen schwerlich von einem allgemeinen Rückfall Griechenlands in tiefe Armut und Isolation während der sogenannten Dunklen Jahrhunderte um 1000 sprechen können. Jedenfalls dokumentieren die imposanten Funde aus dem im 11./10. Jahrhundert aufblühenden Herrschafts- und Siedlungszentrum von Lefkandi auf Euboia (an der Meerenge von Chalkis) eindrucksvoll, dass hier auch die Verbindungen zur Levanteküste und ihren Handelsgütern niemals abgerissen sind. Schon im 9. Jahrhundert konnten kühne euboiische Seefahrer, vom mächtigen Stammstaat auf ihrer Insel unterstützt, eine Vormachtstellung im zentralen Ägäisbereich erringen und des Weiteren im nordsyrischen Al Mina und in Tell Sukas nahe der Orontes–Mündung eigene Handelsstationen aufbauen: Hier oder auf Zypern, jedenfalls aber in einem engen griechisch-semitischen (kanaanäischen) Kontakt- und Austauschbereich, ist wohl kurz vor 800 die geniale Erfindung eines phonetischen, leicht erlernbaren Alphabetsystems – auf der Basis der kanaanäisch-phönizischen Konsonanten-Schriftzeichen – gemacht worden. Schon früh im 8. Jahrhundert hat sich dieses, grundsätzlich auch die Vokale als Sinnträger berücksichtigende Schriftsystem in mehreren Versionen über die ganze griechische Welt und ihre Nachbarkulturen in West und Ost verbreitet: Schriftgebrauch und -kultur, bislang das Monopol privilegierter Eliten von Schreiber-Funktionären, Priestern und Schriftgelehrten, wurden nun in der griechischen Welt zu einem schließlich geradezu selbstverständlichen Gemeinbesitz breiter Bevölkerungskreise.
Schrift und Dichtungen
Mit seiner Offenheit und leichten Nutzbarkeit bot das phonetische Alphabet auch die besten Voraussetzungen, um die bislang nur mündlich überlieferte Heldendichtung und die mit ihr verbundenen mythologischen Weltbilder schriftlich festzuhalten; die dabei verwendete, stark vom Hexameter-Versmaß geformte griechische Dichtersprache stand bezeichnenderweise dem Ionischen und Aiolischen nahe. Mit dem ersten Schritt in diese Richtung aber eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten sowohl in der inhaltlichen Verknüpfung der verschiedenen Sagenkreise als auch in der kompositorischen Ausgestaltung des Erzählstoffs. Am Ende dieser Entwicklung stehen schließlich die Meisterwerke der homerischen Großepen »Ilias« und »Odyssee« (um 700). Allgemeine Vorstellungen und vereinzelt auch Kenntnisse vom reichen literarischen Erbe des altorientalischen Kulturkreises und seiner Mythologien mögen sich stimulierend auf diesen Prozess ausgewirkt haben; von massiven Übernahmen oder gar einer tiefreichenden Prägung der homerischen (Heldensagen-)Epik durch das vorderasiatische Schriftgelehrtentum, mitsamt seinem Schulbetrieb, kann jedoch keine Rede sein. Anders steht es dagegen mit dem »Theogonie«-Werk des in Boiotien lebenden, aber aus einer kleinasiatisch-ionischen Familie stammenden Hesiod von Askrai (im frühen 7. Jh. v. Chr.), der die griechischen Göttersagen und -traditionen mit spezifischen Details in ein kosmologisches Weltbild eingefügt hat, das orientalischer – ursprünglich churritisch-hethitischer – Überlieferung entstammte. Die Rezeption orientalischer Themen und Vorstellungen in Hellas geht im Übrigen weit über das Zeitalter Hesiods und die bildende Kunst der frühen und hohen Archaik hinaus: Auch noch im 5. und 4. Jahrhundert haben prominente Literaturwerke des Orients – zum Beispiel das klassische babylonische Atramchasis-Epos und der Achikar-Roman – nachweislich auf die griechische Geisteswelt eingewirkt.
Die phönizische Siedlungskolonisation im westlichen Mittelmeerraum
Die literarischen und dokumentarischen Überlieferungen der Phönizier/Kanaanäer an der Levanteküste und auch die ihrer späteren Kolonien, der Punier (lat./etrusk. Poeni) im Westen, sind zum größten Teil untergegangen; hier klafft eine höchst fatale Lücke im Quellenbestand der Geschichte des Altertums. Die Erfassung der Geschichte der Phönizier im frühen 1. Jahrtausend v. Chr. basiert daher – abgesehen von den archäologischen Befunden – notgedrungen auf der Auswertung von Zeugnissen ihrer Nachbarn, der Partner wie der Feinde der Phönizier/Punier – von den Tatenberichten assyrischer Könige über babylonische Chroniken und Zeugnisse in der Bibel bis zur griechisch-römischen Überlieferung. In dieser finden sich für die Frühzeit immerhin nicht nur aussagekräftige Legenden über die Anfänge Karthagos und das tragische Schicksal seiner Gründerkönigin Dido/Elissa, sondern auch Notizen und Daten aus der tyrischen Stadtchronik.
Archäologische Befunde
Die archäologischen Befunde zeigen allerdings, dass die erst im 8. Jahrhundert v. Chr. voll einsetzende Siedlungsbewegung, von der Levanteküste aus in den Westen des Mittelmeerraumes, deutlich von der weitaus älteren „prä-kolonialen“ Expansionsphase der Phönizier zu unterscheiden ist. Die bis in die Zeit um 1100 hinaufreichenden Gründungsdaten für Kolonien wie Gades (heute Cádiz an der spanischen Atlantikküste) oder Utica (an der tunesischen Nordküste) haben sich offenbar auf die Einrichtung von zunächst nur saisonal genutzten Stützpunkten in dem weit entfernten Prospektions- und Handelsraum bezogen. Nach den – möglicherweise legendarisch verdichteten – Angaben in der Bibel über die zeitweilig enge Kooperation zwischen Salomon, dem Herrscher von „Groß-Israel“, und Hiram, dem Stadtkönig von Sidon-Tyros, wurden die phönizischen Fernhandelsflotten nach gründlicher Vorbereitung jeweils im Abstand von drei Jahren „auf große Fahrt“ geschickt: Dies gilt besonders für die (grundsätzlich historischen) Expeditionen zur südspanischen Region von Tarsis/Tartessos (nördlich von Cádiz). Damals wurden jedoch auch weite Fahrten – vom Hafenplatz Elath aus durch das Rote Meer – zum „Goldland von Ophir“ (an der Somaliküste oder in Südwestarabien) unternommen. Dabei ging es primär um die Gewinnung von Edelmetallen und Rohstoffen für die aufblühende handwerkliche Produktion in Phönizien sowie um die Einbringung von exotischen Prestigeobjekten wie Pfauen und Affen als Schmuck für die königlichen Hofhaltungen.
Siedlungszentren
Den Beginn einer dauerhaften phönizisch-kanaanäischen Kolonisation wird man demgegenüber mit der schon im 9. Jahrhundert ins Werk gesetzten Errichtung stark befestigter Siedlungszentren auf Zypern (Kition-Larnaka) und in Nordafrika (wahrscheinlich Utica) verbinden können. Um und nach 800 setzte dann an der südspanischen wie an der nordafrikanischen Küste eine intensive Siedlungsbewegung ein, in deren Verlauf zahlreiche, dauerhaft bewohnte Stützpunkte angelegt worden sind. Dabei lässt sich hinter den räumlichen Abständen zwischen den Niederlassungen durchaus eine koordinierende Planung erkennen. Ungefähr zur gleichen Zeit entstanden auch auf den großen Inseln westlich von Malta – vor allem in Sizilien und Sardinien – phönizische Ansiedlungen, die schon bald zu ansehnlichen städtischen Zentren erstarkten. Von deutlich anderem Charakter erweist sich dagegen die schon in den homerischen Epen bezeugte Präsenz phönizischer Kaufleute und Handwerker im griechischen Ägäisraum: Hier hat es offensichtlich keine befestigten Siedlungen und Stützpunkte gegeben. Wohl aber haben ein verstärkter Güteraustausch und die vielfach an Ort und Stelle betriebene Arbeit orientalischer Werkstätten bereits im frühen 7. Jahrhundert einen erstaunlichen Wandel in allen Bereichen des griechischen Handwerks und der bildenden Kunst herbeigeführt (Zeit des „orientalisierenden Stils“). Auf Initiativen phönizisch-kanaanäischer Händler und Handwerker dürfte darüber hinaus die Gründung von Heiligtümern in Boiotien und auf Samothrake (Heiligtümer der Kabiren, der „Großen Götter“) sowie im Isthmosbereich (für Melkart, den Stadtgott von Sidon-Tyros) zurückgehen.
Orientalischer Kultureinfluss
In ähnlicher Weise hat sich in dieser Zeit der von phönizischen Händlern und Werkstätten getragene orientalische Kultureinfluss auf die Städte und Fürstentümer Etruriens (heute: Toskana) ausgewirkt. Hier hatte sich im Gebiet eines altmediterranen Volkstums, dessen Idiom sich keiner bekannten Sprachfamilie zuordnen lässt – verstärkt durch Zuwanderer über See aus dem Osten –, schon im 10./9. Jahrhundert v. Chr. (Villanova-Kultur) eine hochentwickelte frühurbane Zivilisation herausgebildet. Auf den phönizisch-orientalischen Kultureinfluss folgte in Etrurien eine intensive Rezeption spezifisch hellenischer Handwerkskünste, Lebensweisen und Mythen-Traditionen während der Blütezeit des 6. Jahrhunderts; auch die etruskische Schrift basiert auf westgriechischen Alphabetsystemen. Selbst in der Religion, vor allem in der Ausgestaltung der obersten Götter des etruskischen Pantheons, ist der griechische Einfluss unübersehbar. Im politischen Bereich blieb es dagegen für lange Zeit bei den einmal geknüpften, engen Bündnisbeziehungen zwischen etruskischen Gemeinwesen und den Phöniziern des Westens und der gemeinsamen Frontstellung gegen die ebenfalls in den westlichen Mittelmeerraum vordringenden griechischen Kolonisten.
Bevölkerungswachstum
Eine wesentliche Voraussetzung für die phönizische Siedlungsbewegung des 8. Jahrhunderts hatte in einem starken Bevölkerungswachstum in den Metropolen der Levanteküste und ihrem näheren Umkreis bestanden; abgesehen von internen demographischen Faktoren dürfte sich hier aber auch der anhaltende Expansionsdruck des Neuassyrischen Reiches (seit dem frühen 9. Jh.) auf die aramäischen Stämme und Staaten des syrischen Hinterlandes ausgewirkt haben. Hinzu kamen die assyrischen Tributforderungen gegenüber den phönizischen Stadtstaaten, die ein verstärktes Engagement im westmediterranen Kolonialgebiet erzwangen. Jedenfalls war nun an der Levanteküste die lange, fruchtbare Phase eines machtpolitischen Vakuums zu Ende. Die über Schiffe, konkrete Erfahrungen und die erforderliche Logistik verfügende Aristokratie von Sidon-Tyros konnte ihrerseits sowohl aus der einheimischen Stadtarmut als auch aus dem Reservoir an syrischaramäischen Flüchtlingen, die vom schmalen südlichen Küstensaum der Levante aus den Heerzügen und Strafaktionen der Assyrer zu entkommen suchten, genügend Personen gewinnen, um ihre Handels- und Hafenplätze im fernen Westen dauerhaft durch Ansiedler absichern zu können. Selbstverständlich blieb die Masse dieser Neuankömmlinge in ihren isolierten – gegen das Hinterland in der Regel durch Befestigungen abgeschirmten – Wohnsitzen auf fortwährende Unterstützung seitens der adligen Unternehmer und Handelsherren aus Sidon-Tyros angewiesen.
Gründung Karthagos
Einen Sonderfall stellte demgegenüber die Gründung Karthagos an der tunesischen Nordküste dar. Nach den archäologischen Befunden dürfte hier auch das traditionelle Gründungsdatum der Ansiedlung (814) annähernd zutreffen. Diesem Kolonisationsunternehmen war angeblich, infolge eines mörderischen Streits in der Königsfamilie zwischen Dido/Elissa, der verwitweten Tochter des Königs Mutto/Mettes von Tyros, und ihrem jüngeren Bruder Pygmalion, eine tiefe Spaltung im tyrischen Adel vorausgegangen. Auch eine Kolonistenschar aus den Reihen der bereits auf Zypern ansässigen Phönizier soll sich an diesem Siedlungsprojekt beteiligt haben. Die Gestalt der tragisch und kinderlos endenden Gründerkönigin, die der Verfolgung durch ihren in Tyros gebietenden Bruder zwar entkam, sich später im aufblühenden Karthago jedoch nur durch ein Selbstopfer auf dem Scheiterhaufen vor einer aufgezwungenen Ehe und damit neuer Abhängigkeit von Seiten eines kriegerisch drohenden Nachbarkönigs retten konnte, gehört sicherlich der Sage an. Gleichwohl wird man aus den in diesem Gründungsmythos zusätzlich noch enthaltenen, authentisch wirkenden Einzelzügen erschließen dürfen, dass von Anfang an eine starke Gruppe aus den ratsfähigen tyrisch-sidonischen Adelsfamilien an dem Kolonisationsprojekt beteiligt gewesen ist und mit ihren Angehörigen auch dauerhaft in der „neuen Stadt“ (= qart-hadast, griech. Karchedón, lat. Carthago) präsent blieb.
Die Zerstörung Karthagos 146 durch die römischen Belagerer im Dritten Punischen Krieg, vor allem jedoch die Planierungsarbeiten bei der späteren Neugründung der Stadt als römische Kolonie durch Julius Caesar haben zum Teil auch die ältesten Siedlungsschichten im Innenstadtbereich vernichtet, so dass die ungewöhnlichen Ausmaße, die diese „neue Stadt“ bereits im späten 8. Jahrhundert v. Chr. erreicht hatte, sich nur in Umrissen bestimmen lassen. Die Konflikte der Mutterstadt Sidon-Tyros mit dem mächtigen Assyrerkönig Tiglatpileser III. in den 730er und 720er Jahren könnten zu dieser Zeit auch weitere Auswanderungsschübe aus Phönizien nach Karthago und in das übrige westliche Kolonisationsgebiet ausgelöst haben.
Bereits die geographisch-strategische Lage – inmitten einer großen, geschützten Hafenbucht mit ungehindertem Zugang zu einem äußerst fruchtbaren Umland – wies der „neuen Stadt“ die Rolle eines zentralen Bindegliedes zwischen den phönizischen Niederlassungen im äußersten Westen und der Heimatmetropole an der Levanteküste zu. Für die Beziehungen der Phönizier im Westen zu ihrer Mutterstadt Tyros ist es im Übrigen bezeichnend, dass nirgendwo im phönizischen Westen ein dynastisches Stadtkönigtum begründet worden ist; selbst in der mächtigen Kolonie Karthago sind am Ende alle Usurpationsversuche siegreicher Heerführer, die auf die Errichtung einer Militärmonarchie – mit der Folge einer definitiven Emanzipation von der fernen Metropole Sidon-Tyros – abzielten, am Widerstand des regierenden „republikanischen“ Ratsgremiums gescheitert. So hat Karthago über die Jahrhunderte hin an seiner politisch-rechtlichen und kultisch-religiösen Anbindung an die Mutterstadt festgehalten und dem Stadtkönig und den Göttern von Tyros alljährlich – in der spätestens am Ende des 7. Jahrhunderts erlangten und allseits anerkannten Position einer Schutzmacht der phönizischen Ansiedlungen im Westen – ansehnliche Tribute übersandt.
Ansiedlung des euboiischen Adels
Unter dem Eindruck der mit nachhaltigem Erfolg in das Westmittelmeer ausgreifenden Siedlungskolonisation der Phönizier hat schon in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts auch der euboiische Adel, der schon länger über direkte Kontakte zur Levanteküste verfügte, eine eigene, dauerhafte Ansiedlung in einem Handels- und Gewerbezentrum auf der Insel Ischia (Pithekussai) im Golf von Neapel ins Leben gerufen. Neben der Gewinnung und vorläufigen Bearbeitung von Rohstoffen wie hochwertigem Eisenerz, Kupfer und Blei – vornehmlich aus Etrurien – wurde hier freilich auch intensiv Landwirtschaft betrieben. Mit der Gründung von Kyme, der „Mutterstadt“ Neapels, der ersten griechischen Stadt auf dem italienischen Festland, setzte geradezu planmäßig der Aufbau einer Kette euboiischer Kolonien ein – von der Küstenebene Kampaniens über die Meerenge zwischen Unteritalien und Sizilien (Rhegion und Zankle, später Messana) bis an den Ostrand Siziliens (Naxos, Katane und Leontinoi) – die untereinander und mit Euboia im griechischen Mutterland verbunden blieben, da auch die Inselpolis Kerkyra (Korfu) zunächst eine euboiische Gründung war, bevor sie im 7. Jahrhundert von Korinthern besetzt wurde und wider Willen den Status einer korinthischen Tochterstadt annehmen musste. Ein weiteres Kolonisationsgebiet, das sich die euboiische Aristokratie zu erschließen suchte, war die Chalkidike-Halbinsel – zwischen dem Kerngebiet Makedoniens im Westen und der überwiegend von thrakischen Stämmen besiedelten Nordküste der Ägäis.
Die Siedler-Bevölkerung für die neugeschaffenen Stützpunkte in Unteritalien und Sizilien wurde von den euboiischen Adligen aus recht unterschiedlichen Einzugsbereichen rekrutiert – aus Nachbarregionen in Mittelgriechenland, aber auch von abhängigen Inseln (Naxos) oder Küstenstädten in Ionien (Kyme). Mit diesen Kolonisten gelangten bezeichnenderweise die Ethnonyme des südthessalischen Hellânes-Stammes und der boiotisch-attischen Graes/Graikoi in den fernen Westen, um von dort aus – über Namensbildungen wie Pan-Héllenes („All-Hellenen“) oder Megale Hellas (lat. Magna Graecia/„Groß-Hellas“), zunächst nur für einen Teil des aufblühenden Kolonialgebietes in Unteritalien) – rasch zu umfassenden Selbst- und Fremdbezeichnungen für die gesamte griechische Staaten- und Kulturwelt aufzusteigen. Zugehörigkeit zum Hellenentum wurde zur entscheidenden Voraussetzung, um an den überregionalen Opferfesten und den dazu in regelmäßigen Abständen veranstalteten Wettkämpfen im Zeusheiligtum von Olympia und in anderen berühmten Heiligtümern (Delphi, Isthmos, Nemea) aktiv teilnehmen zu können.
Sizilien.
Sprachbarrieren
Den polaren Gegenbegriff zu Pan-Héllenes (bald verkürzt zu Héllenes) bildete von Anfang an die Bezeichnung Bárbaroi. Sie verwies lautmalerisch auf die Sprachbarrieren zwischen den griechischen Neuankömmlingen und der jeweils fremden, unverständlichen Umwelt. Für die inhaltliche Bestimmung dieses für das Welt- und Selbstverständnis des Hellenentums außerordentlich wichtigen Begriffspaares sollten sich jedoch Differenzen im Kultwesen und in der Ethik, vor allem aber in der politischen und soziokulturellen Prägung als ausschlaggebend erweisen. Später, im Zeitalter der Perserkriege (s. Beitrag „Die griechische Staatenwelt bis zum Ausgang der Perserkriege“), verschärften sich die Kriterien für die Zugehörigkeit von Gemeinwesen und Geschlechtern zum Hellenentum noch erheblich. So wurden sogar die griechisch-sprachigen Makedonen, die in den Regionen nördlich und nordwestlich des Olympmassivs unter einer traditionellen Königsherrschaft in patriarchalischarchaischen Zuständen – ohne städtisch-urbane Strukturen und die Bildung eines autonomen Bürgertums – verharrten, allgemein als ein nicht-hellenisches (d.h. „barbarisches“) Volk eingestuft. Das makedonische Königsgeschlecht der Argeaden musste sich daher eigens auf eine angebliche Herkunft aus Argos und eine entsprechende Abstammung von den Herakliden berufen, um 478 v. Chr. – in Abgrenzung von den übrigen Makedonen – seine Anerkennung als hellenisches Fürstenhaus erlangen zu können und damit zur Teilnahme an den panhellenischen Festspielen in Olympia berechtigt zu sein.
Lelantische Fehde
In der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts löste sich der euboiische Stammesverband in jahrzehntelangen Kämpfen zwischen den beiden großen, miteinander rivalisierenden Poliszentren Chalkis und Eretria auf; diese sogenannte Lelantische Fehde – um die Fruchtebene zwischen den beiden Städten auf Euboia – griff auch auf das bis dahin kohärente euboiische „Kolonialreich“ im Westen über. In dem anhaltenden Streit zwischen den euboiischen Metropolen nahmen auf beiden Seiten bald auch Adelsgruppen sowohl aus den Nachbarregionen als auch aus verkehrsgünstig gelegenen Hafenstädten des griechischen Mutterlandes (insbesondere Korinth und Megara) und des Ägäisraumes Partei und drängten nun ihrerseits mit Ansiedlerscharen in den westlichen Kolonialbereich.
Orakelbescheide aus Delphi
So wurde der weitere Verlauf der griechischen Siedlungsbewegung in den westlichen Mittelmeerraum hinein durch eine bunte Vielfalt von unkoordinierten, oft heftig miteinander rivalisierenden Unternehmungen charakterisiert, die sich in der Zusammensetzung der Auswanderer-Gruppen, in ihren Motiven und soziokulturellen Prägungen erheblich voneinander unterschieden; spontane Fluchtbewegungen nach politischen Auseinandersetzungen in der Heimatpolis kamen als „Auslöser“ von Kolonisationsunternehmungen ebenso in Betracht wie akute Hungersnöte. Immerhin gab es in der griechischen Staatenwelt auf religiösem Gebiet Instanzen mit übergreifender politisch-moralischer Autorität, die im Einzelfall beträchtlichen Einfluss auf Kolonisationsunternehmungen ausüben konnten: Neben der im panhellenischen Zeusheiligtum in Olympia betriebenen Orakelstätte hatte vor allem das Apollon-Heiligtum von Delphi, am Südhang des Parnassos in der mittelgriechischen Landschaft Phokis gelegen, sich allseits hohes Ansehen erworben: Immer wieder hatten die in gebundener Sprache formulierten, freilich nur auf Anfrage erteilten Orakelbescheide aus Delphi über private und öffentliche Anliegen – auch in den zunehmenden inneren Konflikten über die Verfassungs- und Besitzordnungen der Polisstaaten – sich als kluge Ratschläge und Anweisungen bewährt. Daher reichte der Einfluss der erkennbar unabhängigen delphischen Priesterschaft, die seit ca. 590 unter der lockeren Aufsicht eines überregionalen „Umwohnerbundes“ (Amphiktyonie) stand, schon im frühen 6. Jahrhundert weit über Hellas hinaus. Sogar die mächtigen, über West-Kleinasien gebietenden Könige des Lyderreiches in Sardes – von Gyges bis Kroisos – zählten im 7./6. Jahrhundert v. Chr. neben den Pharaonen der Saiten-Dynastie zu den eifrigsten Förderern Delphis.
Fester Bestandteil der hellenischen Staatenwelt
Im späten 7. Jahrhundert umgab das Mittelmeerbecken bereits ein Kranz aufblühender griechischer Pflanzstädte (Apoikien) – abgesehen sowohl von dem in sich geschlossenen punisch-karthagischen Bereich in Nordwestafrika und Südspanien (mit Teilen Siziliens und Sardiniens) als auch von der Machtsphäre der etruskischen Städte in Italien und dem von den Assyrern gehaltenen Gebiet am Ostrand des Mittelmeeres. Die griechischen Kolonien verstanden sich freilich in dieser Phase bereits durchgehend als selbständige Polisgemeinden, die sich zwar im Hinblick auf das Kultwesen und die in der Heimat ausgebildeten Institutionen – von den öffentlichen Ämtern bis zu Kalender, Alphabetform und normierter „Staatssprache“ – jeweils an ihrer „Mutterstadt“ orientierten, im politischen und ökonomischen Bereich jedoch, auch gegenüber „Schwesterstädten“, auf ihre Unabhängigkeit bedacht waren. Selbst das Verhältnis zu den griechischen Pflanzstädten in der unmittelbaren Nachbarschaft wurde in der Regel eher von Rivalitäten und Spannungen als von Solidarität und Bündnisbeziehungen bestimmt. Weite Küstenstrecken in Unteritalien und Sizilien mit Städten wie Syrakus, Akragas (Agrigento), Selinus, Taras (Tarent), Sybaris, Kroton, Lokroi und Poseidonia (später Paestum) wurden im Verlauf des 6. Jahrhunderts zu einem festen Bestandteil der hellenischen Staatenwelt. Nordwestlich des Tyrrhenischen Meeres stieg das um 600 vom aiolischen Phokaia aus gegründete Massalia (Marseille) nahe der Rhônemündung zum hegemonialen Zentrum einer Reihe hellenischer Ansiedlungen auf und exportierte nicht allein kostbare griechische Handwerksprodukte, sondern vermittelte auch weitergehende Kultureinflüsse über Südgallien hinaus bis nach Mitteleuropa. Zur gleichen Zeit entstand im libyschen Nordafrika in der gebirgigen Küstenregion, die nach der wichtigsten Stadtsiedlung Kyrene (Mutterstadt Thera/Santorin) die Bezeichnung „Kyrenaika“ erhielt, ein eigenständiges griechisches Kolonialgebiet, das über seine Beziehungen zu den einheimischen libyschen Stämmen auch mit dem libysch-ägyptischen Heiligtum des Zeus Ammon in der Oase Siwa in Verbindung trat und dem dortigen Orakel zu wachsendem Ansehen in der griechischen Staatenwelt verhalf.
Herakles und der Stier, West-Metope des Zeustempels von Olympia. Um 460 v. Chr.
Im benachbarten Niltal hatten bereits einige Zeit zuvor schwergerüstete Söldner aus Ionien – von Lydiens Herrscher Gyges entsandt – den Freiheitskampf der Fürsten aus Sais im Nildelta (26. Dynastie: sog. „Saiten-Zeit“, 663–525) gegen die assyrischen Eroberer und Besatzer unterstützt. Nach errungenem Sieg bestanden daher in Ägypten beste Voraussetzungen nicht nur für griechische Söldner, sondern auch für Kaufleute und Unternehmer zu langfristigen Aufenthalten und wirtschaftlichen Engagements. So lassen sich schon bald danach, in der aufblühenden griechischen Großplastik des archaisch-„dädalischen“ Stils (seit der Mitte des 7. Jhs. v. Chr.) und in den neuartigen, säulenumkränzten Tempelbauten dieser Zeit, ästhetische Einflüsse und Erfahrungen aus der Begegnung zahlreicher Hellenen mit der monumentalen Kunst und Architektur Ägyptens feststellen.
Militärische Versuche der erstarkten ägyptischen Königsmacht, ihre Herrschaft auch auf Syrien auszudehnen, scheiterten an der energischen Gegenwehr des neubabylonischen Herrschers Nebukadnezar II. (605–562); ein prominentes Opfer dieser Auseinandersetzungen wurde das Königreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem (597 und definitiv 586). Dagegen gelang der Aufbau einer starken ägyptischen Seemacht, die mit der Herrschaft über Zypern auch das östliche Mittelmeer unter ihre Kontrolle brachte. Schließlich wurde unter Pharao Necho II. (609–594), in dessen Auftrag die Umsegelung Afrikas erfolgte, sogar das Projekt eines Suez-Nil-Kanals in Angriff genommen, um einen sicheren Schiffsweg vom Mittelmeer zum Roten Meer beziehungsweise zum Indischen Ozean zu eröffnen. Der Kanalbau ist jedoch erst unter dem persischen Großkönig Dareios I. (522/521–486) vollendet und dauerhaft in Nutzung genommen worden.
Psammetich I.
Die Rezeption kultureller Anregungen und Vorbilder blieb in Ägypten während des 7./6. Jahrhunderts jedoch nicht auf die griechische Seite beschränkt: Schon der erste Pharao der Saiten-Dynastie, Psammetich I. (663–609), hatte Anweisungen gegeben, dass junge Ägypter aus der Schreiber-Elite Kenntnisse in der griechischen Sprache erwerben sollten; dementsprechend lassen sich in der Folgezeit innerhalb der ägyptischen Literatur dieser Zeitstufe deutliche Einwirkungen vor allem der homerischen Epen, aber auch der Werke Hesiods nachweisen. Gegen den stetig wachsenden Einfluss der griechischen Zuwanderer erhob sich in Ägypten freilich auch heftiger Widerstand, vor allem in der etablierten libyschen Kriegerschicht des Landes. Erst unter Pharao Amasis (568–526) festigten sich der gegenseitige kulturelle und ökonomische Austausch sowie die politischen Beziehungen der Saiten-Dynastie zur griechischen Staatenwelt und zu prominenten hellenischen Heiligtümern wie Delphi: Der Handelsplatz Naukratis (griech. „die Schiffsmächtige“) im Nildelta wurde für die in Ägypten heimisch gewordenen Griechen zu einer rasch aufblühenden hellenischen Polis, mit eigenen Institutionen und garantierter innerer Autonomie, ausgebaut. Erst die Invasion des Achaimenidenherrschers Kambyses (525/524) und die anhaltende persische Fremdherrschaft haben diese letzte große Blütezeit des pharaonischen Ägyptens – einschließlich der damals erreichten und für beide Seiten äußerst fruchtbaren Verbindung mit dem aufsteigenden Hellenentum – abrupt beendet.
Siedlungspolitik im Schwarzmeergebiet
In der von Milet, der größten und wohlhabendsten Polis Ioniens, betriebenen Siedlungspolitik im Schwarzmeergebiet (griech. Pontos) zeigen sich enge Übereinstimmungen mit der frühesten euboiischen Kolonisationsphase im Westen: Milet konnte freilich über längere Zeit seine Position als Metropole im Kreise seiner zahlreichen „Tochterstädte“ (angeblich mehr als achtzig Ansiedlungen) behaupten. Seit dem Ende des 7. Jahrhunderts bildete sich aus diesen Gemeinwesen – vom Marmara-Meer aus über alle pontischen Küsten und die Krim-Halbinsel bis an die Don-Mündung (Tanais) – ein dichtes Netz von Verkehrs- und Handelsstützpunkten. Dementsprechend gewann die Polis Milet an ihrem ausgedehnten „Kolonialreich“ genügend Rückhalt, um sich in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. – anders als die meisten Festland-ionischen Städte – in langwierigen Kämpfen gegen das aufsteigende Lyderreich von Sardes zu behaupten. Erst 546 v. Chr. wurde die stolze Metropole im Verlauf des Siegeszugs Kyros’ II., des Begründers des achaimenidischen Weltreiches, unter persische Herrschaft gezwungen. Die gewaltsame Unterwerfung durch die Perserheere löste im ionischen Raum eine große Auswanderungswelle aus, deren Kolonistenscharen sowohl im griechischen Westen (Korsika) als auch an der thrakischen Küste (Abdera) und im Nordpontos-Gebiet (Phanagoreia) eine neue Heimat suchten.
An der Ostküste der Krim und auf der gegenüberliegenden Tamanhalbinsel (am Kimmerischen Bosporus) entwickelte sich dann im Verlauf des 5. Jahrhunderts eine fruchtbare Symbiose zwischen den dort etablierten milesisch-ionischen Kolonialstädten und den einheimischen Stämmen im Hinterland, aus der das langlebige, griechisch geprägte Bosporanische Reich erwuchs. Von hier aus verbreiteten sich, mit dem Austausch von begehrten Zivilisationsgütern und künstlerisch hochwertigen Handwerksprodukten, hellenische Kultureinflüsse weit in den skythisch-eurasischen Raum hinein.
Antike Staaten und Kulturen
Treppenanlage zum Audienzsaal (Apadana) des Großkönigs in Persepolis. 5./6. Jh. v. Chr.
Aufstieg und Fall des Neuassyrischen Reiches
Kai Lämmerhirt
Einführung
Der folgende Beitrag behandelt die Geschichte Assyriens von der Mitte des 10. Jahrhunderts bis 609 v. Chr. In dieser Periode stieg Assyrien zum ersten altorientalischen Imperium auf; am Ende wurde es von den verbündeten Medern und Babyloniern für immer von der politischen Landkarte Vorderasiens getilgt.
Geographischer Ausgangspunkt – Umwelt Assyriens





























