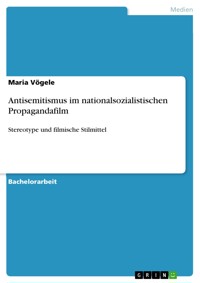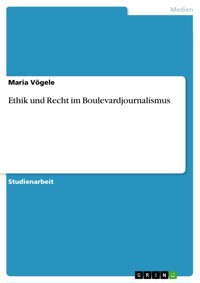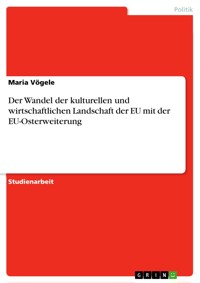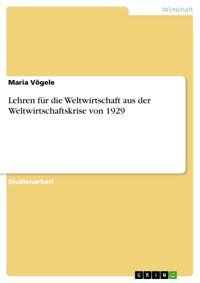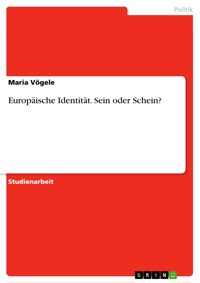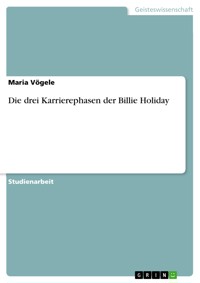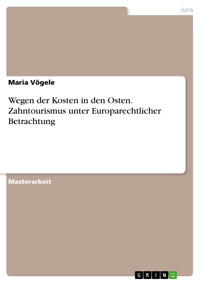
Wegen der Kosten in den Osten. Zahntourismus unter Europarechtlicher Betrachtung E-Book
Maria Vögele
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Jura - Europarecht, Völkerrecht, Internationales Privatrecht, Note: 2, Universität Salzburg (Salzburg Centre of European Union Studies), Sprache: Deutsch, Abstract: Zahntourismus ist in Europa ein aufstrebender Markt. Immer mehr PatientInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz reisen nach Ungarn oder Tschechien, um sich dort einer Zahnmedizinischen Behandlung zu unterziehen. Vor allem die günstigeren Kosten dienen als Motivation, lange Anreisewege in Kauf zu nehmen. Die vorliegende Arbeit nähert sich aus europarechtlicher Sicht an das Thema Zahntourismus an. Verschiedene sekundärrechtliche Schritte seitens der Europäischen Union haben die Inanspruchnahme grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung für die PatientInnen nach und nach erleichtert. Zuletzt wurde eine Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung erlassen. Die vorliegende Arbeit betrachtet den derzeitigen Europäischen Rechtsrahmen und geht der Frage auf den Grund, ob dieser ausreichend ist oder ob es Handlungsbedarf gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus, Bachelor und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Relevanz des Themas
1.2. Hypothesen und Forschungsfragen
1.3. Gliederung der Arbeit
1.4. Abgrenzung des Forschungsbereiches
2. Kompetenzen der Union in der Gesundheitspolitik
2.1. Etablierung einer europäischen Gesundheitspolitik
2.2. Verordnungen der Kommission
2.2.1. Die EWG-VO 1408/71 und VO 574/72
2.2.2. Die EU-VO 883/2004
2.2.3. Die EU-VO 987/2009
2.3. Rechtsprechung des EuGH
2.3.1. Rechtsache C-158/96 („Kohll“) und C-120/95 („Decker“)
2.3.2. Rechtsache C-368/98 („Vanbraekel“), EuGH 12.7.2001, Slg. 2001, I-05363
2.3.3. Rechtsache C-157/99 („Geraets-Smits/Peerbooms“)
2.3.4. Rechtsache C-56/01 („Inzian“)
2.3.5. Rechtsache C372/04 („Watts“)
2.3.6. Zusammenfassung der Rechtsprechung des EuGH
2.4. Zusammenfassung der Patientenrechte
2.4.1. Rechtslage für akute grenzüberschreitende Behandlungen
2.4.2. Rechtslage für gezielte grenzüberschreitende Behandlungen
3. Richtlinie 2011/24 EU
3.1. Hintergrund zur Richtlinie
3.2. Zusammenfassung der wichtigsten Artikel
3.3. Nutzen für die PatientInnen
3.4. Unterschiede zum ursprünglichen Entwurf der Kommission
3.4.1. Art. 5: Qualitäts- und Sicherheitsstandards
3.4.2. Art. 15: Europäischer Referenznetze
3.5. Umsetzung und Ausblick
4. Nationale Rechtslage
4.1. Umsetzung der RL 2011/24 EU in Österreich
4.2. Nationale Umsetzung in Tschechien
5. Zahlen und Fakten zur Patientenmobilität
5.1. Patientenprofil
5.2. Gründe für eine Behandlung im Ausland
5.3. Die häufigsten Behandlungen
5.4. Zufriedenheit mit den Behandlungen im Ausland
5.5. Behandlungsland Tschechien
5.6. Chancen und Perspektiven
6. Medizintourismus
6.1. Reisen für die Gesundheit
6.2. Zahntourismus
6.2.1. Gefragte Zahnbehandlungen im Ausland
6.2.2. Kosten
6.2.3. Spezielle Angebote
6.3. Risiken
7. Methodische Vorgehensweise
7.1. Datenerhebung
7.1.1. Befragungstechnik
7.1.2. Erhebungsinstrumente
7.1.3. Auswahl der Stichprobe
7.1.4. Durchführung der Interviews
7.2. Datenauswertung
8. Ergebnisse der Studie
8.1. Anforderungen im Medizintourismus
8.2. Einheitliche Qualitätsstandards als Lösungsansatz
8.3. Umsetzungsbedarf der RL 2011/24 EU
8.4. Ausblick auf künftige Entwicklungen
9. Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Rechtsverweise
Abbildungsverzeichnis
Anhang
Abstract
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
„Gesund beginnt im Mund“, liest man oft auf Zahnarztprospekten und -inseraten. Dennoch ist der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt für die meisten Menschen eine unangenehme Last. Solange es nur Routineuntersuchungen sind, kann man erleichtert aufatmen. Wenn jedoch festgestellt wird, dass eine größere Behandlung ansteht, weil ein Zahn oder gleich mehrere Zähne geschädigt sind, vergeht einem das Lachen gänzlich. Sogleich stellt sich die Frage, welche Methode man wählt, wann man die Behandlung durchführen lässt und vor allem auch wie die Behandlung finanziert werden soll.
Gerade Zahnersatz darunter fallen Brücken, Kronen und Implantate, sind kostspielige Behandlungen, bei denen die Krankenkasse nur einen geringen Teil der Kosten übernimmt. PatientInnen stehen somit immer vor der Frage, ob sie Kosten sparen wollen, indem sie sich für herausnehmbare Prothesen entscheiden, oder ob sie mehr investieren und damit einen festsitzenden Zahnersatz erhalten, der auf lange Sicht deutlich mehr Komfort verspricht.
Preise zu vergleichen haben KonsumentInnen nicht erst durch das Aufkommen des Internets gelernt. Schon immer wurde um Waren gefeilscht und dadurch versucht, das günstigste Angebot zu erreichen. Doch der Preisvergleich beschränkt sich nicht nur auch Waren, sondern auch auf Dienstleistungen. Ein freier Markt, in dem die Nachfrage den Preis bestimmt, hat sich somit auch für Zahnbehandlungen gebildet. Lange Zeit galt Ungarn als das Zahnparadies schlecht hin. Ganze „Zahndörfer“ sind in den letzten 20 Jahren in den Grenzregionen zu Österreich entstanden. Aufgrund des geringeren Lohnniveaus und der geringeren Materialkosten, konnten bei einer Zahnbehandlung in Ungarn schon damals bis zu zwei Drittel der Behandlungskosten eingespart werden. Spätestens seit dem EU-Beitritt 2004 zieht auch Tschechien nach und hat rund um die Grenzregionen Zahnkliniken errichtet, die sich hauptsächlich auf die Bedürfnisse Österreichischer PatientInnen spezialisieren: mit deutschsprachigem Personal, unkomplizierter Organisation und teilweise auch noch mit weiter reichenden Angeboten: Hotel und Ausflüge inklusive.
Wie sich durch die nähere Auseinandersetzung mit der Thematik gezeigt hat, ist Patientenmobilität ein von Wachstum geprägtes Feld. Einschnitte in Sozialsystemen vieler Mitgliedstaaten in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass die Selbstbehalte bei Gesundheitsleistungen gestiegen sind. Zusätzlich hat die allgemeine Reisebereitschaft der Menschen unaufhaltsam zugenommen. Daher nehmen immer mehr EuropäerInnen auch längere Wege in Kauf, um Kosten im Gesundheitsbereich zu sparen. Für den Medizintourismus sind beide Entwicklungen förderlich. Nähere Informationen und statistische Daten dazu finden sich im dritten Teil der Arbeit.
Ein hoch interessanter Aspekt in der Betrachtung des Phänomens Patientenmobilität ist der rechtliche Hintergrund. Welche Rechte habe ich als PatientIn im Ausland und was bezahlt mir die Krankenkasse im Ausland? Dies sind Fragen, die bei der Organisation eines medizinisch bedingten Aufenthaltes im Ausland eine wichtige Rolle spielen. Schließlich möchte man ja keineswegs Risiken eingehen oder gar „drauf zahlen“. Die rechtliche Basis für die Entstehung des Medizintourismus bildeten bereits frühe Schritte der Europäischen Integration: Die Einheitliche Europäische Akte im Jahr 1987 setzte den Grundstein für einen gemeinsamen Binnenmarkt ohne Barrieren. Die darauf folgenden Rechtsakte erleichterten den EU-BürgerInnen die grenzüberschreitende Mobilität schrittweise. Heute sind alle UnionsbürgerInnen prinzipiell im Besitz der Rechte, sich frei in der Union zu bewegen, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, zu arbeiten, einen Wohnsitz einzurichten, etc.
Gesundheitspolitik als solche liegt laut den Verträgen jedoch nach wie vor in den Händen der Mitgliedstaaten. Seit dem Gipfel von Lissabon 2000 wurde die offene Methode der Koordinierung (OMK) in den Bereichen Sozial-, Beschäftigungs- und Einwanderungspolitik eingeführt. Die OMK sollte ermöglichen, dass die Mitgliedstaaten ihre Gesetze in den genannten Bereichen soweit aufeinander abstimmen, dass es die Komplementarität ihrer Gesundheitsdienste in den Grenzgebieten möglichst gering gehalten wird. Die EU wird dabei nur unterstützend tätig.
Die rechtliche Grundlage für die Koordinierung der Sozialordnungen der Mitgliedstaaten bildeten bis vor kurzem die EWG-VO 1408/71, die EG-VO 883/2004 und die EG-VO 987/2009. Weitgehende Harmonisierung konnte jedoch trotz der Verordnungen lange Zeit nur durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes geschaffen werden. Zuletzt hat die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011, auch „Patientenmobilitätsrichtlinie“ genannt, über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung den rechtlichen Rahmen dafür gelegt, dass die Mobilität von PatientInnen innerhalb der EU künftig einfacher möglich sein wird. Die Wege für eine neue Art des Tourismus scheinen sich immer mehr zu ebnen. Medizintourismus verspricht eine zukunftsträchtige Branche zu werden.
Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich näher mit dem Phänomen Medizintourismus in der EU. Aufgrund der besonderen Ausprägung des Medizintourismus im dentalen Bereich spezialisiere ich mich auf den Zahntourismus. Weiters wurde eine Spezifizierung bezüglich der Länderauswahl vorgenommen: Der besonderer Fokus liegt auf Tschechien. Tschechien ist für mich persönlich von hohem Interesse, da ich im Rahmen meines Studiums ein Auslandssemester in Olomouc (CZ) verbracht habe und ich mir daher auch vor Ort ein Bild von der Situation machen konnte.
1.1. Relevanz des Themas
Nicht erst seit der Diskussion rund um die Patientenmobilitätsrichtlinie wird das Thema grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in der EU immer wieder aufgegriffen. Die zunehmende Bereitschaft der PatientInnen, sich zwischen den Mitgliedsländern zu bewegen und in Kombination dazu das Spannungsfeld zwischen Europäischer und nationale Gesundheitspolitik, gaben bereits Anlass für verschiedene Studien. Erwähnt sei hierbei unter anderem das Projekt Europe for Patients (E4P), das der Frage nachging, ob und wie die EU-Patientenmobilität den Zugang zu Gesundheitsleistungen für die europäischen Bürger verbessert.[1]
Ein weiteres Projekt in diesem Forschungsfeld war Health Access, eine Kooperation von zwölf Europäischen Forschungseinrichtungen, die die Zugangsbarrieren für die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen innerhalb zehn beteiligter Länder untersuchte. Hier kam man vor allem zum Ergebnis, dass nicht versicherte PatientInnen in Europa kaum von den Leistungen im Europäischen Ausland profitieren. In einem zweiten Schritt wurde im genannten Projekt auch die grenzüberschreitende Kooperation erfasst, wobei verdeutlicht wurde, dass es bereits eine starke Zusammenarbeit zwischen bestimmten Mitgliedsländern gibt. Diese beschränkt sich aber hauptsächlich auf Staaten, die schon länger bei der EU sind. Zwischen den „alten“ und „neuen“ Mitgliedstaaten war die Kooperation zum damaligen Zeitpunkt (2007) noch dürftig. [2]
Mittlerweile haben sich auch schon mehrere Dissertationen dem Thema Patientenmobilität in Europa gewidmet. Erwähnt sei hierbei die Dissertation von Alena Ottichová aus dem Jahr 2012, die für die vorliegende Arbeit sehr hilfreich war.[3] Die Arbeit betrachtet erstmals Tschechien als Zielland. Ottichová identifiziert in ihrer Forschungsarbeit die Einschränkungen und deren Hintergründe im Bezug auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleitungen im Länder-Dreieck Deutschland, Österreich und Tschechien. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Einschränkungen, die es derzeit noch gibt, „ein Produkt der komplizierten europäischen und nationalen Regelungen sowie der unterschiedlichen Strukturen und Organisationsformen nationaler Gesundheitssysteme in der EU, in deren Rahmen sich die Hauptakteure – Versicherte, Gesundheitsdienstleistungerbringer und Krankenkassen – bewegen und handeln“[4] sind. Die Arbeit kommt zu der Auffassung, dass es derzeit keine „indirekte Harmonisierung“ der Gesundheitssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten gibt. Weiters werden der Patientenmobilität bewusst Schranken gesetzt, da es für die einzelnen Akteure wirtschaftlich günstiger sei.[5] Ottichová kritisiert im Zuge ihrer Ausarbeitung, dass es immer noch wenig genaues Wissen über das Ausmaß und die tatsächlichen Erfahrungen der PatientInnen mit den verschiedenen Formen der EU-Patientenmobilität gibt. Ebenso sind bisher kaum Daten über den Medizintourismus vorhanden. [6]
Der Grund für die mangelhafte Datenlage liegt darin, dass Krankenkassen häufig keine Informationen darüber erhalten, dass ihre Versicherten im Ausland behandelt wurden (z.B. wenn keine Kostenerstattung beantragt wurde). Weiters gibt es Unterschiede in den Mitgliedstaaten, welche und auf welchem Wege Daten beobachtet werden bzw. wer dafür zuständig ist. Das erschwert den Datenvergleich zusätzlich. Im Medizintourismus könnte die reduzierte Datenlage damit verbunden werden, dass hier nur der Gesundheitsleistungserbringer mit den PatientInnen involviert ist. Die genaue Zahl der Inanspruchnahme kommt den Krankenkassen demnach nicht zu.
Mit genau diesen Problemen in Bezug auf die Datenlage beschäftigten sich Ewout van Ginneken und Reinhard Busse im Buch Cross-border health care in the European Union. Sie demonstrieren, dass die Zahlen der mobilen PatientInnen steigend sind und oft unterschätzt werden und weisen auf die eben genannten Gründe hin.[7]
Seit 2010 haben die Österreichischen Krankenkassen damit begonnen, die Anzahl der Auslandsbehandlungen mit einer Genehmigung statistisch zu beobachten. Kaum erfasst sind jedoch die gezielt in Anspruch genommenen medizinischen Leistungen. Für vorliegende Arbeit sind diese Statistiken somit nicht relevant.
Hingegen sehr hilfreich waren die Erkenntnisse der TK-Mitglieder-Befragungen aus verschiedenen Jahren. Diese ließen Aufschluss darüber geben, wie viele TK Kunden und aus welchen Gründen sie für ihre medizinische Behandlung gezielt ins Ausland gehen. Weiters konnte abgeleitet werden, welche Behandlungen bevorzugt beansprucht werden. Die genaueren Ergebnisse der TK Befragung aus dem Jahr 2012 werden in Kapitel 5 erläutert.
In den letzten Jahren lässt sich folglich ein Trend ableiten, dass auch die Wissenschaft sich angesichts der steigenden Zahlen immer mehr mit dem Thema Patientenmobilität befasst. Genauere Betrachtungen zum Thema Medizintourismus sind noch kaum vorhanden. Die vorliegende Arbeit behandelt ein Phänomen, das zwischen Patientenmobilität und Medizintourismus angesiedelt ist. Die häufigsten in Anspruch genommenen Zahnbehandlungen im Ausland sind jene, die sich nicht im Leistungskatalog der heimischen Versicherungsträger befinden und daher von den PatientInnen selbst zu begleichen sind. Da jedoch im Rahmen der Vor- und Nachbehandlungen auch Standardleistungen anfallen, können sich die PatientInnen zumindest jene rückerstatten lassen. Der Untersuchungsgegenstand Zahntourismus befindet sich somit in einem Spannungsfeld zwischen Patientenmobilität und Medizintourismus. Da dieses Phänomen bisher in keiner Studie näher untersucht wurde, ist es von besonderer Relevanz.
1.2. Hypothesen und Forschungsfragen
Die vorliegende Masterarbeit stellt eine nähere Betrachtung der innereuropäischen Patientenmobilität dar. Insbesondere wird dabei das Thema Zahntourismus behandelt, welches eine spezielle Form der Patientenmobilität darstellt. Sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Zahntourismus ermöglichen, sollen aufgezeigt werden, ehe anhand einer empirischen Untersuchung die praktischen Ausprägungen und Anforderungen im Bereich Zahn- oder Dentaltourismus diskutiert werden. Die Hauptforschungsfrage zum Thema der vorliegenden Arbeit lautet:
Wird der aktuelle europäische Rechtsrahmen den Anforderungen der PatientInnen und ÄrztInnen gerecht oder gibt es Handlungsbedarf?
Die sich daraus ergebenden Unterfragen lauten:
- Welche rechtlichen Rahmenbedingungen ermöglichen Patientenmobilität? Inwiefern unterstützen inländische Krankenkassen Gesundheitsleistungen im Ausland?
- Wie haben die Rechtsakte der letzten Jahre, insbesondere die RL2011/24/EU dazu beigetragen, Patiententourismus zu fördern?
- Wie manifestiert sich Zahntourismus in Tschechien? Mit welchen Angeboten locken Tschechische Praxen ihre PatientInnen an?
- Ausblick: In welche Richtung bewegt sich der Zahntourismus? Wie zukunftsträchtig ist die Branche?
Die Hypothesen, die ich im Rahmen der Arbeit überprüfen möchte, sind folgende:
- Seit der Osterweiterung 2004 und durch die Gesetzgebung des EuGH der letzten Jahre hat Zahntourismus stetig zugenommen.
- Die RL 2011/24/EU hat wichtige Neuerungen gebracht, die den Weg für Patientenmobilität weiter geebnet haben.
- Die Qualität der Zahnarztpraxen in den „neuen“ Mitgliedsländern nimmt stetig zu.