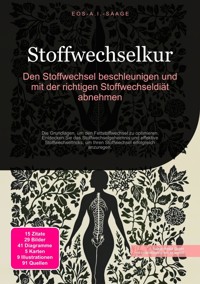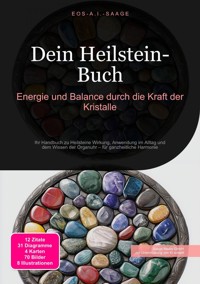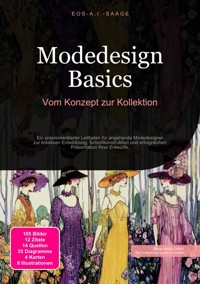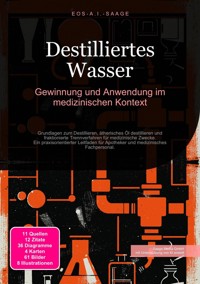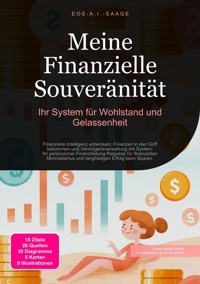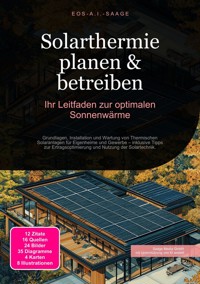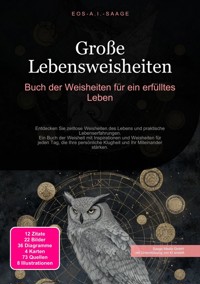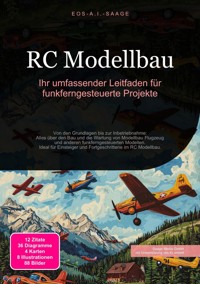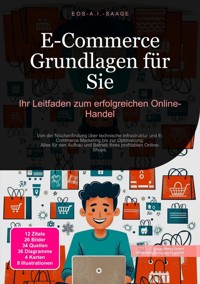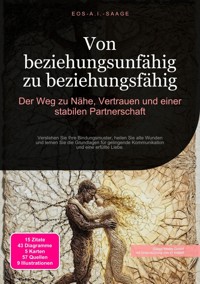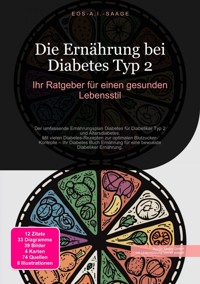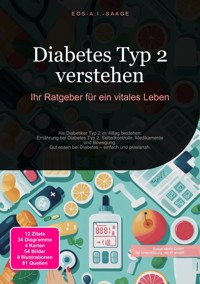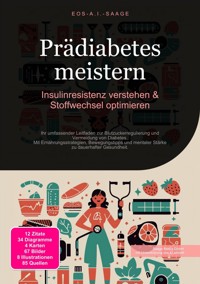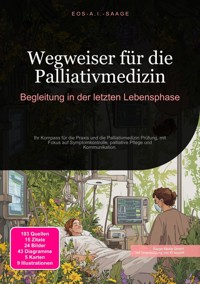
Wegweiser für die Palliativmedizin: Begleitung in der letzten Lebensphase E-Book
D. Eos A. I. Saage
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der "Kompass der Palliativmedizin" bietet Ihnen eine strukturierte und umfassende Orientierung für die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Dieses Werk dient als fundierter Wegweiser für Ihre tägliche Praxis und unterstützt Sie gezielt bei der Vorbereitung auf die Palliativmedizin Prüfung. Das Buch legt einen besonderen Schwerpunkt auf die drei zentralen Säulen der palliativen Versorgung. Im Bereich der Symptomkontrolle finden Sie detaillierte Informationen zur medikamentösen und nicht-medikamentösen Schmerztherapie, zum Umgang mit quälenden Begleitsymptomen sowie zum Ernährungs- und Flüssigkeitsmanagement am Lebensende. Besondere pharmakologische Aspekte, wie die Anpassung der Medikation in der Sterbephase und der Umgang mit Polypharmazie, werden praxisnah erläutert. Ein weiterer Kernbereich widmet sich der Palliativpflege. Hier werden konkrete pflegerische Interventionen zur Komfortförderung, wie Mund- und Hautpflege sowie Lagerungstechniken, beschrieben. Das Buch behandelt zudem die palliative pflege bei physiologischen Herausforderungen wie Atemnot, Übelkeit oder Inkontinenz und bietet nützliche Gedächtnisstützen für den Pflegealltag. Für dieses Buch haben wir moderne Technologien genutzt – darunter Künstliche Intelligenz und individuell entwickelte Softwarelösungen. Sie kamen in vielen Phasen des Entstehungsprozesses zum Einsatz: von der Ideenfindung und Recherche über das Schreiben und Lektorat bis hin zur Qualitätssicherung und der Gestaltung der dekorativen Illustrationen. Unser Ziel ist es, Ihnen damit eine Leseerfahrung zu bieten, die besonders stimmig und zeitgemäß ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Saage Media GmbH SpinLab Spinnereistraße 7 - 04179 Leipzig, Germany E-Mail: [email protected] Handelsregister: Amtsgericht Leipzig, HRB 42755 (Commercial Register: Local-Court Leipzig, HRB 42755) Geschäftsführer: Rico Saage (Managing Director) USt-IdNr.: DE369527893 (VAT ID Number)SaageBooks.com/de/imprint
Publisher: Saage Media GmbH
Veröffentlichung: 07.2025
Umschlagsgestaltung: Saage Media GmbH
Rechtliches / Hinweise
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert, gespeichert oder übertragen werden. Die in diesem Buch aufgeführten externen Links und Quellenverweise wurden zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung geprüft. Auf die aktuellen und zukünftigen Gestaltungen und Inhalte der verlinkten Seiten hat der Autor keinen Einfluss. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der verlinkten Website, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung verweist. Alle verwendeten externen Quellen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Quellen. Für den Inhalt der zitierten Quellen sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Bilder und Quellen Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Die Daten in den Diagrammen, die nicht explizit mit einer Quelle gekennzeichnet sind, basieren nicht auf Studien, sondern sind unverbindliche Annahmen zur besseren Visualisierung. Dieses Buch wurde unter Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) und anderen Tools erstellt. Unter anderem wurden Tools für die Recherche, das Schreiben/Lektorieren und die Generierung der dekorativen Illustrationen eingesetzt. Trotz Kontrolle können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Wir möchten betonen, dass der Einsatz von KI als unterstützendes Werkzeug dient, um unseren Lesern ein qualitativ hochwertiges und inspirierendes Leseerlebnis zu bieten. Die in diesem Buch enthaltenen Verweise beziehen sich auf Online-Quellen, die sorgfältig recherchiert wurden. Die Wiedergabe der Informationen erfolgt stets sinngemäß (paraphrasierend); auf wörtliche Zitate wird verzichtet. Die Interpretation und Darstellung der wiedergegebenen Inhalte spiegelt die Auffassung des Autors wider und muss nicht zwangsläufig mit der Intention oder Meinung der ursprünglichen Autoren übereinstimmen. Bei der sinngemäßen Wiedergabe werden die Kernaussagen der Originalquellen nach bestem Wissen und Gewissen in den Kontext dieses Werkes eingebettet. Dabei kommen zwei Vorgehensweisen zur Anwendung: Sinngemäße Wiedergabe: Kernaussagen werden direkt paraphrasiert und in den thematischen Zusammenhang des Buches gestellt. Übertragung und Anwendung: Erkenntnisse aus einer Quelle, die ursprünglich einem anderen Fachgebiet oder Kontext entstammt, werden auf das spezifische Thema dieses Buches übertragen und angewendet. In beiden Fällen können durch die Übertragung, Vereinfachung und kontextuelle Einbettung die ursprünglichen Formulierungen und Bedeutungsnuancen von den Originalquellen abweichen. Die Verantwortung für die Interpretation und die spezifische Anwendung im Rahmen dieses Buches liegt beim Autor. Alle verwendeten Online-Quellen sind in der Quellenliste am Ende des Buches aufgeführt. Es wird empfohlen, die Originalquellen für Detailinformationen zu konsultieren, wobei die dauerhafte Verfügbarkeit von Online-Inhalten nicht garantiert werden kann. Der Autor hat sich bemüht, komplexe Sachverhalte allgemeinverständlich darzustellen. Dabei können Vereinfachungen und Verallgemeinerungen nicht ausgeschlossen werden. Für die fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der vereinfachten Darstellungen kann keine Gewähr übernommen werden. Die sinngemäße Wiedergabe von Erkenntnissen erfolgt gewissenhaft unter Beachtung der geltenden urheberrechtlichen Bestimmungen. Bei der Vereinfachung, Übertragung und gegebenenfalls Übersetzung von Inhalten in eine allgemeinverständliche Sprache können Bedeutungsnuancen und fachliche Details verloren gehen. Der Autor erhebt keinen Anspruch auf die Rechte der zitierten Werke und respektiert sämtliche Urheberrechte der Originalautoren. Sollte eine unerlaubte Nutzung festgestellt werden, bittet der Autor um Mitteilung, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Für akademische Zwecke und bei der Verwendung als wissenschaftliche Referenz wird ausdrücklich empfohlen, auf die Originalquellen zurückzugreifen. Die vereinfachte Darstellung dient ausschließlich der populärwissenschaftlichen Information. Die Inhalte dieses Buches, insbesondere die Informationen zu Symptomkontrolle, palliativer Pflege, Medikamentendosierungen und Kommunikationsstrategien, wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und zusammengestellt. Sie dienen ausschließlich der Information und der Prüfungsvorbereitung im Bereich der Palliativmedizin. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der dargestellten medizinischen Fakten und Handlungsempfehlungen übernommen. Die Palliativmedizin ist ein sich ständig weiterentwickelndes Feld; Behandlungsstandards, Leitlinien und rechtliche Rahmenbedingungen können sich seit der Drucklegung dieses Werkes geändert haben. Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung für materielle oder immaterielle Schäden, die direkt oder indirekt durch die Anwendung der hier präsentierten Inhalte entstehen, ist ausgeschlossen. Dieses Buch ersetzt in keiner Weise eine individuelle ärztliche, pflegerische oder psychosoziale Beratung, Diagnose oder Behandlung. Die dargestellten Inhalte sind nicht als alleinige Grundlage für gesundheitliche oder therapeutische Entscheidungen gedacht. Bei konkreten medizinischen Fragestellungen oder in einer tatsächlichen Betreuungssituation ist stets die Konsultation von qualifizierten Ärzten, Pflegefachkräften oder anderen Experten des Palliative-Care-Teams unerlässlich. Das gesamte Werk, einschließlich aller seiner Teile wie Texte, Abbildungen und Tabellen, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung. Dies gilt insbesondere für die elektronische Speicherung und Verarbeitung. Eventuell verwendete Produktnamen, Marken und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und unterliegen dem Markenschutz, auch wenn sie nicht explizit als solche gekennzeichnet sind. Alle Rechte Dritter werden anerkannt. Verwendete Quellen sind im Anhang aufgeführt. Informationen zum verwendeten Kartenmaterial Das ggf. in diesem Werk verwendete Kartenmaterial, erkennbar an den Logos "Mapbox" und "OpenStreetMap", wird unter Verwendung von Diensten und Daten erstellt, deren korrekte Quellenangabe an dieser Stelle ergänzt wird. Die Daten unterliegen den folgenden Lizenzen und Copyrights: © Mapbox - mapbox.com/about/maps, © OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org/copyright. Die Geodaten von OpenStreetMap stehen unter der Open Database License (ODbL) zur Verfügung. Wir danken den Mitwirkenden beider Projekte für die Bereitstellung dieser hervorragenden Ressourcen.Inhaltsverzeichnis
○EinleitungEos A.I. Saage
103 Quellen 43 Diagramme 24 Bilder 15 Zitate 5 Karten
© 2025 Saage Media GmbH
Alle Rechte vorbehalten
von Herzen danken wir Ihnen, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben. Mit Ihrer Wahl haben Sie uns nicht nur Ihr Vertrauen geschenkt, sondern auch einen Teil Ihrer wertvollen Zeit. Das wissen wir sehr zu schätzen.
Die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase ist eine der anspruchsvollsten und zugleich erfüllendsten Aufgaben in Medizin und Pflege. Doch wie gelingt es, in dieser intensiven Zeit Sicherheit zu vermitteln, Symptome wirksam zu lindern und eine würdevolle Betreuung zu gewährleisten? Dieses Buch stellt sich den zentralen Herausforderungen der palliativen Praxis: von der komplexen Symptomkontrolle über die empathische Kommunikation bis hin zur ethischen Entscheidungsfindung. Es liefert Ihnen fundiertes Wissen und praxisnahe Handlungsanleitungen, um Ihre Kompetenzen in der Palliativversorgung gezielt zu stärken und Sie auf Ihrem beruflichen Weg zu unterstützen. Sie gewinnen an Sicherheit in der täglichen Arbeit und in der Prüfungsvorbereitung. Der „Kompass der Palliativmedizin“ ist Ihr zuverlässiger Wegweiser für eine professionelle und menschliche Begleitung am Lebensende. Sichern Sie sich jetzt das Rüstzeug für Ihre anspruchsvolle Tätigkeit in der Palliativmedizin und -pflege.
Dieser Ratgeber bietet Ihnen verständlich aufbereitete und praxisnahe Informationen zu einem komplexen Thema. Dank selbst entwickelter digitaler Tools, die auch neuronale Netze nutzen, konnten wir umfangreiche Recherchen durchführen. Die Inhalte wurden optimal strukturiert und bis zur finalen Fassung ausgestaltet, um Ihnen einen fundierten und leicht zugänglichen Überblick zu ermöglichen. Das Ergebnis: Sie erhalten einen umfassenden Einblick und profitieren von klaren Erklärungen und anschaulichen Beispielen. Auch die visuelle Gestaltung wurde durch diese fortschrittliche Methode optimiert, damit Sie die Informationen schnell erfassen und nutzen können.
Wir bemühen uns um höchste Genauigkeit, sind aber für jeden Hinweis auf mögliche Fehler dankbar. Besuchen Sie unsere Website, um die aktuellsten Korrekturen und Ergänzungen zu diesem Buch zu finden. Diese werden auch in zukünftigen Auflagen berücksichtigt.
Wir hoffen, Sie haben viel Freude beim Lesen und entdecken Neues! Sollten Sie Anregungen, Kritik oder Fragen haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. Nur durch den aktiven Austausch mit Ihnen, den Lesern, können zukünftige Auflagen und Werke noch besser werden. Bleiben Sie neugierig!
Eos A.I. Saage Saage Media GmbH - Team www.SaageBooks.com/de/contact/[email protected]ße 7, 04179 Leipzig, GermanySchnell zum Wissen
Für ein optimales Leseerlebnis möchten wir Sie mit den wichtigsten Merkmalen dieses Buches vertraut machen:Modularer Aufbau: Jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen und kann unabhängig von den anderen gelesen werden.Fundierte Recherche: Alle Kapitel basieren auf gründlicher Recherche und sind mit wissenschaftlichen Quellenangaben belegt. Die in den Diagrammen dargestellten Daten dienen der besseren Visualisierung und beruhen auf Annahmen, nicht auf den in den Quellen angegebenen Daten. Eine umfassende Liste der Quellen und Bildnachweise befindet sich im Anhang.Verständliche Terminologie: Unterstrichene Fachbegriffe werden im Glossar erläutert.Kapitelzusammenfassungen: Am Ende jedes Kapitels finden Sie prägnante Zusammenfassungen, die Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Punkte geben.Konkrete Handlungsempfehlungen: Jedes Subkapitel schließt mit einer Liste konkreter Ratschläge ab, die Ihnen helfen sollen, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.1. Grundpfeiler der palliativmedizinischen Behandlung
Wie gelingt es, Schmerz und Unwohlsein zu mindern, die Körperfunktionen zu unterstützen und dabei die individuellen Bedürfnisse am Lebensende zu respektieren? Diese komplexe Herausforderung erfordert ein tiefgreifendes Verständnis spezifischer therapeutischer Strategien. Von der gezielten Linderung physischer Beschwerden über den sensiblen Umgang mit der Energieversorgung bis hin zur präzisen Anpassung medikamentöser Ansätze bilden bestimmte Maßnahmen das unverzichtbare Fundament jeder wirkungsvollen palliativmedizinischen Behandlung. Doch welche konkreten Säulen tragen diese umfassende Fürsorge tatsächlich?
Gegründet von Dame Cicely Saunders im Jahr 1967, gilt dies weithin als das erste moderne Hospiz. Es leistete Pionierarbeit beim ganzheitlichen Ansatz der Sterbebegleitung, indem es Schmerzmanagement mit emotionaler, spiritueller und sozialer Unterstützung kombinierte und damit den Grundstein für die globale Palliativversorgungsbewegung legte.
Inspiriert von St. Christopher's, gründete Florence Wald, damals Dekanin der Yale School of Nursing, 1974 das erste Hospiz in den Vereinigten Staaten. Diese Institution war entscheidend für die Einführung und Anpassung der Hospizphilosophie an das amerikanische Gesundheitssystem.
1974 etablierte Dr. Balfour Mount hier einen wegweisenden Palliativversorgungsdienst. Er prägte den Begriff 'Palliativversorgung', um die damals negativen Konnotationen von 'Hospiz' zu vermeiden und das Konzept in die gängigen Krankenhausumgebungen zu integrieren.
Die WHO war maßgeblich an der Definition der Palliativversorgung und der Befürwortung ihrer globalen Umsetzung beteiligt. 1986 veröffentlichte sie ihre 'Krebs-Schmerzleiter', eine grundlegende Leitlinie für das Schmerzmanagement und hat die Palliativversorgung seither zu einem wesentlichen Bestandteil der öffentlichen Gesundheit erklärt.
Diese Region ist die Heimat des 'Kerala-Modells' der Palliativversorgung, einem bahnbrechenden gemeindebasierten Netzwerk, das in den 1990er Jahren gegründet wurde. Es zeigt ein erfolgreiches, kostengünstiges Modell zur Bereitstellung von Versorgung in ressourcenbeschränkten Umgebungen, das stark auf geschulte Freiwillige und lokale Netzwerke angewiesen ist.
1. 1 Symptomkontrolle und Schmerztherapie
Schmerzen und andere quälende Symptome beeinträchtigen die Lebensqualität schwerstkranker Menschen erheblich. Eine wirksame Symptomkontrolle ist daher zentral für die palliativmedizinische Behandlung. Sie stellt Ärzte und Patienten vor komplexe Herausforderungen: Schmerzen unterschiedlicher Art erfordern spezifische Therapieansätze und Begleitsymptome wie Atemnot, Fatigue oder Übelkeit benötigen maßgeschneiderte Lösungen. Dieses Kapitel beleuchtet bewährte medikamentöse und nicht-medikamentöse Strategien zur Linderung dieser Beschwerden. Es zeigt auf, wie eine präzise Diagnostik und individuelle Behandlungsziele den Grundstein für nachhaltige Erfolge legen. Erfahren Sie, wie eine umfassende Symptomkontrolle das Wohlbefinden entscheidend verbessert und ein würdevolles Leben bis zuletzt ermöglicht.
Wahre Symptomkontrolle in der Palliativmedizin ist die Kunst, durch individuelles Verstehen und ganzheitliche Betreuung dem Menschen nicht nur Schmerzfreiheit, sondern die bestmögliche Lebensqualität bis zuletzt zu ermöglichen.
Es finden sich leichter Menschen, die sich freiwillig dem Tode ausliefern, als solche, die Schmerzen geduldig ertragen.
”Julius Cäsar
De Bello GallicoIt is easier to find men who will volunteer to die than to find those who are willing to endure pain with patience.
Dieses Zitat veranschaulicht drastisch die immense Last des Schmerzes und legt nahe, dass für viele Leiden schlimmer sein kann als der Tod selbst. Es unterstreicht die tiefgreifende moralische und medizinische Notwendigkeit eines effektiven Schmerz- und Symptommanagements in der Palliativversorgung. Das Ziel ist nicht nur, Patienten zu helfen, Schmerzen geduldig zu ertragen, sondern sie so gründlich zu lindern, dass das Leben, wie lange es auch dauern mag, lebenswert bleibt. Es betont, warum die Linderung von Leiden ein Eckpfeiler mitfühlender Sterbebegleitung ist, die es Patienten ermöglicht, in Würde und nicht in stiller Qual zu leben.
1.1.1 Medikamentöse Schmerzbehandlung
Die medikamentöse Schmerzbehandlung bildet einen zentralen Pfeiler in der Palliativmedizin, um das Wohlbefinden von Patienten zu verbessern. Patienten in der Palliativversorgung leiden häufig unter belastenden Symptomen wie Schmerzen, die ihre Lebensqualität und die ihrer Familien erheblich beeinträchtigen. Eine sorgfältige Untersuchung und Anamneseerhebung sind der Ausgangspunkt, um die individuellen Ursachen der Beschwerden zu verstehen und eine gezielte medikamentöse Therapie zur effizienten Symptomkontrolle zu ermöglichen [s1][s2]. Die Identifizierung der Schmerzart ist entscheidend für eine wirksame medikamentöse Behandlung. Man unterscheidet zwischen nozizeptiven, neuropathischen und kombinierten Schmerzen [s3]. Nozizeptive Schmerzen entstehen durch die Reizung von Schmerzrezeptoren im Gewebe, während neuropathische Schmerzen auf Schädigungen des Nervensystems zurückzuführen sind. Die Schmerzintensität lässt sich durch einfache Skalen wie die Verbale Ratingskala oder die Numerische Ratingskala erfassen [s1]. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine Schmerzleiter entwickelt, die als therapeutischer Rahmen für die medikamentöse Schmerzbehandlung dient [s3]. Bei leichten Schmerzen kommen in der Regel nicht-opioide Analgetika zum Einsatz. Hierzu zählen z.B. Paracetamol oder nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), die bei muskuloskelettalen Schmerzen oder Schmerzen durch Knochenmetastasen wirksam sein können [s1]. Bei mäßigen Schmerzen werden schwache Opioide eingesetzt, während bei starken Schmerzen direkt starke Opioide zur Anwendung kommen [s1]. Opioide sollten nach Möglichkeit oral verabreicht werden [s3]. Die Dosis wird individuell auf die niedrigste wirksame und verträgliche Menge eingestellt [s3]. Für die regelmäßige Einnahme stehen sowohl schnell freisetzende als auch retardierte (langsam wirkende) Opioidpräparate zur Verfügung [s3]. Schnell freisetzende Präparate dienen als Bedarfsmedikation bei plötzlich auftretenden Schmerzspitzen, den sogenannten Durchbruchschmerzen[s3]. Bei vorhersehbaren Schmerzexazerbationen, z.B. bei Bewegungen, sollte die zusätzliche Medikation 30 bis 45 Minuten vor dem erwarteten schmerzhaften Reiz eingenommen werden [s1]. Als Bedarfsmedikation wird in der Regel ein Sechstel der regulären täglichen Opioid-Dosis als Lösung oder schnell freisetzende Tablette verschrieben [s1]. Ein Wechsel zwischen Opioidpräparaten, auch Opioidrotation genannt, ist eine gängige Praxis, wenn das ursprünglich gewählte Opioid unwirksam ist oder unerträgliche Nebenwirkungen verursacht [s3][s1]. Dabei sollte die Startdosis des neuen Medikaments reduziert werden [s1]. Häufige und vorhersehbare Nebenwirkungen von Opioiden sind Verstopfung, Übelkeit und Erbrechen [s3]. Um diesen vorzubeugen, wird die gleichzeitige Gabe von Laxantien (Abführmitteln) bei Opioidverschreibungen empfohlen [s3]. Auch Medikamente gegen Übelkeit sollten antizipativ verabreicht werden. Bei neuropathischen Schmerzen, die durch Tumorinfiltration, metastatische Rückenmarkskompression oder therapieassoziierte Nervenläsionen entstehen können, werden häufig Ko-Analgetika eingesetzt [s1]. Hierzu zählen Antidepressiva oder Antiepileptika [s1]. Der Wirkungseintritt dieser Medikamente kann einige Tage dauern [s1]. Bei mittelschweren bis starken neuropathischen Schmerzen müssen Opioide hinzugefügt werden, wobei eine Kombination mit Ko-Analgetika stets in Betracht gezogen werden sollte [s1]. Kortikosteroide können als Ko-Analgetika sehr hilfreich sein, z.B. bei erhöhtem Hirndruck, Nerven-, Plexus- oder Rückenmarkskompression, Leberkapselschmerzen und Lymphödemen [s1]. Spezialisierte Schmerzinterventionen sollten bei mäßigen bis starken Schmerzen in Betracht gezogen werden, die auf Standardmedikamente nicht ansprechen [s3]. Das präzise Timing der Medikamentengabe ist entscheidend, um inkonsistente Effekte zu vermeiden und Intervalle der Medikamentenverabreichung entsprechend dem Wirkungseintritt und der Wirkdauer der gewählten Medikamente einzuhalten [s1]. Der Verabreichungsweg sollte so einfach wie möglich sein; orale Medikamente sind parenteralen (z.B. intravenösen) Anwendungen vorzuziehen, wann immer dies möglich ist [s1]. Eine parenterale Anwendung von Analgetika ist zu erwägen, wenn Übelkeit, Mukositis (Entzündung der Schleimhäute), Dysphagie (Schluckstörungen), Malabsorption (verminderte Nährstoffaufnahme) oder eingeschränktes Bewusstsein die orale Anwendung verhindern [s1].Medikamente zur Linderung von Schmerzen, die in der Palliativmedizin je nach Stärke in Opioide und Nicht-Opioide unterteilt werden.
DurchbruchschmerzPlötzlich auftretende, intensive Schmerzepisoden, die trotz regelmäßiger Basismedikation auftreten und eine zusätzliche Bedarfsmedikation erfordern.
neuropathischer SchmerzBezieht sich auf Schmerzen, die durch eine Schädigung oder Erkrankung des Nervensystems entstehen und eine spezifische medikamentöse Behandlung erfordern.
OpioidrotationDas Wechseln von einem Opioid zu einem anderen, um Wirksamkeit zu verbessern oder Nebenwirkungen bei der Schmerztherapie zu reduzieren.
retardierte OpioideForm von Opioiden, die den Wirkstoff langsam über einen längeren Zeitraum freisetzen, um eine konstante Schmerzkontrolle zu gewährleisten.
Diese Grafik zeigt geschätzte relative Verordnungshäufigkeiten von Analgetikagruppen in der palliativmedizinischen Schmerztherapie. Starke Opioide sind am häufigsten, was die Prävalenz starker Schmerzen widerspiegelt. Nicht-Opioide (Paracetamol, NSAR) sind ebenfalls häufig, oft in Kombination mit Opioiden oder bei milderen Schmerzen. Adjuvantien, die auf spezifische Schmerzen abzielen (neuropathisch, knochenbedingt), sind entscheidend, werden aber breiter eingesetzt. Schwache Opioide treten seltener auf, was möglicherweise auf ihre intermediäre Rolle oder Umgehung hinweist. Bitte beachten Sie, dass diese Zahlen Schätzungen typischer Prämiermuster darstellen, um den multimodalen Ansatz zu veranschaulichen, der in der Palliativpflege unerlässlich ist.
1.1.2 Nicht-medikamentöse Schmerztherapie
Ergänzend zur medikamentösen Behandlung erweist sich die nicht-medikamentöse Schmerztherapie als wichtige Unterstützung bei der Schmerzlinderung und Symptomkontrolle in der Palliativmedizin. Schmerz ist ein vielschichtiges Phänomen, dessen Ausmaß und Empfinden von psychischen, sozialen und spirituellen Faktoren beeinflusst werden. Eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen und seiner individuellen Situation ist daher unerlässlich, um Schmerzen wirksam zu begegnen. Ein wichtiger Aspekt der nicht-medikamentösen Therapie ist die genaue Schmerzbeurteilung. Hierbei geht es nicht nur um die Intensität, sondern auch um die Qualität, Ausstrahlung, den Zeitpunkt des Auftretens und die Auswirkungen des Schmerzes auf den Alltag. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, können Sie beispielsweise ein Schmerztagebuch führen. Notieren Sie darin, welche Aktivitäten den Schmerz lindern oder verstärken, wie sich der Schmerz anfühlt (z.B. brennend, stechend, dumpf) und wie er sich auf Ihre Stimmung oder Ihren Schlaf auswirkt. Diese detaillierten Informationen helfen dem Behandlungsteam, die Schmerzursachen besser zu verstehen und gezielte nicht-medikamentöse Maßnahmen zu empfehlen [s4]. Bei Patienten, die sich nicht verbal äußern können, beispielsweise aufgrund einer fortgeschrittenen Erkrankung oder eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit, gibt es spezielle Beobachtungsskalen, die es ermöglichen, Anzeichen von Schmerz anhand von Verhaltensweisen wie Mimik, Körperhaltung oder Lautäußerungen zu erkennen [s4]. Die Festlegung individueller Schmerzgrenzen und Behandlungsziele ist ein weiterer Pfeiler der nicht-medikamentösen Therapie. Besprechen Sie mit Ihrem Behandlungsteam, welcher Grad der Schmerzlinderung für Sie akzeptabel ist und welche Ziele Sie erreichen möchten, etwa die Fähigkeit, bestimmte Alltagsaktivitäten wieder auszuführen oder erholsamer zu schlafen. Dies ermöglicht eine auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Therapie. Nicht-medikamentöse Ansätze umfassen eine Bandbreite an Techniken, die darauf abzielen, Schmerzen über andere Wege als Medikamente zu beeinflussen. Dazu zählen beispielsweise physikalische Maßnahmen wie Wärme- oder Kälteanwendungen. Ein warmes Bad oder eine Wärmflasche können bei muskulären Verspannungen Linderung verschaffen, während Kältepackungen bei Entzündungen oder Schwellungen wohltuend wirken können. Auch leichte Bewegung und physiotherapeutische Übungen, angepasst an die körperliche Verfassung, können die Beweglichkeit fördern und Schmerzen mindern. Sprechen Sie mit Ihrem Physiotherapeuten über Übungen, die Sie zu Hause durchführen können, um Ihre Gelenke zu mobilisieren oder Muskeln zu stärken. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Entspannung. Methoden wie die progressive Muskelentspannung, Atemübungen oder Aromatherapie können helfen, körperliche und seelische Anspannung abzubauen, was oft eine positive Auswirkung auf die Schmerzwahrnehmung hat. Versuchen Sie, täglich bewusst einige Minuten für eine Entspannungsübung einzuplanen, indem Sie sich an einen ruhigen Ort begeben und sich auf Ihren Atem konzentrieren. Auch die Ablenkung durch angenehme Aktivitäten kann die Schmerzintensität reduzieren. Hören Sie Ihre Lieblingsmusik, lesen Sie ein Buch oder widmen Sie sich einem Hobby, das Sie früher gerne ausgeübt haben. Darüber hinaus können psychologische Unterstützungsangebote einen wertvollen Beitrag leisten. Gespräche mit Psychologen oder Seelsorgern, die Kunst- oder Musiktherapie können dabei helfen, mit den emotionalen Belastungen der Krankheit umzugehen und die Schmerzwahrnehmung positiv zu beeinflussen. Auch das soziale Umfeld spielt eine Rolle: Der Kontakt zu Freunden und Familie, das Gefühl der Verbundenheit und Unterstützung kann das Wohlbefinden steigern und zur Schmerzlinderung beitragen. Ermutigen Sie Ihre Angehörigen, aktiv am Austausch teilzuhaben und Ihnen in kleinen Schritten im Alltag beizustehen. Die Auswahl und Anwendung nicht-medikamentöser Therapien sollte stets in Absprache mit Ihrem Behandlungsteam erfolgen. Was für den einen hilfreich ist, kann für den anderen weniger wirksam sein. Eine individuelle Anpassung und das Ausprobieren verschiedener Methoden sind daher entscheidend, um die für Sie passenden Ansätze zu finden und Ihre Lebensqualität zu verbessern.Der Einsatz ätherischer Öle zur Förderung von Wohlbefinden und zur Reduktion von Anspannung, als ergänzende Maßnahme zur Symptomkontrolle.
MusiktherapieDie Verwendung von Musik und musikalischen Aktivitäten zur Unterstützung der emotionalen und physischen Verfassung von Patienten im Rahmen der palliativen Behandlung.
progressive MuskelentspannungEine Entspannungstechnik, bei der durch bewusstes An- und Entspannen von Muskelgruppen eine tiefere körperliche Ruhe erreicht wird, was zur Linderung von Symptomen beiträgt.
SchmerztagebuchEin Hilfsmittel zur Dokumentation von Schmerzcharakteristika, Auslösern und lindernden Faktoren, um die Behandlungsplanung im Kompass der Palliativmedizin zu unterstützen.
Diese Grafik zeigt Schätzungen, wie häufig nicht-pharmakologische Therapien zur Schmerzbewältigung in der Palliativpflege eingesetzt werden. Entspannungstechniken und sanfte Massagen scheinen häufig angewendet zu werden, wahrscheinlich aufgrund ihrer direkten Anwendbarkeit und positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Musik und Aromatherapie werden ebenfalls häufig eingesetzt. Diese Zahlen sind Schätzungen, die allgemeine Trends und potenzielle Ansätze zur Symptomkontrolle veranschaulichen sollen und keine präzisen statistischen Daten darstellen.
1.1.3 Behandlung von quälenden Begleitsymptomen
Neben der reinen Schmerzbehandlung ist die Linderung quälender Begleitsymptome ein zentraler Pfeiler in der Palliativmedizin, um das Wohlbefinden umfassend zu verbessern. Der Fokus liegt darauf, die gesamte Bandbreite an Beschwerden zu erkennen und gezielt anzugehen. Dazu gehört ein sorgfältiges Vorgehen bei der Dosisinitiierung von Medikamenten, wobei die Regel gilt, mit einer niedrigen Dosis zu beginnen, diese langsam zu steigern und dann so niedrig wie möglich zu halten, um die gewünschte Wirkung bei minimalen Nebenwirkungen zu erzielen [s5]. Viele Patienten erfahren neben Schmerzen auch andere belastende Zustände. Bei lokalisierten Schmerzen können topische Behandlungen, also äußerlich angewendete Cremes oder Salben, eine effektive Alternative oder Ergänzung sein. Diese haben den Vorteil, dass sie gezielt am Schmerzort wirken und nur eine begrenzte Aufnahme in den Blutkreislauf erfolgt, wodurch systemische Nebenwirkungen reduziert werden [s6]. Es ist ratsam, bei muskulären Verspannungen oder Gelenkschmerzen zunächst eine schmerzlindernde Salbe auszuprobieren, bevor auf orale Medikamente zurückgegriffen wird. Grundsätzlich sind niedrig dosierte Schmerzmittel oft eine sichere und empfehlenswerte erste Wahl, insbesondere bei neu auftretenden Beschwerden [s6]. Bei chronischen Schmerzen hingegen sind Opioide nicht immer die optimale Lösung und sollten nur mit Bedacht eingesetzt werden, wobei der Komfort des Patienten stets Vorrang hat [s6]. Atemnot stellt für viele Patienten eine große Belastung dar. Hierbei sollte zunächst auf nicht-medikamentöse Ansätze gesetzt werden. Ein Handventilator, der einen kühlen Luftstrom erzeugt, oder die zusätzliche Verabreichung von Sauerstoff können bereits eine deutliche Erleichterung bringen [s6]. Ergänzend dazu können Achtsamkeitsübungen helfen, die Wahrnehmung der Atemnot zu beeinflussen und die innere Ruhe zu fördern. Falls diese Maßnahmen nicht ausreichen, können pharmakologische Interventionen unter Berücksichtigung von Risiken, Patientenzielen und der Prognose erwogen werden [s6]. Muskelkrämpfe können extrem unangenehm sein und die Lebensqualität stark einschränken. Hier ist es wichtig, zunächst mögliche Elektrolytstörungen wie einen Mangel an Kalium oder Magnesium zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Auch die gezielte Gabe bestimmter Nährstoffe kann zur Linderung beitragen [s6]. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob eine Blutuntersuchung zur Abklärung sinnvoll ist und welche Nahrungsergänzungsmittel für Sie infrage kommen.Schlafstörungen sind weit verbreitet und können die Erholung erheblich beeinträchtigen. Es ist entscheidend, zunächst die zugrunde liegenden Ursachen zu identifizieren und zu behandeln, etwa Schmerzen, Angstzustände oder nächtliche Atemprobleme [s6]. Eine gute Schlafhygiene ist ebenfalls von großer Bedeutung: Dazu gehören regelmäßige Schlafzeiten, ein ruhiges und dunkles Schlafzimmer sowie der Verzicht auf Koffein und schwere Mahlzeiten vor dem Schlafengehen. Auch verhaltensbasierte Therapien, die dabei helfen, ungünstige Schlafgewohnheiten abzulegen, können sehr wirksam sein [s6].Müdigkeit, auch als Fatigue bezeichnet, ist ein häufiges Symptom in der Palliativversorgung und sollte multidisziplinär angegangen werden. Dazu gehört die umfassende Bewertung und Behandlung aller beitragenden Faktoren, wie Anämie, Stoffwechselstörungen oder Depressionen [s6]. Gleichzeitig sollte die Förderung von körperlicher Aktivität, angepasst an die individuellen Möglichkeiten, nicht unterschätzt werden. Regelmäßige, leichte Bewegung wie kurze Spaziergänge oder sanfte Dehnübungen können die Energie steigern und das allgemeine Wohlbefinden verbessern.Bei Juckreiz können einfache Maßnahmen bereits Linderung verschaffen: Verwenden Sie feuchtigkeitsspendende Cremes, vermeiden Sie heißes Baden und aggressive Seifen, tragen Sie lockere Kleidung und sorgen Sie für kühle, befeuchtete Luft im Raum [s6]. Bestimmte Medikamente sind hier eine effektive Erstlinientherapie und bei Bedarf können alternative Wirkstoffe in angepasster Dosierung eingesetzt werden [s6].Depressionen und Angstzustände sind bei schwerkranken Patienten sehr häufig und beeinflussen die Symptomwahrnehmung stark. Eine routinemäßige Beurteilung dieser psychischen Belastungen und eine adäquate Behandlung sind unerlässlich [s6]. Das können psychotherapeutische Gespräche sein, aber auch medikamentöse Unterstützung. Manchmal können bestimmte psychoaktive Effekte von Therapien sogar therapeutisch wirken, indem sie die Wertschätzung von Musik, Geschmäckern, Düften oder anderen ästhetischen Freuden steigern. Dies kann angesichts einer terminalen Krankheit eine wichtige Bereicherung für die Patienten darstellen [s5]. Einige Therapien können zudem vorübergehende dissoziative Zustände hervorrufen, die eine Distanzierung von Schmerzerfahrungen ermöglichen, ohne diese direkt zu lindern. Dies kann eine wünschenswerte Option sein, wenn Patienten von unerträglichen körperlichen oder psychischen Symptomen überfordert sind und Opioide keine ausreichende Erleichterung bieten oder unerwünschte Nebenwirkungen verursachen [s5].Bei Übelkeit und Erbrechen ist eine umfassende Bewertung der Elektrolyte und des Säure-Basen-Haushalts entscheidend, da Störungen hierfür verantwortlich sein können [s6]. Auch potenzielle medikamentöse Ursachen müssen ausgeschlossen oder angepasst werden [s6]. Die Abstimmung der Behandlungsstrategie erfolgt immer in enger Zusammenarbeit mit dem Patienten und seinen Angehörigen, um die bestmögliche Lebensqualität zu erreichen.Bezeichnet Zustandsveränderungen, die zu einer temporären Entkopplung von schmerzhaften Empfindungen oder emotionalem Stress führen können, ohne die Schmerzen direkt zu beseitigen.
DosisinitiierungBeschreibt den schrittweisen Beginn der Verabreichung eines Medikaments zur Linderung von Beschwerden, wobei die Dosierung sorgfältig angepasst wird, um Wirksamkeit und Verträglichkeit zu optimieren.
ElektrolytstörungZustände, bei denen die Konzentration von lebenswichtigen Mineralien im Körper gestört ist, was zu verschiedenen körperlichen Beschwerden wie Muskelkrämpfen führen kann.
FatigueBeschreibt einen Zustand anhaltender, starker Müdigkeit und Antriebslosigkeit, der nicht durch Ruhe gelindert wird und die Alltagsbewältigung erschwert.
TopischBezieht sich auf die Anwendung von Mitteln direkt auf der Haut oder Schleimhaut zur Behandlung lokaler Beschwerden, um unerwünschte Körperweite Effekte zu minimieren.