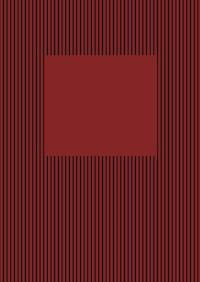
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Weihnachtsgeschichten & Weihnachtsmärchen - Traditionelle, moderne & lustige Geschichten zu Weihnachten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Im Sturm
Weihnachtszauber
Der Weg zurück
Wie Herr Schoißengeyer zu einem Christkindl kam
Assistent Frickenberg
Ein Egoist der Liebe
Frau Bettis Christgeschenk
Der Wohltäter
Am Wege
Das goldene Seil
Eine Insel der Seligen
Das Triptychon von den heiligen drei Königen
Warum feiern wir Weihnachten?
Im Sturm
Ihn fror in seinem dünnen Fähnchen, einem grauen fadenscheinigen Havelock, der im Novembersturme flatterte wie eine altgediente Kriegsflagge.
»Ist eine Kunst!« knurrte er und meinte damit den Sturm, den ungebärdig wilden. Um die dürren Blätter von den zitternden Zweigen zu reißen und die blassen Spätrosen zu erschrecken, die noch irgendwo draußen wehmütig träumen mochten, bedurfte es dieses unsinnigen Grimmes nicht. Und um das graue Wolkengesindel dort droben, das Schnee niederregnen ließ, vor sich herzujagen, brauchte er die Backen auch nicht gar so voll zu nehmen, der wüste Kraftgeselle, der!
Wildjauchzend fuhr der Verhöhnte um die Straßenecke und lehnte den blassen jungen Mann, der durchaus kein Schwächling war an die Wand. Und neben ihm klatschte ein schneefeuchtes Blatt an die triefende Mauer. So klebten sie, Mann und Blatt, im gewaltsamen Drucke des Sturmes einen Augenblick lang nebeneinander.
Da mußte er auflachen, ganz grimmig. Dann drohte er mit der Faust gegen den grauen Himmel und drückte sich das Atemholen des Sturmes benützend, sachte um die gefährliche Ecke.
Fest, krampfhaft fest, hielt dabei die schier erstarrte Faust das Guldenstück, das er sich kurz vorher von einem Bundesbruder gepumpt hatte. Zu den Taschen seiner Hose [S. →]hatte er kein rechtes Vertrauen mehr und die Geldbörse lag zu Hause lange gut. Die grinste ihn jedesmal, wenn er sie hervorzog, gar zu höhnisch an: sie war leer wie das absolute Nichts.
Auch sein Winterrock hatte es besser als er: der »studierte« einstweilen auch und war hübsch warm aufgehoben – wo, ist leicht zu erraten. Viel weniger »schön« mochte er vielleicht nicht sein als der flatternde Sommermantel da – aber warm!
Wärme! Wärme mußte wenigstens seine Mutter haben. Darum hatte er ja den Gulden gepumpt von dem flotten Farbenbruder, dem guten wohlgemästeten Ritschmayer. Und der gab bereitwillig und gab lachend. Und das war schön von ihm. Er wollte kein Mitleid sehen, kein Mitleid fühlen der trotzige Lebenskünstler im Havelock. Das wußte der dicke gemütliche Ritschmayer; darum gab er lachend, trotzdem ihm der »stiere« Theobald Volkmar noch zehn Gulden schuldete, die er gebraucht hatte für die Taxe zum letzten Rigorosum.
Jetzt jagte ihn der Sturm in eine Seitengasse. Wütend kehrte er um, rang mit der in wilder Siegesfreude aufheulenden Windsbraut, schwamm geradezu in Sturm und Schnee und Regen und schnaufte tief auf, als er wieder in der Hauptstraße trottete.
Nur da nicht hinein! Nur da nicht durch! Dort drinnen in der Gasse stand das große Zinshaus seines steinreichen Onkels. Das glotzte ihn immer so höhnisch an mit seinen vielen Fenstern und seiner aufgeklebten protzigen Zementfassade – recht wie ein freches Emporkömmlingsgesicht.
Der, ja der hatte Wärme und Geld und alles was er wollte, der Bruder seines armen toten Vaters, und brauchte für niemand mehr zu sorgen. Aber er hatte sicherlich auch[S. 5] kein Mitleid, keines in den Zügen zur Schau getragenes und keines im Herzen.
Was zum Teufel war es denn, was die beiden Brüder trennte?! Haß? Nein: Stolz, Stolz war es, was den Vater trennte, und Trotz, was den Onkel fernhielt. Weil der Vater das arme zarte Mädchen genommen hatte anstatt die reiche derbknochige Schwägerin des Onkels. So fing's an. Dann kam des Vaters Stolz ins Glühen und Brennen. Er werde schon zeigen, werde schon beweisen, daß er ohne Mammon durchs Leben komme! Seines Lebens Sonne sei die Liebe, seines Lebens Wonne die Arbeit!
»Bettelstolz!« hatte der Onkel gehöhnt. Und darauf flog seines Zimmers Tür dröhnend zu – zugeworfen von dem erzürnten Vater, dem sie gewiesen worden war! Und es flog eine zweite Tür zu und eine dritte: die Herzen der Brüder waren verschlossen für einander und für immer.
So mächtig sind Stolz und Trotz. O Sturm, was bist du für ein jämmerlicher Kraftprotz gegen diese Giganten im Menschenherzen!
Aber des Vaters Sonne leuchtete und seine Wonne ging nie aus. Und ihr gesellten sich froher fröhlicher Sinn bei und sonnenheitere Freude, stille warme Lebensfreude, die über den Seelen von Vater und Mutter lagen wie ein Sonnenglanz. Und in seinem Herzen, in seinem Hause blühte und duftete die Wunderblume Zufriedenheit und waltete und webte still der Zauber unbewußter Poesie: das stille echte Glück war zu Hause bei Vater und Mutter und sein Sonnenglanz fiel auch auf ihn, den heranwachsenden Sohn. – Da mußte wohl eines Tages der Neid vorbeigegangen sein an dem Hause des Glückes und es dem Bruder Hein verraten haben. Und der kam und nahm den Vater mit und ließ Frau Sorge zurück. Und die rief bald, ach![S. 6] nur zu bald ihre unerbittliche Schwester herbei – die Not. Die wehrt den Leibern das tägliche Brot und bringt der Seelen duftende Blüten langsam zum Verdorren ...
Allmählich verblaßte nach des Vaters Tode aller Glanz. Die Hilfsquellen versiegten, das hinterlassene Geld ging aus. Gar viel war's ja nicht. Nur der Stolz blieb dem Sohne als Erbe. Und dieses Erbe konnten nicht Not und nicht Hunger schmälern. Es mehrte sich noch und verstärkte sich noch durch den Trotz. Diese beiden Tyrannen seines Herzens stellte er dem Onkel entgegen, der, durch des Bruders jähen Tod weich gestimmt, rasche Versöhnung suchte. Der Sohn aber wies ihn kalt ab: er, der dem Bruder die Tür gewiesen habe, er hätte müssen den Weg zum Bruderherzen im Leben finden und nicht nach dem Tode. Für dieses nachhinkende Mitgefühl danke er!
Da hatte der gereizte Onkel ein böses Wort gesagt: auch wenn er einst – und das werde kommen! – in Not und Elend vor ihm auf den Knien liegen werde, würde er ihn nicht erhören und ihm nicht helfen, dem Starrkopf, und wenn er zugrunde gehn sollte vor seinen Augen! Damit war's aus mit den zweien, rundweg aus.
So ging in leuchtenden Bildern und ging mit Schaudern und Grimm die Vergangenheit an dem jungen Manne vorüber, der mit dem Lebenssturme weit härter zu ringen hatte, als jetzt mit dem wütigen Herbststurme.
Seine Mienen waren düsterer geworden als droben der graue Himmel. So trat er in den kleinen Krämerladen in der Nähe seiner Wohnung, bestellte Holz und Kohle und nahm einen kleinen Imbiß mit – für die Mutter. Dabei knurrte ihm der Magen just vor dem grinsenden Krämer boshafterweise so laut, daß der Mann es hören konnte. Ueberstürzt eilte Theobald davon.[S. →]
Als er in die Stube trat, die noch manch liebes altes, erinnerunggeweihtes Möbelstück enthielt, lag auf seinem Angesichte ein Lächeln, das so heiter scheinen sollte wie eitel Frühlingssonnenschein und doch nur eines Lächelns herzberührendes Zerrbild war.
Die Mutter sah's und – lächelte ihn gleichfalls an. Aber es war nicht das wehmütige Lächeln, das wie sonst dem Sohne verriet, sie habe ihn durchschaut bis auf seines Herzens dunkelsten Grund: scheu lächelte sie heute und verlegen, schier schamhaft und doch so lieb, so unendlich lieb, daß der erregte Sohn sie in seine Arme schloß und aufstöhnte, aufschluchzte vor Freud und Weh.
Er riß sich rasch los und zog seinen Schatz hervor.
»Mutter – da! Für dich!«
»Und du?«
»Hab schon gegessen – im ... im Studentenheim ...«
Sie sah ihn forschend an und glaubte ihm nicht recht. Im Studentenheim hatte man ihn neulich wie einen Bettler behandelt. Dahin ging er also wohl nimmer. Und neu war ihr diese Selbstverleugnung an ihrem Sohne auch nicht, neu war ihr auch nicht, daß er lieber Hunger litt, als sie darben zu lassen. Er sei jünger – sie müsse sich zuerst sattessen. Für ihn tat's auch eine Krumme trockenen Brotes.
Sonst gab es immer gar seltsam lieben Zank nach solcher Opfertat des Sohnes – heute nahm sie das Päckchen wortlos hin, legte Wurst und Schinken fein säuberlich auf einen Teller und sagte dann mit fast schalkhaftem Lächeln – wie gut stand das ihrem zarten Gesichtchen! – sie wolle schon essen – o! – sehr gern; denn sie, sie habe ja wirklich ... Appetit. »Hunger«, sagte sie nie. Das Wort hatte einen gar zu bitteren Beigeschmack, seitdem sie es[S. →] seinem ganzen Grimme nach kannte. Ja ja, sie werde schon essen, aber der Sohn müsse auch essen – was viel besseres, viel feineres!
Damit ging sie an dem maßlos erstaunten Theo vorbei in die kleine saubere Küche hinaus, und kam lächelnd zurück, eingehüllt in eine duftige Wolke, die von der – ja wahrhaftig! von der Bratenschüssel aufstieg!
»Ja was ist denn das?«
»Rostbraten mit Essig gespritzt, mein lieber Theobald. Und geröstete Kartoffeln dazu. Dein Lieblingsabendmahl!«
»Ja, wer hat denn ...«
»Iß nur und frage nicht! Iß! Glaubst du, ich hab deinen Magen nicht knurren hören! O der! Der hat eine Aufrichtigkeit! Aber so komm doch!«
»Keinen Bissen nehm ich, bevor ich nicht weiß, woher das kommt!«
»Na, woher soll's denn kommen? Vom Fleischhauer!« scherzte die Mutter gutlaunig.
»Mutter, du weißt! Sag mir's! Oder ich geh fort! Ist's vom Onkel?«
Wie seine Augen funkelten und seine Brauen sich zusammenzogen! Die Mutter kannte das. Verlegen, so ganz wundersam verlegen stand sie eine Weile da, zog an ihrer blühweißen Schürze und hauchte endlich hervor:
»Nein, nicht vom Onkel.«
»Von wem denn? Hast du ...« Er blickte im Zimmer musternd herum. Sie wußte, was er meinte.
»Nein, auch nicht. Es ist von ... von Fräulein Erna.«
Wie von einem Peitschenhiebe getroffen, zuckte der junge Mann zusammen. Bis in die Schnurrbartenden zitterte er. Erna war seines Hausherrn feines und schönes[S. →] Töchterlein – und er liebte das schöne feine Kind in aller Glut und Heimlichkeit.
»Almosen!« knurrte er und sank auf den Stuhl, daß er krachte.
Die Mutter stand betroffen da.
»Ich will keine Almosen!« brauste er auf, sprang empor und wollte nach dem dampfenden Teller greifen. Er hätte ihn zu Boden geschmettert, wäre nicht die Mutter blitzschnell dazwischengetreten. Hart war er an sie herangekommen in seinem Ungestüm. Sie wankte, die zarte zierliche Frau, und mußte sich an den Tischrand klammern, um nicht zu stürzen.
Da warf sich der Sohn auf den Stuhl zurück, ließ das Haupt auf den Tisch sinken und schluchzte herzergreifend.
Nun wurde auch das Auge der Mutter feucht. Und sie ahnte nicht einmal, was alles ihres Sohnes Seele in diesem Augenblick durchstürmte.
Langsam war sie auf ihn zugeschritten, legte ihre schmale weiße Hand auf Theobalds zuckende Schulter und sagte mit der ganzen lieben Milde, die sie erfüllte:
»Schau Theo, du sollst nicht so sein. Nicht gar so stolz und so viel zornjäh.« Und als keine Antwort kam:
»Und das mit Fräulein Erna ist so einfach kommen und ist so schön von ihr, so lieb. Hör doch nur! Heut kommt sie auf einmal da herein zu mir in ihrer blonden Lieblichkeit – wie ein Engel. Dann beginnt sie zu plaudern und sagt mir, sie habe gestern in einer Familie von unserem Vater reden hören – so viel Gutes und so viel Schönes, daß sie sich fest vorgenommen habe ...«
»Uns Almosen anzubieten!« stöhnte Theobald auf.
»O nein!« erwiderte die Mutter sanft und lächelte. »Daß es uns nicht glänzend geht, ist ihr ja kein Geheimnis[S. →] geblieben. Denk doch, wie schwer wir immer den Zins zusammen bringen und nie zum Termin. Und daß wir nichts dafür können für unser Kümmernis, das hat sie wohl selbst geglaubt. Gestern aber, sagt sie, habe sie es bestimmt erfahren. Und da ist sie gekommen und hat gesagt, sie habe bereits heute bei einigen Familien angeklopft, damit du dort Stunden kriegst. Hast du doch jetzt nur eine ... Ach, mein Gott! Fadenscheinige Kleider versperren einem die Türen zu den Reichen! Und deinen Doktor willst du ja doch machen. Und denk dir, gleich zwei haben zugesagt! Und wenn ... Ja siehst du, da hat sie gezeigt, was für ein gutes Herz sie hat – wenn ich vorläufig, hat sie gemeint, Geld brauchen sollte – sie, sie schieße mir gern etwas vor. Und du – du könntest es ja dann zurückerstatten, wenn ...«
»Das hat sie gesagt?« Theobald hatte sich aufgerichtet und schaute die Mutter forschend an.
Sie hielt seine Blicke stilllächelnd aus und umschloß mit den ihren voll Innigkeit des Sohnes schönen dunkelblonden Lockenkopf und freute sich – wie schon so oft! – seines scharf geschnittenen edellinigen und kühnen Schnittes. So schön war er und so stolz, so mannesmutig – ach! so recht eine wahre Mutterfreude und Muttersorg. Aber das bleich werden sehen und darben sehen! Gott weiß es, was sie heimlich litt.
»Ja,« nickte sie dann, »das hat sie gesagt – und getan.«
Er war aufgesprungen und ging einige Male durchs Zimmer, hastig, unruhevoll, in voller Wucht. Und plötzlich packte er die Mutter, drückte sie an sein Herz und wirbelte sie darauf ursch nell im Zimmer herum. Es war ein Glückseligkeitssturm, der mit jäher unbezwinglicher Gewalt durch[S. →] sein Inneres gebraust kam – ein Hoffnungssturm sondergleichen.
Aber diesem Glutsturme folgte rasch die lähmende Ernüchterung und dieser ein herb-süßes Bangen.
Still ließ er sich von der Mutter zum Abendessen führen, das fast erkaltet war. Als er so dasaß und mit sichtlichem Hunger – jetzt schmeckte es ja nicht mehr so bitter, dieses harte Wort! – und doch ganz in Gedanken versunken aß, schaute ihn die Mutter lächelnd an. Und aus ihren Augen leuchtete ein solches Uebermaß von Liebe und Zärtlichkeit, daß es ihn heiß durchlief, ohne daß er aufgeschaut und den Blick der Mutter in sich aufgenommen hätte. Er langte nur nach ihrer Hand und streichelte sie zärtlich.
Da glitt wieder ein schier schalkhaftes Lächeln über das kleine feine Gesicht der Mutter. Die hatte doch ihr Geheimnischen: sie hatte dem Fräulein Erna ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Sonst tat sie das nicht so leicht – sie war auch ein wenig stolz! – aber dem lieben Mädchen gegenüber konnte sie nicht anders. Das verschwieg sie dem Sohne. Wie würde der aufgefahren sein, wenn er anhören müßte, Erna habe sich erboten, dem halsstarrigen Onkel ins Haus zu fallen! Wie sie das anstellen werde, wisse sie vorläufig selbst noch nicht, hatte sie, schönen Eifers voll, ausgerufen, die Liebe, aber sie werde schon Mittel und Wege finden! O ja, sie werde sie schon finden! Sie möchte denn doch sehen, ob Milde und Nächstenliebe und bessere Einsicht nicht über Stolz und Trotz siegten! Dabei setzte es auch einen kleinen Seitenhieb auf Theobald ab und der Mutter scharfes Auge merkte gar wohl, wie eine Glutwelle über des Mädchens Wangen flog – merkte das trotz der eingetretenen Dämmerung. Mutteraugen sehen durch Nacht und Finsternis und sehen durch Berge und Wände.[S. →]
Iß du nur ruhig weiter, dachte sie still bei sich, und such nur emsig das letzte, letzte Restchen der seltenen Speise zusammen und tunke mit dem frischen duftigen Brote nur so lange, bis die Teller dastehn, sauber und blank, als kämen sie eben aus dem Schranke.
Als er dies stille Werk getan, lehnte er sich behaglich zurück und blickte sehnsüchtig nach seiner Pfeife, der langen. Leise, ganz leise seufzte er dabei auf. Er wußte ja, die Schachtel, die dort neben der Pfeife stand, war leer – blank leer wie sein Teller ... und seine Tasche. Wie sollte er auch Tabak kaufen, wenn die Mutter, die liebe, kaum zu essen hatte!
»Was der Mensch doch gleich genußsüchtig ist, wenn er den Magen voll hat!« dachte er bei sich.
Die Mutter aber hatte den Sehnsuchtsblick bemerkt. Lächelnd stand sie auf, holte Pfeife und Schachtel herbei und klappte diese vor dem erstaunten Sohne auf – plattvoll war sie mit duftendem Tabak, plattvoll!
Da gab es wieder einen Sturm, einen Freudensturm.
»Und wie hast du denn gleich die richtige Mischung gefunden, Mutting?« fragte er und dampfte gar behaglich darauf los.
»Ist's doch Vaters Mischung.«
Ein Hauch von Wehmut zog durch ihre Herzen, aber er trübte nicht: er vertiefte nur die stille Freude der beiden guten liebevollen Menschen.
Und jetzt fühlte Theobald erst so recht, daß es warm war in dem kleinen trauten Zimmerchen und sah, wie im Ofen schönfarbig die Glut verglimmte. Draußen heulte der Sturm sein Siegeslied weiter und peitschte den wasserschweren Schnee kraftfroh und hohnwild an die Fensterscheiben.[S. →]
»Heul du nur zu!« dachte Theobald, »deine Musik hat das Schauerliche für mich verloren – bis auf weiteres.«
Leise vor sich hinpfeifend, stand er auf, holte ein Buch herbei, setzte sich neben die Mutter hin und begann ihr vorzulesen, wie sie es liebte. Sie nahm eine Näharbeit zur Hand und hörte, ganz Freude und ganz Aufmerksamkeit, dem Sohne zu, der so schön und so eindrucksvoll vorlas. Das war ein Abend wie schon lange keiner.
Nächsten Tages löste er seinen Winterrock aus und spottete nun der Kälte, die dem Sturme gefolgt war.
Und Fräulein Erna hatte auch nicht in den Wind geredet: die Anträge auf Stundenerteilung kamen. Gutbezahlte Stunden. Und taktvolle Leute. Die Jungens ausgesuchte Dummlinge, aber seelengute Kerle.
Klopfenden Herzens hatte er ihr bei schicklicher Gelegenheit gedankt, der guten Fee in seiner Not, und war glückselig erschrocken über den holden Klang ihrer Stimme, die er zum erstenmal zu hören bekam. Und hatte scharf gespäht und siegeskühn gehofft, ihre Wangen würden jäh erglühen, süß verräterisch erglühen; aber sie blieben wie sie waren – um einen Schatten bleicher wurden sie eher. Da war er still und nachdenklich von ihr gegangen und blieb still und nachdenklich die ganzen Wochen hindurch, bis endlich die Zeit seligen Gebens herangekommen war – die Weihnachtszeit.
Einiges Geld hatte er sich ja abgezwackt. Klein nur konnte die Gabe für Mütterchen werden – aber er wußte: ihre Freude war groß auf alle Fälle.
Unter dem Geläute der Weihnachtsglocken ging er am heiligen Abend heim. Leicht war sein Gepäck, aber voll sein Herz. Frohgemut blickte er auf zu den Sternen. Ob wohl auch der Stern seiner Hoffnung aufgehn – und ob er[S. →] Verkünder sein werde der Sonne seines Glückes ... Gott weiß es! Gott füg es!
Unten sah er noch flüchtig auf seine Uhr, die er nach einigen Semestern eifrigen »Studierens« wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt hatte. Es stimmte: sieben Uhr. Früher durfte er nicht kommen, hatte die Mutter feierlich geboten – und wieder so eigen gelächelt. Dabei zeigte sie die Grübchen auf den Wangen, die es einst seinem Vater angetan hatten.
Als er in den kleinen Vorraum trat, schimmerte durch die Türspalten Lichterglanz. Er klopfte. Die Mutter öffnete und meldete wichtig und geheimnisvoll: das Christkind sei gekommen.
Staunend sah er den Baum stehn, der größer war und reicher, als er hoffen konnte. Weh und wohl wurde ihm dabei ums Herz – ist's Ernas Christkind? Kommt sie vielleicht heute selbst herauf und gibt das Herrlichste, das ihm auf Erden beschieden werden konnte?
Unbemerkt legte er seine Gaben neben die andern, die geheimnisvoll verdeckt waren, unter den Baum; beklommen sah er die Mutter an, die offenbar etwas sagen wollte, was ihr leicht vom Herzen, aber schwer über die Lippen ging. Die leuchtenden Augen kündeten es an, die zuckenden Finger redeten es schon.
»Was ist's?« fragte er unvermittelt und seine Stimme bebte.
»Fräulein Erna hat uns etwas gebracht,« sagte sie darauf stockend.
»Fräulein Erna?« Wieder war es Freud und Scham, Zorn und Jubel, was ihn durchstürmte und quälte.[S. →]
»Ja, Theobald, etwas, was du, was wir alle nicht erwarten konnten, nicht erhoffen durften: Liebe und Versöhnung ...«
Da trat aus dem verhängten Alkoven – der Onkel hervor, mehr verlegen als freudig bewegt.
»Du!! Du hier!?« Freundlich klang das nicht.
»Ja, Theobald, ich. Fräulein Erna ist zu mir gekommen wie ein guter Engel. Sie hat mich bekriegt und besiegt, gedemütigt und beschämt. Aber sie hat mich auch emporgehoben und mir Freude gegeben. Und so bin ich denn da und bitte dich, mir zu glauben, was ich sage. Wie es um euch steht, hab ich erst durch sie erfahren. Und hätt' ich's gewußt – wer weiß! Kurz, sie hat's zustande gebracht. Theobald, laß alles vergessen und laß uns wieder gut Freund sein. Gegenseitig wollen wir wieder alles gut machen aneinander. Und dann« – man sah's ihm an, wie es steinschwer und widerwillig aus seinem Innern heraufkroch – »und dann – ich bitte dich, verzeih mir, was ich deinem Vater und dir angetan hab!« Da war er doch weicher geworden, als er hätte zeigen wollen. Aber Erna hat ihn ja so gründlich zermürbt!
Rasch streckte er Theobald beide Hände hin. Und jäh und herzhaft, wie es seiner leidenschaftlichen Natur eigen war, griff der Neffe danach. Ein warmer kräftiger Druck, ein tiefes Versenken der Augenpaare – und alles war begraben und vergeben.
»Ich dank dir,« sagte der Onkel sodann ganz bewegt. Dann setzte er im Tone der Bewunderung hinzu: »So hat sie also doch recht gehabt, die Fräuln Erna! Sie hat gesagt, du wirst mir ohne viel Wesens zu machen die Hand reichen, denn du bist nicht nur stolz, hat sie gesagt, sondern auch gut.«[S. →]
»Das hat sie gesagt?« Rasch ging er zum Baume, zog die Hüllen weg und besah sich unter lebhaften überlauten Worten die Geschenke.
Die Mutter hatte den überstürzten Abbruch des gefürchteten Zwiegespräches wohl bemerkt, sagte aber weiter kein Wort. Sie lächelte nur still vor sich hin, umspielt und umschwirrt von heiteren sonnigen Zukunftsgedanken – einer schöner als der andere.
Theobald musterte die Geschenke und dachte: »Reiche Geschenke, schöne Geschenke, überaus kostbar, überaus praktisch – aber alle, alle vom Onkel, keines von ihr ...« Schnell sah er das Unmögliche einer solchen Handlungsweise des feinen taktvollen Mädchens ein und tröstete sich mit dem Gedanken: es käme doch schließlich alles von ihr und durch sie.
Das gab ihm die Seelenruhe wieder. In heiterem Gespräch und mit noch froheren Gedanken verbrachte er den Abend mit Mutter und Onkel, der ganz verwandelt schien und nicht einmal eins über den Durst trank, wiewohl er reichlich vorgesorgt hatte, daß es einen guten Tropfen gab. Diese Selbstüberwindung war bewunderungswürdig.
Mit dem Entschlusse, nächsten Morgen zur schicklichen Stunde hinabzugehn zu ihr und ihr zu danken, schlief Theobald ein. Er hätte nicht sagen können, wann die Gebilde seiner glückbeflügelten Phantasie abgelöst wurden von den Gebilden des Traumes und welche schöner und glückverheißender waren.
Als er sich nächsten Morgens mit dem dunklen Anzuge, den der Onkel unter den Baum gelegt hatte, fein herausputzte, umgaukelten sie ihn wieder, diese Lichtbilder des Glückes und er wußte nicht mehr, was er gesonnen im Wachen und was er gesponnen mit des Traumes Hilfe.[S. →]
Die Mutter war, ganz eingehüllt in neues weiches Pelzwerk, in die Kirche gegangen.
Eben wollte auch er nach dem Pelze langen, als draußen geläutet wurde. Gleich darauf hörte er die Wohnungstür öffnen und im Vorraume leise Schritte. Kam die Mutter schon zurück?
Da ging nach flüchtigem Klopfen die Tür auf und – Erna stand vor ihm. Sie schien ihm bleicher als sonst und einigermaßen verlegen. Gleich darauf aber sagte sie mit der ihr eigenen Sicherheit:
»Guten Morgen, Herr Volkmar.«
Er erwiderte verlegen ihren Gruß und kam sich in dem neuen Anzuge ungemein gespreizt vor. Stockend sprach er weiter:
»Die Mutter ist nicht daheim und ich – ich wollte eben ... wollte eben hinuntergehn zu Ihnen, Fräulein Erna, mich bedanken ...«
»Sie haben mir nichts zu danken, Herr Volkmar. Ich wollte, ich könnt ...« Sie schwieg. Eine brennende Glut war in ihr bleiches Angesicht gestiegen und rasch wieder versiegt. Starr und totenblaß war es nun geworden. Mit ganz veränderter Stimme brachte sie nun mühsam hervor:
»Herr Volkmar, was ich Ihnen jetzt sagen muß, das durften Sie durch niemand anderen hören als durch mich. Und Sie mußten es zuerst wissen. Vielleicht sollte ich nicht so handeln, aber ich glaube, es muß so sein. Darum bin ich gekommen.«
Er sah sie an und durch seinen Körper ging ein jähes seltsames Frösteln. Sie hatte den Blick gesenkt und sprach das bedeutsame Wort tonlos aus:
»Ich habe mich gestern abend – verlobt, Herr Volkmar.«[S. →]
Wie er sich auch zusammennahm: es zuckte durch seinen Körper, als hätte ihn ein Schlag ins Gesicht getroffen. Und ganz äußerlich fielen die Worte von seinen Lippen:
»Ich gratuliere, Fräulein Erna.«
Sie sah ihn an, traurig-ernst und tief bewegt.
»Es soll kein Zwang sein zwischen uns, Herr Volkmar, und keine Verstellung. Wenn ich Ihnen weh getan habe ...«
Da richtete er sich trotzig auf. Und hart und herb stieß er die Worte hervor:
»Und deshalb haben Sie das alles getan? Aus Mitleid! Aus purem Mitleid!«
»Nein, Herr Volkmar!« entgegnete sie ernst und fest und ihre Stimme bebte in verhaltener Erregung. »Nicht aus Mitleid! Ich hab's getan, weil ich Sie hochschätze, weil ich Ihnen gut bin, Herr Volkmar. Ich habs getan, weil ich Ihre Mutter lieb habe, so lieb haben kann, wie ich die meine lieb hatte, und ich habs getan, weil ich nicht mitanschauen kann, wenn gute edle Menschen leiden. Es fiel mir schwer, den ersten Schritt zu tun – weil ich sah, daß Sie mir gut sind. Aber ich ließ mich nicht abschrecken. Das einmal erkannte Gute führ' ich aus, je früher, desto besser. Das ist das schönste Vermächtnis meiner frühverstorbenen Mutter. Verzeihen Sie also, wenn ich Ihren Stolz ...«
»Um Gottes willen, nicht weiter, Fräulein Erna! Ich, ich bitte Sie um Verzeihung! Ich bin ja rauh geworden! Ich bitte Sie um Verzeihung!« Aus seiner Stimme konnte sie seine gemarterte Seele herausklingen hören.
Unfähig, ein Wort hervorzubringen, reichte sie ihm wie bittend beide Hände hin. Um ihre Lippen zuckte es.
Da kam es über ihn, er wußte nicht wie. Leidenschaftlich erfaßte er die dargebotenen Hände, schlang seine Arme um das holdselige Kind, preßte es an seine Brust und[S. →] küßte es, küßte es mit der ganzen Gier eines nach Glück und Liebe dürstenden Herzens.
Bleich und gelähmt von unsagbarem Schreck, lehnte sie eine Weile an seiner Brust. Dann geschah etwas Unerwartetes: sie schlang plötzlich ihre Arme um seinen Nacken und küßte ihn nicht minder heiß als er sie geküßt hatte. Und unter stürzenden Tränen gestand sie ihm:
»Ich liebe dich. Ich liebe dich unaussprechlich!«
Da faßte er sie an der Schulter, schob sie von sich weg, und sah ihr ins erglühte Angesicht wie ein Wahnsinniger.
»Du liebst mich ... Und doch hast du dich mit einem anderen verlobt!«
»Es war der letzte Wunsch meiner sterbenden Mutter. Sie glaubte fest, ich werde glücklich sein mit dem ernsten stillen Vetter Alfred. Drei Jahre schon verschiebe ich die offizielle Verlobung. Ich hab das getan, weil ich an seiner Seite immer so still wurde, wie er selbst ist. Dem Vater aber sagte ich immer, ich sei noch zu jung ...«
»Und jetzt, jetzt hast du's doch getan weil du mich ...«
»Weil ich gefürchtet hab, ich könne nicht mehr die Kraft aufbringen ... O, wüßtest du, was ich gelitten hab die ganze Zeit her!«
»Das darf nicht sein! Das darf nicht geschehen! Du darfst nicht das Opfer deiner Kindesliebe werden! Liebst du ihn denn, diesen stillen Herrn Vetter?«
»Ich bin ihm gut, ja. Aber was Liebe ist, weiß ich erst durch dich.«
»Dann seh er sich vor, dieser Herr Vetter Schweigsam! Mein bist du! Mein durch die Kraft und Heiligkeit unserer Liebe! Darum will ich dich erkämpfen wenn's sein muß mit dem Einsatz meines Lebens!«[S. →]
»Das wird nicht nötig sein!« sagte da plötzlich eine fremde Männerstimme.
Erstaunt und betroffen sahen sich beide um.
»Alfred!« Bleich und starr stand sie da.
»Mein Herr! Mein Name ist Theobald Volkmar.« Mustergültig förmliche Verbeugung, ein Blick, der alles sagte. Erwiederung weniger steif, aber »tadellos«:
»Alfred Bründherr. Es braucht kein weiteres, Herr Volkmar. Ich bin meiner Base unbemerkt nachgegangen. Zuerst aus Neckerei, dann aus Neugierde. Dann dacht' ich, du könntest ja auch die liebe Frau Volkmar kennen lernen – tret ein und höre Ihre Stimme, mein Herr.« Kleine Pause. Die Blicke aller am Boden.
Alfred Bründherr faßte sich zuerst: »Sie haben ganz recht, Herr Volkmar: Erna darf nicht das Opfer ihrer Kindesliebe werden. Und ich,« hier wurde seine feine Stimme schneidend, »ich will keine Frau, die mich nicht liebt.«
»Hätt' er längst sehen können,« dachte Theobald bei sich und verbiß ein Lächeln. Erna aber unterdrückte es nicht; mild lächelnd sah sie Alfred an und fragte: »Sag mir, Alfred, fällt's dir sehr schwer? Aufrichtig!«
»Schwer wird's mir schon; aber sicherlich nicht so schwer, wie es diesem Herrn da würde, mein' ich. Um es kurz zu machen: Ich gratuliere!«
»Und der Vater?« Die rasche Frage Ernas störte einigermaßen die gegenseitigen, grausam-eleganten Verneigungen der beiden Herren. Alfred lächelte verbindlich.
»Den werd ich schon vorbereiten,« meinte er überlegen. »So viel ich ihn kenne, wird er dem – wahren Glücke« – es zuckte bei diesen Worten seltsam um seine bärtigen Mundwinkel – »seines Lieblings nicht im Wege stehn.« Und bitter-ernst fügte er hinzu: »Es ist ja zum Glück das[S. →] Schwierigste nicht zu überwinden: unsere Verlobung ist noch nicht veröffentlicht.«
»Das Schwierigste nennt er das! Und Glück!« blitzte es durch Theobald und ein scharfes Wort drängte sich gegen seine Zungenspitze, ein Wort, von dem er wußte, daß er es mit der Degenspitze werde einlösen müssen. Aber wozu? Der Herr Vetter ist ja so entgegenkommend! Mit einem raschen Blicke unendlichen Wohlwollens umfaßte er die geschmeidige Gestalt des feinen glatten Mannes und sagte dann, in Miene und Ton und Gebärde voll unverschämter Höflichkeit:
»Danke verbindlichst!« Dabei zwirbelte er hastig den blonden Schnurrbart, so daß er fröhlich-frech und herausfordernd vorstach.
Der andere, der, wie der wunderschöne Durchzieher an seiner rechten Wange zeigte, just auch kein Kneifer war, mußte wohl geahnt haben, was im Geiste und Empfinden seines glücklichen Gegners während dieser peinlichen Sekunden vorgehn mochte; denn er verneigte sich forsch und klirrte hervor:
»Bitte sehr!« Dann ging er.
»Ein lieber Kerl!« rief Theobald mit einem Gemisch von Spott und aufrichtiger Bewunderung, als der Mann draußen war.
»Ja,« sagte Erna ernst darauf, »er war immer streng »korrekt«. Und leiser fügte sie hinzu. »Fast mehr, als gut ist.«
»Mehr, als gut ist!« wiederholte Theobald. »Um Gottes willen! Ein ganzes Leben an der Seite dieses Mannes, Erna, ein ganzes Leben!«













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















