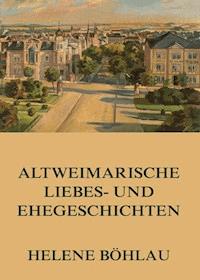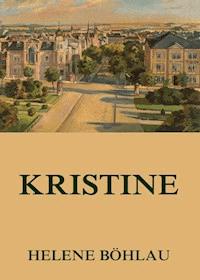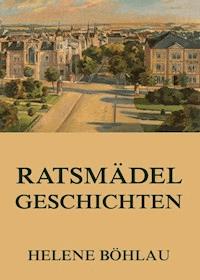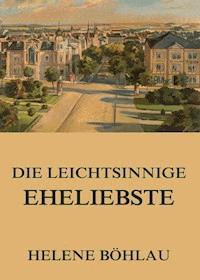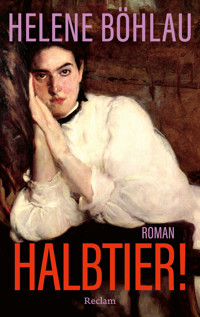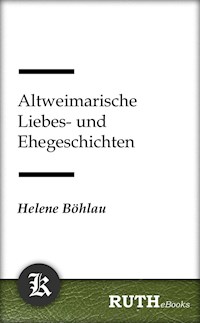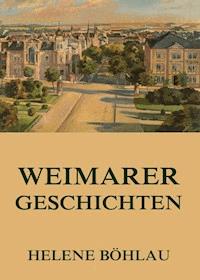
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet die folgenden Geschichten der in Weimar geborenen Schriftstellerin: Regine die Köchin Sommerseele Jugend Die Kristallkugel Der dichtverwachsene Garten Muttersehnsucht Der schöne Valentin Die alten Leutchen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weimarer Geschichten
Helene Böhlau
Inhalt:
Helene Böhlau – Biografie und Bibliografie
Regine die Köchin
Sommerseele
Jugend
Die Kristallkugel
Der dichtverwachsene Garten
Muttersehnsucht
Der schöne Valentin
Die alten Leutchen
Weimarer Geschichten, H. Böhlau
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849605667
www.jazzybee-verlag.de
Helene Böhlau – Biografie und Bibliografie
Nach ihrer Heirat mit Namen Al Raschid Bey. Deutsche Schriftstellerin, geboren am 22. November 1859 in Weimar, verstorben am 26. März 1940 in Augsburg. Tochter des bekannten Verlagsbuchhändlers Hermann Böhlau in Weimar. Obwohl wegen langer, dauernder Kränklichkeit dem Schulbesuch entzogen, erhielt sie eine äußerst sorgfältige Bildung und Erziehung. Die lebensvollen Erzählungen ihrer Großmutter aus der Goethe-Zeit, »der goldenen Tage von Weimar«, sowie die freundliche Teilnahme, welche Walther von Goethe und Friedrich Preller ihr widmeten, verklärten die Mädchenträume ihrer Kindheit und erfüllten ihre Seele mit Taten. Sie machte Reisen in Deutschland und Italien und vermochte erst durch ihre Erfolge die widerstrebenden Eltern mit ihrem frühzeitig hervortretenden Hang zur Schriftstellerei auszusöhnen. Sie genoss das große Glück, in ihrem späteren Gatten einen Freund und Lehrer zu finden, dem sie die Entwickelung ihrer künstlerischen Lebensauffassung dankt. Sie selbst nennt den tiefsten Charakterzug ihrer Seele, »Sonnensehnsucht«. Die Sonne leuchtete ihr Jahre an ihres Gatten Seite, am Marmarameer in Konstantinopel.
Wichtige Werke:
· Der schöne Valentin, Die alten Leutchen, Zwei Novellen, 1886
· Reines Herzens schuldig, Roman, 1888
· Herzenswahn, Roman, 1888
· Rathsmädelgeschichten, 1888
· In frischem Wasser, Roman, 2 Bde, 1891
· Der Rangierbahnhof, Roman, 1896
· Das Recht der Mutter, Roman, 1896
· Im alten Rödchen bei Weimar, Das ehrbußliche Weibchen, Zwei Novellen, 1897
· Die verspielten Leute, Des Zuckerbäckerlehrlings Johannisnacht, Zwei Novellen, 1897
· Verspielte Leute, Roman, 1898
· Schlimme Flitterwochen, Novellen, 1898
· Glory, Glory Hallelujah, Roman, 1898
· Das Brüller Lager, Roman, 1898
· Halbtier! Roman, 1899
· Philister über dir! Schauspiel, 1900
· Sommerseele, Muttersehnsucht, Zwei Novellen, 1904
· Die Ratsmädchen laufen einem Herzog in die Arme, 1905
· Das Haus zur Flamm, Roman, 1907
· Isebies, Roman, 1911
· Gudrun, 1913
· Der gewürzige Hund, Roman, 1916
· Ein dummer Streich, 1919
· Im Garten der Frau Maria Strom, Roman, 1922
· Die leichtsinnige Eheliebste,Roman, 1925
· Die kleine Goethemutter, Roman, 1928
· Kristine, Roman, 1929
· Böse Flitterwochen, Roman, 1929
· Eine zärtliche Seele, Roman, 1930
· Föhn, Roman, 1931
· Die drei Herrinnen, Roman, 1937
· Goldvogel, Erzählungen, 1939
Regine die Köchin
Die Mutter muß sich eine Alte nehmen, eine Alte muß sie sich nehmen, – nein – darauf besteh' ich! Die Frau Mutter ist zu leichtsinnig.« Das sagte unser Vater, ehe Regine ins Haus kam. »Aber Hermann,« antwortete unsere Großmutter und schaute mit ihrem weichen, vom Häubchen eingerahmten Altfrauengesicht ganz betroffen von ihrem Suppenteller auf. Sie aß bei uns, wie immer die Woche zweimal; wann dies geschehen sollte, mußte jedesmal feierlich die Frau Legationsrätin, vulgo Legatse, die eine Etage höher wohnte, eingeladen werden. Aber gerade jetzt zur Zeit war sie gezwungen, unten bei uns zu essen, denn sie hatte keine Köchin.
Von unserer Großmutter Köchin sprach man im Hause auf eine geheimnisvolle Weise, fast ohne Worte, und verstand doch viel zu sagen.
Wir Halbwüchsigen waren aber unterrichtet. Wir wußten, Großmutters Köchin hatte ein Kind bekommen. Weshalb man das nicht ganz einfach sagte, sondern schwieg, geheimnisvoll flüsterte? Es kam uns dies ganz lächerlich vor. Kinder hat ja die ganze Welt. Wir verständigten uns untereinander darüber und waren großmütig genug, den Erwachsenen in ihre Sonderbarkeit nicht hineinzureden.
»Also, Frau Mutter, ich bestehe entschieden darauf, du nimmst dir eine Alte. – Es ist dies das zweite, wenn nicht das dritte Mal, daß bei euch oben, ... nein... nein ... das geht nicht – bei deinem Leichtsinn, Frau Mutter – entschuldige.«
»Wie kommst du mir denn aber vor,« sagte unsere Großmutter und lachte, wie nur sie lachen konnte, o dieses Lachen! Wollte Gott, ich könnt's noch einmal hören. So lachen die Jungen heut nicht, so seelenjung. Es war das Lachen einer andern Zeit, das bei uns im Hause noch hin und wieder erklang, – einer harmlosen, heiteren Zeit. Ich halte es für ein Glück sondergleichen, daß wir in Begleitung dieses Lachens aufblühten.
»Ich sehe darin gar keinen Grund zum Lachen, Frau Mutter,« sagte mein Vater feierlich. »Ich dächte, die Sache ist ernst genug.«
»Du gibst auf deine Leute nicht acht, du läßt sie tun, was sie wollen – du kümmerst dich um nichts.«
»Ach so,« sagte unsere Großmutter. »Nun wird mir's verständlich.« Sie wischte sich die Augen. »Ich kann nicht gerad sagen, daß ich auf eine Alte sehr versessen bin; – aber dir zuliebe soll's eine Alte sein – gewiß eine Alte.«
So kam Regine, die Köchin, ins Haus.
»Sieh sie dir an,« sagte meine Großmutter am ersten Tag, als sie bei uns eingezogen war und gerade durch den Hof ging. Die Großmutter winkte meinem Vater, ans Fenster zu treten.
»Nu – weißt du – –,« sagte mein Vater, als er sie gesehen.
»Es ist eine Alte,« meinte meine Großmutter mit viel Schelmerei in der Stimme.
»Ja, ja,« meinte mein Vater etwas ärgerlich.
»Sie ist gewiß recht tugendhaft.«
»Zuverlässig,« antwortete mein Vater, – »aber – es gibt weniger häßliche.«
Herr Sohn, man kann nicht alles beieinander haben, weißt du.«
Nur zum Scherz hatte unsere Großmutter Reginen freilich nicht genommen. Die Großmutter war eine Frau voller Grazie und voller Behagen; sollte sie von einem schönen, sauberen Mädchen nicht bedient werden, wie sie es liebte, so wollte sie wenigstens vortrefflich essen, und es sollte alles gut serviert sein – und das verstand Regine, beides. Gewiß, häßlich war sie, eine kleine, dicke Person mit einem Schöpflein roter Haare, einem endlosen, dünnen, dünnen, dummen Zöpfchen, das wie ein rotes Schneckenhaus auf ihrem fast kahlen Schädel lag.
Die Knochen schienen ihr zu klein geworden, und so hing die beträchtliche Fleischmasse, wulstig und faltig, nicht recht wohlgeordnet, über derselben. So wandelte Regine durchs Leben und durch unser Haus, niemandem zur Augenweide, doch meinem Vater zur Beruhigung, daß über seinem Haupte, im Kreise der Frau Mutter keine leichtsinnigen Torheiten zu befürchten waren. Er bedachte nicht, daß der Mensch nie sündenbar ist. Unsere Jugendsünden, die Maienblüte wird dahingerafft, und Alterssünden erheben die Häupter oft nur als Ausdruck des Grams, weil sie dahingegangen, die sel'ge Maienpracht.
So mochte es Reginen ergehen; sie hatte geliebt und gelebt und wollte vergessen. Das alles aber ist vorgegriffen; es währte lange, bis wir Regine verstanden.
Als sie in unserm Hause etwas eingewohnt war und sich behaglich zu fühlen begann, kam unser Vater eines Morgens sichtbar verstimmt von seinem Spaziergang im Garten ins Frühstückszimmer, und es stellte sich heraus, daß er Reginen begegnet war, wie dieselbe die Treppe hinabging und ihr das rote, kleinfingerdicke Zöpfchen über die Stufen nachgehüpft war. Das ist so zu verstehen, das entsetzliche Zöpfchen war unglaublicherweise um ein paar Zoll länger als sie selbst, und sie liebte es, dasselbe am Morgen nachzuziehen. Vielleicht träumte sie sich in die Zeit zurück, als das rote Schnürlein vielleicht ein armdicker Zopf gewesen. Jedenfalls hatte sie geglaubt, einen ganz andern Eindruck mit ihrem roten, langen Naturspiel auf unseren Vater hervorzubringen, als ihr tatsächlich gelungen war. Sie war unheimlich stolz auf ihren Hauptschmuck. Ja, es war lang, das Zöpfchen, entsetzlich lang. Uns Kinder grauste davor. und unser Vater hatte sich wirklich ganz außerordentlich davor erschreckt.
»Es geschieht ihm ganz recht,« sagte die Großmutter, »weshalb hat er mir die Alte aufgehängt. Mir wäre es schon lieber, sie hätte ein Kind, als so einen miserabel garschtigen Zopf.«
»Weißt du, Frau Mutter, das verstehst du nicht. Du stammst aus einer ganz frivolen Zeit,« antwortete ihr mein Vater.
»I wo,« sagte die Großmutter und lächelte ihrer lieben Zeit zu.
»So, du hast Regine also begegnet? Ja, ja, das ist ihre Morgentoilette. Sie kehrt auch so bei mir, die Regine. Ja, du kannst ganz beruhigt sein, die ist höchst sittenstreng.«
»Ob sie es aber immer war, lassen wir dahingestellt sein,« sagte mein Vater ärgerlich.
»Verlange nichts Unmögliches von ihr, Regine lasse ich nicht wieder gehen.«
»Frau Mutter,« sagte mein Vater, »wann wirst du lernen, die goldene Mittelstraße zu gehen! Entweder umgibst du dich mit Personen, die vor Leichtsinn und Jugend nicht wissen, wo ein und aus, ober du nimmst dir Ungeheuer ins Haus, die keine Phantasie zu erdenken imstande ist. Ich hatte den Wunsch, daß eine vernünftige Matrone mit weißer Schürze und behäbigem Aeußeren da oben bei dir schalten und wallten sollte. – Wäre dir das nicht selbst ein angenehmer Gedanke?«
»Ja, gewiß, wenn die Matrone zu kochen verstände wie Regine; aber ich traute den Matronen nicht recht, die ich sah. Du wirst nächsten Sonntag schmecken, wenn ihr oben bei mir eßt, daß Regine goldeswert ist.«
Ja, und sie war goldeswert. Sie kochte, als wäre ihr Vater ein Dichter gewesen und das Talent hätte sich bei ihr umgesetzt. Und sie war auch Tochter eines Dichters. Es wird alles an den Tag kommen.
Wir hatten große Wäsche im Haus, und unsere Mutter bat die Großmutter, daß diese ihr Regine auf ein paar Stunden leihen möge, um zu helfen. Regine aber widerstand mit ruhiger Würde unserer Aufforderung.
»Nein,« sagte sie zur Großmutter, »das tut mir leid, das kann ich heut nicht, ein andres Mal wieder recht gerne. Heut wird ein Stück von meinem Vater selig aufgeführt, und Sie erlauben wohl, Frau Geheimrat, daß ich auch ins Theater gehe.« »Ja, um Himmels willen,« sagte meine Großmutter – »was ist denn das?«, griff nach dem Theaterzettel mit dem Abonnementsbillett, der wie immer auf seinem Platze lag; da sah die Großmutter, daß heute ein seit Jahrzehnten vergessenes, wieder neu ausgegrabenes Stück von Raupach gegeben wurde.
»Und Sie sind Raupachs Tochter!« rief die Großmutter – »du allmächtige Güte! Wie ist denn das alles miteinander möglich?«
Ja, es war alles miteinander möglich. Eine Kette der interessantesten Angelegenheiten verhüllten wie eine Wolke Regine, die Köchin, vor meinen erstaunten Augen. Sie war nicht nur Raupachs Tochter. – Nein – sie war jahrelang in Goethes Haus aufgewachsen, mit seinen Enkelkindern erzogen worden, dann war sie zum Ballett gekommen, und es war ihr schlecht ergangen, – schlecht ergangen. – Ein Tränenstrom verschlang die letzten Worte und Schicksale. – Ich sehe sie noch stehen, Raupachs Tochter, die rote Zöpfleinschlange zusammengerollt auf dem kahlen Schädel, die sonnte sich im Augenblick glühendrot im hellen Sonnenlicht. Unter Regines Kattunjacke wogten sehr unregelmäßige, gestaltlose Formen. Meine jungen Augen aber sahen das alles nicht mehr. Ein Glorienschein umwob die armselige Person. Ich hätte ihr wie einer Heiligen die Hände küssen mögen.
»Ach, setzen Sie sich. Regine, setzen Sie sich,« sagte ich zaghaft. Mir war es unmöglich, ihre geheiligte Person hier stehen zu sehen. Unsere Großmutter saß und machte große, große Augen, und die Brille war über den Augen, auf der Stirn zu sehen. Ich drückte Regine auf einen Stuhl nieder.
»O, Regine, Regine!« sagte ich. Ich hatte den Faust in diesen Tagen zum allerersten Male gelesen, hatte drunten im Stern, in Goethes Garten, unter hohen Bäumen, in Anbetung ganz versunken, auf dem Boden gekniet. Meine leidenschaftliche, kinderjunge Seele war dahingeschmolzen im ersten großen Eindruck.
Unsere Großmutter hatte ja auch Goethen gekannt; – aber dies – das fühlte ich, war etwas andres. Ich empfand das Intime des Zusammenlebens im selben Nest; ohne daß Regine nur den Mund auftat, wußte ich alles – alles, was geschehen war, oder hätte geschehen können. – Mit ihm hatte sie dieselbe Luft geatmet, er hatte sie gestreichelt – ihr etwas zu tun anbefohlen. Sie hatte ihn gesehen, wenn er zum Frühstück kam, gesehen beim Essen und Trinken und reden gehört! Reden gehört und auch lachen – vielleicht auch schelten.
Das Staunen verließ mich nicht, ich schaute und schaute auf Regines heilige Person und Schauer überliefen mich. Auch die Großmutter hab' ich mein Lebtag nicht so erstaunt gesehen.
»Na, so reden Sie doch, wie ist denn das alles möglich?«
Regine, die Köchin, dieser armselige Rest, war also von all der Herrlichkeit in Weimar noch übrig geblieben.
»Ach, Frau Geheimerätin, möglich ist gar vieles.«
»Ja, hat denn der Raupach nicht für Sie gesorgt?«
»Du lieber Gott, du lieber Gott,« sagte Regine, »was so'n Dichter is. – Nee, Frau Geheimerat, die machen sich nicht viel ›Schkrupel«; aber meine Mutter stand der sel'gen Frau Geheimerat Goethe recht nah, so hat sich das gemacht.«
»Regine, und da haben Sie wahrhaftig in Goethes Nähe gelebt?«
»No ja, ›nadierlich«,« sagte Regine.
»Das Kompott, was mer letzten Sonntag hatten, die Hagebutten mit Rosinen, waren Exzellenz Goethe sein Lieblingskompott. Das Kochen hab ich im Goethschen Hause von jung auf noch so mit gelernt. – Auch der Hammelbraten mußte allemal mit reichlich Thymian angesetzt werden, wie's letztemal, wo's den Herrschaften so schmeckte. Ja, auf eine gute Küche gab der Herr Geheimerat schon was.«
»Haben Sie denn gar nichts von Goethe?« fragte ich.
»O ja,« sagte Regine, ihre Wortkargheit war unerschütterlich.
»Was Sie haben, zeigen Sie mir?« bat ich.
Sie nickte.
Und so kam ich hinauf in ihre Bodenstube, die sie vor aller Augen sonst streng abschloß. Ich glaube, jetzt zwar nicht der Heiligtümer wegen, sondern um einen Zufluchtsort zu haben, in dem sie ungestört ins Vergessen sinken oder sich davon wieder erholen konnte.
Wir fanden sie nach Jahren dort wirklich einmal im tiefsten Vergessen liegend, schwer betrunken. Der Schlosser hatte die Türe erbrechen müssen. Darauf kam sie von uns fort als Oberköchin ins Krankenhaus nach Blankenhain, nicht ohne daß die Großmutter scharfe Anzüglichkeiten unseres Vaters wegen des unmoralischen Betragens ihrer Leute hinnehmen mußte, was sie in gewohnter Anmut über sich ergehen ließ.
Mit Schauer betrat ich Reginens Kammer. Sie führte mich noch an diesem selben Tag, ehe sie ins Theater zur Aufführung des Stückes ihres Vaters ging, hinein, wies stumm auf ein eingerahmtes Stückchen vergilbtes Papier, auf das eine graue Haarlocke geheftet war.
»Die hab' ich mir selbst aufgelesen, als der Geheimerat einmal geschoren wurde.«
»Ach,« fragte ich, »wie war das?«
»No, da kam der Friseur Eberwein, der ihm immer die Haare brannte, dann hat der Geheimerat geschellt, damit eins rauf sollte, und da kam ich, weil sie unten gerade alle was zu tun hatten. ›Daß die Haare nicht herumfahren,« sagte er, und da sammelte ich sie auf; – es waren nicht viele.«
Unter die Locke hatte Regine selbst frei nach Goethe geschrieben, vor langer Zeit, die Tinte war ganz gelb geworden:
»Wer nie sein Brot mit Tränen aß, Wer nie in kummervollen Nächten In seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.«
Arme Regine.
Darauf öffnete sie ihre Lade, die sie wohl ihr Lebtag in allerlei Elend begleitet hatte, und nahm ein Bündel heraus. Ohne ein Wort zu sagen, entfaltete sie ein vergilbtes Männerhemd mit wunderlichem Gefältel an der Brust.
Ein Hemd von Goethe!
Das zarte Linnen hatte seinen Körper berührt. Es war ihm so nahe gewesen, ein Stück seiner selbst. Gespensterhaftes Bangen berührte mich, wie Regine, die Tochter Raupachs, in ihrem Feiertagskleide, in der ärmlichen Dienstbotenkammer, das goethische Hemd ausbreitete, ohne ein Wort zu sagen.
Sie ließ mich ungestört in meiner Versunkenheit. Das schauerliche Vergehen alles Lebens, auch des Göttlichsten, erschütterte mich.
Endlich sagte sie: »Es war eins von den ganz alten. Sie taugten so nischt mehr.«
Dann breitete sie ein purpurrotes Kleid, mit dunkelblauen Borden aus. »Das hat meiner Mutter schon in ihrer Jugend gehört,« sagte Regine. »Das stammt noch von Frau von Goethe.«
»O, lassen Sie sehen. Regine,« bat ich. Ich berührte es. Es war aus weicher, indischer Seide. Sein tiefes Rot sah aus wie heiße, glückliche Liebe. Auf diesem zarten Stoff haben seine Augen in Liebe geruht. – Wie klein und zierlich muß Christiane gewesen sein, eine zierliche, volle Gestalt – und so geliebt! – geliebt von dem Herrlichsten! O, wie muß dein Herz unter dem roten, zarten Kleid geschlagen haben, du glückliche Christiane! Dein Grab finden sie nicht mehr. – Vergangen bist du lange, lange schon, verwest, in Staub zerfallen – und dein Kleid leuchtet noch in roter Glut, wie in den Tagen, als er dich darin küßte. Seine Hände haben auch diese kühle, feine, anschmiegende Seide gespürt.
Ich war ganz überwältigt und sagte: »Ach Regine, daß alles, alles vergeht!«
Regine sagte: »Ich meine, das wäre so übel nicht. Mich verlangt nach gar nischt mehr.«
Von diesem Tage an hockte ich, wo ich Reginens habhaft werden konnte, bei ihr, sah ihr zu beim Plätten, beim Kochen, beim Zimmerreinigen, und ihre Stummheit löste sich mehr und mehr. Uralter Dienstbotenklatsch aus jenem gesegneten Hause kam wieder ans Sonnenlicht; aber auch der intimen, köstlichen Dinge die Fülle, die jener Zeit entstammten und sie lebhafter als manche gründliche Abhandlung vor Augen treten ließen.
Wir hatten bei der Großmutter Sonntags goethische Apfelsuppe mit Korinthen und Semmelbrösel gegessen, goethischen Hasenbraten mit Salbei, das heilige Kompott aus Hagebutten und Rosinen. Ich, Halbwüchsige, aß diese Gerichte, als verzehrte ich das heilige Abendmahl, mit tiefer Hingabe; aber auch mit vorzüglichem Appetit. Denn wahrhaftig, Goethe hatte Poesie gegessen. – In Goethes Haus hatten sie es verstanden, zu kochen. Mein guter Vater war längst mit Regine ausgesöhnt. Dies Zusammenfließen des goethischen Haushaltes mit dem unsrigen hatte für uns Kinder etwas unbeschreiblich Geheimnisvolles. – Mir erschien es immer wieder wie ein Wunder und eine Offenbarung, wenn Regine ihre Speisen auftrug, und es war mir oft, als wären wir des großen Dichters Gäste. Er war mir in diesen Speisen gegenwärtig wie in seinen Werken, ja gegenwärtiger, in einer ahnungsvollen Körperlichkeit. Wie die ersten Christen das heilige Abendmahl in stiller, tiefer Ekstase zu sich nahmen, tranken und verzehrten, fühlte und schmeckte ich ihn. Er war da! – – Nie vergesse ich Reginens heilige Mahlzeiten bei der lieben, teuren Frau. – Und wer ihn auch liebt, den alten Sonnenmenschen, von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte; – in Trank und Speise habt ihr ihn alle nicht empfunden! In jener Zeit liebte ich ihn, wie eine heilige Seele Gott ihren Herrn lieben mag.
Nach solch einer wundervollen Mahlzeit schickte mich meine Großmutter einst hinaus in Regines Küche, damit ich nachschaute, wo der Kaffee bliebe. – – Wie ich in die Küche eintrat, glaubte ich in einen Traum geraten zu sein, denn was ich sah, war eine Unmöglichkeit. – Ich stand und starrte – ich blieb stumm und ganz verwirrt, ich fragte nicht nach dem Kaffee, wagte überhaupt nicht den Mund zu öffnen. Regine aber, in geheimnisvollem Gleichmut, nahm einen Teller aus der Spülwanne und trocknete ihn, darauf nahm sie einen kleinen Marmorgrabstein aus demselben Spülwasser und trocknete ihn. Es war ein kleiner Grabstein aus weißem Marmor mit Goldschrift, und zwischen den Tellern sah ich noch eine dunkle Grabtafel und ein schmales Grabkreuzlein hervorschauen. –
»O Regine,« sagte ich nach einer Weile, »was tun Sie da –?«
»Gar nischt,« sagte sie.
Ich wußte nicht, wie ich noch einmal fragen sollte. Sie kümmerte sich nicht um mich und trocknete ihren Grabstein, fuhr mit einem Holzstücklein und dem Trockentuch in den ausgehöhlten, vergoldeten Namen. Ich folgte ihren Fingern und las »Aennchen«, den Geburts- und Sterbetag. Es war der Grabstein eines kleinen Kindchens. –
»Wem gehört das?« fragte ich endlich wieder.
»Das war meins,« sagte Regine. Auf der dunkeln, kleinen Tafel stand ein ganz verblichener Männername – »Hofschauspieler« war am deutlichsten zu lesen, – und auf dem Kreuzlein war Reginens eigner Name eingegraben: »Regine Moll« – und das alles zwischen Tellern und Schüsseln im Spülwasser.
»Regine,« sagte ich wieder, »was soll das eigentlich? – – Und Sie möchten doch auch den Kaffee bringen.«
Sommerseele
Meine Großmutter hatte einen alten Küchenschrank. – »Unter der Linde, aus welcher der alte Schrank gezimmert wurde, hat eine goethische Liebste gesessen.« Das sagte die Großmutter, als wir Enkel oben in ihrer Küche zuschauten, wie die Ananaserdbeeren aus einem kupfernen Topf, in dem sie in lauter Zucker und Glut ihre duftenden Seelen aushauchten, in Gläser gefüllt werden sollten. Die kleine Küche duftete herzbewegend. Der würzige Geruch drang durchs offene Fenster hinaus in sonnedurchschienene Juniluft. Die Schwalben zogen in kristallener Bläue ihre zarten, schrillen Wonne- und Jagdrufe nach sich. Der Küchenschrank bekam ein Gesicht; ich sah ihn gewissermaßen zum erstenmal. Da stand er – aus weichem, wie sammetweich gescheuertem Holz, trug etliche Kupfergefäße, eine messingene Teemaschine – altes Hausgerät, das nur noch blank gerieben, aber kaum mehr gebraucht wurde.
Aus seinem Innern drang Brotgeruch; aber ein eigentümlicher Brotgeruch, ein Geruch nach Brotgenerationen, die bis hinab in die Jugendzeit meiner Urgroßmutter reichten. Unvergeßlich ist mir dieser Geruch. Er verband uns mit einer fernen, fernen Zeit, mit nie gesehenen, nahverwandten, vergessenen Menschen.
»Unter der Linde, aus der dieser Schrank gemacht wurde, hat eine goethische Liebste gesessen.« Der Schrank trieb Blätter und Blüten und ward zu einem Baum voller Geheimnisse. Damals waren die Ananaserdbeeren gerade in Gefahr gekommen, anzubrennen. Es entstand ein Durcheinander, kleine, eifrige Schreie der Großmutter: »Ei – ei – ei – ei – ei der Tausend!« Die alte Köchin brummte, die Ananaserdbeeren dufteten auf höchster Höhe des Duftes. Um den Topf wob sich eine Wolke weißen Dampfes, der Großmutter lief die Brille an. Sie schob sie auf die Stirn. – Sie rührten und schauten.
Die Beeren waren, gottlob, gerettet. Wir aber wurden hinausgeworfen. Regine, die Köchin, verstand keinen Spaß, denn sie war eine alte, sonderbare Person mit sonderbaren Schicksalen, die ihre erste Jugend im goethischen Hause verlebt hatte. Mit zwölf Jahren war sie Spielgefährtin und Wärterin von Goethes Enkelin Alma, worauf sie sich gar viel zugute tat, und von uns Kindern wurde sie deshalb wie ein heiliges Wunder angestaunt und verehrt.
»Großmutter,« sagte ich am Abend, als, ich mit der lieben Frau in ihrem blumengeschmückten Zimmer saß, »was für eine Geschichte mag das sein, von der goethischen Liebe unter dem Lindenbaum, aus dem dein Küchenschrank gemacht wurde?«
»So,« sagte meine Großmutter, »willst du das wissen? – Ja, das war etwas. – 's ist nie so recht ans Tageslicht gekommen. – Bei uns daheim, in meiner Jugend war auch gar mancherlei davon bekannt. Die Sache ist mit den Leuten, die davon wußten, begraben worden.
Mein alter Küchenschrank, der von der Urgroßmutter stammt, ist freilich aus dem Holze gemacht, von jenem Lindenbaum, unter dem der alten Bäckermeisterin Bauchen, von der wir die Semmeln bekommen, ihre Großtante mit den Schwestern gesessen hat.«
»Ja, das sagtest du schon einmal,« unterbrach ich sie.
»Das hab' ich oft gesagt,« wiederholte meine Großmutter, »und oft hat es mir meine Mutter gesagt. Zu deren Aussteuer kaufte dein Urgroßvater bei der Bauchschen Familie, die damals Metzgersleute waren, das Holz zu diesem Schranke, altes, ausgetrocknetes Lindenholz –,« und die Großmutter erzählte mancherlei, was sie wußte.
Wir gingen an einem schönen Sommertage, gegen Abend, die liebe Frau und ich, auf der leichten Anhöhe, von der aus man in das grüne Ilmtal blickt, oben am Horn spazieren.
Es war zur Zeit, als die Mohnblumen wie Blutstropfen in den Feldern standen; das Laub der Bäume war von einer ganz erstaunlichen Dichte und Mächtigkeit, denn noch hatte man unbewußt die kahlen Bäume im Sinn. Und die neue Gestalt hatte noch etwas Befremdliches an sich. Sie rauschten so weich und voll, wie sie im Juli, wenn die Blätter härter sind, nicht mehr rauschen. Man spürte im Rauschen dieser Blätter weiche Zartheit, und es löste sich noch ein junger, würziger Duft von ihnen.
Meine Großmutter und ich, wir trugen beide große Mohnblumensträuße. Um diese Zeit zogen wir gar zu gern miteinander aus. Und ich sah sie noch, wie eifrig sie in die Kornfelder einbrach mit einer jugendlichen Freude am Blumenraub. Ich war die Aengstlichere. »Das geht nicht, Gomelchen, das geht nicht, so tief darfst du nicht hinein!«
»Geh, laß mich, du siehst doch, wie geschickt ich's mach'.«
Ich: »Wenn dich wer sieht.«
Sie; »I gar – laß nur!«
Und wie sie ging, so leicht und ungebeugt von Zeit und Erfahrungen, ein lieber Trost für die, die auch einmal alt werden müssen. Alter, wo ist dein Stachel, Kummer, wo ist dein Sieg?! – Leid und Kummer waren ihr hoch über die Seele gegangen; aber wie ein buntschillerndes Entlein war ihre Seele immer wieder glatt und schimmernd aus der trüben Flut aufgetaucht und war im Sonnenlichte weitergeschwommen.
»Sieh einmal da,« sagte sie und wies auf ein knorriges Taxusgebüsch, das, in einem Zaun aus Korneliuskirschen eingeklemmt, ersticken wollte. Seine unterdrückten, aus der Erde schwer herausgerungenen Aeste waren mit wenigem saftigem Grün bedeckt.
»Siehst du, von demselben Busche hier haben meine Schwester und ich in unserer Kinderzeit im Winter gar oft frisches Grün geholt zum Geburtstag und auch für unsere Pyramide zu Weihnachten. Damals war der Taxus schon genau so uralt; aber er hatte doch viel mehr Grün. Es war auch noch mehr von ihm da, man sah damals noch, daß er zu einer Taxushecke gehört hatte.« Dabei brach sie mit leicht in dem Gelenk sitzender Hand einige Korneliuskirschenzweige, um ihrem alten, treuen Freunde Luft zu machen.
Ich hatte sie schon einmal so gesehen, wie sie die wild gewachsenen Rosenranken auf einem ihr sehr teueren Grab beiseite schob, weil sie den Efeu zu ersticken drohten. Mich hatte damals ein großes Weh überlaufen, wenn ich daran dachte, daß sie dem Schläfer dort unten das Haar gar oft zärtlich aus der Stirn gestrichen haben mochte, wie jetzt die Rosenranken von seinem Grabe. Und ihre Augen hatten freundlich ernst dabei geblickt, genau wie jetzt.
Sie ging auf Gräbern, wo sie auch ging, die liebe, alte Frau, und sie ging mit einer hohen seelischen Anmut, – die ich nie wieder gesehen habe, – bei meiner Mutter in schweren Tagen, da sah ich, wie dieselbe rührende, heilige Anmut wie ein Schleier ihren großen Schmerz verhüllte. Und ich dachte: So hinterläßt eine Generation der andern das Ornat der wehmütig schmerzlichen Menschenwürde. Unserer Großmutter Menschenwürde war ein leichtes, weiches Schleierchen.
Aber ich gehe andere Wege, als ich zu gehen beabsichtige. Ich wollte sagen, wie ich zur Kenntnis einer seltsam schönen Geschichte kam, die ich gar lange Jahre mit mir umhertrug, ehe ich sie niederschrieb.
Wir standen also vor dem alten Korneliuskirschenzaun, der den verknorrten Taxus zu ersticken drohte.
»Weißt du,« sagte meine Großmutter, »hier, an dieser Stelle, ist meiner Mutter Küchenschrank gewachsen.«
»Hier war das?« fragte ich betroffen, denn ich wußte nun schon so manches.
»Ja, hier, hinter dem Zaun, standen zwei große Linden vor einem Häuschen, und darin wohnten sie. Das Häuschen hat der Metzgermeister Bauch abtragen lassen, weil es jedenfalls baufällig war, und am Ende des Gartens wurde zu meiner Zeit das neue dort gebaut, mit dem Blick auf die Stadt.«
»Was du nur weißt, das sag' mir doch!« bat ich, »und daß niemand mehr diese Geschichten kennt?«
»Die sie kannten, sind vergessen,« sagte meine Großmutter wehmütig. »Die alte Bäckermeisterin, die muß noch allerlei von ihrer Mutter wissen, denn deren Mutter war ja eine von den Schwestern.«
Unsere Köchin Regine sagte einmal, daß es in Goethes Garten zu Goethes Lebzeiten gespukt hat. Sie bleibt dabei. »Was ich weiß, das weiß ich –« So ist ihre Redensart. – »Und es hat nicht etwa in der Nacht gespukt, sondern am hellichten Tag, mittags zwölf Uhr, und nur im Sommer in heißer Sonnenglut.«
»Das gibt es ja gar nicht. Regine.«
»So?« sagte sie, »das gibt's nicht? – Und wenn ich Ihnen sage, die Alma Goethe hat's selbst gesehen, als ich dabei war, und ist vor Schrecken ein paar Tage im Bett gelegen – und der alte Herr ist so oft zu ihr hinein. Ich Hab' damals immer bei ihr sitzen müssen und weiß, was sie geredet haben – die Alma war damals ein Kind – Gott, so'n drei bis vier Jahr. Ich mocht' so'n zehn, zwölfe gewesen sein, etwa; das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Die Alma, was die Enkelin vom alten Herrn war, und ich, wir saßen im Garten, und ich lehrte sie stricken. – Die Alma war ein ganz außerordentliches Kind, und schön, sag' ich Ihnen. Wenn ich an die Hundert werde, die Alma vergess' ich nicht. – Aus ihren Augen brach's wie Sonne heraus, so braune, große dunkle Augen in einem Gesicht wie eine zarte Rose, und die Haare goldblond, eine ganze Mähne, nicht zum Durchkämmen. Man konnte gar nicht von ihr fortsehen. Sie sprang und hüpfte. Nie sah man sie ruhig gehen. Die war so voller Leben, das ist gar nicht zu beschreiben. Und solche müssen so früh sterben! – – Der Tod von der Alma ist mir seinerzeit arg gewesen. – Du mein Gott, – du mein Gott! Ach, und wer alles so weiß. Na, wie wir so damals saßen – – – – es war in Mitte Sommer, die Rosen blühten am Hause hin, überall blühten auch die Zentifolien – und der Eisenhut und der Mohn und die Aglei. – Ja, was der goethische Garten damals gewesen ist, ist nicht zu sagen. – Der Paradiesgarten kann nicht schöner sein. Es war im letzten Jahr des alten Herrn. Geblüht hat's damals, ich sag' Ihnen – nie seitdem hat's wieder so geblüht. Es war, als wüßten's alle Sträucher im Garten, daß der alte Herr bald fort müßte, und wollten Abschied nehmen. – Wir saßen im Schatten; aber heiß war's, kein Wölkchen am Himmel, die Schwalben schrien, und ein Duft stieg auf von all den Rosen und Blumenzeug. Es mochte so gerade Mittag sein, und still war's ringsumher, als wenn alles eingeschlafen wär'.
Mit einem Mal – da sehe ich, daß die Alma ganz blaß ist, und sieht so eigen vor sich hin.
»Alma!« ruft ich – »Alma, was ist denn?« Sie antwortet nicht und regt sich nicht. Ich fass' vor Schreck ihre Hand; aber sie rührt sich nicht.
»Ich fürcht' mich,« sagt sie jetzt ganz leise, kaum hörbar wie im Traum. – »Es ist jemand im Garten, hier bei uns.« Aber sie rührt sich immer noch nicht. –
Da seh' ich den alten Herrn aus dem Hause treten, die Arme auf dem Rücken, im weißen Hausrock. Und wie er so einige zwanzig Schritt von uns noch entfernt ist – da erhebt sich die Alma, geht mit starren Augen, schneeweiß, ihm entgegen, bleibt stehen, faltet die Hände. – Und ich höre, wie sie sagt – aber es klingt wie ein schwerer, tiefer Seufzer – O! – o!– o! Der alte Herr ist auch stehen geblieben. Er faßt sich an die Brust und fährt so sacht an seinem Arm hin. Er sieht auch! ganz eigentümlich aus – – Und so stehen sie.
Nie im Leben ist mir so bange gewesen, – denn da war etwas, und da sehe ich, daß die Alma ganz matt hinsinkt, ganz auf die Seite, so sanft sah das aus. Ich kann mich vor Schreck nicht rühren und denke, sie ist tot; – aber der Herr ist schon bei ihr und hebt sie auf und hat das Kind in den Armen. Auch er ist ganz bleich.
Ohne ein Wort zu reden, trägt er sie durch den Garten, und durch die Zimmer, und durchs ganze Haus, und legt sie in ihrem Stübchen auf ihr Bett. – Sie hat die Augen weit auf. – Sie war aber bei sich. Er hielt ihre beiden Händchen in den seinen, und so bleibt er neben ihr sitzen; und keins regt sich. Ich stehe an der Türe, die ich hinter mir zugemacht habe, und wage kaum zu atmen.
»Ist dir bange, Alma?«
Sie schüttelt den Kopf.
Nach einer Weile sagt sie leise: »Sie war so schön«
»Wer, mein Kind?«
»Die bei dir war, die aus dem Schatten zu dir hinwehte,« so sagte die Alma. »Kennst du sie?«
»Kind? – was sprichst du?«
»Du weißt ja« sagte Alma ruhig. Dann fielen ihr die Augen zu, und sie schlief. Er saß noch lange nachdenklich neben ihrem Bettchen und hielt die kleinen Hände – dann erhob er sich und sah sehr ernst aus. Er erblickte mich und sagte: »Verlasse sie keinen Augenblick!»
Nach einer Stunde schon kam er wieder, nahm wieder an ihrem Bettchen Platz, da erwachte sie gerade und sagte:« Haare wie ein gold'nes Schleierchen und dunkle – dunkle Augen.»
»Du teures Kind!« das sagte er sehr bewegt und ganz erschüttert. »Ja, dunkle – dunkle Augen – das war die Sommerseele.« – Und gegruselt hat mich's wie um Mitternacht auf dem Friedhof. Unsere Dienstboten hatten immer vom Sommermittagspuk im Garten gesprochen. Die kleine Alma aber hatte ihn gesehen. – Sie war einige Tage sehr matt, und still, und der alte Herr behielt sie viel um sich. Gesprochen hat sie nie von dem, was sie gesehen. – Und dann hat sie es wohl wieder vergessen. Und nun sagen Sie nicht, das hat sich die kleine Alma eingebildet. So'n kleenes Kind. Wenn Sie die beiden gesehen hatten; die Alma und den alten Herrn. Nie sah ich etwas Feierlicheres, als den alten Herrn im weißen, langen Schlafrock, wie er das arme, schöne Kind durch den Garten und durchs Haus trug und dann an ihrem Bettchen saß, so tief in Gedanken, daß eins ehrfürchtig davor hätte niederknien können.« Regines Geschichten zogen mich hinter ihr her, so lief ich ihr auch immer nach, wenn sie zum Bäckermeister Bauch ging.
Regine hat mich mit zur alten Bäckermeisterin Bauch genommen, wie schon einigemal. Da haben die beiden Alten viel geplaudert, und ich habe zugehört.
»Mein Vater selig hatte noch die Möbel aus dem kleinen Haus am Horn,« sagte die alte Bäckermeisterin, »in das die Pfarrerswitwe mit ihren Töchtern nach dem Tode des Mannes gezogen war, dann hat er sie verkauft – schade drum! – Jetzt war' mancher froh, wenn er sie hätte. Sie waren ganz eigen, weiß und grün gemalt und schön, reich vergoldet und auf dem Schrank ein großes rotes Herz mit Strahlen als Krönung, und auf dem Betthimmel auch, und überall Herzen und Dornenkronen. – So alte Erbstücke sollte eins nicht weggeben. – Es tut mir selbst drum leid.
Eine uralte Zeichnung hatte meine Mutter auch von ihrer Mutter und den Schwestern; wo die hingekommen ist, weiß ich auch nicht mehr; aber wie oft haben wir sie als Kinder gesehen! Da saßen alle vier Schwestern unter einem Baume nebeneinander. Der Baum stand in der Mitte. Es war nicht schön gemacht; aber die Mutter sagte, ihre Mutter täte sie erkennen an einem Tuch. Unter jeder Figur stand etwas, und unter dem Bilde stand: »Das hat der Uerle gemacht.» Und der Uerle, das war der Mann von der Lieschen. Die Mutter sagte immer: Das war ein überspannter Kerl, trotzdem er unser Verwandter war. Ja – ja, so vergehen die Sachen und die Dinge!«
Durch gar eigentümliche Zufälle stehen heutzutage dieselben wunderlichen Möbel, von denen die alte Bäckermeisterin sprach, in meinem Schlafzimmer. Tiefgrüne Schnörkel bedecken wie dichtes Laubwerk einen elfenbeinweißen Grund. Dazwischen sind Dornenkronen und durchstochene und brennende Herzen, als Bekrönungen von Schrank und Bett ein großes, rotes, brennendes Herz in einer Gloriole von goldenen Strahlen. Reichvergoldete Schnitzereien lassen die märchenhaften Stücke gar prächtig erscheinen.
Ein wunderlicher Kauz muß der gewesen sein, der diese Stücke zimmerte und malte, und man gedenkt des Unbekannten mit Wohlgefallen, ob man eine Schranktür öffnet oder sich zur Ruhe legt, als einer starken, phantastischen Persönlichkeit. –
Unter den Linden, die so wohlvertraut in meine Seele rauschten, als hätte ich sie selbst gekannt und geliebt, stand ein kleines Haus in einem großen, langen Garten, auf dem lieblichen Höhenzug, das Horn genannt, dem zu Füßen die Ilm rauscht und das alte Städtchen Weimar liegt. Es war zu jener Zeit noch nicht geheiligt und erhoben vor allen Städten des Deutschen Reiches, sondern lag schlecht und recht, wie es so ein altes Landstädtlein tut, an seinem kleinen, muntern Fluß und träumte so hin. – Und seine Weimaraner wurden geboren und wurden gewickelt und wie Ameisenpuppen in die Wiegen gelegt, und wurden aufgezogen, und begannen sich zu verlieben, und taten irgend etwas mit großer Wichtigkeit, und zankten und klatschten, kauften und verkauften, und wurden dann wieder in ihre Särge eingesponnen und in die Erde gelegt.
Vom Horn aus sah man nichts als ein Häuflein grauer, buckliger Schieferdächer, die wie eine Herde mißfarbener Tiere mit Rückenpanzern enggepfercht zwischen Mauern und Türmen beieinander hockten. Es war ein uraltes Gedränge im kleinen Raum, und es sah aus, als könnten die Mauern ihre gepanzerte Herde nicht beieinander halten, als quölle sie ihnen heraus. Die wenigen Häuser, welche hie und da in Gärten auf dem Horn standen, gehörten wohl auch zu Weimar, aber waren der Enge entsprungen und badeten sich da oben von allen Seiten in Regen, Sturm und Sonnenlicht. Es waren aber alles recht armselige Hütten oder Sommerhäuser, die von Weimaranern zur Gartenzeit einige Wochen benutzt wurden. Das kleine Haus unter den Linden gehörte der Pfarrerswitwe von Süßenborn. Sie war nach dem Tode ihres Mannes mit ihren vier Töchtern und mit all ihrem Hausrat dahinein übergesiedelt.
Das Häuslein enthielt vier Stuben und eine Küche. Haus und Garten und der Witwe kleine Pension waren das Lebensbrot der fünf Weiblein. Der Garten brachte Früchte, Gemüse, Erdäpfel. Die Mädchen hatten die Schule in Süßenborn frei. Wenn eins von der Schule abfiel, gesellte es sich der Mutter zu, die eine große Geschicklichkeit hatte im Handschuhnähen und -zuschneiden. Und wer etwas recht Feines wollte, der scheute den Weg nicht und bestellte bei der Pfarrerswitwe seine Festhandschuhe. Sie arbeitete immer nur auf Bestellung und hielt sich nie einen Vorrat, denn sie scheute jede Unternehmung, die Sorge und Grübelei machen würde. Sie hatte ihre vier Mädchen gar wohl behütet und erzogen in der Stille und Abgeschiedenheit auf dem Horn.
Mit den Pfarrersleuten aus Süßenborn standen sie in regem Verkehr, auch mit dem Lehrer und seinen Kindern, und auch in Weimar hatte die brave Witwe einigen Anschluß. – Aber sie ließ die Mädchen nicht oft hinab und nur selten zu einem Tanz oder sonst einer Festlichkeit. Ihr Leben floß friedlich dahin und in einer gar lieblichen Schönheit, wie man es, je weiter die Geschichte fortschreitet, verspüren wird. – Die älteste Pfarrerstochter hatte sich ein junger Pfarramtskandidat, als er in der Nähe von Weimar angestellt wurde, zum Weibe geholt. Sie war aber gar bald als blutjunge Witwe mit einem Kindlein wieder bei ihrer Mutter im alten Haus unter den Linden eingekehrt, und so hatten sie nun, die zwei Witwen und die drei Jungfrauen, ein winziges Bübchen bei sich.
Im Rebengarten, der sich, wie jener der Witwe, sanft abfallend dem Tale zuneigte, war ein sonderbarer Mensch eingemietet, der seit Jahren schon an der Witwe und ihren Töchtern mit großer Treue hing – ein braver Handlungsgehilfe, Schreiber, Geschäftsführer der ersten Kolonialwarenhandlung unten in der Stadt, für die er durch Tüchtigkeit der Mann für alles geworden war. An dunklen, einsamen Winterabenden, wenn da oben am Horn kein menschliches Wesen mehr anzutreffen war, und wenn das Licht durch die Herzen der Fensterläden aus dem Wohnstübchen der fleißigen Frauenzimmer in die dunkelste, einsamste Oede hinausfiel, da war es ihnen gar heimisch, wohlbekannte Schritte auf das Häuschen zukommen zu hören. »Der Uerle,« sagten dann eine oder zwei oder alle zu gleicher Zeit– »der Uerle.« Die Oede draußen hatte gleichsam eine Seele bekommen, eine sehr freundliche, vertraute Seele. Sie lag nicht mehr gar so tot und unermeßlich in ihrer stillen Dunkelheit um das warme Nest. Bald folgte ein Klopfen am Fensterladen in immer gleichbleibendem Rhythmus. So klopft nur der Uerle, sollte das heißen, seid ganz ruhig, ihr macht nichts Unrechtem auf! – Nein, es war nichts Unrechtes, was da kam und von einer der Töchter mit der kleinen Oelfunzel – die andern saßen derweil im Dunkeln – hereingeleuchtet wurde. »Allerseits einen guten, geruhsamen Abend!« erklang dann eine etwas hölzerne, unbiegsame Stimme, und ein Duft nach allen erdenklichen nützlichen Dingen drang mit dem Eintretenden ins Zimmer. Der Duft des Kolonialwarengewölbes, der mit dem Uerle aufs Horn gewandert war: Kaffee und Sirup und getrockneter Stockfisch und Salzgurken und Zimmet, Mandeln, Zitronat und Kardamom, Zitronenschale, Lorbeerblatt. All diese Dinge hatten um den langen Menschen eine Atmosphäre gewoben, der er nicht mehr entfliehen konnte.
Die Mädchen sagten: »Er riecht wie ein Weihnachtspunsch.« Es roch für das ganze Häuslein nach Festlichkeit, nach heimischem Behagen, nach Geselligkeit.
Die Frauenzimmer waren uneingestandenermaßen dem Uerle dankbar, daß er überhaupt da war. Ohne Uerle wären die Winterabende am Horn gar zu weltverloren einsam gewesen, ohne den Uerle hätten die beiden Linden vor dem Häuschen bei Sturm und Regen gar zu schaurig wie zwei große Riesenbesen die Wolken gekehrt. – Und auch des Nachts war es ein guter Gedanke, daß im Nachbarhäuslein der Uerle lag und schlief, der Uerle, der sein Leben für sie alle dahingegeben hätte.
Trat er abends ein, wurde die Arbeit beiseite gelegt, und sie rüsteten sich zum Musizieren, oder die Mutter erzählte Märchen, gesegnete, uralte Märchen, oder der Uerle las vor, der Uerle, der tagsüber am Heringsfaß, an der Kaffeeröstmaschine, am Hauptbuch, im Keller seinen Mann stand, wurde abends ein wirklicher und wahrhaftiger Schöngeist.
Er mußte jeden Tag eine ganz gewaltige Umwandlung über sich ergehen lassen, so eingreifend wie die Umwandlung der Puppe zum Schmetterling. Und jeden Tag dieselbe Geschichte, das halte einer aus! Zu jener guten, alten Zeit, da war das möglich, da waren die Nerven der Menschen noch kinderjung, noch nicht gezerrt und gepeinigt wie die unsern, da konnte ein Mensch zwei ganz verschiedene Arten von Dasein führen und in jedem sich ausleben, wie ein Kind am Vormittag Pfarrer und am Nachmittag Räuber spielen kann, beides mit der vollen Kraft seiner Seele.
Nur der Duft des Kolonialwarengewölbes, der war nicht zu vertreiben, der hing sich auch dem Schöngeist an.
So saßen sie, und Uerle kam, mit Büchern gepolstert, die hagere Gestalt hatte allerlei Auswüchse, und jeder Auswuchs war literarisch bedeutungsvoll. Des alten Musäus Märchen hatte er unter seinem Rock dahergebracht, Wielands Werke, was nur irgend Neues und Altes für ihn erreichbar war.
Das war eine gar wunderliche Sache zwischen Uerle und den Pfarrerstöchtern. Wie mit Ketten hing sein Herz an ihnen. Er wohnte als ihr Wächter und Freund da oben auf dem weltverlassenen Horn, und sie waren ihm alle vier in die Seele hineingewachsen.
Im Winter war es ihm, als stände er Lieschen, der Aeltesten, am nächsten. Die liebte das stille Daheimsitzen, die langen, gemütlichen Abende. Die Bratäpfel legte stets sie ins Rohr. Das Feuer schürte sie. Die Lampe putzte sie. Sie war, so schien es ihm, im Winter besonders liebenswert. Anne, die blutjunge Witwe – als er dies sanfte Wesen mit ihrem Kindchen im Frühjahr auf der Bank unter den Linden einst sitzen sah, die ersten Stare pfiffen in den Wipfeln, da rührte ihn das sanft sich lösende Weh, das aus den jungen Augen sprach, und die Liebesfrühlingsregung der jungen Mutter zum Kinde und das Frühlingslallen des Kindleins und das zarte Knospen um sie her, und bewegten Herzens verband er sie wieder mit seiner Liebe zum Frühling.
Der Sommer zog herauf, die Felder dufteten, die Mohnblumen standen wie Blutstropfen im blühenden Korn, die Rosen, die Kirschen und alle Sommerblumen im Garten blühten. Die Linden vor dem Hause trugen ihre goldene Blütenlast und dufteten Sommersicherheit. Mächtige Bienenvölker sogen an den abertausend Blüten, und die vollaubigen, dunklen, goldüberstäubten Bäume dröhnten wie zwei Orgeln, so gewaltig war das Summen der Bienenvölker in ihren Kronen. Und abends klang aus den offenen Fenstern des Häuschens unter den dröhnenden Bäumen Musik und Gesang. Vier Mädchenstimmen sangen zu Spinett und Laute Sommersehnsuchtslieder. Die schwachen Mauern des kleinen Hauses konnten kaum der Töne Ueberschwall fassen. – Das war ein Duften und Dröhnen und Klingen zu Ehren des Sommers, und wer vorüberging, sah und hörte mit Staunen die dunklen Baumorgeln vor dem singenden Haus, das seine Klänge nicht zu fassen wußte.
Uerle liebte die dritte Schwester Alma wie ein geheimnisvolles Sommerlied, das so schön und tief war, wie es keines auf Erden gibt, das gesungen und gebetet wird.
Da war nicht eins, das er so aus vollem Herzen vor sich hin hätte singen können, wenn er an Alma dachte und an die Sommerherrlichkeit um sie her. Am ehesten noch das:
»Geh aus, mein Herz, und suche Freud' In dieser schönen Sommerszeit An deines Gottes Gaben.«
Das Lied des alten Paul Gerhard. Uerle war kein Dichter, er kannte die Todesnöte der Dichter nicht, ihre Kämpfe nicht und ihre Qualen nicht. Er pflückte nur ganz friedlich die Schönheiten, die aus diesen Qualen und Seligkeiten wuchsen, und wenn er Schöngeist wurde, wurde er Dichterfreund, so rückhaltlos und hingebend, wie die Dichter wahrlich wenig Freunde auf Erden gehabt haben.
Saß er abends unter den dröhnenden Bäumen und hörte auf den Gesang der Mädchen, so rannen ihm vor Seligkeit die Tränen über die Wangen.
Alma, das wundervolle, blonde Mädchen mit den dunklen, geheimnisvollen Sommeraugen, der sehnsuchtsvollen Stimme, hatte in den Sommerwochen einen Anbeter, wie ihn sich ein Götterbild nur hätte wünschen können, und er duftete sogar wie Weihrauch, nach Lorbeer, Kaffeepulver, Zitronenschale und Kardamom. Er trieb tatsächlich einen verschwiegenen Gottesdienst mit ihr. Er betete an, er kniete nieder. Freilich nur in seiner Vorstellung, denn nie hätten seine steifen, spießbürgerlichen Glieder, die ihm die schönheitstrunkene Seele zusammenhielten, sich zu solchem Götzendienst hergegeben.
Sie war für ihn die Blüte des Sommers oder dessen Frucht. Im Winter war es ihm, als schliefe sie, als wenn man sie nicht wecken dürfte, da hatte sie etwas so tief Sehnsüchtiges – Wartendes, daß sie ihm immer zu Herzen ging. Ihm war's, als stürbe sie jedesmal mit dem Sommer. Sie blieb dann sein Sorgenkind; aber er sah im Herbst Ulrikchen zu einem rotbackigen, köstlichen Herbstapfel werden. Das übrige Jahr stand er mit ihr auf Kriegsfuß.
Uerle kam schwer aus seinem Seelenfrieden und hielt wohl für das wichtigste Gesetz, Frieden zu halten mit sich selbst; so hatte er sich auch mit dem wunderlichen Schicksal, sich in vier Frauen zu verlieben, kunstvoll abgefunden.
Im Grund seiner Seele liebte er aber auch noch die zarte, sanfte Mutter der vier Mädchen. An ihr hing er Frühling, Sommer, Herbst und Winter und wurde nicht müde, der alten, lieblichen Frau zu dienen, wo und wie er konnte. So hatten die Frauenzimmer auf dem Horn wirklich einen erprobten Freund, auf den sie bauen und dem sie trauen konnten. So verschwiegen Uerle auch seine vierfache Liebe hielt, so lebten die Mädchen doch in der Sonnenwärme dieser Liebe und gediehen in Weltfremdheit und Einsamkeit gar herrlich.
Es war an einem Sommerabend, da kam Freund Uerle und sah feierlich aus. Er trug auch sein Feiertagsgewand und hatte in der Brusttasche einen kleinen literarischen Auswuchs. »Er hat etwas in der Tasche,« sagte Alma, »er bringt etwas Schönes.« »Ja,« sagte Uerle bewegt, »die Jungfern werden Äugen machen. Wir setzen den Tisch unter die Linden, und den bequemen Stuhl der Frau Mutter tragen wir hinaus. Ich werde beim Bienengesumme etwas lesen, wie wir alle, alle noch nichts gehört haben. – Wollte Gott,« setzte er hinzu, »ich dürfte niederknien und dem herrlichen Menschen die Hände küssen. Und noch eins: ehe ich anfange, wäre es sehr schön, wenn die vier werten Jungfern« – die junge Witwe wurde dabei nicht weiter berücksichtigt – »ein Lied zum besten geben wollten. Meinen guten Rock Hab' ich schon angezogen; aber die Seele muß auch rein werden von allem, was ihr anhängt.« Die Mädchen waren gern bereit und sangen, und er saß unter den Linden. »Herr Gott,« sagte er, »was für ein glücklicher Mensch bin ich doch! Wissen Sie noch, Frau Pfarrerin, wie wir einander kennen lernten, – wie ich Ihnen den Kaffee, Zucker, Reis und Mehl selber heraustrug, weil ich mich hier oben gern auskennen wollte – und wie mir's gleich so sehr gefiel? Sie setzten mir damals ein Schälchen Kaffee für den langen Weg vor, und wir kamen ins Plaudern. – Wie die Zeit dahingeht, Frau Pfarrerin!« – Als der letzte Ton des Liedes verklungen war und die Mädchen heraustraten, holte Uerle den Stuhl für die Frau Mutter, setzte sich an den Tisch, brachte weihevoll und langsam ein Büchlein aus der Tasche und sagte: »Das ist von einem geschrieben, gegen den alle andern bisher gar nichts sind – aber auch gar nichts!«
»Das hat er schon so oft gesagt!« meinte Ulrikchen und lachte.
»Und hat er nicht recht gehabt, war nicht eins schöner wie's andere?« meinte die kleine Witwe.
»Ja,« sagte die Mutter, »zu Dank sind wir dem guten Uerle verpflichtet.«
»Werteste Frau Pfarrerin, der Dank ist ganz auf meiner Seite.«
Wenn Uerle höflich wurde, stand es bedenklich um ihn, da brannten auch seine Ohren, und wenn die Ohren ihm brannten, stand das Herz ihm in Feuer. Und die Höflichkeit war gewissermaßen das Ventil für seine Leidenschaften. Seine Glieder, seine Stimme, seine Bewegungen, alles lag bei dem armen Menschen in Fesseln und Banden und Steifheit. – O, hätte er die Höflichkeit nicht gehabt, so wäre er gewiß vor Ekstase schon zersprungen.
»Ich bitte,« sagte er gemessen, »die liebe Frau Pfarrerin und die verehrten Jungfern, ganz andächtig zuzuhören!«
Er schlug das Buch auf und las: »Des jungen Werthers Leiden.«
Die Bäume dröhnten vom Summen der Bienenvölker. Im Himmelsblau jubilierten die Lerchen ihr Abendlied, und das Korn duftete den großen Opferduft der weiten Ebene. »Des jungen Werthers Leiden« las er noch einmal und machte wieder eine Pause.
»Nun?« fragte Ulrikchen.
»Verzeihen Sie – wenn Sie wüßten. Wissen Sie, daß Tausende von jungen Herzen jetzt in ganz Deutschland hingerissen sind, daß man nicht ein und aus weiß unter der Jugend vor Begeisterung? – Unten in Weimar hörte ich, daß es schon Jünglinge gäbe, die sich ganz so kleideten, wie in diesem Buche der junge Werther es tut. Ja, so etwas geschah noch nicht. Heute nacht hab' ich gelesen und gelesen und gelesen, und wenn es die Schicklichkeit erlaubt hätte, wär' ich da schon herübergelaufen und hätte vor dem Fenster im Mondenschein das Wundervolle Ihnen allen vorgelesen.«
»Nun, so beginnen Sie doch,« meinte Ulrikchen.
»Ich habe immer gedacht,« sagte Alma ruhig und sinnend, »es müßte einmal etwas Wundervolles geschehen. – Ein Tag ist wie der andere, und es muß doch einmal etwas geschehen, daß man vor Wonne sterben könnte.«
»Du mein Gott, Kind,« sagte die Pfarrerin, »versündige dich nicht! – Danken muß man Gott, verläuft ein Tag wie der andere. Gutes kommt selten, und vor dem Bösen möge der Herr uns behüten.« »Ich meine,« sagte Alma, »ein jeder Mensch müßte einmal blühen wie ein Rosenstrauch oder wie unsere Lindenbäume.«
Ulrikchen lachte. »Und die Bienen müßten einem dann um den Kopf summen wie hier.«
»Nein,« erwiderte Alma ernst, »die müßten einem im Herzen summen, in der Seele, es müßte alles klingen und schwirren vor Seligkeit. Ich weiß gewiß,« sagte Alma ganz feierlich, »ich war einmal ein Rosenstrauch, ehe ich der Mutter Tochter wurde, der hat ungezählte Rosen getragen, ungezählte – ist ganz zu lauter Rosen geworden – – und ist so selig gewesen. Und der Duft aller Rosen war die große, große Freude seines Herzens.«
»Ach, Alma,« meinte Ulrikchen, »so red' nicht so dumm und stör' nicht!«
»Jungfer Ulrikchen,« sagte Uerle erbleichend, »Sie müssen die Schwester reden lassen! – Ja, um Gottes willen, lassen Sie sie reden! Reden Sie, Jungfer Alma, das wird Ihnen wohltun! Es ist eine heilige Stunde jetzt, und das, was Sie sagen, weiß ich ja, weiß ich ja längst!«
»Nun hört sich aber alles auf!« rief Ulrikchen.
»Ja, was ist Ihnen denn?« fragte die Frühlingsliebe, die blutjunge Witwe.
»Nein – nichts – nichts!« sagte Uerle verwirrt. »Ich erschrak nur, daß sie es auch weiß.«
»Aber was weiß?« meinte die Pfarrerin. »Träumt ihr denn?«
»Nein, nein,« sagte Uerle, »es ist auch gar nichts – Gott möge die liebe Jungfer Alma behüten.«
»Na, der Wunsch wäre am Platze gewesen, damals, als sie gar so ein schöner Rosenstrauch gewesen ist, da hätte man einen Stadtsoldaten davorstellen müssen, denn ich hätte mir auch einen Arm voll gelangt,« sagte Ulrikchen.
Uerle kam aber nicht leicht aus seiner Verwirrung, denn Alma hatte ausgesprochen, was er dunkel gefühlt. Sie empfand wie er selbst, daß sie gar eng und geheimnisvoll mit dem Sommer zusammenhing. Es überschauerte ihn. Er fühlte sich ihr nah. –
»Am vierten Mai: Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Bester Freund, was ist das Herz des Menschen!« begann er zu lesen und las weiter.
Und zuviel hatte er nicht gesagt. Sie waren, als er für dieses Mal das Buch schloß, jedes in seiner Art davon benommen. – Sogar Ulrikchen, die einen losen Schnabel der Literatur gegenüber hatte, gab sich drein, es sehr, sehr reizend zu finden.
Alma war ganz still.
»Nun und Sie, Jungfer Alma, was sagen Sie?«
Sie sah ihn bittend an. »Man bringt ihn ins Gered' mit dem Sprechen darüber. Er hat sich das nicht gedacht, als er's schrieb, daß so viel fremde Leute es lesen würden.«
Uerle sagte etwas lächelnd: »O nein, Jungfer Alma, er hat ein großer Dichter damit werden wollen.« »Nein, gewiß nicht!« sagte sie hastig.
»Aber nein, so eine Idee! Meinen Sie, die Dichter schreiben und dichten nicht für die Menschen und für den Ruhm?«
»Ja, die anderen; aber das sind ja doch dann wohl auch keine Dichter, das sind Krämer.«
»Ich bin müde,« sagte sie, stand langsam auf, nickte allen eine Gute Nacht zu, küßte die Mutter auf die Stirn und trat ins Haus.
»Sonderbares Frauenzimmer,« meinte Ulrikchen und gähnte. Uerle verabschiedete sich auch. Als sie unter sich waren, meinte die junge Witwe: »Der Uerle scheint sich in unsere Alma verliebt zu haben.«
»Nee, das hat er nicht,« antwortete Ulrikchen »der Uerle liebt uns alle ein für allemal miteinander und damit basta!«
Uerle war diesen Sommer ganz außer dem Häuschen, wie sie in Weimar sagen. Was er vom Verfasser des jungen Werther erlangen konnte, das brachte er angeschleppt und war in einer wahren Aufregung. »Werthers Leiden« behielt den Platz auf seinem Herzen.
Ulrikchen erkundigte sich oft, ob das eine unheilbare Geschwulst unter seiner Brusttasche wäre. »Wenn man nur dem armen Uerle eine recht unglückliche Liebe verschaffen könnte,« neckte sie ihn im Beisein der andern, »damit er sich abkrageln könnte. – Wär' das ein Hochgenuß!« »Jungfer Ulrikchen,« sagte Uerle einmal bekümmert, »ich bin ein ganz armseliger Mensch; zu meiner Schande muß ich gestehen, mir fiele wahrscheinlich in des jungen Werthers Fall irgend eine vernünftige, friedliche Lösung ein. Ach, ich bin ein nichtsnutziger Kerl!«
»Jetzt weiß ich mir aber keinen Rat, Uerle, ist Er denn ganz närrisch geworden?« sagte bei so einer Gelegenheit die gute Frau Pfarrerin bekümmert. »Hab' ich doch mein' Tag solch sündliche Torheit nicht gehört! Wo hat Er denn sein Christentum, Uerle? Mein Gott, der ganze Herr Goethe reicht unserm Uerle das Wasser nicht, was Treue und Bravheit und friedliche Lebensführung ist – und macht ihn uns noch ganz närrisch!
Ich wollte, er hätte das Geschreibe unserm Uerle überlassen, da wäre eine friedliche und moralische Sache dabei herausgekommen!«
»Hochzuverehrende Frau Pfarrerin,« antwortete ganz verwirrt und erregt Uerle, »das hätte ich nicht gedacht, daß so eine vernünftige, kluge Frau solch eine Blasphemie zu sagen imstande wäre.«
»Was wäre?« fragte die Pfarrerin. Uerle verdeutschte es ihr.
»Da sei Gott vor!« rief die Pfarrerin, »und was hat das mit euch jungen, törichten Leuten zu tun?«
»Mit uns? – Mit uns?« schrie Uerle. »Ja, will uns denn die Frau Pfarrerin vielleicht in einen Topf tun?«
»Ei was,« sagte die Pfarrerin, »ich halt' mich an die Menschen, und da gehört ihr doch wohl zueinander. Ein bissel klüger oder weniger klug, das spricht nicht mit.«
»Herr Gott im Himmel – Herr Gott im Himmel! So eine Frau! – Uns zueinander!« Uerle war ganz außer sich.
»Ach was, Genie,« sagte die Frau Pfarrerin, »ein guter Mensch soll einer sein.«
»Hier handelt sich's aber nicht darum, sondern um eine Liebesgeschichte, um ein herrliches Kunstwerk, Frau Pfarrerin!«
»Ja, ja,« sagte die gute Frau, »solch ein herrliches Kunstwerk hat jeder durchgemacht, und alle werden's durchmachen, aber da sei Gott vor, daß sie's auch alle beschreiben und wenn sie's noch so schön täten! Ich kann nun einmal die Dichtersleut' nicht so unmäßig bewundern. Und lieber ist mir allemal einer, der sein Heiligstes ins Herz verschließt, wie Sie, Herr Uerle.«
»Liebwerte Frau Pfarrerin, das lassen Sie nur sein, mich hier zu nennen. Nicht wert bin ich, ihm die Füße zu küssen.«
»Pfui!« rief die Frau Pfarrerin, »und das sagt ein Mannsbild, weil einer eine Liebesgeschichte artig vorzutragen weiß. Ei, sind Sie denn ganz des Kuckucks! Ist denn so ein Mannsbild als Mensch ein rein Garnichts, und nur, was so einem eingetrichtert ist, oder seine Kunstfertigkeit gilt etwas. Da lob' ich mir die Frauenzimmer, die müssen als Menschen etwas gelten, wenn sie gelten wollen. Die hat ausgespielt, die als Mensch nichts gilt. Mannsbilder sind doch ein ganz unnatürliches Volk!«
Die Frau Pfarrerin war mit ihrem guten Freund Uerle gar nicht mehr so recht zufrieden und gar, als er an einem trüben Novembertag, ohne anzuklopfen, abends ins Zimmer gestürzt kam und gar nicht zu Worte kommen konnte, weil er ganz außer Atem war.
»Nu, aber was?« fragte seine alte Gönnerin etwas ungeduldig.
»Ach, verzeihen Sie, sie haben unten in Weimar den Goethe –«
»Was?«
»Ja – das haben sie! – Sie haben ihn lassen holen. Unser junger Herzog ist genau so vernarrt in ihn wie...« Uerle sprach respektvoll nicht aus.
»Ach, das lassen Sie sich doch nicht weismachen, der ist ja bürgerlich! – Wo werden die! – Die sehen ihn sich einmal an, warum nicht? Langweilen tun sie sich ja so; dann lassen sie ihn aber laufen.«
»Nee, nee! Damit wird's nichts!« rief Uerle sehr erregt. »Unser kleiner Herzog soll nicht mehr ohne ihn leben können.«
»Ohne einen Bürgerlichen?– Sei'n Sie nich komisch – das sagen Sie wem anders!« rief die Pfarrerin geärgert.
»So vernagelt, wie Sie glauben, Frau Pfarrerin, ist unser junger Herzog nun noch nicht. Goethe ist eben doch unten und bleibt auch, und damit basta, und Feste gibt's auf Feste. Sie sollen alle ganz toll sein. – Na, geklatscht wird jetzt schon, daß es eine Art hat. Gesehen habe ich ihn noch nicht, aber ...«
»Der Uerle wird jetzt irgendwo Posto fassen und lauern, und wir werden das Nachsehen mit dem Uerle haben,« meinte Ulrikchen.
»Beileibe nicht,« antwortete er – »aber Sie werden sehen. Sie werden sehen –«
Mit Uerle war es den ganzen Winter nicht richtig. Die übrige Literatur ließ er liegen und summte »Wanderers Sturmlied«, wo er ging und stand, und deklamierte es den Pfarrersleuten, – und »Götz von Berlichingen« las er abends mit heiliger Inbrunst. In keinem Hause drunten in Weimar mochte des jungen Herzogs Freund so gefeiert werden wie im Häuschen am Horn.
Der heilige Augustinus sagt: »Verlangt dich nach der Erde, wirst du zu Erde. Verlangt dich nach Gott – was sage ich – so bist du Gott.«
Verlangt dich nach Goethe, wirst du zwar nicht Goethe; aber du könntest es bis zu dessen Abschreiber bringen. So erging es Uerle. Ein Februarabend fand ihn über ein goethisches Manuskript gebeugt. Seine Ohren brannten, seine Seele war ungeheuer zusammengefaßt. Der Dichter konnte nicht weltentrückter geschaffen haben, als Uerle abschrieb. Ja, er hatte den Mut gehabt, Herrn Goethe seine Dienste anzutragen, und war für gut befunden worden zu einer Abschrift.
Jetzt hörten fürs erste die Abende bei Pfarrers auf, denn Uerle schrieb nächtelang. Am Morgen aber, ehe er ins Geschäft ging, brachte er Alma das Manuskript, und sie mußte es in seinem Beisein in ihre Lade schließen und versprechen, den ganzen Tag das Haus nicht zu verlassen.
Der Sommer zog wieder herauf.
Die langen Tage, die kurzen Nächte, die heißen Stunden bewegten sein Herz.
Almas Schönheit strahlte, ihre Laune war so warm, so sonnig; was sie tat, tat sie mit großer Freudigkeit. Mit den warmen, großen Tagen erwachte sie zu ihrem Lebensfest.
Unter ihren Sommerblumen im Garten mußte man sie sehen, um ihr Wesen ganz zu fassen. Da lag über der jungen Person eine Seligkeit gebreitet, wie sie eines Menschen Wesen nur im Augenblick höchsten Glückes durchleuchtet. Vielleicht einmal im Leben, wenn die schweren, körperlichen Stoffe von Lebenswonne ganz durchdrungen sind.
Wer aber die Erinnerung in sich trägt, als Rosenstrauch einst geblüht zu haben, dem ist die heilige Sommersonne Glücks genug, um ganz in Freude aufgelöst zu werden.
Die Pfarrersmädchen saßen an einem stillen Abend mit der Mutter im Wohnzimmer und sangen, während Alma sie am Spinett begleitete. Die Linden tropften in voller Blütenpracht, und ihr Duft hatte wie jedes Jahr die Bienenvölker angelockt. Die Bäume dröhnten vom Bienensummen und Brausen wie zwei Orgeln, und das Häuschen schien die süßen, starken Klänge der vier Frauenstimmen in seinen Mauern nicht fassen zu können. Es strömte über. Ein leichter, warmer Regen fiel.