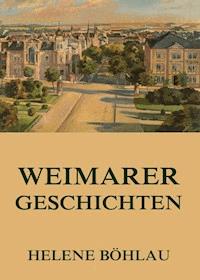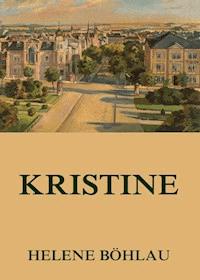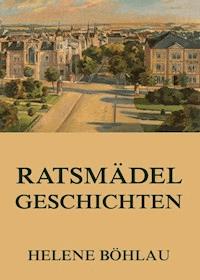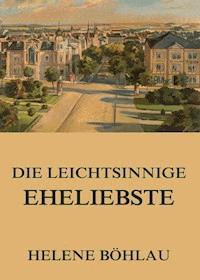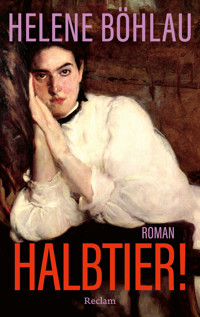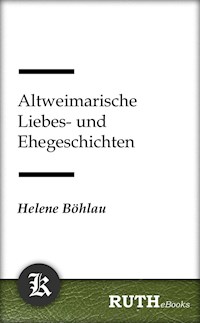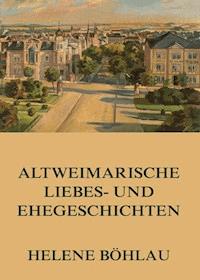
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält die folgenden Geschichten der in Weimar geborenen Autorin: Im alten Rödchen zu Weimar. Das ehrbußliche Weiblein. Eine kuriose Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Altweimarische Liebes- und Ehegeschichten
Helene Böhlau
Inhalt:
Helene Böhlau – Biografie und Bibliografie
Im alten Rödchen zu Weimar.
Das ehrbußliche Weiblein.
Eine kuriose Geschichte.
Altweimarische Liebes- und Ehegeschichten, H. Böhlau
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849605674
www.jazzybee-verlag.de
Helene Böhlau – Biografie und Bibliografie
Nach ihrer Heirat mit Namen Al Raschid Bey. Deutsche Schriftstellerin, geboren am 22. November 1859 in Weimar, verstorben am 26. März 1940 in Augsburg. Tochter des bekannten Verlagsbuchhändlers Hermann Böhlau in Weimar. Obwohl wegen langer, dauernder Kränklichkeit dem Schulbesuch entzogen, erhielt sie eine äußerst sorgfältige Bildung und Erziehung. Die lebensvollen Erzählungen ihrer Großmutter aus der Goethe-Zeit, »der goldenen Tage von Weimar«, sowie die freundliche Teilnahme, welche Walther von Goethe und Friedrich Preller ihr widmeten, verklärten die Mädchenträume ihrer Kindheit und erfüllten ihre Seele mit Taten. Sie machte Reisen in Deutschland und Italien und vermochte erst durch ihre Erfolge die widerstrebenden Eltern mit ihrem frühzeitig hervortretenden Hang zur Schriftstellerei auszusöhnen. Sie genoss das große Glück, in ihrem späteren Gatten einen Freund und Lehrer zu finden, dem sie die Entwickelung ihrer künstlerischen Lebensauffassung dankt. Sie selbst nennt den tiefsten Charakterzug ihrer Seele, »Sonnensehnsucht«. Die Sonne leuchtete ihr Jahre an ihres Gatten Seite, am Marmarameer in Konstantinopel.
Wichtige Werke:
· Der schöne Valentin, Die alten Leutchen, Zwei Novellen, 1886
· Reines Herzens schuldig, Roman, 1888
· Herzenswahn, Roman, 1888
· Rathsmädelgeschichten, 1888
· In frischem Wasser, Roman, 2 Bde, 1891
· Der Rangierbahnhof, Roman, 1896
· Das Recht der Mutter, Roman, 1896
· Im alten Rödchen bei Weimar, Das ehrbußliche Weibchen, Zwei Novellen, 1897
· Die verspielten Leute, Des Zuckerbäckerlehrlings Johannisnacht, Zwei Novellen, 1897
· Verspielte Leute, Roman, 1898
· Schlimme Flitterwochen, Novellen, 1898
· Glory, Glory Hallelujah, Roman, 1898
· Das Brüller Lager, Roman, 1898
· Halbtier! Roman, 1899
· Philister über dir! Schauspiel, 1900
· Sommerseele, Muttersehnsucht, Zwei Novellen, 1904
· Die Ratsmädchen laufen einem Herzog in die Arme, 1905
· Das Haus zur Flamm, Roman, 1907
· Isebies, Roman, 1911
· Gudrun, 1913
· Der gewürzige Hund, Roman, 1916
· Ein dummer Streich, 1919
· Im Garten der Frau Maria Strom, Roman, 1922
· Die leichtsinnige Eheliebste,Roman, 1925
· Die kleine Goethemutter, Roman, 1928
· Kristine, Roman, 1929
· Böse Flitterwochen, Roman, 1929
· Eine zärtliche Seele, Roman, 1930
· Föhn, Roman, 1931
·
Im Rödchen bei Weimar, da hat vor Zeiten ein Dorf gestanden; jetzt ist es ein einsames niedriges Gehölz von etlichen hohen Eichen und Buchen, Ahorn und Erlen überragt; das zieht sich, sanft ansteigend, bis an den weiten, schönen Buchenwald hin auf dem langgestreckten Rücken des Ettersberges, dem Wahrzeichen der guten Stadt Weimar.
Das Dorf ist längst vergessen und versunken, ein Bruderkrieg hat es vom Heimatboden weggefegt, wie so manches andre Dorf und Städtchen, von dessen Dasein kein Mensch mehr weiß.
Aber einst hat es gestanden und geblüht, das Dörflein Roda bei Weimar, und Doktor Faust, der Wundermann, soll, so erzählt man sich, in Roda geboren sein, also so nahe dem Orte, wo er in großer Verklärung für ewige Dauer auferstehen sollte.
Im Rödchen bei Weimar gehen mancherlei Sagen um, die aus versunkenen, vermoderten Mauerresten aufsteigen, wie es auf verlassenen Stätten vergessener Menschen zu geschehen pflegt. Ueber dem Ganzen liegt ein eigener Zauber – eine wehmütige Stille. Der Duft von frischem und gefallenem feuchten Laub verbindet sich eigentümlich scharf. Das macht das Erlen- und Eichenlaub, das auf nassem Grunde zu dichter Decke sich verbunden hat.
Im Rödchen steht ein Wirtshaus und davor, unter jungen Bäumen, einige grau verwitterte Bänke.
Auch dieses Wirtshaus hat jetzt etwas Melancholisches, Vereinsamtes und Verwahrlostes.
Noch zu Anfang unsres Jahrhunderts zogen die Weimaraner gern hinaus zum Rödchen, da gab es Feste über Feste dort.
Wo jetzt am Sonntag der eine oder andre kleine Bürgersmann mit Weib und Kind gelangweilt sein Seidel saures Bier trinkt und vorsichtig sich dazu auf die alten morschen Bänke setzt, da war früher ein reges, warmes, heiteres Leben.
Und gerade diese heimlichen Nester sind es, über denen so eine weiche Stimmung liegt – ein Mollton, wie es über alten vergessenen Gärten zu klingen scheint, die von der jetzigen Generation nicht mehr heimgesucht werden.
Das waren die Nester der Empiremenschen und deren Vorfahren; da haben sie sich harmlos wohlgefühlt, dahin sind sie gezogen, um glücklich und lustig zu sein.
Und wenn jetzt unter den Weimaranern noch so ein verspäteter Kumpan stecken sollte, der die Blutwellen der Leute Anfang dieses Jahrhunderts und Ende des vorigen unvermischt ererbt hat, so ein Abkömmling, der sich in seiner Zeit nicht heimisch fühlt, so ein Träumer, der sich nach etwas sehnt, was er nie kannte, der wird einsam alte, vergessene Wege gehen, die einst seine lustigen Vorfahren so gern wanderten, nach Tröbsdorf, nach Süßenborn zum Aepfelwein, nach Nora, Taubach und auch zum Rödchen.
Und überall wird er alte mürbe Bänke finden.
Unter dem Hausrat der vergessenen Wirtschaften werden hie und da noch steife uralte Täßchen sein, die die Empireleute zurückließen. Und er wird aus so einem Täßchen mit Wehmut trinken und sich nach Menschen, die er nie kannte, wie nach guten Kameraden sehnen. Er wird hie und da in diesen Nestern noch auf ein altes Gartenhaus stoßen, auf einen morschen, gemütsgrün gestrichenen Fensterladen, und alles wird ihm zu Herzen sprechen. Aber es ist wenig, was zurückgeblieben ist – und wir verstehen es nicht mehr.
Und wohl uns, daß wir es nicht verstehen – denn verstünden wir's, würde es uns fehlen auf Schritt und Tritt, das heimliche, seelenruhige Behagen der Alten, ihr harmloser Lebensgenuß.
Eine andre Zeit geht über die Erde hin – eine ganz andre Zeit; allmählich zerfallen und verschwinden die Nester mit den gemütsgrün gestrichenen Fensterläden, den rosa Mauern, den alten Gärten, wo sich unsre Vorfahren einst des Lebens gefreut.
Oben im Rödchen war einst das Haus schmuck und sauber – ganz wie es sein mußte, und ein bemoostes Dach deckte die rosa Mauern – und wo jetzt rings ums Haus klitschiger feuchter Rasen ist und Huflattich wächst und ein paar Hühner trübselig gackern, war ein Garten, ein ganz wunderschöner; Reseda und Flox und Centifolien und Pfingstrosen, Rittersporn und Nachtviolen, Verbenen und Kapuzinerkresse, Obstbäume, von denen noch ein paar wenige uralte Krüppel vor etlichen Jahren standen, Beerensträucher und Himbeerhecken und alles lustig durcheinander und lauschige ländliche Lauben.
Auf dem einsamen Hause lag von alters her ein Schankrecht, das der damalige Förster zu seinem und der Weimaraner Nutzen vortrefflich auszuüben verstand.
Eigentlich war es die Frau Försterin, der diese Ehre gebührte, Haus und Hof so wohl in stand zu halten und es den Gästen behaglich zu machen, vorzüglich zu braten und zu backen, der Försterin und den Töchtern; der Alte kümmerte sich nicht groß darum, der hatte im Ettersberg sein Revier, das ihm Arbeit genug brachte, so daß er den ganzen Tag auf den Beinen war.
Wenn er spät von draußen heimkehrte, sah er es gern, wenn er noch ein paar Leute in dem Gastzimmer vorfand, zu denen er sich dann setzte, um noch ein Partiechen zu machen und zu paffen. Es war ein großer riesenstarker Mann, ein wahrer Wetterbär, der nichts im Kopfe hatte, als seine Pflicht zu thun und von jedem, der mit ihm in Verbindung stand, zu verlangen, daß er die seine thäte. Zu Hause hielt er strenges Regiment. Es war ihm nicht ganz recht, daß die Frau ganz Wirtsfrau geworden war. Da es aber einmal so gekommen, sollte auch das in Ordnung vor sich gehen.
»Daß du mir nicht knappst und geizt, wie das die Frauenzimmer an der Art haben,« sagte er. »Einem jeden sein voll gerüttelt Maß, wie's ihm gebührt, nicht mehr und nicht weniger.«
Er wollte nicht, daß es drunten in Weimar hieße, der alte Walter machte sich mit seiner Wirtschaft Geld.
»Wie sich's gehört, nicht mehr und nicht weniger!«
Was aber mehr als die Redlichkeit des Alten zog, und ebenso wie die guten Werke der Försterin, wie der Kaffee und die Kräpfel und das selbst eingelegte und zu Zeiten auch selbst gebraute Bier und die saftigen Schinkenbrote und was es sonst noch gab, das waren die Kinder des Försters, die drei Mädchen.
Der Förster, der an seinen Mädchen mit einer Liebe hing, wie nur große, bärenhafte Menschen etwas Junges, Hübsches, Zierliches zu lieben verstehen, hatte seine Jüngste, die Ludovikchen hieß, mit dem Kosenamen Schlimpimperlein umgetauft und die zweite, ein dunkeläugiges hübsches Mädchen, das nach der Mutter geartet war und tapfer mitwirtschaftete, rief er Ludschevadel und die Aelteste, die schon verheiratet war, hatte er ihr Lebtag nicht anders als Schmirankel genannt.
Und niemals rief er seine Töchter anders, als mit den Namen, die er ihnen selbst gegeben. Von ihrer Kindheit an hatte er nicht leiden können, wenn irgend etwas an ihnen nicht sauber war. Sie hätten sich dem Vater nicht in einem befleckten Kleide, einer schmutzigen Schürze oder mit wirrem Haar zeigen dürfen, da konnte er ganz außer sich geraten, wenn er dergleichen an ihnen bemerkte.
Die allerliebste war ihm, wie das fast immer der Fall ist, die Jüngste, das Schlimpimperlein.
Das war ein dunkelblondes Mädchen, mit weißer Haut, einem weichen Gesichtchen, hellbraunen Augen und wie aus dem Ei geschält.
Sie war ein stilles feines Kind und wie mit einemmal ein blütenjunges vollkommenes Weibchen geworden, mit aller Klugheit und dem Selbstbewußtsein solch eines schönen Geschöpfchens. Der große bärenhafte Vater hing an diesem Mädchen mit einer fast demütigen Zärtlichkeit.
»Die hat mir keine trübe Stunde gemacht und ihrer Mutter auch nicht. Die ist so ruhig und wohlgesittet schon auf die Welt gekommen, nicht wahr, Alte?« sagte er wohl zu seiner Frau –»die war da, man wußte nicht wie.«
Die Försterin mochte es wohl schon wissen, aber sie nickte immer dazu, wenn ihr Mann das Schlimpimperlein so lobte.
Es war zur Welt gekommen, als der Förster im Ettersberge beim Holzschlag war – und als er abends heimkam, lagen Mutter und Kind und schliefen ganz wohlgemut. Das hat er dem Schlimpimperlein nie vergessen können.
Als seine beiden Aeltesten geboren wurden, das war ihm jedesmal »verflucht nahe gegangen«, wie er sagte.
Schlimpimperlein aber hatte ihm diese, wie er sie nannte, »gottverdammten Stunden« erspart.
Aber eine »gottverdammte Stunde« hatte ihm die Aelteste auch noch eingebracht, das war – als die Mutter zu ihrem Alten eintrat, der gerade sein Nachmittagsschläfchen gehalten hatte, und sagte: »Du, bei uns drüben ist der junge Adjunkt; mit mir hat er schon gesprochen – er will nun zu dir.«
»Was will er denn?« brummte er verschlafen in den Bart.
»Na, Alter – was wird er denn wollen, du?« Die Försterin legte ihm die Hand auf die Schulter und wollte ihn ein bißchen, halb in Verlegenheit, halb scherzend rütteln. Er stand aber wie ein Eichbaum.
»Du weißt's ja, Alter – der Adjunkt – thu doch nicht so!«
Aber der Alte rührte sich nicht.
»Ich weiß gar nichts,« brnmmte er.
»Du mein Gott – das mußt du ja doch längst wissen – das weißt du ja – die Schmirankel will er und hat eben sehr, sehr artig bei mir angefragt – und möchte nun zu dir herein.«
»Laß mich,« kam es hart zwischen den Zähnen, die die Pfeife hielten, heraus.
»Na, Alter, geh – thu doch nicht so. – Er steht schon draußen. Soll ich ihn denn nicht rufen – Alter?« sagte die Försterin ängstlich.
»Nein,« sagte er und hielt sich steif und steifer.
»Na, du wirst doch nicht – der Schmirankel ihrem Glück im Weg stehen wollen – da hast du ja gar keine Veranlassung – denk doch, so eine Partie!«
»Geh mir weg!« brummte er. »Macht, was ihr wollt – das ist den Weibsleuten ihre Angelegenheit – Mich laßt's aus!«
Der Försterin war's, als wäre er dabei bleich geworden; – das mußte aber wohl eine Täuschung gewesen sein, bei so einer Gelegenheit. Aber er hatte den Hut genommen und war, ohne rechts oder links zu sehen, aus dem Hause gegangen, so daß die Försterin ihn noch aufhalten mußte, um zu fragen: »Na, was soll ich ihm denn aber sagen – du?«
»Was du willst! Mich sollst du in Frieden lassen!«
Und fort war er – und kam abends, als alle längst zu Ruhe gegangen waren, erst wieder heim – hat sich aber später mit dem Adjunkten ganz gut befreundet, trotzdem in der ersten Zeit eine stehende Redensart bei ihm war: »Für fremde Leute seine Kinder erziehen, das fehlte mir.« –
Schmirankels Hochzeit war noch ein böser Tag für den Riesen, ein Tag, den er in allen Ausdrücken, die ihm zu Gebote standen, verfluchte. Dann ging es aber besser, als er dachte.
Schmirankel kam oft von Weimar herauf, allein und mit dem Manne, und das waren allemal Festtage. Schmirankel, die manchmal übellaunig gewesen war, benahm sich, wenn sie zu Besuch war, wie die gute Stunde selbst und der Adjunkt war wie ein Sohn. »So ein großer fix und fertiger Sohn ist mir mit einemmal ins Haus gekommen,« sagte der Vater einmal schlau zur Mutter – als hätte er etwas ganz besonders Ueberraschendes ausfindig gemacht.
Försters waren glückliche Leute und galten auch dafür.
Möchte wissen, wenn da oben im Rödchen ruppiges Volk gesteckt hätte, oder eine einsame alte Wirtsfrau mit einer schmutzigen Kellnerin, ob da das Rödchen so einen Zulauf gehabt hätte, wie zur Zeit, als das Glück und das Behagen selbst dort wohnte; als da oben nicht geknappst und gespart wurde, als sie da oben noch Blumen zogen und der Garten in einem Flor stand, daß man seinesgleichen hätte suchen können. In dem Garten, in den stillen ländlichen Lauben, da saßen des Nachmittags die alten Damen beim Kaffee und die unverbesserlichsten unter ihnen machten ihr Partiechen miteinander. – Wie der Flox im Rödchen duftete und die zarten Verbenen und die Büschel Reseda, die am Wege hin wuchsen, das findet man nirgends mehr so, und die alten Damen wurden von Anna, die im Hause Ludschevadel hieß, so verständig und brav bedient, daß sie alles Lobes voll waren. Frau von Goethe, als Frau Geheimrätin von Goethe und auch als Mamselle Vulpius ging gar zu gern hinauf ins Rödchen, und die Schopenhauern und Adele. Auch dem Arthur Schopenhauer hatte es das Rödchen angethan, der spazierte mit Vorliebe, wie mir das Ratsmädchen, die Röse, in ihren alten Tagen erzählt hat, auf der großen aufsteigenden Wiese umher, die sich neben dem Rödchen, von Tannen umsäumt, bis zu den vollzweigigen Buchen des Ettersberges hinaufzieht und von der aus man einen wunderhübschen Blick auf Weimar hat; aber der Arthur Schopenhauer kehrte auch mit Vorliebe bei Försters ein und man neckte ihn ein wenig mit Walters Ludschevadel, von der er gesagt haben soll, daß sie das einzige vernünftige Frauenzimmer in ganz Weimar sei.
Für das junge Volk und die lebhafteren Gemüter standen Bänke und Tische außerhalb des Blumengartens unter einer hohen Linde, die mächtig aufgewachsen und die uralte Dorflinde des vergessenen Dörfleins Roda war, wie man erzählte.
Wenn diese Linde im Rödchen blühte, dann gab's ein Fest für Jung und Alt.
Unter der Linde war seit undenklichen Zeiten schon der Boden gedielt und manches Tänzchen hat der alte Baum, der nun längst gefallen ist, mit angesehen. Zur Lindenblütenzeit tanzten unter den Blüten die Menschen und oben zwischen den Blüten die Bienen, und die Vögel flogen ein und aus und die Fideln klangen, daß es eine Lust war.
Die Lauben, zu denen die schmalen Wege durch die Blumen und die überhängenden Beerensträucher führten, waren eben nur für die alten, vorsichtigen Damen, wenn die aber abends nach Hause gegangen waren, da nisteten sich allerlei lose Vögel dort ein, die die Abendkühle nicht scheuten, wie es die alten Damen thaten.
Manchmal hatten die Försterin und die Töchter wirklich alle Hände voll zu thun, da war kein Fleckchen unbesetzt.
Und wenn abends der Förster heimkam, rief es ihm von allen Bänken entgegen: »Prost, Herr Förster!« und hie und da machte man ihm Platz und er setzte sich mit dem vergnügtesten Gesicht von der Welt.
Das hatte er gern, so einen Empfang, und die Gäste hatten alle den Riesenmenschen gern. Niemand hatte etwas gegen ihn, und das wußte er, das war sein Stolz.
Es war ein prächtiger Riese, der Förster, und sah, wie er schon ein gut Stück über die Fünfzig hinaus war, so frisch und mächtig aus wie ein Stück Hochwald; er war so ein rechter Forstteufel und unangekränkelt.
Wenn er etwas sagen wollte, riß er zuvor den Mund hoch auf, daß seine großen Zähne glänzten, und schaute sich die Leute vergnügt an und dann schnappte er erst wieder zu und fing zu sprechen an.
Wer ihn sah, der wurde guter Laune.
Nur nachmittags, nach dem Schläfchen, war ihm eine Weile nicht zu trauen.
Die alte Madame Kummerfelden, die ihrer Zeit in Weimar, Leipzig und Hamburg eine recht angesehene Schauspielerin gewesen war und jetzt auf ihre alten Tage unten in Weimar eine Nähschule gegründet hatte, die sehr in Flor und Achtung stand und die sie in ihrem eigenen kleinen Hause abhielt, das »am Entenfang« hieß, weil es an einer Schleuse des Lottenbaches lag, bis zu der die Enten von der Lottenmühle ihre Reisen ausdehnen konnten, – diese alte Madame Kummerfelden, die oft, wenn sie Ferien in ihrer Nähschule gegeben hatte, bei Försters oben tagelang steckte, sagte, wenn sie ihrem großen Freund, dem Förster, nach seinem Schläfchen in den Weg lief: »Da geht er umher wie ein brüllender Löwe und suchet, welchen er verschlinge.«
So war es auch, er band dann gern mit aller Welt an und suchte Streit, und wer im Hause irgend konnte, der ging ihm dann aus dem Wege.
In dem Manne steckte eine Riesenhaftigkeit, die er sonst ganz gut zu beherrschen wußte, aber in der schwachen Stunde nach dem Schläfchen, in der er noch nicht alles wieder recht beisammen hatte, brach sie ihm wie unter den Händen hervor.
Und bei noch einer Gelegenheit war er ganz armselig. Er litt etwas an der Gicht, oder am Podagra, am »Bock« sagte er, denn er war jahrelang in Tirol bei einem vornehmen Herrn Förster gewesen, und in Tirol nennt man das Podagra: »den Bock«.
Wenn er den Bock hatte, war er hilflos wie ein Kind und kroch mit seinem Bock ins Bett und machte einen Spektakel, so daß alle im Haus Respekt vor des Vaters Bock hatten.
»Vatter,« sagte Ludschevadel, wenn er nicht so ganz bei Laune war, »Vatter, was ist Ihnen denn?«
»Der Bock noch lange nicht!« brummte er dann.
Da war dieser aber gewöhnlich schon im Anmarsch, denn sonst hatte der Förster keine schlechte Laune, und dann begann ein großes Treiben im Haus, dann mußten Betten gewärmt werden und Habersäcke ließ er sich heiß machen, alle zehn Minuten einen, und allerhand Thee wollte er trinken, um nur um Gottes willen seinen Bock los zu werden.
Da mußte jeder Gast zurückstehen und alles zurückstehen. Das wußten die Leute auch; wenn sie an dem Tag kamen, an dem der Förster den Bock hatte, durften keinerlei Ansprüche gemacht werden.
Der Bock gehörte nun einmal mit in die Familie und man mußte seit Jahren schon mit ihm rechnen.
Dem Förster war es gar nicht recht, daß sie seinen Bock als so etwas ganz Gewöhnliches ansahen.
Der Förster hätte gewünscht, daß die Leute jedesmal in neues Entsetzen darüber mit ihm zusammen ausgebrochen wären. – Und wehe dem, der des Vaters Bock für einen Augenblick vergaß und im Uebermaß seiner Gesundheit einmal auflachte, dem machte der Förster die Hölle heiß.
Das war so eine eigene Sache mit dem Bock.
Eine ordentliche Verwundung hätte er als Ehrensache ohne Augenzwinkern ertragen. Das war etwas für Männer, dagegen hatte er nichts einzuwenden und hatte es auch durchgemacht.
Er hatte einst einen Hieb über seinen Dickkopf bekommen, daß die Schwarte eine Handbreit auseinandergeklafft hatte; das war in der Ordnung gewesen, – aber der Bock war keineswegs in der Ordnung, da war nichts Ehrenhaftes dabei.
»Eine Schweinerei,« wie der Förster sich ausdrückte.
Und noch heute hätte er sich das Fleisch von den Knochen hauen lassen, wenn es darauf angekommen wäre, wenn es wahrhaft heiliger Ernst einmal werden sollte: »Alte,« sagte er, wenn sie miteinander am späten Abend noch allein in der Wohnstube saßen, »wenn einmal der deutsche Teufel wachgeblasen wird, da bin ich auch dabei – so lang bleib' ich ein junger Mann. – He – umsonst bin ich kein solcher Bär. Ich fahr' einmal nicht in die Grube, ohne ein paar Dutzend Lumpenhunde vorausgeschickt zu haben.«
Und wenn die Försterin über solche Rede zu jammern begann, schlug er mit der Faust auf den Tisch: »So ein Weib hat kein Herz im Leib!«
Und wenn die Försterin dann das Ihre darauf sagte, meinte er: »Geh, du bist eine Memme.« Und dann saß er und brütete vor sich hin und schlug wieder mit der Faust auf den Tisch.
Das harte Los des Vaterlandes ging dem Wackeren nah – und bei jeder neuen Schmach, die ihm zu Ohren kam, war er ein schwer getroffener Mann.
*
Der Kanonendonner der Schlacht am 14. Oktober 1806 dröhnte und rollte bis über Weimar hin, bis hinauf ins Rödchen, der Himmel war bleiern, der Oktobernebel lag schwer auf der Erde. Und in diesem Nebel wüteten die Völker gegeneinander, brüllte der Tod und waltete das Schicksal. In Weimar zitterten aller Herzen.
Der Förster war in tiefer Erregung. Er war gerade unten in Weimar gewesen, als die Truppen vom Erfurter Thor her in die Stadt gezogen kamen, und er war einer der Ersten gewesen, die von der Affaire bei Saalfeld zu hören bekommen. Kurfürstlich sächsische Soldaten hatten zu ihm von Saalfeld gesprochen, vom 10. Oktober, und der Förster hatte geflucht und gewettert und hatte so mehr und mehr Leute um sich und die Kurfürstlich-sächsischen angezogen.
Ein preußischer Offizier war spottend hinzugetreten und den Förster hatte sein böser Jähzorn überkommen: »Maulheld, verdammter!« hatte er geschrieen – und wäre dem Preußen an die Kehle gesprungen, hätten ihn die Umstehenden nicht ebenso erregt zurückgehalten.
Es war vom Förster eine böse Stimmung ausgegangen.
Und als der Riese seine äußere Ruhe wiedergewonnen hatte, da stand er und sah Regiment auf Regiment an sich vorüberziehen, Infanterie, Kavallerie und Artillerie, und auch die fünftausend Silbermänner, die auserlesene Mannschaft.
Aber sie hatten ihm alle nicht gefallen.
»Das sind die Rechten nicht,« hatte er immer wieder, wenn neue Scharen an ihm vorüberkamen, in seinen blonden langen Bart gemurmelt und den Kopf dazu geschüttelt.
In das Lager auf dem Horn war er gar nicht gegangen, sondern wieder hinauf in das Rödchen und war oben im Ettersberg seiner Pflicht nachgekommen.
Als am 14. Oktober die ersten dumpfen Kanonenschüsse dröhnten und die Frauensleute oben im Rödchen sich nicht zu lassen wußten vor Aufregung und Angst, ging der Förster über die Felder unter die drei großen einsamen Kiefern, die zwischen der Ettersburger Chaussee und dem Rödchen noch stehen, drei düstere Bäume, und schaute auf Weimar hinab und auf die Höhenzüge hin, hinter denen eine große Schlacht geschlagen wurde.
Er hat den ganzen Tag nichts gegessen und nichts getrunken und kaum mit jemand gesprochen, wie ein Verzweifelter.
Einmal sagte er und strich Schlimpimperlein über das Haar: »Das wird ein böser Tag für alle Deutschen,« und dann zur Frau: »Geh, Alte, und nehmt mit, was ihr meint, das ihr nehmen müßt. Geht bis zur vierten Wildraufe, da richtet euch in der Hütte ein, du und die Mädchens und die Magd. – Und daß sich keines hier sehen läßt, bis ich euch hole.«
Die Försterin wollte nicht, redete drein, da reckte er sich auf und stand wie aus Erz gegossen vor ihr.
Und als das Haus leer war, schloß er's ab und ging hinunter nach Weimar.
Das war um die dritte Stunde am Nachmittag gewesen. Er kam mitten hinein in den Durchzug der geschlagenen Truppen, die in grenzenloser Unordnung durch die Straßen sich wieder zurück zum Erfurter Thor wälzten, und die Franzosen mit ihren Geschützen schossen von der Altenburg aus ihnen nach.
Da zog das Elend hin und das Pflaster dröhnte davon. Sie waren alle vom Schicksal Gezeichnete, die schwer Blessierten, von denen welche quer über den Pferden hingen, und die abgequälten, todesmatten, blutbefleckten Davongekommenen und die Kanoniere mit den schwarzen Gesichtern, die ihnen der Atem der Schlacht gefärbt hatte, als wäre ihnen Trauerflor darüber gebunden, und die zertrümmerten Geschütze ohne Räder und die Gäule mit dem wilden, blutdürstigen Blick, die die wütenden Schrecken, die entfesselte Riesenwut der menschlichen Bestie mitgesehen und mitgerast hatten. – All das quoll gehetzt und verfolgt grausenerregend durch die engen Gassen, als sollten die auseinandergesprengt werden.
Die Luft dröhnte von den Kanonenschlägen, die Häuser zitterten, die Fenster klirrten – und jedes Herz lebte in Angst und Grauen. Dann auf eine Weile Stille, schwüle Stille, ein sanfter Abendhimmel, todesruhige Straßen, das herbstliche Abendzwitschern der Spatzen, die ganze Gleichgültigkeit der Natur über dem Städtchen ausgebreitet. In den Häusern herzensbange Geschäftigkeit. – Dämmerung. –
Und mit der Dunkelheit das Hereinbrechen des Schicksals, das alles Ahnen der bebenden Herzen überstieg.
Der Feind in der Stadt! Der Feind mit allen Rechten des Siegers – des Stärkeren!
Furchtbar klar muß es zu Tage treten, wenn die dicken Köpfe etwas begreifen sollen.
Und es trat zu Tage, das unantastbare Recht des Stärkeren – so klar zu Tage, daß auf den dicken, dumpfen Köpfen die Haare zu Berge standen, die Flammen aus den friedlichen Häusern schlugen, wilde Schreie aus den stillen Bürgerstuben hinaus in die Nacht gellten – Schreie, die ausgestoßen wurden, weil alles bedroht war, das Leben, das Gut, Ehre, das Obdach – alles.
Angstschreie vor dem Recht des Stärkeren heulten von Haus zu Haus, drangen durch alle Ritzen und Fenster, durch Rauch und Qualm, durch die düstere wilde Nacht.
So erfuhren sie das Recht des Stärkeren!
Jetzt zweifelten sie nicht mehr. Daß sie so etwas erleben mußten – die dumpfen braven Leute im Schloß und im Städtchen! – Die Zähne klapperten ihnen vor dieser großen Lehre, die von Zeit zu Zeit über die verschlafene Menschheit hindonnert, die große Lehre, daß unter dem bürgerlichen Ehrenrock, dem Zopf, dem Bausch, dem Schleppkleid, der Halsbinde, den engen Stiefeln, der ehrbaren Zimperlichkeit, der würdevollen Vortrefflichkeit, dem ganzen gedrehten, geschwänzelten Behaben die Bestie wohnt – die wilde, blutdürstige Bestie, an die niemand recht glauben will – und die, wenn ihre Zeit wieder einmal gekommen ist – hohnlachend die Maske abwirft und sie in Schmutz und Blut stampft und nackt und unverstellt hervorspringt zu Mord und Wut und Raserei, zu jeder Scheußlichkeit und Schändlichkeit bereit, die Bestie aller Bestien, der es keine nachthut. – Da ist's ihr wohl, dem sonst geschnürten, eingeengten Vieh.
Die Schreie der Mißhandelten das ist Musik, die hat es lange nicht gehört! Heut' ist's sein Recht! Offen und unversteckt! Alles ist erlaubt! Es ist Wonne, es ist Raserei, der Schaum steht vor wilder Lust, das sein zu dürfen, was sie ist, der Bestie vor dem Maul und es heißt ehrlicher Krieg und Mannesmut und alles ist in schönster Ordnung.
Solches haben die Leute in Weimar bei finsterer Nacht und bei hellem freundlichen Sonnenschein kennen gelernt. Bei hellem freundlichen Sonnenschein, der der Menschen Elend naiv und göttlich gleichgültig beleuchtete. Die helle Sonne, die hat den Weimaranern damals weh gethan; wie war das häßlich, diese helle Sonne über all dem Greuel – taktlos!
Und sie hatten doch gemeint, daß der Himmel mit ihnen weinen müßte. Das hätten sie sich nicht vorgestellt, das machte sie betroffen. Er lachte und das war auch in der Ordnung so – vielleicht hielt er's mit den Franzosen.
In dunkler Nacht, die von brennenden Häusern zuckend erhellt wurde, und im hellen bösartigen Sonnenschein, da war ein alter blonder großer Bursche auf seinen starken Beinen Tag und Nacht unterwegs. Er hatte keine Sorge für das eigene Haus und hielt es mit allen, die bedrängt waren. Wie ein Teufel fuhr er durch die Straßen, durch das wilde, schleppende, brüllende Pack, stürzte da in ein Haus und dort in eins, und wo er eintrat, war eine ruhige, gesunde Kraft eingetreten, die geängstigten Leute sahen auf. »Da ist der Förster,« sagten sie – und da gab es immer zu thun für ihn. Er trat den Plünderern, die sich, von der unsinnigen Todesangst der Bürgersleute angestachelt, aufgeregt fühlten und sich ihrer Gewalt freuten, ruhig, gut gelaunt entgegen, riß den Mund auf und lachte das eindringende Diebsgesindel an und packte den ersten besten am Kragen und hielt ihn in die Höhe und ließ ihn zappeln und zeigte ihn gutmütig lachend wie einen Hasen den geängstigten Leuten und dem Gesindel, das nicht wußte, was es davon halten sollte – der alte Riesenbursche mit der Riesenkraft und dem guten Humor verblüffte sie und sie zogen ab – für einmal wenigstens.
»Da ist eine Kraft von Zwanzig drin!« sagte der Förster und schlug sich auf die Brust – und nickte den Leuten zu: »Ruhig Blut – ruhig Blut! – Verblüfft sie doch, die Hunde!« rief er den Zitternden, Hohläugigen, Bangwangigen zu.
»Wenn in jedem Haus so ein blonder Kerl säß, da würden sie so artig kommen und so vorsichtig nehmen, aus Angst, daß sie was auf die Tatzen bekämen.« – Das sagte er immer wieder und immer wieder und begriff nicht, daß die Leute es nicht verstanden und nicht thaten, was er wollte, daß er keinen einzigen solchen blonden Kerl irgendwo fand, sondern lauter Leute, die drei Tage lang in der Gänsehaut steckten mit blauen Lippen, blauen Nägeln und klappernden Zähnen.
Der Förster vom Rödchen und Goethes kleines Weib, seine kleine tapfere Freundin, von der ihr später einmal hören sollt, wie ihr die wilden Tage hingegangen sind, das waren die einzigen frischen Leute in Weimar, die nicht nur an sich und ihr Hab und Gut dachten, sonder für andre zu sorgen Zeit und Kraft fanden.