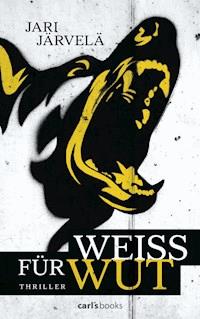
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thrillerserie um eine junge Graffiti-Sprayerin
- Sprache: Deutsch
Ein 19-jähriges Mädchen, das sich »Metro« nennt, ist leidenschaftliche Street-Art-Künstlerin. Zusammen mit ihrem Freund kundschaftet sie täglich ungewöhnliche Orte aus, um sich dort heimlich mit ihren gesprayten Kunstwerken zu verewigen. Als sie eines Nachts entdeckt werden, stirbt ihr Freund bei einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst. Metro kann fliehen. Ihre Trauer entlädt sich in einem wütenden Racheplan: Sie will dem Mann, der ihren Freund auf dem Gewissen hat, das Leben zur Hölle machen. Mit ihren ganz eigenen Mitteln …
Ein hoch dramatischer Thriller mit einer ungewöhnlichen Serienheldin, die niemanden kalt lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ein 19-jähriges Mädchen, das sich »Metro« nennt, ist leidenschaftliche Street-Art-Künstlerin. Zusammen mit ihrem Freund kundschaftet sie täglich ungewöhnliche Orte aus, um sich dort heimlich mit ihren gesprayten Kunstwerken zu verewigen. Als sie eines Nachts entdeckt werden, stirbt ihr Freund bei einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst. Metro kann fliehen. Ihre Trauer entlädt sich in einem wütenden Racheplan: Sie will dem Mann, der ihren Freund auf dem Gewissen hat, das Leben zur Hölle machen. Mit ihren ganz eigenen Mitteln …
Ein hoch dramatischer Thriller und der grandiose Beginn einer neuen Serie.
Der zweite Band ist bereits in Vorbereitung.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Tyttö ja pommi bei Crime Time, Helsinki.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2014 by Jari JärveläPublished in agreement with Stilton Literary Agency, Finland
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
bei carl’s books, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15997-9V001www.carlsbooks.de
A wall is a very big weapon. It’s one of the nastiest things you can hit someone with.
Banksy
Metro
Gegen halb drei hatte ich auf einmal das Gefühl, dass irgendwas faul war. Am Nachthimmel schien ein rotes Warnlämpchen aufzuleuchten, das mich aufforderte, sofort abzuhauen.
»Lauf, Mädchen, lauf!«, gellte das Lämpchen mit heulender Sirenenstimme.
In Wahrheit gab es dort oben natürlich keine rote Lampe, sondern nur träge dahinziehende Wolkenfetzen, die immer wieder den Blick auf einzelne flimmernde Sterne freigaben.
Ich machte die Augen zu und lauschte. Ich war mir sicher, ein leises Klirren gehört zu haben, und zwar nicht von der anderen Seite des Waggons, wo Rust arbeitete.
Auf dem Rangierbahnhof am Hafen war es ansonsten totenstill. Die Stille klang unheilvoller als jeder knirschende Laufschritt im Schotter. Mir war, als unterdrückte jemand in der Dunkelheit ein Niesen. Angriffsbereit.
Ich wünschte mir, die Streckenmasten könnten sprechen.
Garantiert lauerte irgendwo im Schatten eine Ratte. Kein Tier, sondern eine Ratte – ein Mann von irgendeinem privaten Sicherheitsdienst. Der Dienst bestand darin, dass die Ratte zuschlug und zutrat, dir die Glieder verrenkte, mit dem Knüppel auf dich eindrosch und dir Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Im Namen des Gemeinwohls. Dann zerrte die Ratte dich vor Gericht, wo man dir für ein bisschen Farbe eine sechsstellige Summe als Schadenersatz aufbrummte. Die Ratte selbst bekam für gebrochene Arme und zerschmetterte Schädel einen Orden.
Hinter mir befanden sich das herbstliche Meer, zäh wie flüssiges Metall, und ein paar alte Kräne. Hafenkräne. Vor mir ragte ein hoher Felsen auf. Tagsüber glänzte die Felswand rötlich, als blutete sie. Im Augenblick verdeckte sie bloß das Stadtzentrum. Leuchtreklame warf ihren Schimmer über den dunklen Granit.
Reglos wartete ich fünf Minuten lang. Es war fünf nach halb drei. Das Klirren war verstummt. Ich verfolgte das Verrinnen der Zeit auf der Kirchturmuhr, die zwischen den Bäumen hinter dem Felsen gerade noch zu sehen war. Mein Herz hämmerte mir ein Loch in die Jacke. Ich war mucksmäuschenstill und zwang mich, langsam zu atmen. Mit der Spraydose in der Hand stand ich neben dem Waggon auf meiner selbst gebastelten Aluminiumleiter, die ich im Handumdrehen zusammenklappen und im Rucksack verstauen konnte. Ohne Leiter kam ich nicht hoch genug. Ich hatte gerade erst zwei gezackte, ineinander übergehende Buchstaben in Rot und Gelb geschafft.
RY
Entlang des Waggons sollte der Schriftzug RYEBREAD entstehen, Roggenbrot – lesbar nur, wenn man dazu in der Lage war, die ineinanderflammenden Buchstaben zu deuten, die rote und gelbe Zungen aussandten. Kein einfaches Bombing, kein simples Gekleckse, sondern ein echtes Piece, ein Kunstwerk.
Die Längsseite eines Güterwaggons der Bahngesellschaft VR ist dreizehn Meter lang und drei Meter hoch und geradezu prädestiniert als Leinwand. Jedenfalls unserer Ansicht nach – natürlich nicht nach Ansicht der Ratten und der Bosse der VR.
Eine Waggonseite bietet fast vierzig Quadratmeter freie Malfläche. Achtzig, wenn man die andere Seite mit einrechnet. Bei einem Dutzend Waggons hintereinander schimmerte vor meinen Augen ein leerer Screen von tausend Quadratmetern. Die Fußbodenfläche von fünfzig Einzimmerwohnungen. In der Kasse eines Immobilienmaklers wäre eine solche Fläche Millionen wert.
Uns kostete sie gar nichts. Sofern wir nicht geschnappt wurden.
Für uns waren die Waggons eine kostenlose, durch Städte und ländliche Gebiete rollende Galerie, viel zweckmäßiger als Schilder am Straßenrand. Auf die Idee, Güterzüge zu nutzen, waren die Werbeagenturen nie gekommen. Wir schon.
In dieser Septembernacht waren wir zu zweit unterwegs, Rust und ich.
Jere
Ich spielte mit dem Jungen Lego. Er hatte aus den Steinen einen uralten Tempel errichtet, den ich jetzt erforschen sollte. Mein Legomann hatte einen breitkrempigen Hut auf dem Kopf und ein Vergrößerungsglas in der Hand. Der Legotempel war voll von Fallgruben, Falltüren, einstürzenden Decken, wackligen Wänden, Giftspeeren, Krokodilen, Schlangen, herabrollenden Felsbrocken, zusammenkrachenden Brücken.
Am wichtigsten war, dass der Legomann in jede einzelne Falle tappte.
Der Legomann hatte den gleichen Namen wie ich. Jere. So hatte mein Sohn ihn getauft.
Beim ersten Mal hatte ich einen schweren Fehler begangen: Ich war den Gruben zunächst ausgewichen und hatte den Legokrokodilen die Fresse poliert. Ville hatte vor meinen Augen die halbe Konstruktion demoliert und sich heulend in sein Zimmer verzogen. Vergeblich hatte ich zu meiner Verteidigung erklärt, dass doch er selbst darum gebeten hatte, ganz ganz ganz schlau zu sein.
»Du musst die Fallen umgehen«, greinte er auch jetzt wieder, aber mir war klar, dass er das Gegenteil meinte. Der Legomann sollte sich für unglaublich schlau halten und trotzdem wie ein Idiot in jede Falle gehen.
Ich schob die Figur vorwärts. Wenn ich Chef bei Lego gewesen wäre, hätte ich für die Gesichter eine andere Farbe gewählt als Gelb. Der Legomann stürzte kopfüber in eine Grube und wurde unter einem Haufen Ziegel begraben. Ich fragte mich kurz, ob mein Sohn sich wohl wünschte, dass es mir ebenso ergehen möge, denn er rief immer wieder begeistert: »Jere hat Pech gehabt, hoho!«
Der Kopf des Legomannes löste sich vom Rumpf, als ihn ein in der Wand verborgenes Schwingbeil traf. Dann biss ihn eine Kobra, und der Legomann wand sich in Krämpfen, bis er schließlich reglos liegen blieb. Er hatte seinen Schlapphut eingebüßt. In seinem Kopf prangte ein Loch, wo der Hut befestigt gewesen war. Ich spähte hinein. »Der hat kein Hirn«, merkte ich an. »Der ist hinüber.«
»Weiter, Jere!«, drängte Ville. »Weiter, weiter, weiter! Du lebst noch!«
Also erwachte der Legomann in meiner Hand wieder zum Leben, steckte sich Arme und Beine an und machte sich auf zur nächsten Falle. Vorsichtig schlich er an einer Wand entlang – ausgerechnet an der Wand, aus der gleich ein Bündel Speere in seine Flanke schießen würde. Völlig unerwartet.
»Weiter, weiter!«, befahl Ville.
»Zeit, ins Bett zu gehen«, rief Mirjami von der Tür.
»Neiiin!«
»Doch, Papa muss morgen früh aufstehen«, sagte ich.
»Neiiin!«
Wir ließen den Tempel auf dem Fußboden stehen, und ich versprach, ihn morgen neu zu durchschreiten. Es gebe darin über tausend Fallen, denen der Lego-Jere ausweichen müsse, prahlte der Junge. Ganz in echt.
»Aber er soll nicht in diese Fallen tappen?«
»Nein, dran vorbeigehen soll er!«, rief Ville. »Versprich mir, dass er dran vorbeigeht! Versprichst du es mir? Dass er schlau ist, Papa?« Ville nahm mich an der Hand und sah mich aus müden Rehaugen an. Unwillkürlich fragte ich mich, wann Kinder das Manipulieren lernten. Wahrscheinlich sofort, sobald sie aus der Gebärmutter purzelten. Zuerst wickelten sie die Mutter um den kleinen Finger, dann den Vater.
Ich setzte mich an den runden Esstisch und sah Ville dabei zu, wie er seinen Kakao schlürfte. Seine Wangen glühten, als wäre er gerade anstelle des Legomannes selbst durch den mit Fallen gespickten Tempel gehetzt. Mirjami saß zwischen uns, ich hatte aus dem Wohnzimmer einen Sessel für sie geholt, in dem sie es sich bequem machen konnte. Sie saß gern in der Küche und beobachtete das Leben draußen am Vogelhäuschen und entlang der Wohnstraße dahinter.
»Ratet mal, wie viele Legosteine es pro Mensch gibt«, sagte ich.
»Drei«, schlug Mirjami vor.
»Falsch.«
»Eine Million«, riet Ville.
»Na, hör mal, auf der Erde leben mehr als sieben Milliarden Menschen. Wenn von denen jeder eine Million Legosteine hätte, wären das irrsinnig viele!«
»Wie viele denn?«, fragte Ville und kratzte mit dem Löffel über den Boden seines Kakaobechers.
»Unbegreiflich viele«, antwortete ich. »Die ganze Erde wäre von einer meterhohen Schicht bedeckt. Wir würden gar nicht mehr dazwischenpassen. Ihr habt beide falsch geraten. Ihr habt noch einen Versuch.«
»Was war die Frage?«, erkundigte sich Mirjami. Sie schenkte meinen Worten manchmal irritierend wenig Beachtung, auch wenn sie so tat, als würde sie mir zuhören.
»Wie viele Legosteine gibt es pro Mensch auf der Welt? Sowohl drei als auch eine Million ist total falsch.«
»Vier«, sagte Mirjami.
»Eine Million Milliarden«, rief Ville. »Eine Million Zillionen Milliarden.«
»Falsch«, erwiderte ich. »Falsch. Es sind hundert. Auf jeden Menschen kommen hundert Legosteine.«
»Hö«, kam es von Mirjami. Das Ganze interessierte sie nicht im Geringsten.
»Ich hab aber viel mehr«, wandte Ville ein.
»Dir geht es ja auch tausendmal besser«, sagte ich, »im Vergleich zum Durchschnittsmenschen.«
Ich streichelte Mirjamis runden Bauch. Der errechnete Geburtstermin war kurz nach Weihnachten. Nach Mirjamis Ansicht musste es für ein Kind ganz schrecklich sein, in der Weihnachtszeit zur Welt zu kommen, weil niemand den Geburtstag eines Weihnachtskindes feiern wollte. Ihre Großmutter war am 23. Dezember geboren und hatte kaum je Geburtstagsgäste gehabt. Nicht einmal, als sie achtzig geworden war. Die Gäste waren eine Woche eher gekommen, hatten ein paar Geschenke auf den Tisch gelegt, hastig eine Tasse Kaffee hinuntergekippt und waren wieder aufgebrochen, ehe ihnen nachgeschenkt werden konnte. Man hatte über die vorweihnachtliche Hektik geklagt. Man hatte mehr über den Weihnachtsmann gesprochen als über die achtzigjährige Oma.
»Dann musst du eben versuchen, die Geburt bis Anfang Januar rauszuzögern«, hatte ich zu Mirjami gesagt.
»Und wie soll ich das bitte schön anstellen?«
»Wenn das Kind Anfang Januar geboren wird, ist es bei allen Sportwettkämpfen das älteste seines Jahrgangs«, hatte ich ihr erklärt. »Kommt es im Dezember zur Welt, dann ist es fast ein Jahr jünger als die Januarkinder. Es wird überall benachteiligt sein. In jeder Sportart. Von Geburt an.«
»Ich soll allen Ernstes eine Woche lang die Beine zusammenkneifen, wenn es an Heiligabend kommen will?«, hatte Mirjami pikiert zurückgefragt.
Wenn sie so drauf war, hatte es keinen Zweck, vernünftig mit ihr zu reden.
Es dämmerte bereits, als ich aus dem Haus trat. Unser Nachbar Sorsasalo hatte vor zwei Jahren im Sommer am Rand seines Grundstücks ein kleines Gewächshaus aufgestellt. Dort baute er Wein an, Hybridreben, die selbst dem finnischen Winter standhielten. Auch jetzt war er gerade wieder in seinem Gewächshaus beschäftigt. Ich war ein paarmal dort drinnen gewesen. Es war so klein, dass man den Kopf einziehen und sich seitlich hineinzwängen musste. Im vergangenen Sommer hatte Sorsasalo mich zwischen den wuchernden Ranken hindurch in die hinterste Ecke geführt, wo zwei Hocker und ein kleiner Tisch standen. »Das hier wird meine Weinprobenecke«, hatte er gesagt. Dann hatten wir Whisky getrunken, weil noch keine einzige Weintraube herangereift war.
In diesem Herbst werde die Ernte für mindestens zehn Flaschen reichen, rief Sorsasalo mir jetzt zu.
Ich fuhr zur Baracke, zog meine Arbeitskleidung an und befestigte den Teleskopknüppel und den kürzeren Schlagstock, das Pfefferspray und die Handschellen am Gürtel. Dann rief Raittila uns in sein Büro. Wir waren mehr als zehn Leute. Die Stühle reichten nicht.
Für heute Abend sei mit der Bahn ein spezieller Deal ausgehandelt, erklärte Raittila. Es seien dreimal so viele Männer im Einsatz wie sonst, und wenn die Schmierer geschnappt würden, bekäme jeder von uns einen Sonderbonus. Auf dem Rangierbahnhof am Haupthafen standen seit zwei Tagen Güterwaggons als Köder, und einer zuverlässigen Quelle zufolge würden dort heute Nacht ein paar Bazillen auftauchen.
Wir waren das Antibiotikum.
Metro
RYE
Inzwischen war auch das E fertig, mit spitz zulaufenden Querstrichen, die an die gespaltene Zunge einer Kreuzotter erinnerten.
Der Roggenbrot-Schriftzug war keine bestellte Werbung von der hiesigen Großbäckerei Vaasan Mylly, sondern eine Hommage an Cornbread, den Jungen, der das Graffiti erfunden hatte. Er hatte sich Ende der Sechzigerjahre in Philadelphia in ein Mädchen verliebt und angefangen, an dessen Schulweg Liebesbekenntnisse zu hinterlassen. Hunde pinkeln an Laternenpfähle, um Zeichen zu setzen. Cornbread suchte sich Stellen, die dem Mädchen garantiert auffallen würden. Er schrieb an die Wände:
CORNBREAD LOVES CYNTHIA
Das Mädchen hatte nicht die leiseste Ahnung, um wen es sich dabei handelte, wunderte sich nur, dass überall im Asphaltdschungel plötzlich die gleiche gefühlvolle Botschaft zu lesen war. Oder auch nur CORNBREAD. An den seltsamsten Stellen. Auf dem Bürgersteig an der Straßenecke, die das Mädchen morgens auf dem Schulweg passierte. An Dachrinnen, Lüftungsrohren, Sockeln. Schließlich verbreitete sich das Writing auch über die Umgebung der Schule hinaus. CORNBREAD stand oben an Laternenpfählen, CORNBREAD stand auf Backsteinmauern, ganz hoch oben, wo nur die Feuerwehr oder Mauerschwalben hinkamen.
Der Junge war schüchtern. In der Schule kannte ihn niemand unter dem Namen Cornbread. Er hatte sich für dieses Pseudonym entschieden, weil er das dampfende Maisbrot seiner Großmutter so gern aß. Der unsichtbare, Maisbrot mampfende Junge liebte Cynthia.
Das ist die Grundidee von Street Art in Reinform: Jemand Unsichtbares schafft Sichtbares. Ein Graffiti ist eine Bombe, deren Splitter sich in der ganzen Stadt verbreiten.
Ich fände es ziemlich cool, wenn überall in der Stadt Writings auftauchten, die verkündeten: RUST LOVES METRO.
Metro, das bin ich. Und mit Rust teile ich das Bett.
RYEB
Als ich das B fertig gesprayt hatte, hörte ich wieder das leise Klirren. Es kam aus der Richtung des alten Bahnhofs. Das rote Backsteingebäude war schon vor Jahren geschlossen worden. Sonntags fanden in dem verlassenen Wartesaal manchmal Flohmärkte statt, auf denen die Leute verfärbte Tassen, vergilbte Bücher und zerbrochene Erinnerungen feilboten. An die Reisenden erinnerte nur mehr ein Schild, auf dem geschrieben stand, wie viele Kriegskinder von diesem Bahnhof aus mit dem Zug nach Schweden geschickt worden waren, anno Schnee und dazumal.
Es waren irre viele gewesen. Mir war nicht ganz klar, wie sie mit dem Zug nach Schweden gekommen waren, zwischen hier und dort lag schließlich das Meer. Vielleicht hatten sie die Blagen aber auch nur in die nächste Stadt verfrachtet und zur Arbeit in die Margarinefabrik geschickt.
Das Bahnhofsgebäude stand hinter einer Kurve, von unserem Standort aus konnte ich es also nicht einsehen. Dazwischen verlief eine Straßenüberführung, auf der so frühmorgens selten jemand unterwegs war.
Wenn man den Gleisen ein paar Kilometer in Richtung Norden folgt, kommt man zum Bahnhof Hirtentor. Dort verläuft die einstige Grenze zur städtischen Viehweide. Vor dem Bau der Bahnstrecke waren dort nur ein Zaun und im Zaun ein Tor, durch das die Hirten ihre blökenden und muhenden Herden trieben. Heute beginnt am Hirtentor eine ausgedehnte Weide für Züge statt für Schafe und Kühe, und gleich hinter der Haltestelle liegt ein Verschiebebahnhof von einem Kilometer Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung, auf dem lange Güterzugkarawanen abgestellt werden.
Am Hirtentor gibt es mehr Gleise und wesentlich weniger potenzielle Zeugen als unten am Hafen. Mehr Fluchtwege.
Dort sprayten wir oft.
Zwar patrouillierten auch die Ratten auf dem Gelände jenseits des Hirtentors häufiger, aber dort lagen mehr als zehn Gleise nebeneinander, und beim Sprayen konnten wir uns zwischen den Waggons verstecken, sogar in hellen Sommernächten oder im Winter im Scheinwerferlicht, das vom Schnee vervielfacht wurde. Westlich der Gleise stand ein dichter Wald, in dem wir Schutz suchen konnten, wenn Gefahr im Verzug war. Durch den Wald erreichte man einen hohen Felsen. Dorthin kamen sie nicht mit dem Auto. Mit ihren aufgepumpten Muskeln waren sie zwar fähig, nach Testosteron stinkende Gewichte zu stemmen, aber rennen konnten sie alle nicht.
Trotzdem durfte man sich nicht von ihnen schnappen lassen, denn dann wurde man verprügelt und für sämtliche Graffitis, die in früheren Jahren an Züge gemalt worden waren, zur Kasse gebeten. Für alle, nicht nur für die eigenen.
Die Ratten bezeichneten unsere Arbeiten als Schmierereien. Sie waren nicht dazu bereit, von Graffitis zu reden. Oder von Tags. Von Pieces. Von Stencils. Von Stickern. Vor allem aber waren sie nicht bereit, von Kunst zu reden.
Schmierereien.
Widerliche Schmierereien.
Schmierereien von beschissenen Schmierschwuchteln.
Bei den Ratten zu Hause hingen von der Großmutter geerbte Gobelins mit eingewirkten kämpfenden Auerhähnen. Das hielten sie für wahre Kunst.
Im vergangenen Jahr war der Rangierbahnhof am Hirtentor zu einem Ort geworden, an dem die Ratten und wir regelmäßig Katz und Maus spielten. Die Ratten wussten, dass wir uns dort aufhielten, und belauerten uns, und wir belauerten die Ratten.
Doch mittlerweile war Herbst, und sowie die Abende dunkler geworden waren, waren wir wie die Zugvögel gen Süden geflogen, näher ans Stadtzentrum und in dieser Nacht auf den Rangierbahnhof am Hafen, der kleiner war als die ausgedehnte Zugweide am Hirtentor.
Schon seit zwei Tagen standen auf den Gleisen unterhalb der Kirche sieben Waggons, die nur darauf warteten, einen neuen Anstrich zu bekommen. Sollten die Ratten ruhig am Hirtentor Wache halten. Wir arbeiteten hier, ohne dass sie es ahnten.
Jere
Raittila erläuterte uns per Landkarte die Anlage des Hafengebiets und geeignete Stellen, an denen wir uns auf die Lauer legen konnten. Er trug eine samtgrüne Weste aus Wollstoff, dazu eine Uhrenkette, als wäre er später noch zu einem Festmahl im neunzehnten Jahrhundert geladen. Wenn er an Abendeinsätzen teilnahm, zog er sich einen Overall über die Weste. Unter den Kollegen hieß es, er lege Weste und Uhrkette nicht einmal dann ab, wenn er sich mit seiner Frau im Bett abstrampelte.
Oder, nein, Raittila strampelte sich im Bett natürlich nicht ab. Er fragte seine Frau höflich: Darf ich um zwanzig Uhr null null Ihre Vagina mit meinem Penis penetrieren? Den Rhythmus ließ er sich von einem Metronom vorgeben.
Das Hemd wechselte er täglich.
Raittila vergewisserte sich, dass jeder seinen Platz kannte. Er hatte immer einen Stift in der Tasche, der sich zum Zeigestock ausziehen ließ. Damit deutete er auf die einzelnen Posten. Sämtliche Fluchtwege würden somit abgeschnitten, und dann fügte Raittila auch noch hinzu, wir hätten hoffentlich daran gedacht, uns warm anzuziehen, denn wir würden eine ganze Weile reglos dort auf unseren Posten ausharren müssen. Diesmal würden wir sie auf frischer Tat ertappen und den Schweinen die Haxen brechen.
»Endlich haben wir mal genug Leute«, erklärte Raittila, während er den Zeigestock zusammenschob. Er sah zu den Männern hinüber, die leihweise von der Niederlassung in Lahti zu uns gestoßen waren. Es reichte ihm nicht, dass wir einander zunickten. Wir mussten uns auch noch die Hand geben und uns vorstellen. Durch gute Manieren unterscheide sich der Mensch vom Barbaren, meinte Raittila.
Ich hatte die Namen der Männer aus Lahti sofort wieder vergessen. Aber ihr Händedruck war fest.
»Wir legen das Netz anfangs weit genug aus, um die Bazillen anzulocken«, fuhr Raittila fort. »Koivisto bleibt die ganze Nacht über als Späher auf dem Hafenkran. Er meldet sich, sobald die Bazillen gekommen sind. Dann ziehen wir den Kreis enger. Auf meine Anweisung. Das Meer macht die Überwachung einer Längsseite überflüssig, das erleichtert uns die Arbeit.«
Koivisto sei bereits oben auf dem Kran, erklärte er, mit zwei Lagen Unterwäsche und einem gefütterten Overall gegen die Kälte.
»Und wo pinkelt er?«, warf Hiililuoma ein.
»Er hat einen Pisspott dabei«, sagte ich.
Raittila funkelte mich so böse an, dass ich den Mund schnell wieder zuklappte.
»Einige von uns können sich tatsächlich besser beherrschen als andere – und zwar in jeder Hinsicht«, kommentierte er trocken.
Die Menge der Schmierereien an den Zügen und Bahnstrecken war in den vergangenen zwei Jahren auf das Sechsfache angewachsen. Im Herbst vor einem Jahr war das Ganze regelrecht explodiert, und die Bahn hatte uns damit beauftragt, die Schuldigen dingfest zu machen. Raittila hatte außer uns Sicherheitskräften auch einen Grafologen an der Hand, der festgestellt hatte, dass die Schmierereien von höchstens vier oder fünf verschiedenen Urhebern stammen konnten. Es war unsere Aufgabe, diese Zelle von Schmierterroristen auszuheben.
Bisher war es den Bazillen allerdings gelungen, uns zu entwischen. Wir hatten sie einige Male an den Bahndämmen auf frischer Tat ertappt, aber ehe wir sie hatten einbuchten können, waren sie auch schon in der Dunkelheit verschwunden gewesen. Sie erinnerten mich immer an nervöse Fliegen – nicht ganz einfach, sich ihnen unbemerkt mit erhobener Klatsche zu nähern. Einmal hatte ich mit Mattson und Hiililuoma zwei Bazillen durch mannshohes Farnkraut gejagt. Wir waren in vollem Tempo durch raschelndes Gebüsch und Mückenschwärme gerannt, und ich war felsenfest davon überzeugt gewesen, dass direkt vor uns die Kapuze der einen Bazille gewippt hatte. Dann standen wir urplötzlich mit nassen Schuhen und Strümpfen im Meer. Von der Bazille keine Spur. Wir kehrten mit triefenden Socken zurück. Mattson hatte sich im Geäst den Overall zerrissen.
»Wir sollten einen Antrag stellen und Hunde auf sie hetzen«, hatte Mattson gesagt, während er die Finger durch die Löcher in seinem Overall gesteckt hatte. »Wie bei Sträflingen auf der Flucht.«
Sobald wir aber auch nur einen von ihnen erwischten, war der Rest ein Kinderspiel. Die Schadenersatzforderung konnte pauschal dem einzigen Geschnappten aufgebrummt werden – ein guter Grund, um die Mittäter zu verpfeifen.
Und es gab noch andere Mittel, die Wahrheit ans Licht zu holen.
Der Sommer war erheblich ruhiger gewesen als die Zeit von März bis Mai. Wir hatten schon geglaubt, die Bazillen hätten das Ende ihres natürlichen Zyklus erreicht. Bei einer Morgenbesprechung im August hatte Raittila sogar Torte spendiert und voll Eifer erklärt, früher oder später würden die Bazillen in eine andere Stadt ziehen oder Kinder kriegen und einen Baukredit aufnehmen, fortan die übrigen Schmierer hassen und sich ihrer Vergangenheit schämen. Sie würden bürgerlich werden. Oder eine lange Asienreise antreten und mit wirrem Kopf an den Stränden von Goa vor sich hin gammeln oder im Indischen Ozean von Quallen versengt werden. In anderen Städten seien ähnlich schwere Schmierepidemien auch von allein vergangen. Wir hatten uns die Erdbeertorte schmecken lassen und genickt, aber dann waren vor drei Wochen auf dem Rangierbahnhof am Hirtentor in einer einzigen Nacht elf Waggons bemalt worden, und von Raittila war kein Wort mehr von Goa und Quallen oder vom bürgerlichen Leben einstiger Bazillen zu hören gewesen. Die Bahn hatte ihn zu einer Besprechung eingeladen – offiziell war es eine Einladung gewesen, in Wahrheit aber ein klarer Befehl. Raittilas Gesicht hatte geglüht wie Grillkohle, als er von der Sitzung zurückgekommen war. Er rief alle zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen, sogar diejenigen, die gerade freihatten. Als wir zur Baracke kamen, schickte Raittila uns in unsere Autos zurück. Eine lange Wagenkolonne fuhr hinter dem Boss her bis in die Nähe von Kyminlinna. Dort parkten wir auf einer Sandfläche.
Raittila führte uns schweigend durch einen Fichtenwald und befahl uns mit einer Handbewegung, die letzten dreißig Meter durchs Unterholz zu kriechen. Niemand protestierte, weil Raittila selbst in Weste und Nadelstreifenhose vorneweg über das feuchte Moos kroch. Von einem Bahndamm aus starrten wir zwischen den Fichten hindurch auf die leeren Gleise, die von Norden nach Süden führten.
Eine Viertelstunde später rumpelte ein Personenzug gen Norden. Eine geschlagene Stunde später ertönte das erste Knurren. Raittila fuhr uns an, unseren Ärger hinunterzuschlucken und unsere Mägen verdammt noch mal im Zaum zu halten. Wer sich bewegte oder auch nur einen Mucks verlauten ließ, würde gefeuert. Fristlos. Das gleiche Schicksal erwartete diejenigen, die rechts und links neben dem Jammerlappen lägen, damit dieser sich später in der Schlange beim Arbeitsamt nicht so einsam fühlte.
Nach zwei Stunden auf Posten war meine Kleidung durchnässt. Die Feuchtigkeit hatte sich vom Bauch über den ganzen Körper ausgebreitet. Ich zitterte unkontrolliert und hätte beim besten Willen nicht mehr aufspringen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Kriebelmücken und irgendwelche verdammten Gnitzen hatten meine Hände mit roten Quaddeln übersät, und aus dem Jucken im Gesicht schloss ich, dass meine Fresse inzwischen der Visage eines Windpockenpatienten ähnelte. Irgendwo in meiner Nähe nieste jemand. Raittila fauchte, der Nieser solle gefälligst still sein oder könne sich einen Job im Kindergarten suchen, als Kindergartentante dürfe er dann den lieben langen Tag ganz nach Belieben rotzen und schniefen. In der gesamten Zeit zählten wir drei in verschiedene Richtungen fahrende Personenzüge und einen Güterzug mit achtundzwanzig Waggons. Außerdem überquerten zwei Stadtkaninchen die Gleise.
Erst in der Abenddämmerung stemmte Raittila sich steif und mühsam wieder auf. Ich hörte, wie seine Knie knirschten. Er baute sich vor uns auf, zückte den Metallstift aus seiner Tasche und zog ihn zum Zeigestock aus. Dann dozierte er, wir hätten soeben nur genau das getan, was die Bazillen Abend für Abend und über Stunden täten, ohne sich zu beschweren. Sie hätten die Motivation, sie hätten den Willen, sie hätten die Geduld, auf den entscheidenden Moment zu warten, sie gingen mit glühender Leidenschaft an die Arbeit. Die Bazillen scherten sich nicht um Kälte, Nässe, Wind, Schneeregen und erst recht nicht um Regeln. Deshalb wären die Bazillen bei ihrer Arbeit auch so erfolgreich und wir nicht. Wir spielten uns mit unseren Knüppeln auf, dabei wären wir nichts weiter als ein Haufen fauler, bequemer, wabernder Sülzköpfe, die ihre Zeit lieber mit der Fernbedienung in der Hand auf dem Sofa verbrächten als mit ehrlicher Arbeit. Ein Haufen, der unter keinen Umständen seine Komfortzone verlassen wollte. Wenn der rotznäsige, schniefende, sein Doppelkinn mästende Couch-Potato-Trupp, den er hier vor sich sähe, auch nur ein Viertel vom Arbeitseifer der Bazillen besäße, hätten wir die Schmierer schon vor einem Jahr geschnappt.
»Die Bazillen fordern keinen Achtstundentag, sie jammern weder über Überstunden noch über ihr Gehalt. Sie bekommen nämlich gar nicht erst eins. Die Bazillen fordern keinen Nachtzuschlag, feiern nicht krank und nehmen keinen freien Tag, weil die Frau schon wieder ein Kind kriegt oder der kleine Ville Fieber hat.«
Während seiner Predigt hatte Raittila seinen Zeigestock der Reihe nach auf jeden von uns gerichtet. Beim Thema Geburt und bei Ville zeigte er auf mich.
»Ich käme unter Garantie besser zurecht, wenn ich euch feuern und stattdessen diese Bazillen einfach bekehren würde. Da würden beide Seiten Geld sparen, sowohl unsere Firma als auch die Bahn.«
Raittila machte auf dem Absatz kehrt und ließ uns Rotznasen in dem Fichtenwäldchen stehen.
Nach der Befehlsausgabe schwärmten wir aus. Meine Vierergruppe machte sich auf den Weg zum Hafen. Wir ließen den Wagen oberhalb des Hafengebiets stehen, an der Ecke neben dem Elektroladen. Hiililuoma, die beiden anderen Sicherheitsmänner und ich kletterten über den Maschendrahtzaun und liefen gebückt an einem länglichen Lagergebäude vorbei, dessen Wand fleckig war und abblätterte, als wäre sie von Schuppenflechte befallen. Linker Hand lag der Rangierbahnhof.
Wir vier hatten die Aufgabe, den Weg zur Überführung dichtzumachen. Die anderen Teams würden die Bazillen daran hindern, ins Stadtzentrum oder tiefer ins Hafengebiet zu gelangen. Jeder potenzielle Fluchtweg musste abgeschnitten werden.
Koivisto meldete vom Kran aus, noch seien keine illegalen Spieler auf dem Platz.
Aus unserem Kleeblatt waren nur Hiililuoma und ich mit Earbuds ausgestattet. Wir warteten hinter den Abfallcontainern beim Lagerhaus. Aus dem nächststehenden Container strömte süßlicher Fäulnisgeruch.
»Diesen Posten hat er uns doch aus purer Bosheit zugeteilt. Und vorher hat er noch einen Pferdekopf in den Container geschmissen«, zischte Hiililuoma.
»Ich kann die Waggons überhaupt nicht sehen«, flüsterte einer der anderen hinter ihm. »Wo sind die Scheißdinger?«
Es war einer von denen aus Lahti, die ich nicht kannte. Er sah aus, als wäre er kaum volljährig. Sein Gesicht war von Pickeln übersät. Ihm würde ein verdammt langer Abend bevorstehen, wenn er schon nach fünf Minuten die Schnauze voll hatte.
Mit der Tarnfarbe, die Raittila uns mitgegeben hatte, schwärzten wir uns gegenseitig die Gesichter.
Metro
Jetzt hörte ich das Klirren schon zum dritten Mal. Es flatterte aus etwa hundert Metern Entfernung aus dem Schatten bei den Trägerbalken der Überführung zu mir herüber. Diesmal war klar: Das Geräusch war alles andere als belanglos. Es schien, als hätte mit diesem Klirren irgendjemand verkündet, dass er von nun an unsere Zukunft beherrschte.
So wird man bei dieser Arbeit. Ein einziges Klirren ist ein dreihundert Seiten dickes Buch, das man zu deuten und zu verstehen sucht, während man immer schneller sprayt.
Wenn es von einer Ratte ausgegangen war, dann lauerten in der Nähe garantiert mehr davon. Ratten bewegten sich immer im Rudel.
Ich zupfte mir die Kapuze zurecht. Vor das Gesicht hatte ich mir ein Tuch gebunden, was gar nicht nötig gewesen wäre. Weiße Gesichter leuchten in der Dunkelheit heller als Reflektoren. Aber meine Haut ist dunkel. Mein Vater stammt aus dem Kongo, meine Mutter aus Kouvola.
Die Liebe hatte sie zusammengeführt, und meine Geburt hatte sie wieder getrennt.
Nachdem ich zur Welt gekommen war, hatten die beiden sich zunächst ein gemeinsames Zuhause eingerichtet und zwei Winter lang in einem Holzhaus gebibbert, in dem die Gardinen im Winter geschaukelt hatten, selbst wenn das Fenster geschlossen gewesen war. Später erfuhr ich, dass ich damals andauernd krank gewesen war, und das Verhältnis zwischen meinen Eltern war mit jeder meiner Erkrankungen angespannter geworden. Meinetwegen. In meinem dritten Herbst beschlossen sie, in eine Gegend zu ziehen, in der die Winter milder waren. Mutter schaffte es volle sechzig Kilometer weit nach Süden, bis ans Ufer des Finnischen Meerbusens. Mein Vater zog weiter.
Zuletzt hatte er mir vor fünf Jahren eine Karte aus Berlin geschickt.
Auf dieser Karte hatte er mich ermahnt, ein braves Mädchen zu sein und meiner Mutter zu gehorchen, und darum gebeten, ich möge ihm ein aktuelles Foto von mir schicken. Darunter hatte seine Adresse gestanden. Damals, mitten in der Pubertät, hatte ich kein Bedürfnis verspürt, ihm irgendwas zu schicken. Allenfalls ein Kilo Scheiße.
Jetzt, mit neunzehn, dachte ich ein wenig anders darüber, aber die Karte mit der Anschrift existierte nicht mehr. Die Karte hatte ich nach dem Lesen verbrannt, und die Adresse war mit ihr in Rauch aufgegangen. Ich erinnerte mich nur noch an das Bildmotiv, einen pinkfarbenen VW-Käfer.
Ich spähte unter dem Waggon hindurch. Auf der anderen Seite sah ich die Füße der Klappleiter, die Rust mitgebracht hatte. Der Rangierbahnhof fiel zum Meer hin ab. Hinter dem roten Felsen war der dröhnende Bass eines vorbeiratternden Zuges zu hören.
»Rust«, flüsterte ich.
Keine Antwort.
Das vierte Klirren.
Der September war die perfekte Zeit zum Sprayen. Die Nächte waren bereits dunkel, und niemand bemerkte uns, sofern wir außerhalb des Lichtkreises der Straßenlaternen blieben. Im August verbringen die Leute noch zu viel Zeit auf ihren Terrassen, schlendern spätabends draußen herum und wollen auch noch die letzten samtweichen Nächte des fliehenden Sommers einfangen, um die hinter der nächsten Ecke lauernden nasskalten Monate besser zu überstehen.
Der erste September ist die Grenze. Da sieht der Normalbürger entsetzt auf seinen Kalender und verschwindet abends in geschlossenen Räumen, ganz unabhängig vom Wetter. Selbst aus dem Fenster blickt er am liebsten erst, wenn im Februar die Sonne wieder hervorkommt.
Im Herbst leeren sich die Straßen der Stadt. Deshalb ist der Herbst auch die ideale Jahreszeit für Street Artists. September, Oktober, November. Dunkle Nächte, leere Straßen. Der Winter: nicht ganz so ideal. Im tiefsten Winter werden die Finger und die Farbe vor Kälte steif und fest, und im Spätwinter, wenn es wieder heller wird, treiben sich von Neuem Spaziergänger draußen herum, was im Vergleich zum Herbst regelrecht absurd erscheint. Während ein warmer Septemberabend die Menschen nach drinnen und unter die Decke scheucht, bringt eine beißende Frostnacht im April sie dazu, mit offenem Mantel und vor Begeisterung prustend durch die Straßen zu schlendern, als hätte man die Türen eines Irrenhauses geöffnet. Im Frühjahr müssen wir uns zusehends von den öffentlichen Orten zurückziehen, in leere Fabrikhallen und verlassene Gebäude.
Die helle finnische Sommernacht ist allerdings unser schlimmster Feind. Noch problematischer als die Ratten.
Aber in den Herbstnächten können wir im innersten Stadtkern arbeiten, und nur die Sterne leisten uns Gesellschaft.
RYEBR
Ich ging zur anderen Seite des Waggons hinüber. Im Nacken zwickte mich das Gefühl, dass mir die ganze Zeit jemand nachschlich, bereit, mich mit stählerner Pranke zu packen und durchzurütteln. Ich blickte mich flüchtig um, und meine Nackenhaare stellten sich auf.
»Rust? Rust?«
Ich flüsterte. Rust stand mit dem Rücken zu mir, völlig in seine Arbeit vertieft. Beim Sprayen vergaß er die Welt um sich herum.
Nur Amateure schalten ihren iPod ein und stecken sich Kopfhörer in die Ohren, während sie writen. Die Amateure werden als Erste geschnappt und zahlen die Zeche der Profis. Man muss Ohren haben wie eine Fledermaus.





























