
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mixtvision
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Lenni und Serkan sind beste Freunde. Bis der neue Mitschüler Benjamin auftaucht, die Theater-AG fast sprengt, einen beliebten Lehrer kritisiert und Rassismus offen anprangert. Lenni muss plötzlich Stellung beziehen. Aber für wen? Wer hat ihr eigentlich recht? Und was haben Elif und ihr Kopftuch damit zu tun? Ein hochaktuelles, aufrüttelndes Jugendbuch über Freundschaft und Liebe, über Leben und Tod, das für Diskriminierung sensibilisiert – ganz ohne erhobenen Zeigefinger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Shaïna
Die Arbeit an diesem Buch wurde unterstützt durch das Förderprogramm NRW Soforthilfe 2020, wofür die Autorin recht herzlich dankt.
© Kathrin Schrocke, 2023
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
© 2023 Mixtvision, Leopoldstraße 25, 80802 München
www.mixtvision.de
Alle Rechte vorbehalten.
Covergestaltung: zero-media.net, München
Layout und Satz: Nadine Clemens
E-Book Herstellung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-95854-990-6
Kathrin Schrocke
Weisse TrÄnen
17. Oktober 2016
PROLOG
Im ersten Augenblick bringe ich es komischerweise überhaupt nicht zusammen. Wir an der alten Eiche am See – und die blauen Lichter der Polizeiautos, die unwirklich durch die Nacht wabern und schlagartig eine Atmosphäre von CSI: Miami in unseren verschlafenen Schwarzwald-Ort zaubern. Wahrscheinlich hätten wir uns einfach später treffen sollen, nicht schon um zehn. War ja im Grunde klar, dass irgendwer um diese Zeit noch mal mit dem Hund eine Runde dreht. Oder ein altes Ehepaar ist um den See gewandert und hat den Notruf gewählt. Weshalb müssen Erwachsene ständig spazieren gehen? Und warum bitte nachts? Das finde ich tausendmal verdächtiger als ein paar Jugendliche, die unter einem Baum ein Grab ausheben.
Das blaue Licht schwappt über Elifs verschrecktes Gesicht, über die versteinerte Miene von Serkan und die weit aufgerissenen Augen und Münder von Luisa und Alex. Benjamin ist zu diesem Zeitpunkt zum Glück gerade pinkeln gegangen. Wirklich ein Glück. Ich will die deutsche Polizei nicht unnötig dissen. Aber man hört ja nichts Gutes über deren Umgang mit Schwarzen. Ich sage nur verdachtsunabhängige Kontrolle und so. Haha. Benjamin würde jetzt wahrscheinlich ausflippen, dass ich ihn schon wieder auf seine Hautfarbe reduziere. Und von verdachtsunabhängig kann in dieser Situation wohl auch nicht gerade die Rede sein. Aber wenn du von drei Polizeiautos eingekreist bist, deren Scheinwerfer die Szene beleuchten, werden dir die sichtbaren Fakten auf einmal sehr bewusst und dir ist klar, in welche Schublade die dich sofort pressen. Ich zum Beispiel stehe wie paralysiert da und halte dummerweise eine Urne in Händen. Elif hat als Einzige die Arme in die Luft gereckt, als würde die Polizei das von uns so erwarten. Leider hat sie mit der rechten Hand immer noch den Spaten umklammert und sagen wir so, Spürhunde oder superschlaue Tatort-Analysten müssen jetzt schon mal nicht mehr herbestellt werden. Serkan kniet nach wie vor vor dem ausgehobenen Loch, als wolle er die exakte Tiefe des Grabes vermessen. Den Polizisten ist in dem Moment vermutlich egal, dass ich normalerweise Klassenbester in Mathe bin. Dass ich letztes Jahr beinahe die Schachmeisterschaft »Schwarzwald Teens« gewonnen hätte und als Linksaußen im Fußballverein des Nachbarorts spiele. In diesem einen Moment bin ich bedauerlicherweise nur ein auf frischer Tat ertappter Grabräuber und/oder geisteskranker Störer von Totenruhe.
Ich wundere mich ehrlich gesagt kein bisschen, dass der muskelbepackte Polizist Luisa und Alex nach Hause schickt, als wären sie nur zufällige Zeugen des Ganzen. Aber klar, man nimmt nicht so gerne den Sohn des Bürgermeisters und die Tochter der Sparkassen-Filialleitung fest. Wahrscheinlich würden sie unter anderen Umständen sogar mich gehen lassen und nur Serkan und Elif zur peinlichen Befragung behalten.
Die Polizistin starrt misstrauisch auf Elifs Kopftuch und Serkan ist wahrscheinlich allein wegen seiner braunen Augen verdächtig. Aus einer Islamismus-Nummer wäre ich als Katholik definitiv raus und ich sehe genau, dass sowohl der kräftige Polizist als auch seine Kollegin versuchen, sich einen Reim auf all das zu machen. Das Problem ist nämlich, dass ich nun mal derjenige bin, der die Urne an sich gepresst hält. Modell Green Spirit, eigentlich für Waldbestattungen gedacht und laut Beipackzettel beeindruckend schnell und ohne Rückstände verrottbar. Aber natürlich verrottet das Ding nicht innerhalb von 15 Sekunden.
Mir ist vollkommen klar, dass ich spätestens JETZT richtig in Schwierigkeiten stecke und die Probleme der vergangenen Wochen nur das beschissene Vorspiel waren.
12. September 2016
1
»Morgen, Sportsfreund!« Mein Vater senkte die Zeitung. »Und? Bereit, das neue Schuljahr zu rocken? Du weißt ja: You only live once! Und wenn ich mich richtig erinnere, stehen die Mädels in der zehnten Klasse bei einem Schlange.«
Ja, eindeutig. Er war ein Android, ausgestattet mit einer peinlichen Software für Jugendsprache. Noch bevor mein Wecker gegangen war, hatte ich ihn zum morgendlichen Joggen aufbrechen hören. Jetzt saß er frisch geduscht und in eine Wolke HUGOBOSSgehüllt mir gegenüber und gab mir das Gefühl, ein Loser zu sein. Er schob die ungeöffnete Packung Müsli zu mir herüber. Auf dem Karton war ein gestreifter Strandstuhl abgebildet und wie ein Blitzlicht kam die Erinnerung an Saskia zurück: Wie sie mich auf Teneriffa in das kleine gelbe Holzhaus mit den Sonnenschirmen gezogen hatte, als hätte ich schon tausende Male mit älteren Mädchen herumgemacht und als hätte ich ein Diplom darin, ein echt kompliziert zugeknotetes Bikini-Oberteil fachgerecht aufzubekommen. Ich hatte stümperhaft überspielt, dass ich auf all diesen Gebieten ein absoluter Anfänger war, und nach einem missglückten Entkleidungsversuch (und unter dem aufgebrachten spanischen Wortschwall einer Putzfrau) waren wir verlegen zurück zur Karaoke-Party geschlichen. Ungefähr drei Tage lang war ich zu Saskias Schatten geworden. Ich hatte ihre Nähe am Büfett gesucht und war ständig in Blickachse ihrer Familie herumgelungert. Aber sie hatte mich mit tödlicher Kühle ignoriert. Als gegen Mitte der Woche ein durchtrainierter dänischer Rettungsschwimmer im Ferienclub angereist war, war ich endgültig zu Luft geworden. Während ich mir – neben ihr am Schokobrunnen stehend – übertrieben viele Erdbeeren auf einen Teller gehäuft hatte, hatte sie mir zugezischt: »Du bist echt niedlich und wahrscheinlich hast du einen tollen Charakter, Kiddo. Aber bitte hör auf, mich zu stalken. Ich war an dem Abend einfach lost und damit endet unsere Geschichte.«
Genervt riss ich an der Müslipackung herum. Warum ließ das dumme Ding sich bitte nicht öffnen? Vor meinen Eltern hatte ich sowohl meine ultrakurze Urlaubsromanze mit einer Zwölftklässlerin als auch meinen anschließenden Liebeskummer geheim halten können, aber innerlich litt ich immer noch wie ein Hund.
»Es wird langsam Zeit, dass du dich außerschulisch ein bisschen mehr engagierst, findest du nicht, Lenni?« Die Sätze meines Vaters vermischten sich mit der verblassenden Erinnerung an Saskias Lachen. Ich engagierte mich durchaus außerschulisch, aber leider waren die Dänen in dieser Disziplin eindeutig besser. Dad seufzte. »Gib rüber. Wie kann man nur so ungeschickt sein?« Mit einer lässigen Bewegung öffnete er die Verpackung. »Ehrenamtliche Betätigung ist gut für den Lebenslauf«, fuhr er fort. »In spätestens zwei Jahren wirst du es brauchen. Und ich spreche dabei nicht von der Theater-AG, sondern von richtigen Qualifikationen. Ich habe Herrn Regenmacher gestern bei der Gemeinderatssitzung getroffen und er ist der Meinung …«
Die Worte meines Vaters drangen nicht ganz zu mir vor. Durch die kleinen Fenster unserer Bauernstube konnte ich die ersten Schüler auf dem Weg Richtung Bushaltestelle sehen. Ich checkte müde mein Smartphone. Serkan hatte um 6:00 Uhr morgens einen Screenshot der Uhrzeit und ein kotzendes Emoji geschickt. Seufzend schüttete ich mir Haferflocken mit verschrumpelten, gefriergetrockneten Erdbeeren in eine Schüssel. Summer-Strawberry-Edition? Was für ein Fake! Ich schlang das Frühstück lustlos herunter. Wie unglaublich wäre das gewesen, nach den Ferien endlich eine Freundin zu haben! Sex oder zumindest so etwas Ähnliches gehabt zu haben. Aber ich Vollpfosten war bereits an der ersten kleinen Hürde gescheitert.
»Ich habe mir außerdem überlegt, ob du nicht in den Weihnachtsferien zwei Wochen bei meinem Kumpel Bernhard aushelfen willst?«, fuhr mein Vater unbeirrt fort. »Er kann Unterstützung momentan sehr gut gebrauchen. Du weißt ja, er ist ein begnadeter Schreiner.« Er schlürfte an seinem Kaffee.
Bernhard war vor allem ein begnadeter Sargbauer, was perfekt zu meiner Weltuntergangsstimmung passte. Mein Leben befand sich in einer Abwärtsspirale.
Ich starrte meinen Vater unglücklich an. Am liebsten hätte ich gesagt: »Ein dänischer Rettungsschwimmer hat mein erstes Mal vereitelt!« Stattdessen sagte ich: »Ich lasse mir das mit Bernhard durch den Kopf gehen. Könnte wohl einiges von ihm lernen.«
Verdutzt blickte mein Vater auf. »Cool!«, sagte er, sichtlich verwirrt, dass ich einen seiner Vorschläge tatsächlich in Betracht ziehen wollte. Über die Zeitung hinweg zeigte er mir ein strahlendes Lächeln. Seit einiger Zeit hatte ich den Verdacht, dass er eine Affäre mit seiner neuen Zahnärztin hatte. Sein Gebiss war mittlerweile so perfekt gebleacht, dass es nicht mehr als Alibi taugte.
Mom spazierte in die Küche, die Holzdielen knarrten. Meine kleine Schwester Jasmin folgte ihr auf den Fuß und zwängte sich zu mir auf die Eckbank. Im Vorbeigehen schaltete Mom das Radio an. Human von Rag’n’Bone Man füllte die Küche.
»Mama, was will ich später mal werden?«, fragte Jasmin. Ein aufgeschlagenes Freundschaftsbuch lag vor ihr. Erwartungsvoll und mit gezücktem Filzstift saß Jasmin da.
Unsere Mutter ging zum Wasserkocher und machte sich ihren stimmungsaufhellenden Kräutertee. Was Sinn machte, wenn man an ihren bevorstehenden Arbeitstag und die Vorliebe meines Vaters für seine Zahnärztin Frau Dr. Schnabel dachte.
»Was willst du denn werden?«, fragte sie über die Schulter hinweg.
»Tierärztin?«, überlegte Jasmin unsicher.
»Schreib Präsidentin der Europäischen Zentralbank«, schlug ich kauend vor.
»Lehrerin?«, fragte Jasmin ratlos.
»Du kannst alles werden, was du willst, mein Schatz«, sagte unsere Mutter aufmunternd. Jasmin kritzelte etwas in die Spalte, das verdächtig nach Topmodel aussah.
»Was ist mein liebstes Urlaubsland?«, fragte Jasmin weiter.
Jetzt wirkte Mama genervt. »Du hattest sechs Wochen Zeit, diese Fragen zu beantworten. Muss das jetzt fünf Minuten vor Schulbeginn sein?«
Meine kleine Schwester zog einen Schmollmund und sah unseren Vater Hilfe suchend an. Der zuckte mit den Schultern. »Du hast deine Mutter gehört«, fällte er ein Urteil. »Gib einfach zu, dass du es nicht ausgefüllt hast.«
Meine Eltern sind eine echte Bastion und seit ihrer Schulzeit zusammen, was einen gewissen Druck auf mich erzeugt. Ich meine ja nur. Sogar mein Vater mit dem Gebiss eines US-amerikanischen Talkshow-Moderators und seinem heißen Draht zur Sargbauer-Szene hat es irgendwann mal geschafft, jemanden abzuschleppen. Dass meine Eltern sich auch noch auf meinem Gymi kennengelernt hatten, machte die Sache nicht wirklich leichter.
»Dann mag sie mich aber nicht mehr«, beklagte sich Jasmin.
»Sie mag dich nicht mehr, wenn du ihr mit 14 ihren ersten Freund ausspannst«, tröstete ich sie. Jasmin kicherte und zeigte mir den Vogel. Mit ihren neun Jahren war es offenbar unvorstellbar für sie, dass sie sich irgendwann für mehr interessieren könnte als die Merchandise-Produktpalette der Eisprinzessin.
Das Telefon klingelte und meine Mutter griff nach dem Hörer. »Wehrle am Apparat?« Ihr Arbeitstag hatte endgültig begonnen. Ich schraubte das Nutella-Glas auf und steckte meinen Finger hinein. Missbilligend zog mein Vater die Augenbrauen nach oben. »Weißt du, wie viel Kalorien das hat? Wir sollten den Mist nicht mehr kaufen.«
»… im Krankenhaus oder zu Hause gestorben?«, hörte ich meine Mutter freundlich fragen.
Ach ja, ich habe vergessen zu erwähnen, dass meine Eltern zu allem Überfluss ein Bestattungsinstitut haben. Daher rührt vermutlich der Hang meines Vaters zu akribischer Lebensplanung. Man wartet außerdem ständig darauf, dass er einem reflexhaft Erde über den Kopf streut oder versehentlich anfängt, einen einzubalsamieren.
Ich schnappte meinen Rucksack.
»Pass auf dich auf!«, sagte Papa.
»Wenn ich tödlich verunglücke, seid ihr zwangsweise die Ersten, die es erfahren. Oder nicht?«, stellte ich fest. »Jasmin, du achtest darauf, dass sie meinen letzten Willen respektieren. Bitte verbrennt mich und verstreut meine Asche feierlich auf dem Drive-in vor McDonald’s.«
»Sehr witzig.« Mein Vater schüttelte humorlos den Kopf.
»Apropos McDonald’s. Hol dir nach der Schule bitte was vom Bäcker«, sagte Mom, die ihr Telefonat schon wieder beendet hatte. »Ich muss Jasmin mittags zur Reitstunde bringen.«
»Na toll!«
»Tu nicht so, dich habe ich auch schon zigmal zu irgendwelchen Fußballturnieren, Schachgruppen oder Freunden gefahren.«
Ich zog die Tür geräuschvoll hinter mir zu und ging zu meinem Fahrrad. Frustriert steckte ich mir die Kopfhörer ins Ohr, Happy von Pharrell Williams flutete meinen Gehörgang. Nichts klappte in diesem Scheißleben, alles lief schief: Ich war ein sechzehnjähriger Typ aus dem Schwarzwald, der auf Teneriffa sein Herz verloren hatte. Dessen Mutter ihm die Nahrungszufuhr verweigerte und dessen Vater jede Menge Leichen im Keller hatte. Lenni heiße ich übrigens nach dem Schutzheiligen Leonhard. Es wäre zumindest ein Lichtblick, würde ich nach Lenny Kravitz heißen.
Mein Handy ging, eine Nachricht von Serkan trudelte ein: SOS, ich werde von einem Nerd verfolgt! Ich antwortete mit einem riesigen Fragezeichen. Nichts. Er hob auch nicht ab, als ich anrief. Sofort schwang ich mich auf mein Fahrrad, um meinem besten Freund zu Hilfe zu eilen.
2
Ich raste über die Kreuzung, aber weder Serkan noch der Schulbus waren irgendwo zu sehen. Etwas außer Atem bog ich auf den Schulparkplatz ein und ergatterte einen der Rockstar-Parkplätze im Freien. Während ich hastig an meinem teuren Fahrradschloss drehte, ging mir folgendes Thema durch den Kopf: Ich war seit vier Monaten sechzehn. Aber die entscheidenden Entwicklungsschritte auf dem Weg zum erwachsenen Mann fehlten: Ich hatte noch keinen einzigen Rausch gehabt. Ich hatte nie heimlich das Auto meiner Eltern entführt, obwohl ich dank eines Youtube-Tutorials zumindest theoretisch wusste, wie man beim Überfahren einer roten Ampel eine erstklassige Vollbremsung machte. Und ich hatte noch nie eine feste Freundin gehabt, weshalb ich mich vor Teneriffa sogar mit der Frage herumgequält hatte, ob ich in Wahrheit schwul sein könnte. Aber weder hatte ich jemals irgendwelche leidenschaftlichen Gefühle für meinen besten Freund Serkan gehabt, noch hatte ich Bock auf die Aktionen der LGBTQ-Gruppe an meiner Schule.
Happy war aus, ich tippte auf Repeat und ging hinüber zum Eingang. Unter dem Schriftzug »Kant-Gymnasium« stand der schwärzeste Junge, den ich jemals gesehen hatte. Sein Outfit irritierte mich. Er steckte in einem gebügelten weißen Hemd mit schicker, schmaler Krawatte. Bei jedem anderen hätte diese Aufmachung unpassend gewirkt. Aber der Typ trug dazu einen beeindruckenden Afro. Bestimmt war er ein begnadeter Tänzer. Für einen kurzen Moment überlegte ich, ob unser Rektor den Jungen für ein PR-Foto herbestellt hatte. Wir hatten vergangenes Jahr das Label »Schule ohne Rassismus« erhalten und Herr Regenmacher, genannt Rainmaker, ließ keine Gelegenheit aus, in den sozialen Medien zu feiern, dass wir alle voll woke waren und Ausländerfeindlichkeit bei uns keine Chance hatte.
»Hi«, sagte ich zu dem Neuen.
»Hi«, er lächelte verkrampft.
»Ach, du bist schon da!«, hörte ich hinter mir eine vertraute Stimme. Serkan war endlich eingetroffen. Er hatte seine Schwester und seinen kleinen Bruder Ismet im Schlepptau. Gedankenverloren blätterte Ismet in einer zerfledderten Ausgabe von Geolino. Die Welt um sich herum schien er vergessen zu haben, während des Lesens bewegte er stumm seine Lippen. Serkans Hilferuf war offenbar bloß ein Witz gewesen. Mir fiel wieder ein, dass Ismet ab diesem Schuljahr auch zu uns aufs Gymnasium ging.
Elif sah mich mit einem strahlenden Lächeln an. Die Sommerferien waren lang gewesen und außer Serkan hatte ich keinen der Kayacans über Wochen gesehen. Seit Neuestem benutzte Elif Lippenstift. Er hatte die gleiche Farbe wie ihr blassrotes Kopftuch.
»Hi Lenni! Du bist verhaftet wegen sexy!« Sie umarmte mich und ein vertrauter Mädchenduft hüllte mich ein. Alles an Elif war weich und duftend und ich erinnerte mich gerührt daran, wie Serkan und ich uns vor Urzeiten im Kindergarten als ihre Beschützer aufgespielt hatten. Der kühle Stoff ihres Kopftuchs streifte meine Wange.
»Und du bist verhaftet wegen hot!«, antwortete ich grinsend. Wir pflegten dieses alberne Ritual seit vergangener Fasnacht, als Olli Schulzes Schlager mit dem tiefsinnigen Text auf unserer Schulparty rauf- und runtergespielt worden war. Elif war einfach nur süß. Und sie sagte meist unverblümt, was sie dachte.
»Was liest du da eigentlich die ganze Zeit, Ismet?«, fragte Serkan.
»Was über Spinnen. Wusstest du, dass manche Spinnen die Farbe wechseln können, um sich der Umgebung anzupassen?«
»Ja, klar«, sagte Serkan, »ein Schutzmechanismus.«
»Hast du etwa meine Hefte gelesen?«, fragte Ismet verwirrt.
»Nein. Aber alle Folgen von Spiderman gesehen«, witzelte Serkan.
Er streichelte Ismet über den Kopf. »Pack das Heft weg und verhalte dich wie jeder andere Fünftklässler an dieser Schule. Jage Pokémons, sammle Fußballsticker oder hab einen Wachstumsschub. Ich will nicht, dass die Leute dich für sonderbar halten.«
»Welche Leute denn?«, fragte Ismet und sah seinen älteren Bruder unschlüssig an.
Die Mitglieder der queeren Cheerleader schoben sich an uns vorbei. Ich schnappte das Wort Glitzerkanone auf und entschied endgültig, nicht dazu zu gehören.
Serkan sah in Richtung des Neuen. »Willkommen, Bruder!«, begrüßte er ihn. »Abgefahrene Krawatte. Aber brauchst du hier nicht. Ich heiße übrigens Serkan.« Er klopfte dem Jungen freundschaftlich auf die Schulter, als würden sie sich schon seit einer Ewigkeit kennen.
»Hi, ich bin Benjamin. Meine Familie ist vor zwei Wochen hergezogen.« Schlagartig wirkte der Neue entspannt.
»In welche Klasse gehst du?«, fragte Serkan neugierig. »Vielleicht kommst du ja zu uns, das wäre doch toll. Nicht wahr, Lenni?«
Sein Blick streifte mich, aber seine Aufmerksamkeit galt einzig und allein Benjamin. Wir stellten fest, dass er tatsächlich ein Neuzugang unserer Klasse war. Erst nachdem das geklärt war, schlug Serkan auch mir auf die Schulter.
»Benjamin?« Rainmaker war endlich eingetroffen. Er sah den neuen Schüler feierlich an. »Ich bin Herr Regenmacher. Du hast schon Freunde gefunden? Gut so, aber jetzt bringe ich dich erst mal ins Sekretariat.« Unser Rektor legte vertraulich den Arm um ihn. Es war ein kurioses Bild, weil Rainmaker seine übliche stonewashed Levis-Jeans trug, einen grobmaschigen Pulli und die obligatorischen weißen Sneaker dazu. Rainmakers Outfits waren aufdringlich jugendlich. Und Benjamin … war irgendwie overdressed und wirkte mit seiner Krawatte erwachsener als unser Rektor. Die zwei machten sich auf den Weg Richtung Sekri. »Wir sind hier sehr stolz auf die verschiedenen Nationalitäten unserer Schüler.« Rainmaker klang regelrecht beschwipst, als wäre Benjamin eine Trophäe. Und in gewisser Weise war er das auch: Er war der erste schwarze Schüler hier an der Schule. »Weißt du, die Frau unseres Bürgermeisters hier am Ort ist Französin …«, fuhr Rainmaker fort. Serkan lachte ungläubig.
»Ich bin Leipziger«, hörten wir Benjamin im Weggehen mit einem gereizten Unterton sagen. »Ich wollte Sie noch was wegen der Busverbindung fragen …«
»Na toll, das war’s jetzt endgültig mit unserem kläglichen Versuch, uns als Schule ohne Rassismus zu feiern«, murmelte Serkan müde.
Ich musterte meinen Kumpel unsicher. »Was meinst du damit? Regenmacher war doch übertrieben nett zu ihm.«
»Ja, eben …« Serkan zog eine Grimasse. »Kann er ihn nicht einfach ganz normal behandeln, so wie jeden anderen auch? Und was sollte der Hinweis mit den vielen Nationen?«
»Ist doch klar, dass er es bei Benjamin sagt«, legte ich ein Wort für Rainmaker ein. »Ich meine, es ist offensichtlich, dass er nicht von hier ist. Er wollte ihn halt beruhigen und hat es überhaupt nicht böse gemeint.«
Serkan starrte mich ein paar Sekunden lang schweigend an. »Ach, weißt du was? Lass gut sein, Lenni. Sonst wirst du mir unsympathisch.«
»Spinnst du?« Ich stieß meinen besten Freund ungläubig an. Ich verstand überhaupt nicht, was er von mir wollte.
Wir reihten uns in den Pulk an Ankömmlingen ein. »Hast du dich aufs Vorsprechen für die Theatergruppe vorbereitet?«, fragte ich, um endlich das Thema zu wechseln.
Serkan nickte verlegen. »Ja, hab ich. Was denkst du denn?«
Elif schob sich an uns vorbei. »Serkan hat jeden Tag geübt!«, platzte es stolz aus ihr heraus. Wie zufällig berührte sie meinen Ellenbogen. »Du bist doch auch wieder dabei, oder, Lenni?«
Ich nickte. Das Spielen lag mir nicht, aber es machte mir Spaß, mich um Licht und Sound und ein paar Effekte zu kümmern. Außerdem mochte ich Theaterleiter Prasch wahnsinnig gern. Und die Theater-AG war eine eingeschworene Gruppe. Gerüchteweise sollte es dieses Mal ein Musical werden.
»Wo ist die Aula?« Der zehnjährige Ismet drängte sich zwischen uns. Unter all den größeren Schülern wirkte er auf einmal schrecklich verloren.
»Na, denk mal nach«, sagte Serkan und deutete auf das unübersehbare Schild mit der Aufschrift Aula. »Immer dem Pfeil nach!« Er beugte sich zu seinem Bruder hinunter. »Du schaffst das. Streng dich an und sei nicht frech zu den Lehrern.«
»Ich bin nie frech …«, murmelte Ismet. Er fasste etwas ängstlich nach Serkans Hand. Der aber schob ihn seufzend in die Gruppe der anderen Fünftklässler und Ismet verschwand in der Menge.
Sorgenvoll sah Serkan seinem kleinen Bruder hinterher. »Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee mit dem Gymi war«, murmelte er leise.
»Jetzt hör endlich damit auf!«, sagte Elif entgeistert. »Er ist Einserschüler. Wenn du nicht an ihn glaubst, wer denn dann?«
»Natürlich glaube ich an ihn«, erwiderte Serkan. »Aber du weißt doch ganz genau, wie das ist. Ab sofort muss er sich doppelt beweisen.«
»Du bremst ihn mit deiner Ängstlichkeit richtig aus!«, sagte Elif. Serkan erwiderte etwas auf Türkisch.
»Chillt mal!« Ich kapierte nicht, was die zwei für einen Aufstand machten. Ismet würde den Schulstart schon packen. Ich hatte es damals doch auch geschafft. Und meine Noten waren echt mies gewesen. »Komm, wir müssen da rüber! Ich habe keine Lust, bei den Strebern in der ersten Reihe zu landen.« Ich zog Serkan von seiner kleinen Schwester weg und schenkte ihr ein entschuldigendes Lächeln. Elifs Gesicht wurde vom blassroten Stoff ihres Kopftuchs eingerahmt. Zum ersten Mal fiel mir auf, wie erwachsen sie wirkte.
***
Prasch stellte seine abgewetzte braune Ledertasche auf das Pult. Er sah mitgenommen aus. Zu Beginn des letzten Schuljahrs hatte er einen Herzinfarkt gehabt und war lange krankgeschrieben gewesen. Aber zum zweiten Halbjahr war er an die Kant zurückgekehrt und wir hatten unser Theaterstück wie geplant aufführen können. Wie alt war er eigentlich? Er war schon Lehrer hier gewesen, als meine Eltern Teenager gewesen waren.
Als könnte er meine Gedanken lesen, schlenderte er zum Fenster und blickte nachdenklich hinaus. »Ihr wisst ja vielleicht, dass es mein letztes Jahr hier ist«, sagte er mit seiner vertrauten Stimme zu unserer Spiegelung in der Fensterscheibe. Jetzt blickte er hinüber zu den Waldwipfeln auf der anderen Seite des Tals. Die Bäume bewegten sich sachte im Wind. Davor glitzerte der See, wie ein fernes Versprechen.
»Das Timing für meinen Abgang ist natürlich perfekt gewählt«, sagte Prasch, hörbar ironisch. »Es fällt mit den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Schule zusammen. Das heißt dann wohl: jede Menge kostenfreie Häppchen, Sekt und ein extra Budget für die Theater-AG. Ich würde ja gerne behaupten, ich hätte meinen Renteneintritt bewusst so gelegt. Aber es ist reiner Zufall.«
Mein Blick löste sich von Praschs Spiegelbild und wanderte über die Hinterköpfe meiner Mitschüler. Serkan und ich saßen auf unserem Stammplatz ganz hinten. Das Sonnenlicht brach sich in Luisas hellblondem Haar. Wie immer hockte sie in der ersten Reihe. Den Platz neben ihr besetzte Alex, der Sohn der Elternsprecherin und des Bürgermeisters. Er ging mir gewaltig auf den Sack, weil er ständig mit seiner französischen Zweisprachigkeit prahlte. Leider sah er auch noch verdammt gut aus. Es würde mich nicht wundern, wenn Luisa und er über kurz oder lang ein Paar werden würden. Ich konnte mir schon lebhaft vorstellen, wie sie bescheuerte Selfies von sich in die Welt hinausschickten. Die sozialen Medien waren für Menschen wie Luisa und Alex gemacht. Niemand hatte Bock, Fotos von mir zu liken. Das dumpfe Gefühl, ständig vom Leben benachteiligt zu werden, stieg erneut in mir auf. Die Welt war ungerecht. Wann fing endlich meine Glückssträhne an? Wann bot das Leben mir einmal etwas?
Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass auch Serkan nach vorne zu Luisa starrte. Luisa war der offizielle Star der Theatergruppe – übertrieben hübsch, übertrieben klug. Serkan wollte seit einer halben Ewigkeit bei ihr landen.
»Glaubst du, dass Luisa und Alex …« Serkan hatte sich zu mir gebeugt. Aber er kam nicht dazu, die naheliegende Frage zu stellen.
Prasch hatte sich zu uns umgedreht. »Also, alles, was ich damit sagen will: Reißt euch dieses Schuljahr ein bisschen am Riemen. Macht, dass es eine schöne Zeit und ein gelungener Abschied für mich werden. Ich will als alter Tattergreis nur schöne Erinnerungen an meine Jahre als Lehrer haben.«
Ich spürte einen Kloß im Hals. Ich wollte nicht, dass Prasch aufhörte. Er war mir in all den Jahren ein echter Vertrauter geworden. Er hatte mich motiviert, als meine Noten auf wackligen Beinen standen, und mehrmals mit Lehrern gesprochen, ein Auge zuzudrücken, damit ich nicht sitzen blieb. Vor allem aber würde er mir als Leiter der Theater-AG fehlen. Mir gefiel die Begeisterung und Leidenschaft, mit der Prasch tolle Stücke auf die Bühne brachte. Mir gefiel der Zusammenhalt unter den Theaterleuten, den er jedes Jahr schuf. Ich freute mich jetzt schon auf die legendären Grillpartys in seinem Garten.
»Ihr wisst also, was zu tun ist!«, sagte Prasch und hob mahnend die Hand. »Nervt mich nicht mit irgendwelchen Gendersternchen und zieht nicht spontan in den heiligen Krieg. Vor allem nicht, wenn ich euch dringend für die Theater-AG brauche!« Er sah von Pauline, die im letzten Schuljahr ein Referat über die Frauenbewegung gehalten hatte, zu Serkan und zwinkerte ihm zu. »Haben wir uns verstanden, Osama? Na, ihr wisst schon, wie ich es meine. Und macht mir gefälligst ein spektakuläres Geschenk zum Abschied.«
Die Klasse lachte. Prasch war bekannt dafür, dass er provozierte. Aber im Grunde seines Herzens war er ein echt netter Kerl. Serkan neben mir seufzte.
Es klopfte. Noch ehe Prasch die Tür erreicht hatte, wurde sie aufgeschoben und Rainmaker kam mit Benjamin herein.
Alle starrten in seine Richtung. Ein Tuscheln setzte ein, in der Mitte des Raums kicherte jemand. Rainmaker wippte aufgeregt auf seinen weißen Sneakern herum. »Ein paar von euch haben Benjamin schon kennengelernt!«, sagte er. »Bitte kümmert euch ein bisschen um ihn. Gibt es noch irgendwo einen Platz für ihn, Siggi?« Er hatte seine Frage direkt an Prasch gestellt.
Serkan hob hastig die Hand. Wir hatten extra einen Stuhl für Benjamin reserviert. Jetzt entdeckte er uns und nickte erleichtert. Noch ehe Prasch sein Okay geben konnte, kam Benjamin zielstrebig zu uns nach hinten gelaufen.
Rainmaker drückte dem überrumpelten Prasch einen Brief in die Hand. Dann verschwand er schnell wieder nach draußen.
Praschs Augen wanderten über das Schreiben. Er ging gemächlich zur Tafel und schrieb Benjamins Namen auf. Benjamin Schneidmüller. Die Kreide quietschte mit jedem Strich. Ich fragte mich, ob ich das versprochene Whiteboard vor dem Abitur noch erleben würde.
Luisa hatte sich zu uns umgedreht. Neugierig und mit sichtlicher Faszination musterte sie den Neuen.
»Woher kommst du, Junge?«, fragte Prasch freundlich, während er die Kreide zur Seite legte und dumpf in die Hände klatschte. Kreidestaub stob in die Luft – ein Regen aus winzigen weißen Pünktchen.
Benjamin kratzte sich an der Schläfe. »Aus Leipzig.«
Verblüfft lächelte Prasch. Er drehte sich zu dem Namen um, studierte ihn eingehend und sah dann Benjamin wieder an. »Ich sehe und staune.«
Er öffnete seine Tasche und holte gemächlich ein paar Sachen heraus: ein glänzendes neues Leder-Etui mit Stiften, sein dickes taubenblaues Notizbuch. Taschentücher und die Zitronendrops, die er bei jeder Gelegenheit kaute. »Ich meine, wo kommst du wirklich her?«, fragte er, während er ein Bonbon entpackte. »Somalia oder Ghana vermute ich?«
»Nein«, sagte Benjamin. »Ich bin in Leipzig geboren. Meine Mutter ist auch in Leipzig geboren. Mein … «
»Schon gut«, winkte Prasch ab. Und dann in breitestem Sächsisch: »Ein Ossi also. Mir soll’s recht sein, wenn dir das lieber ist.« Prasch erntete ein paar vereinzelte Lacher. »Nichts für ungut. Ich bin Geschichtslehrer«, sagte er wieder in seinem normalen Dialekt. »Deshalb interessieren mich Hintergründe.«
»Wo kommen Sie denn her?«, drehte Benjamin den Spieß einfach um. Ich bemerkte, wie der Anflug eines verblüfften Lächelns in Serkans Gesicht entstand.
»Na ja, von hier natürlich«, sagte Prasch irritiert. »Hier geboren, nie hier weggekommen. Ein echtes Landei also. Weißt du, Benjamin, ich habe nur eine höfliche Frage gestellt. Das war reines freundliches Interesse am Gegenüber. Man muss dem anderen nicht immer gleich das Schlechteste unterstellen.« Jetzt griff er sichtlich genervt nach dem Schwamm. Langsam wischte er Benjamins Namen weg. Die Buchstaben verschwanden, einer nach dem anderen.
3
Jasmin stieß ohne zu klopfen die Türe auf und stolperte barfuß in mein Zimmer. Das Konzept von Privatsphäre hatte sie immer noch nicht kapiert. Oder ich rangierte in ihrer Wahrnehmung unter einem Haustier, das man jederzeit nach Lust und Laune belästigen konnte.
»Du sollst klopfen!«, sagte ich ungehalten.
»Warum?« Sie sah mich mit Unschuldsmiene an.
»Weil ich vielleicht nicht gestört werden will? Oder etwas mache, das dich nichts angeht!« Ich dachte an Saskia, auf die ich mir inzwischen ungefähr eine Million Mal einen runtergeholt hatte. Die Vorstellung, dass meine Eltern oder meine kleine Schwester hier hereinplatzten, während ich … Es war demütigend, ein Teenager zu sein.
Jasmin spazierte an mir vorbei Richtung Fenster, ging auf die Zehenspitzen und spähte hinaus. Obwohl schon September war, herrschte draußen herrlichstes Wetter. Die Hitze hatte sich unter den Balken gestaut, aus dem Erdgeschoss wehten Celloklänge nach oben. Ab sechzehn Uhr war der Trauer-Raum des Beerdigungsinstituts für Besucher geöffnet. Schon jetzt roch es im ganzen Haus nach Kerzenwachs und ätherischem Öl – ab Punkt vier Uhr mussten wir Lebenden uns unauffällig verhalten. Soweit ich wusste, hatte heute Korbinian Dienst. Er war der wichtigste Mitarbeiter meiner Eltern.
Ich hockte auf meinem Bett unter der Dachschräge und scrollte mit dem Handy durchs Netz.
»Serkan kommt auf seinem Mofa angerollt!«, berichtete Jasmin von ihrem Wachposten am Fenster aus. Serkan war nach dem Unterricht noch zum Getränkemarkt gefahren, wo er seit letztem Jahr jobbte. Offenbar hatten sie ihn früher wieder nach Hause geschickt.
Ich schaltete die Musik leiser. Bosse sang über die schönste Zeit und den ersten Kuss. Und verlaufenen Kajalstift von irgendeinem Mädchen, das er liebte und wegen dem er später zusammenbrach. Offenbar war er auch auf Teneriffa gewesen.
»Serkan parkt sein Mofa«, berichtete Jasmin, als wären wir vom Verfassungsschutz und würden einen Verdächtigen bewachen.
Serkan schaute vor der Heimfahrt meist noch kurz bei mir vorbei. Er lebte mit seiner Familie in der nächstgrößeren Stadt. Sein Vater war stellvertretender Filialleiter im Supermarkt hier im Ort. Das war auch der Grund, warum seine Kinder die Kant besuchten. Er nahm sie morgens auf dem Weg zur Arbeit mit. Den Heimweg mussten sie mit dem Bus zurücklegen. In der Stadt hatten wir im gleichen Wohnblock wie die Kayacans gewohnt, damals, als meine Eltern noch Studenten gewesen waren. Serkan und ich waren zusammen in den Kindergarten gegangen, während Mama und Papa versucht hatten, trotz Uni-Stress ein normales Familienleben zu führen. Aber dann hatte sich alles schlagartig verändert, als meine Großeltern verunglückt waren und mein Vater von heute auf morgen das Beerdigungsinstitut geerbt hatte. Wir waren hierhergezogen und hatten ein ganz anderes Leben begonnen. Der Kontakt zu den Kayacans war jäh abgebrochen. In der fünften Klasse hatte ich Serkan dann überraschend am Gymi wiedergetroffen und es war sofort die gleiche Vertrautheit und Nähe wie damals entstanden. Jasmin war erst geboren worden, als Oma und Opa bereits gestorben waren. Sie konnte sich überhaupt kein anderes Leben als dieses hier vorstellen. Und auch meine Erinnerungen an die Großeltern, die Stadt und unsere kleine Wohnung ohne Balkon verblassten.
»Serkan kommt ins Haus!«, berichtete Jasmin.
Ich checkte noch rasch meine Nachrichten. Rainmaker wünschte über den Instagram-Account @KantSchulefuerVielfalt allen Schüler*innen ein erfolgreiches Schuljahr und verkündete, dass die Schulchronik dank einer Spende dieses Jahr auch in Blindenschrift gedruckt werden würde. Gab es irgendeine blinde Person an der Schule? Würden sie jemandem die Augen ausstechen, damit wir eine Quote erfüllten? Irgendwie kam ich bei all der Inklusion nicht mehr mit.
Ich klickte Rainmaker weg. Der Typ musste es immer übertreiben.
»Serkan kommt die Treppe rauf!« Jasmin hatte sich vorfreudig vom Fenster abgewandt und starrte zur Tür. Es klopfte. Serkan wusste eben genau, dass die Erde sich auftun konnte, wenn man ohne Vorwarnung in Zimmer von Sechzehnjährigen platzte.
»Serkan darf eintreten!«, sagte ich laut. Und an Jasmin gerichtet: »Jasmin geht in ihr eigenes Zimmer!«
»Sprichst du nur noch in der dritten Person und im Befehlston mit uns?«, fragte Serkan. Er warf meiner kleinen Schwester lächelnd eine Capri-Sonne zu. Mama erlaubte das gelbe Gesöff nur zum Kindergeburtstag. »Klingt, als würdest du die Welt regieren, Lenni. Was ein riesiges Missverständnis ist, Digger.« Er stellte seinen Rucksack neben den Schreibtisch und reichte mir einen Werbezettel. »Wegen mir kann Jasmin ruhig bleiben.«
»Cool! Die neue Superhelden-Edition!« Schon hatte Jasmin mit dem Strohhalm die Verpackung aufgespießt und schlürfte den Inhalt.
»Wegen mir aber nicht«, sagte ich und starrte begriffsstutzig auf den Flyer. Es war eine Werbung für Federkernmatratzen. Erst dann las ich »Dänisches Bettenlager« darunter.
»L-O-L«, sagte ich in Superzeitlupe. »Musst du noch extra Salz in die Wunde streuen?« Serkan war der Einzige, der von Saskia wusste.
»War nur ein Joke!«, antwortete Serkan versöhnlich. Er riss die Tüte Chips auf, die neben meinem Computer lag und stopfte sich eine Handvoll in den Mund. »Habe noch nichts zu Mittag gegessen.«
»Bedien dich«, sagte ich überflüssigerweise. »Und nimm deinen Dänisches-Bettenlager-Flyer wieder mit.«
»Im Urlaub war auch jemand aus Dänemark!«, griff Jasmin das Stichwort dankbar auf. Sie walzte mit der Handfläche über die leere Getränke-Packung. Eine blond gelockte Superwoman würde Einzug in ihre Sammlung finden. »Er hieß Eldar und hat mir gezeigt, wie man krault. Und Mama hat er beigebracht, wie man jemanden aus dem Wasser rettet, der unmächtig ist.«



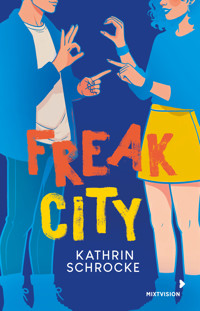















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









