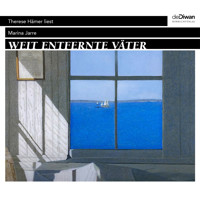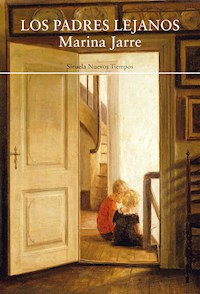Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Marina Jarre ist eine zutiefst originelle, kraftvolle und prägnante Schriftstellerin, ihre Bücher sind unverzichtbare Meisterwerke.“ Claudio Magris Das kleine Mädchen Marina lügt gern und mit poetischer Hingabe. Ein Akt rebellischer Selbstbehauptung gegenüber einer Welt, in der es die strengen Regeln der Mutter gibt, um deren Liebe sie ringt, aber auch den glutäugigen Vater, der erst mittags aufsteht und sich an keinerlei Regeln zu halten scheint. Einer Welt, in der sie getauft und trotzdem jüdisch sein soll – wie ihr russischer Großvater, den die Mutter verachtet. Marina Jarre erzählt von der Kindheit im multikulturellen Riga der 1930er Jahre. Vom jähen Bruch, als sie nach der Trennung der Eltern zu ihren Großeltern ins faschistische Italien kommt. Von der Aneignung einer neuen Sprache, in der sie zu ihrer Stimme und ihrer Wut findet, in der sie mit ihren Kindern spricht und sich von der Tochterrolle befreit, von der Wandlung der kleinen Lügnerin zur großen, wahrhaftigen Schriftstellerin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Das kleine Mädchen Marina lügt gern und mit poetischer Hingabe. Ein Akt rebellischer Selbstbehauptung gegenüber einer Welt, in der es die strengen Regeln der Mutter gibt, um deren Liebe sie ringt, aber auch den glutäugigen Vater, der erst mittags aufsteht und sich an keinerlei Regeln zu halten scheint. Einer Welt, in der sie getauft und trotzdem jüdisch sein soll — wie ihr russischer Großvater, den die Mutter verachtet.Marina Jarre erzählt von der Kindheit im multikulturellen Riga der 1930er Jahre. Vom jähen Bruch, als sie nach der Trennung der Eltern zu ihren Großeltern ins faschistische Italien kommt. Von der Aneignung einer neuen Sprache, in der sie zu ihrer Stimme und ihrer Wut findet, in der sie mit ihren Kindern spricht und sich von der Tochterrolle befreit, von der Wandlung der kleinen Lügnerin zur großen, wahrhaftigen Schriftstellerin.
Marina Jarre
Weit entfernte Väter
Roman
Aus dem Italienischen von Verena von Koskull
Hanser Berlin
Der Lichtkreis
Meiner Schwester Sisi
Es gibt Tage, an denen ist der Himmel über Turin gewaltig. Tage sommerlicher Schwüle, wenn die Hitze von morgens an über dem Horizont liegt, auf der einen Seite über den Hügeln und auf der anderen über den Bergen. Im Morgengrauen rauschen die Bäume in weiten, laubigen Wogen, eine sachte und stete Bewegung, die über die ganze Stadt hingeht. Der Himmel ragt in mattem, gleichförmigem, wolkenlos gelblichem Grau und regt sich nicht. Unter diesem Himmel fliegen und zwitschern die Schwalben. Wenig später, gegen acht, schließen die immer sachter wogenden Bäume das Zwitschern in sich ein, bis ihre Bewegung verebbt, der Himmel sich blendend gelb färbt und das Geräusch der Autos die Straßen erfüllt.
Hin und wieder höre ich Gianni oder einen seiner Freunde über das Turin ihrer Kindheit und Jugend reden, als sie im »Italia« eislaufen gingen; hier führte die Fußgängerbrücke über die Gleise, dort lief man durch die Straße mit den Puffs oder durch die noch unbegradigte Via Roma entlang der alten Läden. Turin endete am Ospedale Mauriziano, dahinter lagen die Wiesen.
Beim Reden über dieses Turin klingen Gianni und seine Freunde kein bisschen betrübt, sie trauern nichts nach. Nur den Schienen der Tramlinie 8, die vor ein paar Jahren herausgerissen wurden, habe ich Gianni nachtrauern hören. »Die werden schon sehen«, sagte er grimmig, »wenn es kein Benzin mehr gibt!« Einmal, bei einem Spaziergang durch den Parco del Valentino, trauerte er auch der riesigen Araukarie im Botanischen Garten nach, deren gekappter Stamm als gigantischer, grauer Stumpf über die Mauer ragt.
Er redet von Menschen, und während er redet, zieht die Stadt sich zu einem engen Kreis zusammen, in dem jeder jeden kannte.
»Die hatte schon als Kind krumme Beine«, bemerkt er, als er eine Dame überholt.
»Kennst du sie?«
»Nein, aber wir sind zusammen zur Grundschule gegangen; sie war auch auf der Silvio Pellico.«
Er trauert dem Turin von früher nicht nach, überlege ich, weil er es nicht verloren hat. Er hat seine Kindheit nicht verloren.
Oft bin ich auf die Kindheit der anderen neidisch. Manchmal beneide ich ganz plötzlich sogar ein Kind im Kinderwagen oder eine junge Schwangere mit ihrem hübschen, anmutigen Babybauch. Der Neid wurzelt im altbekannten Unbehagen, dass ich nachfragen muss, dass ich ausgeschlossen bin, und in der Wehmut, die ich wiederum für das Turin von früher empfinde, aus dem, ganz nahtlos, das Kind im Kinderwagen und die anmutige junge Frau mit ihrem prächtigen Babybauch hervorgegangen sind.
Das Bedauern, das Gianni und seine Freunde offenbar nicht empfinden, speist sich eben aus dem, was ich nicht weiß, was ich nicht gesehen habe, aus Gerüchen, die ich nicht gerochen habe, aus der Existenz dieser Frau, die ich nicht gewesen bin.
Seit weit über dreißig Jahren lebe ich in Turin und kenne die neue Stadt, die sich ringförmig um den alten Kern ausgedehnt hat, in- und auswendig, sie ist mit mir erwachsen und alt geworden, die riesigen, von Mietskasernen lückenlos gesäumten Straßen im Süden und Westen; die neuen Einfamilienhäuser in den Wohnvierteln der Hügel, die nebligen, sich lichtenden Viertel an der Autobahn Richtung Mailand, wo es entlang der Straße nichts als Tankstellen zu geben scheint, und darüber nachtfunkelnde Leuchtreklamen.
Einmal verbrachte ich den Sommer in Turin mit einem Pflanzenbestimmungsbuch. Nachmittags um fünf verließ ich das Haus und wanderte an den Grünanlagen im Zentrum und im Viertel Crocetta entlang, besuchte die öffentlichen Parks und bestimmte anhand der Beschreibungen und Abbildungen im Buch die Bäume.
Der Sommerwind stob staubigen Papiermüll zur dichten Kuppel der Rosskastanien empor. Im Garten nebenan blühte ein Schnurbaum, auf den den kleinen Grünflächen in der Via Bertolotti verblühten die Seidenbäume. In den Giardini Lamarmora leuchteten die Blätter der Judasbäume, wenn sich die Abenddämmerung wegen der Gewitter, die jeden Sommer wie schwarze, sich mal im Norden, mal im Süden öffnende Schotten die Stadt umkreisen, bläulich färbte, dann also leuchteten die Blätter der Judasbäume in hellem, sattem, blau bestrahltem Grün.
Während ich mich umblickte — ist das wohl eine Flügelnuss oder ein Götterbaum? —, durchrieselten mich Schauder von Verbundenheit, die, obschon diffus und ungerichtet, denen galt, die, wie ich, des Sommers in Turins Straßen unterwegs waren.
Während ich die Orte Straße für Straße erwanderte, auf den von Staub, Papier, zerschmolzener Eiscreme, Kondomen, Spritzen und Hundekot verdreckten Gehsteigen, wurde die Straße selbst zu einem Ort, zum einzig möglichen, von den anderen Orten ununterscheidbaren Ort, und die Menschen auf dem Gehsteig und ich mit ihnen voneinander ununterscheidbar.
Neue Mietshäuser wuchsen an neuen schlammigen, endlos nackten Straßenzügen in die Höhe, verletzlich zunächst in ihrer versprengten Einsamkeit, dann eingehegt zwischen erdigen, mit mageren Bäumchen bepflanzten Inseln — Zürgelbäume? —, und plötzlich durchschnitten gerade Ahornreihen den großen Parkplatz zwischen dem Krankenhaus San Giovanni Vecchio und dem Palazzo della Borsa: willkürliche Veränderungen, anfällig für weitere abenteuerliche Wandlungen, durch unsichtbare Hand und über Nacht. Geschmackssache, die Telefonzellen, die genauso aussehen wie die Zeit-und-Raum-Transporter aus Science-Fiction-Filmen, dabei ganz klar als solche erkennbar, um ihrerseits die tägliche Notwendigkeit und Natürlichkeit solcher Teleportationen zu bezeugen.
Dies ist der namenlose Ort, anderen Orten gleich, und meine Zeit, der Zeit der anderen gleich. Ich werde nicht mehr fliehen.
Als ich mir als Kind vorstellte, von zu Hause fortzulaufen, war Italien das Land meiner Zuflucht. Italien, die Heimat meiner Mutter, wo es immer warm war und man lange Stunden im Garten verbrachte. Was machte da schon der Durchfall, der meine Sommerferien wegen des zu vielen, noch grün von den Bäumen gepflückten Obstes begleitete.
Meine Schwester und ich sind in Riga geboren.
Ein Foto von mir mit fünf Jahren: Das Haar zu zwei dicken Zöpfchen links und rechts neben dem kleinen Gesicht geflochten, gekleidet in das feine Kordsamtkleidchen, das, wie alle anderen, meine Mutter ausgesucht hat, und darüber die dünne Hausschürze, stehe ich neben dem Puppenhaus und halte mit einer Hand meine Babypuppe Willi fest, die auf dem flachen Dach neben dem Käfig des Kanarienvogels Pippo sitzt. Ich deute ein kleines, stures Lächeln an und blicke seitlich in die Ferne.
Mit dem gleichen verkappten Lächeln über dem störrischen kleinen Kinn und abermals mit abgewandtem Blick sitze ich auf einer anderen Fotografie neben meiner Mutter und meiner Schwester, die mit neugierig strahlenden Augen geradeaus schaut. Auf dem mir zugewandten Profil meiner Mutter liegt ein stolzes und gerührtes Lächeln. Im Augenwinkel hat sie zwei winzige Falten.
Mein Selbstbild ist mit den Ängsten verbunden, die ich hatte; meine Wahrnehmung der anderen mit dem Auftauchen meiner Schwester in meinem Leben.
Wir gehen in den Kaisergarten, ich habe die Hände auf die Stangen des Kinderwagens gelegt, in dem meine Schwester liegt. Ich glaube, ich schiebe ihn, und erinnere mich noch genau an das Funkeln der Stangen vor dem Gesicht. Hinter mir geht das Kindermädchen, und natürlich schiebt sie den Wagen. Aber ich denke: »Jetzt werden alle mich sehen und sagen, was für ein liebes Mädchen, das sein Schwesterchen spazieren fährt.« Wir treffen jemanden und bleiben stehen. Und dieser Jemand über mir sagt auf Deutsch: »Was für Augen die Kleine hat, wie zwei schwarze Pflaumen.« Sofort ist mir klar, dass es die Augen meiner Schwester sind, die wie zwei schwarze Pflaumen aussehen. Das Wort Pflaume hat einen unendlich sanften Klang. Und meine Mutter wiederholt diesen Klang, als das Kindermädchen ihr später davon erzählt.
In der Nacht träume ich, wie ich auf demselben Gehsteig über die Ahornblätter laufe; neben mir geht ein winzig kleines, weißliches, weiches Wesen. Ich zerquetsche es, und es zu zerquetschen, gibt mir ein gewaltiges Gefühl von Macht. Ich weiß, dass es »lebt« und dass ich es töten kann. Dass ich über es verfüge. Ein anderes Mal finde ich gleich mehrere davon auf einem Mäuerchen und zerquetsche sie ebenfalls. Dort, wo ich sie zerquetscht habe, bleibt ein großer Fleck zurück. Wenn ich wach bin, erschrecken mich diese Träume: Wenn ich wach bin, kann ich niemandem etwas zuleide tun und nicht einmal hinsehen, wenn die Kutscher ihre Pferde peitschen. Man hat mir erzählt, gestürzte Pferde mit einem gebrochenen Lauf müsse man töten, denn »wenn ein Pferd stürzt, kommt es nicht wieder hoch«.
Bei unseren Gängen zum Kaisergarten muss ich kaum älter als zwei gewesen sein, denn der Altersunterschied zwischen mir und meiner Schwester beträgt nur dreizehn Monate. Aus diesen dreizehn Monaten stammen auch die beiden Fotos aus unserem Familienalbum. Auf dem ersten, das mein Onkel geknipst hat, sitze ich nackt auf einem Korbstuhl in der Sonne, im Garten vor dem Haus meiner Großeltern mütterlicherseits in Torre Pellice. Ich lache über das ganze Gesicht, und meine Mutter steht hinter der Stuhllehne und beugt sich lächelnd über mich. Auf dem anderen Bild, das ein Fotograf aufgenommen hat, lehne ich mich stehend an meine Mutter, die in einem sehr weiten Kleid neben mir auf den Knien hockt. Ich habe ein winziges, ernstes Gesicht, kleine Augen, eine kleine Nase, einen kleinen Mund und spärliches, glattes Haar. Auf der Rückseite des Fotos steht ein handschriftlicher Vermerk meiner Mutter, in dem sie mich »Marinette« nennt. An diesen hübschen Namen habe ich keinerlei Erinnerung. Als kleines Mädchen wurde ich »Miki« genannt — ein Spitzname, den mir meine Schwester gab —, und meine Großmutter mütterlicherseits nannte mich Mina, mit französischer Betonung auf dem a.
Gut möglich, dass meine Liebe für die nackte Herbst- und Frühlingssonne, die besonders klar und kühn durch die Stämme und kahlen Zweige zu blitzen scheint, Teil jener dreizehn Monate ist, die zwischen meiner Geburt und der meiner Schwester liegen. Jedes Mal versuchen sie dann Gestalt in mir anzunehmen, Erinnerungen an nicht erlebte Begebenheiten oder an nicht bewusst wahrgenommene Empfindungen, und ich sage: »Das ist gut so, ich habe keine Angst.« Oder: »Ich bin, wie ich bin, und das will ich genießen.«
Doch vor allem habe ich das Gefühl, woanders zu sein, die ersten Schritte eines anderen zu tun.
Dabei wusste ich sehr früh, wo ich mich befand, obwohl sich mein Bewusstsein auf den jeweils gegenwärtigen Ort und die jeweilige Zeit beschränkte — mein Zimmer, die Straße vor unserem Haus, das vom Meer gestreifte Stück Strand — und Ortswechsel ausblendete. An jenem Ort und in jener Zeit war jede meiner Gesten und jedes Wort zutiefst bedeutsam und entscheidend. Ich bannte die Ereignisse in einem Rahmen, um mich ihnen sofort stellen zu können — zunächst erschienen sie mir allesamt bedrohlich —, und wusste nicht, dass man warten oder die Dinge aufschieben konnte.
Ich hatte daher viele Ängste — ich war feige, sagte meine Mutter —, in denen sich Menschen und Orte mischten: Es gab Menschen, die mich in Bedrängnis brachten, Orte, die beängstigende Wesen heraufbeschworen. Doch an jedem Ort und in jedem Augenblick suchte ich nach dem Mittel, der Geste oder dem Wort, um meine Ängste allein zu bewältigen. Ich war auch eine Lügnerin, sagte meine Mutter.
Ich fürchte mich vor meiner Mutter, ich fürchte mich vor ihr, wenn sie da ist, und sehne mich nach ihr, wenn sie nicht da ist. Ich bekomme zu hören, diese Liebe würden alle Kinder für ihre Mutter empfinden. Und ihre Mama liebt sie ebenfalls, weil sie gelitten hat, um sie zur Welt zu bringen. Das verstehe ich nicht, warum liebt sie sie, wenn sie gelitten hat? Hingegen verstehe ich sehr wohl, warum die Mama die Kinder macht und dass man ihr im Krankenhaus den Bauch aufschneiden muss, um sie herauszuholen.
Als ich geboren wurde, ist meine Mutter auch ins Krankenhaus gegangen. Bevor ich zur Welt kam, hat sie sich wochenlang übergeben; sie blieb an den Lattenzäunen stehen, um sich in Ruhe zu übergeben. Am Abend vor meiner Geburt hat sie aufgehört, sich zu übergeben. Ich bin ein paar Wochen zu früh geboren. Das sollte doch nun endlich mal ein Vorzug sein, aber das ist es nicht, denn es war meine Mutter, die mich zu früh hat kommen lassen, weil sie auf eine Leiter gestiegen ist, um ein paar Marmeladengläser auf den Schrank zu stellen.
Dann habe ich immer grün in die Windeln gemacht und nachts geweint.
Ich habe spät laufen und spät sprechen gelernt; man hielt mich für dumm, doch die alte Njanja, die mit mir spielte, wenn ich nachts wach wurde, und mir russische Lieder vorsang, sagte, ich sei hochintelligent.
Die Erwachsenen haben keine Angst, das ist der Unterschied zwischen ihnen und mir. Ich weiß nicht, ob sie gut daran tun, keine Angst zu haben: Sie laufen über zugefrorene Seen. Das Eis knirscht; wer garantiert den Erwachsenen, dass es nicht bricht?
Sie lassen nachts die Öfen brennen; dann fackeln ihre Häuser ab — vor allem die der Arbeiter am Stadtrand —, und die Feuerwehrleute müssen anrücken und sie löschen.
Mein Onkel wirft mich in die Luft und fängt mich wieder auf. Er hat viel Spaß daran, aber schafft er es auch, mich wieder aufzufangen?
Ist den Erwachsenen nicht sogar der Zeppelin abgestürzt, der eines Morgens, ganz silbrig im Sonnenlicht, direkt vor unseren zur Düna gelegenen Fenstern vorbeizog?
Auch ich werde irgendwann erwachsen sein, aber ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Ich fürchte — und daran denke ich oft —, in einer einzigen Nacht auf einen Streich groß zu werden. Wie soll ich am nächsten Morgen Kleider in der passenden Länge finden? Ich werde allein losgehen und mir welche kaufen müssen, und die Erwachsenen werden sich wegen meiner zu kurzen Kinderkleidchen lustig über mich machen. Sie machen sich gern über mich lustig, und ich hasse es, wenn sich jemand über mich lustig macht. Vor allem hasse ich die, die sich über mich lustig machen.
Beim Gehen drehe ich mich um und präge mir die Straße ein, damit ich allein wieder nach Hause finde, sollte ich irgendwo zurückgelassen werden. Und für den Fall, dass meine Mutter es nicht rechtzeitig wieder in den Zug schafft, lerne ich auch die Namen sämtlicher Haltestellen auswendig, durch die wir auf der langen, viertägigen Reise kommen, die uns im Sommer bis nach Italien bringt; nach Italien, nach Torre Pellice. Der erste italienische Name, den ich lerne, ist »Garda«, Lago di Garda — Gardasee —, und eines Morgens sehe ich ihn, kaum bin ich aufgewacht, im Zugfenster, ein schmaler Schnipsel smaragdgrünen Wassers.
Als ich meiner Mutter erkläre, was ich auf der Straße tue, warum ich mich beim Spazierengehen dauernd umdrehe, ist sie zutiefst beleidigt.
Dabei will ich doch nur, dass sie mich endlich lobt. Normalerweise lasse ich mich wie ein Paket von einem Ort zum anderen bugsieren, und kaum bin ich da, grabe ich mir schleunigst einen Bau. Ich hasse Kindergesellschaften, auf denen mich irgendein Erwachsener in meinem Eckchen stört, mir riesige, widerliche Cremeschnitten anbietet und mich ausfragt, was ich gerne mache. Magst du Schlittenfahren oder Eislaufen? Magst du heiße Schokolade? Gehst du gern in den Kindergarten?
Einmal nehmen sie mich mit, um ein kleines, frisch geborenes Kind anzusehen; wir sind zu Besuch bei jemandem von der holländischen Gesandtschaft. In einer Fensternische hinter einem großen Vorhang habe ich mir ein abgeschiedenes Plätzchen gesucht, schaue mir ein Bilderbuch an und lese die Überschriften in Großbuchstaben. Und schon stöbert mich der übliche Erwachsene auf und nimmt mich mit den anderen Kindern mit, um das Neugeborene anzusehen. Das Zimmer, in dem die Wiege steht, ist hell erleuchtet und voller Menschen. Es riecht nach heißer Schokolade. Das Kind hat nackte Beine und Füße. Es ist dick und weiß. Alle sagen »so ein hübsches Kind«, aber ich muss mich fast übergeben, vielleicht wegen des Kakaogeruchs oder weil ich gesehen habe, dass sich ein Haar um den großen Zeh des Kindes kringelt.
Hin und wieder übergebe ich mich. Ich esse nicht gern Fleisch und kann ohne weiteres den ganzen Nachmittag lang gekaute Fleischklumpen im Mund behalten, gut versteckt in den Backentaschen. Meine Mutter pult sie mit dem Finger heraus und schimpft auf mich ein. Sie hat recht, ich sollte mich überwinden, sie hinunterzuschlucken; wenn ich es nicht tue, wachse ich nicht.
Als ich Keuchhusten hatte, ließ Mama über die italienische Gesandtschaft Apfelsinen kommen. Sie kosten schrecklich viel und liegen aufgereiht auf einem hohen Bord. Ich esse sie, um ihr einen Gefallen zu tun, dann huste ich sie wieder aus — teuer, wie sie sind —, während meine Schwester, die ebenfalls Keuchhusten hat, es schafft, sie wieder hinunterzuschlucken. Meine Mutter lacht, als sie davon erzählt und beschreibt, wie meine Schwester hastig hustet, die Apfelsinen wieder hinunterschluckt, »Fertig!« sagt und weiterspielt.
Ich esse nicht gern; es gibt nur wenige Gerichte, auf die ich versessen bin. Gekochter oder geräucherter Lachs. Abends im Dunkeln gehe ich ihn mir auf dem Küchentisch anschauen, rosig und duftend, schon fertig für den nächsten Tag. Auch Kissel esse ich gern (ein säuerliches Beerenkompott) und Nudelsuppe und Würstchen ebenfalls; die kaufen wir auf unserer Reise an den deutschen Bahnhöfen, serviert auf einem Papptellerchen mit Senf und einem weißen Brötchen. Doch an all diesen Speisen verzaubern mich auch Kleinigkeiten, die gar nichts mit dem Geschmack zu tun haben: das wunderschöne Rosa des Lachses oder die geleeartige Durchsichtigkeit des Kissels, der dampfige Duft der Würstchen und die klare Form des weißen Brötchens.
Lebertran wiederum ist mir kein bisschen zuwider. Er hat nichts von einem Lebensmittel und sieht aus wie flüssiger Klebstoff. Während meine Schwester sich unter den Tischen und hinter dem Sofa versteckt, wenn der Moment der täglichen Ölration gekommen ist, schlucke ich sie ergeben hinunter. Natürlich hoffe ich, mich damit endlich hervorzutun, aber ehrlich gesagt, kostet es mich nicht viel. Doch meine Mutter, die meine abstoßenden Ernährungsvorlieben womöglich erahnt, scheint meine Fügsamkeit gegenüber Lebertran fast mit Ekel zur Kenntnis zu nehmen und bemitleidet stattdessen meine Schwester, die sie, wenn auch mit strenger Miene, hinter dem Sofa hervorzerrt. Was würde sie wohl sagen, wenn sie wüsste, dass ich, eingeschlossen im Badezimmer, regelmäßig Nivea-Creme nasche und danach sorgfältig über die Oberfläche lecke, damit sie wieder glatt wird?
Hin und wieder bin ich kurz davor, ihr zu erzählen, dass ich im Bad Nivea-Creme esse; und wenn sie darüber lachen würde, statt mich auszuschimpfen? Oder ich würde ihr gern sagen, wieso ich so lange im kleinen Klosett neben der Küche verschwinde. Ständig sind sie böse auf mich, weil ich so oft dort drin bin, dabei störe ich doch niemanden; ich hocke nur auf dem Klodeckel und rede mit dem Hund, der in der Glühbirne eingesperrt ist.
Eingesperrt im Glühfadenpferch, und ich rede mit ihm, bemitleide ihn und bemitleide mich: »Hund«, sage ich zu ihm, »du bist dort eingesperrt, und ich bin hier eingesperrt, und wenn ich rausgehe, schimpfen sie mit mir und schicken mich morgen ins Eisbad.« Außerdem habe ich herausgefunden, dass ich bei Schnupfen einen ekligen Geruch in der Nase habe. »Hund, du hast keinen Schnupfen; du bist sauber, geruchlos und hell in deinem Pferch.«
Aber ich rede nicht mit meiner Mutter, es lähmt mich, dass ich nichts Lobenswertes an mir habe. Wenn sie mich ansieht, spüre ich, dass sie mich durchschaut. Es hat keinen Zweck, ihr etwas vorzumachen, ich bin nichts wert. Wenn sie mich wenigstens dafür bemitleiden würden, doch niemand bemitleidet mich. Nicht einmal, wenn ich krank bin. Ich bin oft krank, alberne Krankheiten, die »Kinderkrankheiten« heißen. Als meine Schwester wenige Monate alt war, erkrankte sie so schwer, dass sie fast gestorben wäre. Danach war sie nie wieder krank.
Meine Mutter betet meine albernen Krankheiten herunter wie den Rosenkranz ihrer Qualen; kaum werde ich krank, sorgt sie sich und bleibt zu Hause, um mich zu pflegen. Während ich allmählich auf dem Weg der Besserung bin, ist jedes Fiebermessen ein heikler Moment. Einmal, als das Thermometer noch immer siebenunddreißig fünf, statt sechsunddreißig acht anzeigt, wird sie so wütend, dass sie es in die Ecke pfeffert. Oder es war etwas anderes, an das ich mich nicht erinnere. »Was hast du angestellt? Bist du aufgestanden und ans Fenster gegangen? Ohne Pantoffeln? Bist du auf dem Bett herumgehopst?« Ich habe Angst vor ihr, aber sie tut mir leid: Es stimmt ja, sie muss zu Hause bleiben, um mich zu pflegen, dabei hat sie an der Universität so viel um die Ohren.
Ich bin allerdings ganz froh, krank zu werden. Gerade weil sie zu Hause bleiben muss, um mich zu pflegen. Abgesehen von den klebrigen gelben Halswickeln und dem Löffelchen des Arztes, finde ich das ganze Krankheitszeremoniell großartig. Der Teller blasse Brühe auf dem Tablett — das Tablett samt sauberer Serviette, ganz für mich allein — und der Geschmack der Hustensäfte erst. Jeden Morgen wäscht meine Mutter mich gründlich und pudert mich ein. Eingehüllt in den Duft meiner Waschungen, kuschele ich mich unter die Decke und betrachte die Sonne auf der Tapete. In ihrem kleinen Lichtquadrat an der Wand gehört auch sie ganz allein mir. Ich bin vor jeder lauernden Gefahr geschützt und kann mich von den Anstrengungen der täglichen Gegenwehr ausruhen.
Wie eine Spinne kauere ich im Zentrum meines Lebens und webe ein schützendes Netz um mich. Ich darf meinen Platz nie verlassen, bin auf mich selbst gestellt und kann mir nicht die winzigste Ablenkung erlauben: Ich muss versuchen, den anderen möglichst wenig von mir preiszugeben, die mich Stück für Stück zerstören wollen.
Mit ihren Fragen, ihrem Gelächter: »Gehst du gern eislaufen? Gehst du gern in den Kindergarten, magst du heiße Schokolade?« Oder: »Sag dies, sag das, was sagst du zu der Dame?«
Egal was ich sage, sie lachen darüber.
Vergeblich die Bemühungen meiner Mutter und meines Großvaters, mir ein merci zu entlocken, als Großvater mir unter dem Haselstrauch im Garten von Torre Pellice eine Weintraube hinhält. Großvater war — wie seltsam — im Morgenmantel. Er war bereits sehr krank und verbrachte die meiste Zeit des Tages im Bett. An jenem Nachmittag war er mit unendlich langsamen Schritten auf die Wiese getappt, um Trauben zu pflücken. Nun hielt er sie in der Hand, mit ihren schönen, goldfarbenen Beeren, doch ich bekam den Mund nicht auf. Ungeduldig und enttäuscht presste Großvater die Lippen zusammen.
Wenige Monate später sind wir wieder in Riga, und eines Morgens führt uns die Gouvernante in Mamas Zimmer. Sie sitzt im Unterkleid auf dem Bett, die Arme nackt, und weint mit kraus gezogener Nase. Großvater in Italien ist gestorben.
Auch dieses Mal schwieg ich, natürlich aus Vorsicht, um mir keine Blöße zu geben. Aber ich war auch verblüfft: Ich hatte meine Mutter noch nie weinen sehen und begriff nicht, weshalb sie weinte.
Es rührte mich nicht — die Großen rührten mich nie, unser sterbender Hund rührte mich, der mit seiner kranken Schnauze vergeblich nach Luft rang —, vielmehr kam es mir vor, als wäre sie nicht mehr meine Mutter (sie war Großvaters Tochter), und das machte sie mir in ihrer unerklärlichen Erschütterung so fern — galten ihre Gefühle nicht einzig meiner Schwester und mir? —, dass man sie nicht mehr fürchten konnte.
Außerdem darf man seine Gefühle nicht zeigen, wer es tut, spielt bestimmt nur Theater.
Als ich meinen Vater zum letzten Mal sah — ich war zwölf Jahre alt, er und meine Mutter ließen sich gerade scheiden, und er war uns für ein paar Tage in Torre Pellice besuchen gekommen, wo wir seit zwei Jahren bei Großmama lebten —, verabschiedeten wir uns im Vicolo ai Dagotti, in dem das Haus meiner Großeltern steht. Vielleicht war ich auf dem Weg in die Schule: Ich war allein, meine Schwester war womöglich schon vorgegangen. Als ich gerade in die Hauptstraße einbiegen wollte, lief mein Vater, der an der Gassenecke zurückgeblieben war, mir nach, holte mich ein, schloss mich in die Arme, hob mich hoch und küsste mich weinend auf den Mund. Diese unserem üblichen Umgang so fremde Geste verblüffte mich und stieß mich ab. Als er mich wieder absetzte, stob ich grußlos davon und ließ ihn, groß in seinem dunklen Mantel, in der Gasse stehen.
Während ich rennend in die große Straße einbog und mir mit der Hand über den Mund wischte, fragte ich mich immer wieder: Was ist bloß in ihn gefahren? Und zugleich: Wer ist er?
Ich war verblüfft, aber ganz anders als bei meiner weinenden Mutter. Ihr Weinen hatte sie mir fremd gemacht, doch die plötzliche und unerwartete — nicht geschauspielerte — Reaktion meines Vaters hatte etwas in mir zu fassen bekommen. Etwas, das es nicht gab, das abwesend war.
Sogleich empfand ich diese Abwesenheit wie eine Schuld, lang ehe mir klarwurde, dass ich ihn im Vicolo ai Dagotti zum letzten Mal zurückgelassen hatte, groß in seinem dunklen Mantel, aufrecht im Angesicht der Deutschen, die ihn im Oktober oder November 1941 in Riga erschossen.
Eine zwischen ihm und mir, die wir einander nicht hatten kennenlernen können, geteilte Schuld.
Ich weiß so gut wie nichts über ihn. Mir bleiben nur spärliche Kindheitserinnerungen. Ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter und er sich begegnet sind, wusste lange nicht, weshalb sie geheiratet hatten, kenne das Datum seines Todes nicht und habe das seiner Geburt den Scheidungspapieren meiner Mutter entnommen.
Ehe er zum letzten Mal fortging, hatte er mir eine Uhr geschenkt. Eine klobige Uhr mit einer asymmetrisch eckigen Form und römischen Ziffern, die mir kein bisschen gefiel. Jahre zuvor hatte er uns eine Puppe geschenkt, die genauso groß war wie ich und in kein Puppenbett passte. Jedes Mal schenkte er nur eine Puppe, ohne zu sagen, für wen von uns beiden sie war; von der Pariser Weltausstellung hatte er eine Negerpuppe mitgebracht, die sich meine Schwester sofort unter den Nagel riss, obwohl mein Vater beim Kauf bestimmt nicht im Sinn gehabt hatte, wem er sie geben würde. Bei einem seiner gerichtlich vereinbarten Besuche, die er uns während unserer letzten Monate in Lettland abstattete, hatte er uns — der Ärmste — riesengroße weiße Plüschkaninchen mitgebracht. Grässliche, monströse Viecher, mit denen man nicht spielen konnte.
Nie schickte er mir das Puppenteeservice, um das ich ihn in sämtlichen Briefen bat, die ich ihm aus Torre Pellice schrieb, denn das kleine Porzellanservice, ein Geschenk meiner Mutter, war zusammen mit dem Spielzeug, meinen Büchern und Puppen zu Hause zurückgeblieben. Bei unserem Aufbruch hatten wir nichts mitnehmen dürfen und mussten so tun, als würden wir morgens zur Schule gehen; stattdessen waren wir zu Mama in die Wohnung gegangen, in der sie nach der Trennung lebte.
Hin und wieder träume ich noch immer, ich müsste die Koffer packen und wäre nicht in der Lage, alles Nötige mitzunehmen. Meistens träume ich, ich müsste mit meinen kleinen Kindern fliehen und entscheiden, welche ihrer Anziehsachen ich einpacken soll. Auch die Decken muss ich hastig zusammenraffen, ehe die Katastrophe hereinbricht.
Ich trug die Uhr lange, und als sie kaputtging, konnte ich mich erst nach Jahren dazu durchringen, sie durch eine winzig kleine neue zu ersetzen. Ich hob die riesige, sperrige, kaputte Uhr zwischen meinem Krimskrams auf, bis ich sie während eines Umzuges wegwarf.
Sonst besitze ich nichts mehr von meinem Vater, weder ein Foto noch einen Brief. Nicht einmal den letzten Brief, den er uns 1941 schrieb, gleich nachdem die Deutschen Riga besetzt hatten. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, was mit diesem Brief geschehen ist, der mehrere Jahre lang zwischen meinem Papierkram steckte, zerrissen und zerknittert, wer weiß, von wem. Großmama hasste unseren Vater und hätte es bestimmt fertiggebracht, jede Spur von ihm verschwinden zu lassen. Allerdings ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich ihn bei einer meiner Aufräumaktionen weggeworfen habe.
Von diesem in seiner unleserlichen Handschrift verfassten Brief ist mir nur ein Satz im Kopf geblieben, den er unterstrichen hatte: »… denn vergesst nicht, dass Ihr ebenfalls Jüdinnen seid«.
Der Satz erschien mir bedeutungslos, und ebenso wenig begriff ich den Grund, weshalb er uns bat — ich war sechzehn, meine Schwester fünfzehn —, ihn auf welchem Weg auch immer aus Lettland herauszuholen. Wie hätten wir das bewerkstelligen sollen?
Ich war ihm nie nahegekommen: Er war der einzige Erwachsene, der für keinerlei Verhaltensregeln stand, vielmehr lehnte er sie allesamt ab.
In der großen, lichten und gepflegten Wohnung unserer Mutter lebte er wie ein Fremder. Er war hochgewachsen, dunkel, mit Geheimratsecken — er war schon fast vierzig, als ich geboren wurde —, und vermutlich sehr schön. Er sah aus wie ein »arabischer Prinz«, behauptete die Köchin.
Unser Tagesablauf deckte sich nicht mit seinem. Manchmal begegnete ich ihm, wenn ich morgens zur Schule aufbrach, in den noch dunklen, laternenbeschienenen Straßen. Er war auf dem Heimweg, den weißen Seidenschal um den Hals. Bei meiner Rückkehr um ein Uhr lungerte er in Pantoffeln und Morgenmantel herum, strich durch die Zimmer und zog einen entsetzlichen Männermuff hinter sich her. Oder er saß tief in einem Sessel versunken, las seine russischen Zeitungen und rauchte dabei dicke Zigarren mit goldfarbener Banderole, die ich mir zum Spiel als Ring auf den Finger streifte. Zu Mittag aß er Kalbsfußsülze. Er trank Tee aus einem hohen, von einem Henkelring eingefassten Glas.
An einem Nachmittag ging er mit uns an Mamas Stelle zum Ballett und schlief hinten auf der Bühne ein. Er schnarchte so laut, dass er bis ins Parkett zu hören war.
Ein paarmal begleitete er uns zu verschiedenen Sportwettkämpfen. Sport interessierte ihn, in der Sowjetunion war er Trainer gewesen. Er erzählte: »Neunzehnhundertachtzehn saß ich in einem Boot auf der Düna, und von der Brücke aus wurde auf mich geschossen.« Deshalb hatte er aus der Sowjetunion fliehen müssen.
Ich weiß noch, dass er das Pfeifen der Schüsse nachmachte, wenn er diese Anekdote zum Besten gab.
Einmal gingen wir mit ihm zu einem Wettgehen. Dort wackelte ein kleiner, dunkler, völlig verschwitzter Mann auf seinen krummen Beinen hektisch auf der Laufbahn im Kreis. Er fuchtelte herum und sprach in einer unverständlichen Sprache, und als man ihm ein Glas Wasser reichte, schlürfte er es in sich hinein und spuckte es auf den Boden. Mir war das peinlich, denn er war Italiener, und meine Mutter war auch Italienerin, genau wie dieses komische Männchen ohne Manieren.
Mein Vater redete schlecht von den Italienern, vor allem von einem — ein gewisser Mussolini —, den ich eine Zeitlang ebenfalls für einen Geher hielt. Auch von den Sowjets und den Deutschen redete er schlecht. Er versuchte mir ein seltsames Deutsch beizubringen — Jiddisch — und amüsierte sich köstlich, wenn ich es aussprach wie er. Mama wurde böse und sagte, er sei wütend auf die Deutschen, weil er es nicht geschafft habe, sein Studium in Deutschland zu beenden.
Doch seine Freunde waren fast ausnahmslos Deutsche. »deutsche Nichtsnutze«, wie Mama zu sagen pflegte. Einer von ihnen war Gefängnisarzt, und eines Nachmittags war seine Frau bei uns zu Hause aufgetaucht und hatte sich beschwert, »Herr Gersoni« würde ihren Gatten dazu anstiften, sich die ganze Nacht mit ihm herumzutreiben. Mein Vater hatte diebische Freude daran, ein schlechtes Vorbild abzugeben. Aber wieso ließ sich dieser »deutsche Nichtsnutz« darauf ein?
Unser Vater tat noch andere Dinge, die Väter nicht tun oder tun sollten.
Einmal kaufte er einen Autobus. Er nahm uns mit in die Garage, wo der Bus untergestellt war, um ihn uns zu zeigen.
Der Bus hatte zerschlissene Sitze, und ich fragte mich sofort — traute mich aber nicht, die Frage laut zu stellen —, ob wir von nun an mit diesem Bus statt mit dem Diatto herumfahren müssten. Einmal hatte ich schon in einem Sidecar sitzen müssen, das neben dem Motorrad über das Kopfsteinpflaster hoppelte. Doch zum Glück war der Bus nur ein »Geschäft« meines Vaters. Genau wie der Diatto — eine Zeitlang waren es sogar zwei Diattos gewesen —, der noch immer auf einen Käufer wartete.
Die Geschäfte meines Vaters waren solcherlei Schrullen — ähnlich wie seine Interessen für sportliche Wettkämpfe —, denen er sich widmete, statt sich, wie Mama sagte, um seine Arbeit zu kümmern. Er war Michelin-Vertreter für die baltischen Länder.
Wenn ich von Riga träume, dann nur von der Straße, in der sich sein Büro befand. In meinen Träumen ist sie menschenleer, mit grobem Pflaster und von hohen Häusern gesäumt, die sich wie die Wipfel einer sturmgepeitschten Pappelallee über die Straße neigen. Es ist ein Angsttraum, das Pflaster und die Häuser sind schwarz, und ich laufe zum Büro meines Vaters, ich will zu ihm. Stattdessen finde ich dort, einer nach dem anderen in einer Abfolge blitzschneller Verwandlungen auf einem Stuhl sitzend, unbekannte Männer mit alten Gesichtern und geschlossenen Augen. Weinend wache ich auf.
Auf dem Heimweg von der Busbesichtigung streiten unser Vater und unsere Mutter.
Sie kommen nicht gut miteinander aus. Daran ist er schuld, er brüllt herum und lenkt nie ein. Er zeigt nicht den kleinsten Funken guten Willen, dabei muss Mama so viel arbeiten, um alle Rechnungen zu bezahlen. Zweimal im Jahr reist er nach Paris, um »sich zu amüsieren«.
Sie kommen nicht gut miteinander aus; sind nie gut miteinander ausgekommen.
Als mir eine alte Postkarte meiner Mutter in die Hände fällt, in der sie ihren Eltern schildert, wie ich im Hochstuhl sitze und ihnen — ihr und Sammy — beim Mittagessen zusehe, kommt es mir vor, als schriebe sie von anderen Menschen.
Ihr Zerwürfnis ist ein täglicher Zustand, über den meine Schwester Sisi und ich ab und zu reden. Wie soll man auch mit jemandem auskommen, der zweimal im Jahr nach Paris fährt, um sich zu amüsieren? Der tagsüber schläft, keine Rechnungen zahlt und herumbrüllt? Die Köchin sagt zum Dienstmädchen, er hätte Mama geschlagen, aber das glaube ich nicht; doch jedes Mal wenn er anfängt herumzubrüllen, fürchte ich, es könnte passieren.
Mama ist sehr mutig; sie bietet seinem Geschrei die Stirn. Sie bietet sowieso jedem die Stirn, sogar den Zöllnern. Während sie unsere Koffer durchwühlen, schimpft sie auf sie ein.