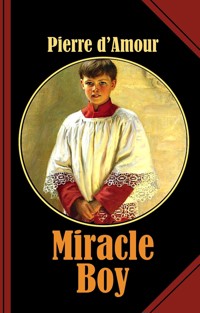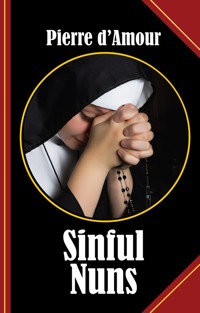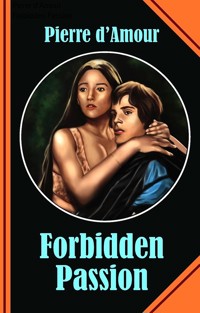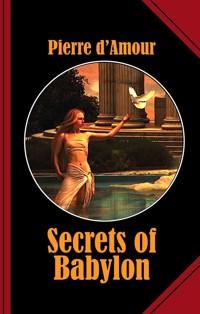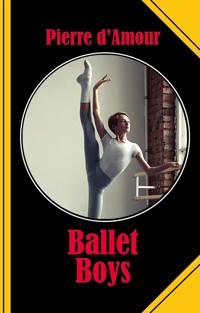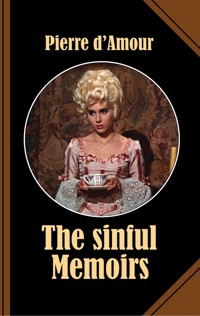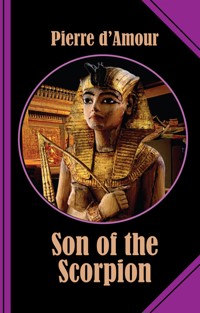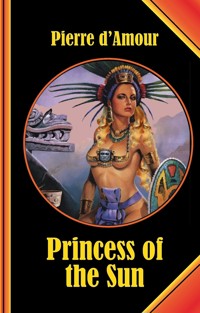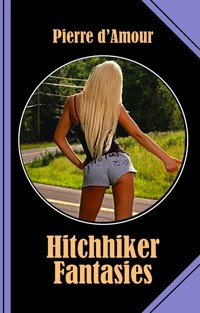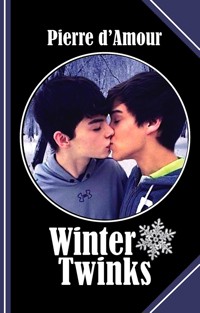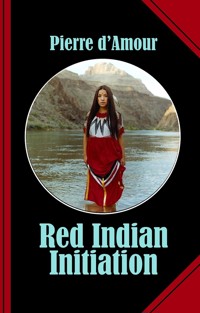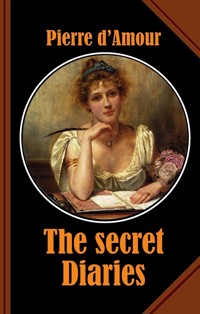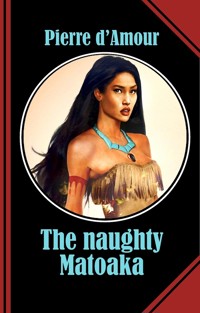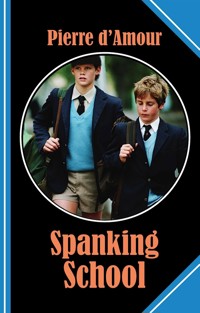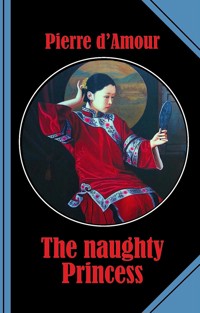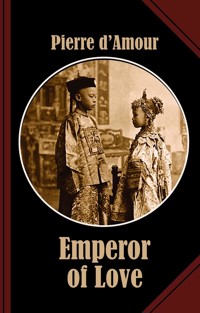6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jed Ashbury war am Ende. Die Indianer hatten ihn geschlagen und ausgepeitscht, und seine Füße waren mit Blasen und offenen Wunden bedeckt. Allein in der Wüste... hatte er keine Chance. Bis er die Überreste eines Wagenzuges entdeckte. Die Indianer hatten ihn überfallen, und Jed fand Wasser, Proviant und neue Kleidung. Und ein Bündel mit Briefen, aber das hätte er lieber nicht an sich nehmen sollen. Denn diese Briefe bedeuteten Ärger, und den konnte Jed in seiner Lage am wenigsten gebrauchen...
Weit ist das Land enthält acht ausgewählte Erzählungen von Louis L'Amour, der als der weltweit erfolgreichste Western-Autor gilt.
Der Apex-Verlag veröffentlicht Weit ist das Land in seiner Reihe APEX WESTERN als durchgesehene Neu-Ausgabe, ergänzt um ein Essay von Dr. Karl Jürgen Roth.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
LOUIS L'AMOUR
Weit ist das Land
Erzählungen
Apex Western, Band 15
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
WEIT IST DAS LAND (Riding For The Brand)
DIE KRAFTPROBE (Four-Card Draw)
DIE SCHULD SEINES BRUDERS (His Brother's Dept)
DER MARSHAL VON SENTINEL (A Strong Land Growing)
DIE REITER MIT DER TRUTHAHNFEDER (The Turkeyfeather Riders)
SANDY KID (Lit A Shuck For Texas)
DER FARMER UND DER INDIANER (The Nester And The Piute)
DER MANN AUS DER WÜSTE (Barney Takes A Hand)
»I‘m just a storyteller«: Louis L‘Amour und seine Western - Ein Essay von Dr. Karl Jürgen Roth
Das Buch
Jed Ashbury war am Ende. Die Indianer hatten ihn geschlagen und ausgepeitscht, und seine Füße waren mit Blasen und offenen Wunden bedeckt. Allein in der Wüste... hatte er keine Chance. Bis er die Überreste eines Wagenzuges entdeckte. Die Indianer hatten ihn überfallen, und Jed fand Wasser, Proviant und neue Kleidung. Und ein Bündel mit Briefen, aber das hätte er lieber nicht an sich nehmen sollen. Denn diese Briefe bedeuteten Ärger, und den konnte Jed in seiner Lage am wenigsten gebrauchen...
Weit ist das Land enthält acht ausgewählte Erzählungen von Louis L'Amour, der als der weltweit erfolgreichste Western-Autor gilt.
Der Apex-Verlag veröffentlicht Weit ist das Land in seiner Reihe APEX WESTERN als durchgesehene Neu-Ausgabe, ergänzt um ein Essay von Dr. Karl Jürgen Roth.
WEIT IST DAS LAND (Riding For The Brand)
Er hatte den Planwagen über eine Stunde lang beobachtet. Nichts hatte sich bewegt, kein Geräusch war zu hören gewesen. Die Körper der beiden Tiere, die den Wagen gezogen hatten, lagen deutlich sichtbar im Gras. Fast eine Meile entfernt stand ein einsamer Büffelbulle, der sich schwarz gegen den grauen Dunst der Entfernung abhob.
In der Nähe des Wagens bewegte sich nichts. Aber Jed Asbury hatte zu lange im Indianergebiet gelebt, um seinen Skalp wegen einer augenscheinlichen Tatsache zu riskieren. Er wusste, dass ein Indianer stundenlang völlig bewegungslos verharren konnte. Er hatte nicht die Absicht, irgendetwas dem Zufall zu überlassen, zumal er splitternackt und unbewaffnet war.
Vor zwei Tagen war er von Indianern bis auf die Haut ausgezogen und zum Spießrutenlaufen gezwungen worden. Aber er war schneller gelaufen, als sie erwartet hatten, und hatte ohne größere Verletzungen entkommen können.
Jetzt, meilenweit entfernt, war er an der Grenze seiner Belastbarkeit angekommen. Trotz wenig Wasser und noch weniger Nahrung war er zwar immer noch in der körperlichen Verfassung, weiter zu marschieren, aber seine Füße machten nicht mehr mit. Sie waren zerschnitten und geschwollen und völlig mit getrocknetem Blut verkrustet.
Vorsichtig ging er weiter. Indem er jede nur mögliche Deckung ausnutzte, näherte er sich allmählich dem Wagen. Als er noch zwanzig Meter entfernt war, ließ er sich im Gras nieder, um den Anblick, der sich ihm bot, genau zu durchdenken.
Es sah wie nach einem Angriff aus. Augenscheinlich war der Wagen verlassen, und die Körper von zwei Männern und einer Frau lagen ausgestreckt im Gras. Kleidungsstücke, Papiere und Küchengeräte lagen verstreut umher und zeugten von einer hastigen Plünderung. Was auch immer die Zukunftspläne dieser Menschen gewesen waren, sie waren jetzt zunichte gemacht. Die Ausbreitung der Zivilisation in Richtung Westen hatte ein weiteres Opfer gefordert. Und die Toten würden es ihm nicht missgönnen, wenn er sich nahm, was er brauchte. Er erhob sich aus dem Gras und ging vorsichtig auf den Wagen zu, ein, großer, muskulöser junger Mann, unrasiert und ungepflegt.
Um die Körper machte er einen Bogen. Merkwürdigerweise waren sie nicht verstümmelt, was sehr ungewöhnlich war, und die Männer trugen immer noch ihre Stiefel. Wenn er keine anderen fand, würde er sich ein Paar von ihnen nehmen. Aber zuerst musste er den Wagen untersuchen.
Wenn Indianer den Wagen geplündert hatten, so hatten sie das in größter Hast getan, denn das Innere befand sich in einem Zustand völliger Verwüstung. Unten in einem Koffer fand er einen Anzug aus feinem, schwarzem Tuch, außerdem ein Paar handgearbeiteter Lederstiefel, ein wollenes und mehrere weiße Hemden.
»Das war der Sonntagsanzug von jemandem«, murmelte er. »Ich probier' die Stiefel besser nicht mit meinen geschwollenen Füßen an.«
Er fand saubere Unterwäsche und zog einfachere Kleidungsstücke an, die er ebenfalls in diesem Koffer gefunden hatte. Als er genügend bekleidet war, um sich vor der Sonne zu schützen, holte er Wasser aus einem halbleeren Fass, das seitlich am Wagen hing, und badete seine Füße, dann bandagierte er sie mit weißen Stoffstreifen, die er von einem Kleid heruntergerissen hatte.
Seinen Füßen ging es gleich viel besser, und da die Stiefel eine Nummer größer waren, als er sie gewöhnlich trug, versuchte er es. Sie waren zwar etwas unbequem, aber er konnte damit laufen.
Mit einer Schaufel, die an der Seite des Wagens angebunden war, grub er ein Grab und beerdigte die drei Toten Seite an Seite. Er breitete einige Decken aus dem Wagen über sie, schaufelte die Erde wieder hinein und häufte über dem Grab Steine auf. Dann sprach er, den Hut in der Hand, den 23. Psalm.
Die Wilden, oder wer sie sonst umgebracht hatte, hatten alles nur flüchtig durchsucht. Deshalb ging er wieder zu dem Wagen zurück, um nach Dingen zu suchen, die er gebrauchen konnte, oder die ihm Aufschluss über die Identität der drei Toten geben würden. Er fand einige Dokumente, ein Testament und eine Handvoll Briefe. Zusammen mit einem Poncho, den er gefunden hatte, legte er sie auf die Seite und durchsuchte einen Nähkorb. Er erinnerte sich an die Angewohnheiten seiner Großmutter und leerte den Korb aus. Unter dem gepolsterten Boden des Korbes fand er einen großen, versiegelten Umschlag.
Er riss ihn auf und grunzte zufrieden. Es waren, sorgfältig in Seidenpapier eingeschlagen, zwanzig Zwanzig-Dollar-Münzen darin. Er steckte sie ein und durchsuchte weiter den Koffer. Er fand noch mehr sorgfältig zusammengelegte Kleidungsstücke. Mehrere Male unterbrach er die Untersuchung des Wagens, um die Umgebung zu beobachten, aber er sah nichts. Der Wagen stand an einer derartig unübersichtlichen Stelle, dass ein Reiter sogar wenige Meter entfernt hätte vorbeireiten können, ohne ihn zu sehen. Jed hatte sich offenbar von der einzigen Seite genähert, von der aus man den Wagen sehen konnte.
Ganz unten im Koffer fand er eine Stahlkassette. Er öffnete sie gewaltsam mit einer Hacke. Drinnen lag, auf einem Stück Samt, ein herrliches Paar Pistolen, mit Silber überzogen und wunderschön graviert, mit Griffen aus Perlmutt. Daneben fand er, eingeschlagen in ein Handtuch, ein Paar Patronengurte aus schwarzem Leder und zwei Pistolenhalfter. Daneben befand sich ein Beutel mit .44er Patronen. Sofort lud er die Waffen und füllte dann die Patronengurte. Danach probierte er aus, wie ihm die Waffen in der Hand lagen. Den Rest der Patronen verstaute er in seinen Taschen.
Unter einem anderen Kleidungsstück fand er ein Messer mit Perlmutthandgriff und einer vorzüglich gehärteten Stahlklinge. Es war ein spanisches Kampfmesser und ein besonders schönes Stück. Er hing sich die Scheide so um den Hals, dass der Griff genau unter seinem Kragen lag.
Er trug seine neuen Habseligkeiten zusammen und legte sie gebündelt auf den Poncho. Dann band er den Poncho mit einer Schnur zusammen, um ihn auf dem Rücken tragen zu können. In der Innentasche seines Mantels verstaute er die Dokumente und die Briefe. In die äußere Tasche steckte er ein schmales, ledergebundenes Buch, das er im Wagen gefunden hatte. Er las zwar wenig, aber er wusste um den Wert eines guten Buches.
Er war drei Jahre, mit Unterbrechungen, zur Schule gegangen und hatte Lesen, Schreiben und etwas Rechnen gelernt.
Er fand eine Feldflasche und füllte sie. Als er den Wagen weiter durchstöberte, fand er die Vorratskiste, die fast leer war. Nur ein bisschen Kaffee und etwas schimmliges Brot waren darin zu finden, sonst nichts. Er nahm den Kaffee, einen kleinen Topf und einen Blechbecher. Dann sah er nach der Sonne und machte sich auf den Weg.
Jed Asbury war daran gewöhnt, für sich selbst zu sorgen. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass es Unrecht wäre, das mitzunehmen, was er gefunden hatte. Und das wäre zu der damaligen Zeit auch keinem anderen Mann in den Sinn gekommen. Das Leben war hart, und jeder schlug sich durch, so gut er konnte. Wenn die Toten irgendwelche Erben hatten, dann würde in den Briefen oder in dem Testament ein Hinweis darauf zu finden sein. Wenn er in der Lage war, würde er ihnen alles zurückzahlen. Kein Mensch würde ihn dafür verurteilen, dass er sich genommen hatte, was er zum Überleben benötigte. Aber es war selbstverständlich, dass er seine Schulden zurückzahlte.
Jed war auf einer Farm in Ohio geboren worden. Seine Eltern waren gestorben, als er zehn Jahre alt gewesen war. Danach war er zu einem griesgrämigen Onkel geschickt worden, der in einem Fischerdorf in Maine lebte. Drei Jahre lang hatte ihn sein Onkel auf einem Fischerboot wie einen Sklaven arbeiten lassen. Bis Jed schließlich das Boot, das Hochseefischen und seinen Onkel im Stich gelassen hatte.
Er war nach Boston gegangen und hatte auf Umwegen Philadelphia erreicht. Er hatte als Laufbursche und in einer Mühle gearbeitet und schließlich einen Job als Laufbursche in einer Druckerei bekommen. Er hatte Zuneigung zu einem Mann gefasst, der oft in den Laden kam, einem ruhigen Mann mit dunklem Haar und großen, grauen Augen und einem merkwürdig breiten Kopf. Der Mann schrieb Geschichten und literarische Kritiken und lieh Jed ab und zu Bücher zum Lesen. Sein Name war Edgar Poe, und es hieß, dass er der Pflegesohn von John Allan war, dem angeblich reichsten Mann in Virginia.
Als Jed die Druckerei verließ, ging er an Bord eines Windjammers und trat eine Reise um das Horn an. Von San Franzisco aus war er für ein Jahr auf die Goldfelder in Australien gegangen, dann nach Südafrika und schließlich zurück nach New York. Damals war er zwanzig Jahre alt gewesen und ein großer, gutgewachsener junger Mann, der durch das Leben, das er geführt hatte, abgehärtet worden war. Auf einem Flussdampfer war er nach Westen geschippert und dann den Mississippi hinunter nach Natchez und New Orleans.
In New Orleans hatte ihm Jem Mace das Boxen beigebracht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er alles, was er über das Kämpfen wusste, auf diese Art und Weise gelernt. Von New Orleans aus war er nach Havanna gegangen, dann nach Brasilien und dann wieder zurück in die Staaten. In Natchez hatte er einen Falschspieler entlarvt. Jed Asbury hatte eine Idee schneller gezogen, und der Falschspieler starb, ein Opfer der Selbstjustiz mit einem sechsschüssigen Revolver. Jed hatte die Stadt gerade noch verlassen können, ehe etliche wütende Kumpane des Spielers ihn erwischt hatten.
Auf einem Dampfer war er auf dem Missouri bis Fort Benton gefahren und dann, auf dem Landweg, nach Bannock. Auf Frachtzügen war er nach Laramie und dann nach Dodge gereist.
In Tascosa hatte er unvermutet dem Bruder des toten Spielers aus Natchez gegenüber gestanden, der von zwei wütenden Kumpanen begleitet worden war. Zwei seiner Feinde hatte er getötet und den dritten verwundet. Er selbst hatte bei dem Zwischenfall eine Kugel ins Bein bekommen. Er war weiter nach Santa Fé gereist.
Mit vierundzwanzig Jahren war er heimatlos und sah sich nach einem Ziel um. Er zog als Bullenbändiger über die Jahrmärkte und stieß dann zu einem Wagenzug nach Cheyenne. Die Comanchen, die im Norden Raubzüge unternahmen, hatten etwas dagegen, und er war der einzige Überlebende.
Er wusste ungefähr, wo er sich befand, nämlich irgendwo südwestlich von Dodge. Aber möglicherweise auch näher an Santa Fé als an der Stadt der Viehtreiber. Er musste sich jedoch in der Nähe des Viehpfades, der nach Tascosa führte, befinden, also ging er in diese Richtung. Entlang des Flussufers müssten sich eigentlich verirrte Rinder von Herden, die früher hier vorbeigetrieben worden waren, finden lassen, so dass er etwas zum Essen hatte, bis er auf eine Herde mit Treibern traf.
Während er in der Hitze auf dem staubigen Pfad entlang marschierte, wechselte er sein kleines Bündel immer wieder von einer Schulter auf die andere und drehte sich des öfteren um, um die Gegend hinter sich zu überprüfen. Er war mitten im Indianerland.
Am Morgen des dritten Tages erspähte er eine Viehherde, die in Richtung Kansas getrieben wurde. Als er auf die Herde zuging, ritten ihm zwei der drei Reiter entgegen.
Einer davon war ein magerer Mann mit rotem Gesicht, gelblichem Schnurrbart und einem humorvollen Ausdruck um die Augen. Der andere war ein untersetzter, freundlicher Reiter auf einem gefleckten Pferd.
»Howdy!« Die Stimme des älteren Mannes klang belustigt. »Machen Sie einen Morgenspaziergang?«
»Durch die Zuvorkommenheit einer Bande von Co- manchen. Ich war mit einem Wagenzug von Santa Fé nach Cheyenne als Viehtreiber unterwegs, und wir hatten eine kleine Auseinandersetzung mit der Winchester. Sie hatten die besseren Karten«, erklärte er kurz.
»Sie werden ein Pferd brauchen. Haben Sie je mit Vieh gearbeitet?«
»Ab und zu. Brauchen Sie jemand?«
»Vierzig im Monat und freies Essen.«
»Der Kaffee ist schrecklich«, sagte der andere Reiter. »Dieser dämliche Kerl hat es nie gelernt, einen Kaffee zu machen, der nicht nach Seifenlauge schmeckt.«
Nachts im Camp holte Jed Asbury die Papiere, die er im Wagen gefunden hatte, heraus. Er öffnete den ersten Brief und las ihn:
Lieber Michael,
wenn Du diesen Brief erhältst, bedeutet das, dass George tot ist. In der Nähe von Willow Springs wurde er von einem Pferd abgeworfen. Er starb am nächsten Tag. Die Hauptranch umfasst 60.000 Morgen, und die anderen Ranches sind zweimal so groß. Das alles wird Dir oder Deinen Erben gehören, falls Du geheiratet hast, seit wir das letzte Mal von Dir gehört haben. Aber nur, wenn Du oder Deine Erben den Ort innerhalb eines Jahres nach Georges Tod erreichen. Wenn Du Deinen Besitz nicht innerhalb dieser Zeit beanspruchst, wird das Ganze an den nächsten Verwandten übergehen. Aus den Briefen wirst Du Dich sicher daran erinnern, was Walt für ein Mensch ist.
Natürlich hoffen wir, dass Du sofort hierher kommst, denn wir alle wissen zu genau, wie es sein wird, wenn Walt alles übernimmt. Du wirst jetzt ungefähr sechsundzwanzig Jahre alt sein und solltest imstande sein, Walt in seine Schranken zu verweisen. Aber sei vorsichtig. Er ist gefährlich und hat schon mehrere Männer umgebracht.
Im Moment ist alles in Ordnung, aber es droht Ärger mit Besovi, einem unserer Nachbarn. Wenn Walt alles übernimmt, wird das mit Sicherheit geschehen. Genauso, wie diejenigen von uns, die so lange hier gearbeitet und gelebt haben, hinausgeworfen werden würden.
Tony Costa.
Der Brief war an Michael Latch, St. Louis, Missouri, adressiert. Nachdenklich faltete Jed den Brief zusammen und überflog die anderen. Er erfuhr vieles, aber doch nicht genug.
Michael Latch war der Neffe von George Baca gewesen, einem Rancher mit amerikanisch-spanischer Abstammung, dem in Kalifornien eine riesige Haçienda gehörte. Weder Baca noch Tony Costa hatten Michael jemals gesehen. Genauso wenig der Mann namens Walt, der offensichtlich der Sohn von Georgs Halbbruder war. Das Testament stammte von Michaels Vater, Thomas Latch, und übereignete ihm die Rechte an einer kleinen Ranch in Kalifornien.
Aufgrund eines nicht abgeschickten Briefes und anderer Unterlagen stellte Jed fest, dass der jüngere der beiden Männer, die er begraben hatte, Michael Latch gewesen war. Der andere Tote und die Frau waren Randy und May Kenner gewesen. In einem Brief wurde ein Mädchen namens Arden erwähnt, das die drei begleitet hatte.
»Die Indianer müssen sie mitgenommen haben«, murmelte Jed. Er überlegte kurz, ob er versuchen sollte, sie zu finden, ließ den Gedanken aber dann als undurchführbar fallen. Nach einer Nadel im Heuhaufen zu suchen, war eine Aufgabe, die zumindest an einem festen Ort ausgeführt werden musste. Aber zu versuchen, eine der vielen umherziehenden Banden von Comanchen zu finden, wäre eine schier unmögliche Aufgabe. Dennoch würde er die Armee und die Handelsagenturen informieren. Vielleicht konnte man, wie schon so oft, in Verhandlungen treten und sie würde, gegen ein entsprechendes Tauschangebot an Waren, wieder zurückgebracht werden. Falls sie noch lebte.
Dann kam ihm ein anderer Gedanke.
Michael Latch war tot. Riesiger Grundbesitz erwartete ihn, ein schönes, bequemes Leben, das der junge Latch geschätzt haben würde. Jetzt würde der Besitz an Walt fallen, wer auch immer das war - außer er, Jed, nahm den Namen von Michael Latch an und meldete Anspruch auf den Besitz an.
Der Mann, der sein neuer Boss war, kam von einem Ritt um die Herde zurück. Er blickte Jed an, der die Briefe weglegte. »Wie, sagten Sie, war Ihr Name?«
Jed zögerte nur einen Moment. »Latch«, antwortete er, »Michael Latch.«
Warmes Sonnenlicht lag auf der Haçienda, die Casa Grande genannt wurde. Die Hunde räkelten sich schläfrig und zufrieden unter den Bäumen und öffneten kaum die Augen, als der große Fremde sein Pferd durch das Gatter lenkte. Nach Casa Grande kamen viele Fremde, und die Ungewissheit, die über der riesigen Ranch lag, interessierte die Hunde nicht.
Tony Costa, der im Hauseingang stand, richtete seinen mageren Körper gespannt auf und schützte seine Augen mit der Hand gegen das Sonnenlicht, um den Fremden genau betrachten zu können.
»Señorita, es kommt jemand!«
»Ist es Walt?« Schnelle, energische Schritte erklangen auf dem steinernen Boden. »Was sollen wir nur machen? Wenn doch bloß Michael da wäre!«
»Heute ist der letzte Tag«, sagte Costa düster.
»Sieh nur!« Das Mädchen berührte seinen Arm. »Genau hinter ihm! Das ist Walt Seever!«
»Zwei Männer sind bei ihm. Wir werden Ärger bekommen, wenn wir versuchen, ihn zu hindern, Señorita. Er wird nicht bereit sein, die Ranch an eine Frau zu verlieren.«
An der Treppe schwang sich der Fremde von seinem schwarzen Pferd. Er trug einen breitkrempigen, schwarzen Hut und einen Anzug aus feinem, schwarzem Tuch.
Seine Stiefel waren handgearbeitet und fast neu. Doch als sie die Waffen sah, schnappte sie nach Luft.
»Tony! Die Pistolen!«
Der junge Mann stieg die Treppe hinauf, zog seinen Hut und verbeugte sich. »Sind Sie Tony Costa? Der Vormann auf der Casa Grande?«
Die anderen Reiter kamen lärmend in den Hof geritten, und ihr Anführer, ein großer Mann mit kühnen, harten Augen, stieg ab. Er schob den Fremden zur Seite und baute sich vor dem Vormann auf.
»Nun, Costa, ab heute gehört die Ranch mir, und Sie sind gefeuert!«
»Das denke ich nicht.«
Alle Augen richteten sich auf den Fremden. Das Mädchen sah erschrocken und plötzlich sehr vorsichtig aus. Dieser Mann war stark, dachte sie plötzlich, und er hatte keine Angst. Er hatte ein glattrasiertes Gesicht, freundliche graue Augen und eine gewisse Selbstsicherheit, die von Erfahrung herrührte.
»Wenn Sie Walt sind«, sagte der Fremde, »dann können Sie wieder dahin zurückreiten, wo Sie hergekommen sind. Diese Ranch gehört mir. Ich bin Michael Latch.«
Auf Walt Seevers Gesicht zeigten sich Furcht und empörte Ungläubigkeit. »Sie? Michael Latch? Das können Sie nicht sein!«
»Warum nicht?« Jed war ganz ruhig. Da er Seever anblickte, konnte er die Wirkung seiner Worte auf Costa oder das Mädchen nicht sehen. »George hat nach mir geschickt. Hier bin ich.«
Außer empörter Wut zeigte sich noch etwas anderes auf Walts Gesicht, irgendein gefährlicher Verdacht oder eine Information. Plötzlich hegte Jed den Verdacht, dass Walt genau wusste, dass er nicht Michael Latch war. Oder es zumindest stark bezweifelte. Tony Costa hatte sich neben Jed gestellt. »Warum nicht? Wir haben ihn erwartet. Sein Onkel hatte ihm geschrieben, und nach Georges Tod habe ich ihm geschrieben. Wenn Sie daran Zweifel haben, dann schauen Sie sich die Pistolen an. Gibt es denn noch ein zweites Paar derartiger Waffen auf der Welt? Gibt es vielleicht zwei Männer auf der Welt, die solche Waffen machen können?«
Seever blickte auf die Waffen, und Jed sah, dass der verärgerten Gewissheit auf seinem Gesicht Zweifel und Verwirrung folgten.
»Ich will mehr Beweise haben als ein Paar Pistolen.«
Jed nahm den Brief aus seiner Tasche und reichte ihn Walt. »Ist von Tony. Ich habe auch das Testament meines Vaters und andere Briefe.«
Walt Seever starrte den Brief an und schleuderte ihn dann in den Staub. »Lasst uns hier verschwinden!« Er schwang sich aufs Pferd.
Jed Asbury beobachtete, wie sie wegritten, und wunderte sich über Walts seltsame Reaktion. Bis Seever den Brief gelesen hatte, war er völlig sicher gewesen, dass Jed nicht Michael Latch war. Jetzt war er sich nicht mehr so sicher. Aber wodurch war er am Anfang so sicher gewesen? Was konnte er wissen?
Das Mädchen flüsterte Costa etwas zu. Jed drehte sich um und lächelte sie an. »Ich glaube, Walt war nicht sehr glücklich darüber, mich hier zu finden«, sagte er.
»Nein.« Costas Gesichtsausdruck verriet nichts. »Das war er wohl nicht. Er wollte die Ranch übernehmen.« Costa drehte sich zu dem Mädchen um. »Señor Latch? Darf ich Ihnen Señorita Carol James vorstellen, eine - ein Mündel von Señor Baca und eine gute Freundin.«
Jed akzeptierte die Vorstellung.
»Sie müssen mein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Ich möchte alles, was Sie mir über Walt Seever erzählen können, erfahren.«
Costa wechselte mit Carol einen Blick. »Natürlich, Señor. Walt Seever ist ein malo hombre, ein schlechter Mensch, Señor. Er hat mehrere Männer umgebracht und ist ziemlich gewalttätig. Die Männer, die bei ihm waren, sind Harry Strykes und Gin Feeley. Sie sind Revolverhelden, und es wird von ihnen behauptet, dass sie Diebe wären.«
Jed Asbury hörte zwar aufmerksam zu, wunderte sich aber immer noch über Carols Reaktion. Hatte sie den Verdacht, dass er nicht Michael Latch war? Wußte sie, dass er nicht Latch war? Und wenn dem so war, warum sagte sie nichts?
Er war überrascht, dass sie ihn beide so ohne weiteres akzeptiert hatten. Denn selbst als er sich entschlossen hatte, den Platz des Toten einzunehmen, war er sich nicht sicher gewesen, ob er damit durchkommen würde. Er fühlte sich schuldig und voller Scham, obwohl Michael Latch tot war, und der einzige, dem er etwas streitig machte, offenbar ein schlechter Mensch war, der als erste Tat den Vormann der Ranch gefeuert hätte, einen Mann, dessen Heim schon immer diese Haçienda gewesen war.
Er war wie von Teufeln gehetzt über Land geritten, um noch zum richtigen Zeitpunkt hier einzutreffen. Und doch hatte er während des ganzen Ritts mit sich selbst über das Pro und Contra dieser Aktion gestritten.
Er war ein Niemand, ein Herumstreuner, ein Gelegenheitsarbeiter, ein Abenteurer vielleicht. So wie Hunderte von anderen Männern, die in den Westen kamen und wieder gingen, und die oft nicht mehr hinterließen als ihre Knochen in der Wildnis und ihr Fleisch, das zu neuer Erde wurde.
Er hatte Michael Latch nicht gekannt und wusste auch nicht, welche Art von Mensch er gewesen war. Aber er vermutete, dass er ein guter Mensch gewesen war, einer, dem man vertrauen konnte. Warum sollte er eigentlich nicht die Ranch vor Walt Seever retten, sich ein Heim schaffen und die Art von Mensch sein, die Michael Latch gewesen wäre?
Während des ganzen, wilden Ritts nach Westen hatte er mit seinem schlechten Gewissen gekämpft und versucht, sich einzureden, dass das, was er tat, das Richtige war. Latch hatte dadurch keinen Nachteil mehr, und Costa und Carol schienen durch seine Ankunft erfreut zu sein. Allein der Ausdruck auf Seevers Gesicht war den ganzen Ritt wert gewesen.
Aber es gab etwas anderes, was ihn störte. Das war Walt Seevers eigenartige Reaktion, als er sagte, dass er Michael Latch war.
»Sie sagten«, wandte er sich an Carol, »dass Seever ganz sicher gewesen ist, der Erbe zu sein?«
Sie nickte. »Ja, bis vor ungefähr drei Monaten hasste er George Baca dafür, dass er Ihnen die Ranch hinterlassen hat. Dann änderte er plötzlich sein Benehmen und schien ganz sicher zu sein, dass er sie bekommen würde, dass Sie niemals hier auftauchen würden, um Ihr Erbe zu übernehmen.«
Es war ungefähr drei Monate her, dass Jed Asbury auf den verlassenen Wagen und die ermordeten Menschen gestoßen war. Und für die Morde hatte er die Indianer verantwortlich gemacht. Aber dass die Leichen voll bekleidet und der Wagen ungeplündert zurückgelassen worden waren, ähnelte keinem Indianerüberfall, von dem er wusste. Drei ermordete Menschen - konnte Seever etwas davon wissen? War er darum so sicher gewesen, dass er alles erben würde?
Der Gedanke setzte sich bei ihm fest. Seever musste von den Morden etwas gewusst haben. Wenn das so war, dann waren die drei nicht von Indianern umgebracht worden, und das warf einige Fragen auf. Wie kam es, dass der Wagen so ganz allein in der Wüste stand? Und was war aus dem Mädchen namens Arden geworden?
Wenn die Indianer diesen Überfall nicht begangen und Arden weggeschleppt hatten, dann musste das jemand anderer getan haben. Und wo auch immer Arden war, sie würde wissen, dass er nicht der echte Michael Latch war. Sie würde wissen, dass Jed Asbury ein Betrüger war, aber sie würde wahrscheinlich auch wissen, wer die Mörder waren.
Jed trat auf die weitläufige Terrasse und blickte über das grüne Tal unterhalb des Ranchhauses. Er starrte in das Tal hinunter, und sein Kopf war voll mit Zweifeln und Besorgnis.
Es war ein schönes Land, gut bewässert und fruchtbar.
Mit seinem Wissen über Bodenbestellung und Viehhaltung konnte er hier die Arbeit, die George Baca begonnen hatte, weiterführen. Er würde das tun, was Michael Latch getan hätte, und er würde es vielleicht sogar besser machen. Es war eine gefährliche Situation, aber wann hatte er sich nicht in einer gefährlichen Lage befunden? Und die Menschen auf dieser Ranch waren gute Menschen, ehrbare Menschen. Selbst wenn er nur die Ranch vor Seever und seinem gesetzlosen Haufen retten konnte, war das ein ausreichender Grund dafür, den Platz des Toten einzunehmen. Doch eigentlich legte er sich nur Ausreden für seine Handlungsweise zurecht.
Die Waffen, die er trug, bedeuteten ebenfalls etwas. Carol hatte sie wiedererkannt und Seever ebenfalls. Was hatten sie für eine Bedeutung?
Er befand sich auf unsicherem Boden. Jedes Wort, das er sagte, musste er sich genau überlegen. Selbst wenn sie ihn noch nie vorher gesehen hatten, musste es doch irgendwelche Familiengeschichten oder Traditionen geben, von denen er nichts wusste. Er bemerkte eine Bewegung hinter sich und drehte sich um. In der hereinbrechenden Dämmerung sah er Carol.
»Gefällt es Ihnen?« Sie deutete auf das Tal.
»Es ist wundervoll! Ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen. Mit so einem Stück Land könnte man eine Menge anfangen. Es könnte ein Paradies sein.«
»Irgendwie sind Sie anders, als ich erwartet habe.«
»Bin ich das?«, fragte er vorsichtig und wartete darauf, dass sie mehr sagte.
»Sie sind viel selbstbewusster, als ich es mir vorgestellt habe. Onkel George pflegte zu sagen, dass Mike ein stiller Typ war. Dass er viel las, aber nicht viel herumkam. Die Art und Weise, in der Sie mit Walt Seever umgegangen sind, hat mich ziemlich in Erstaunen versetzt.«
Er zuckte mit den Achseln. »Ein Mann kann sich ändern. Er wird älter, und wenn er dann nach Westen geht, um ein neues Leben anzufangen, macht ihn das selbstbewusster.«
Sie bemerkte das Buch in seiner Hosentasche. »Was ist das für ein Buch?«, fragte sie neugierig.
Es war eine abgenutzte Ausgabe von Plutarch. Hier befand er sich auf sicherem Boden, denn auf dem Vorsatzblatt stand die Widmung: Für Michael von Onkel George. Er zeigte es ihr, und sie sagte: »Das war ein Lieblingsbuch von Onkel George. Er sagte immer, dass mehr bedeutende Männer Plutarch gelesen hätten als jedes andere Buch, die Bibel ausgenommen.«
»Ich mag es. Ich hab' nächtelang darin gelesen.« Er blickte ihr voll ins Gesicht. »Carol, was glauben Sie, wird Walt Seever tun?«
»Er wird versuchen, Sie umzubringen, oder jemand den Auftrag dazu geben«, antwortete sie. Sie deutete auf die Pistolen. »Sie sollten besser lernen, die da zu benutzen.«
»Ich versteh' ein wenig davon.« Er wagte nicht zuzugeben, wie gut er damit umgehen konnte. Denn diese Fertigkeit lernte ein Mann nicht über Nacht, und ebenso wenig eignete er sich die guten Nerven an, die ihre Benutzung erforderte, wenn man einem bewaffneten Feind gegenübertrat. »Seever hat fest mit dieser Ranch gerechnet, oder?«
»Er hat viel darüber gesprochen.« Sie blickte zu ihm empor. »Wie Sie wissen, ist Walt kein Blutsverwandter von Onkel George. Er war der Sohn einer Frau, die den Halbbruder von George Baca heiratete.«
»Aha.« Offensichtlich war Walt Seevers Anspruch auch nicht fundierter als sein eigener. »Aus den Briefen weiß ich, dass Onkel George wollte, dass ich das Anwesen übernehme, aber ich fühle mich wie ein Außenseiter. Ich habe Angst, dass es vielleicht falsch ist, eine Ranch, die andere Leute aufgebaut haben, zu übernehmen. Walt hat vielleicht mehr Anrecht darauf als ich. Es ist vielleicht falsch, wenn ich auf meinem Recht bestehe.«
Er war sich bewusst, dass sie ihn forschend ansah. Als sie dann antwortete, geschah das wohlüberlegt, als hätte sie eine Entscheidung getroffen.
»Michael, ich kenne Sie nicht näher, aber Sie müssten wirklich ein sehr schlechter Mensch sein, um so gefährlich und böse wie Walt Seever zu sein. Ich würde sagen, ganz egal, wie die Umstände sind, dass Sie bleiben und das Ganze durchstehen sollten.«
War das vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie mehr wusste, als sie zugab? Doch es war nur natürlich, dass er hinter jeder Äußerung Misstrauen witterte. Er musste das tun, sonst lief er womöglich in eine Falle.
»Es ist jedoch nur fair, Sie davor zu warnen, dass Sie sich auf eine gefährlichere Sache eingelassen haben, als Sie vielleicht erwartet haben. Onkel George wusste sehr genau, was Ihnen bevorsteht. Er kannte die Bösartigkeit von Walt Seever. Er bezweifelte, dass Sie gerissen oder tapfer genug sein würden, um Seever zu bekämpfen. Deshalb muss ich Sie warnen, Michael Latch, dass Sie möglicherweise getötet werden, wenn Sie bleiben. Doch ich glaube, dass Sie genau das tun sollten.«
Er lächelte in der Dunkelheit. Seit seiner Kindheit hatte er immer im Angesicht des Todes gelebt. Er war weder tollkühn noch verwegen, denn ein wahrhaft tapferer Mann war niemals tollkühn. Doch wenn es notwendig war, würde er dem Tod furchtlos ins Antlitz blicken. In einer derartigen Situation war er schon früher gewesen.
Er war hier ein Eindringling, obwohl der Mann, dessen Platz er eingenommen hatte, tot war. Doch vielleicht konnte er dessen Aufgabe übernehmen und die Ranch für diejenigen, die sie liebten, zu einem sicheren Ort machen. Dann konnte er weiterziehen und diese Ranch Carol und der Obhut von Tony Costa überlassen.
Er drehte sich um. »Ich bin müde«, sagte er. »Ich hab' einen langen und beschwerlichen Ritt hinter mir. Ich möchte mich jetzt gerne ausruhen.« Er machte eine Pause. »Vielleicht sollte ich doch bleiben...«
Jed Asbury lag bereits in tiefem Schlaf, als Carol in das Esszimmer ging, in dem Tony Costa an dem langen Tisch saß. Was hätte sie ohne ihn anfangen können? Er hatte dreißig Jahre mit ihrem Vater gearbeitet und sein ganzes Leben auf der Haçienda verbracht. Jetzt war er über sechzig Jahre alt. Aber er hielt sich immer noch so gerade und war immer noch so schlank wie als junger Mann. Und er war klug.
Costa blickte auf. Er trank bei Kerzenlicht Kaffee. »Egal wie es ausgeht, Señorita, es hat angefangen. Was denken Sie jetzt?«
»Nachdem ich ihn gewarnt habe, sagte er mir, dass er bleiben würde.«
Costa betrachtete den Kaffee in der Tasse. »Haben Sie keine Angst?«
»Nein. Er hat Walt Seever Paroli geboten, und das reichte mir. Alles ist besser als Walt Seever.«
»Si.« Costas Zustimmung war deutlich. »Señorita, haben Sie seine Hände beobachtet, als er Seever gegenübertrat? Sie waren bereit, Carolita... bereit, zu ziehen. Dieser Mann kennt sich mit Waffen aus. Er ist ein starker Mann, Carolita!«
»Ja, ich glaube, du hast Recht. Er ist ein starker Mann.«
Zwei Tage lang ereignete sich, was die Stadt betraf, nichts. Walt Seever und seine hartgesottenen Kumpane hätten vom Erdboden verschwunden sein können. Aber auf der Casa Grande Ranch passierte einiges, und Tony Costa pfiff die meiste Zeit anerkennend vor sich hin. Jed Asbury hatte keine besondere Ausbildung genossen, aber er konnte mit Menschen umgehen, er wusste, wie man sie führte und wie man die besten Ergebnisse bekam. Vor allen Dingen hatte er praktische Erfahrung und Wissen darin, wie man Vieh behandelte und wie man eine Ranch führte.
Nach seiner Unterhaltung mit Carol war er am nächsten Morgen um fünf Uhr aufgestanden. Als sie erwachte, teilte ihr die alte Maria, die Köchin, mit, dass der Señor in seinem Büro schon fleißig arbeitete. Die Tür war einen Spaltbreit offen, und als sie vorbeiging, sah sie ihn in die Rechnungen der Ranch vertieft. Vor sich hatte er eine Landkarte mit den Grundstücken der Ranch aufgestellt, und während er die Verteilung der Rinder überprüfte, studierte er die Karte.
Er nahm ein hastiges Frühstück zu sich, und um acht Uhr saß er im Sattel. Seine nächste Mahlzeit aß er in einem Außencamp, und erst nach Einbruch der Dunkelheit kam er zurück. In zwei Tagen verbrachte er zwanzig Stunden im Sattel.
Am dritten Tag rief er Costa zu sich ins Büro und sandte Maria, um Carol zu bitten, auch dabei zu sein. Sie kam überrascht und neugierig.
Jed trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und die silbernen Pistolen. Sein Gesicht schien in diesen zwei Tagen schmaler geworden zu sein, aber als er Carol erblickte, lächelte er.
»Sie sind schon länger hier als ich und sind, in gewissem Sinne, mein Partner.« Ehe sie ihn unterbrechen konnte, drehte er sich zu Costa um. »Ich möchte, dass Sie als Vormann hierbleiben. Ich habe Sie beide jedoch hergebeten, weil ich einige Änderungen plane.«
Er zeigte auf einen Punkt auf der Landkarte. »Dieser enge Weg führt in offenes Land und dann in die Wüste. Ich fand dort Viehspuren, die hinausführten. Es könnte sich dabei um Viehdiebe handeln. Wenn wir ein paar Felsen sprengen, wird er geschlossen sein.«
»Eine gute Idee«, stimmte Costa zu.
»Dieses Feld...« Jed deutete auf ein großes Gebiet in der Nähe des Farmhauses. »... muss eingezäunt werden. Wir werden Flachs darauf anpflanzen.«
»Flachs, Señor?«
»Er wird sich gut verkaufen.« Er deutete auf ein kleineres Gebiet. »Auf dieser Fläche werden wir Wein anpflanzen, der durch die Hügel dort geschützt wird. Es können Zeiten kommen, in denen wir nicht nur von Pferden oder Vieh leben können. Deshalb müssen wir uns noch andere Quellen für unser Einkommen erschließen.«
Carol sah ihn voller Verwunderung an. Dieser neue Michael Latch war voller Tatkraft. Er hatte die Situation sofort fest in der Hand und war dabei, Veränderungen einzuführen, über die Onkel George nur nachgedacht hatte.
»Außerdem, Costa, müssen wir das ganze Vieh zusammentreiben. Holen Sie alle Rinder und sondern sie alle aus, die über vier Jahre alt sind. Die werden wir verkaufen. Draußen im Busch habe ich eine ganze Menge von Tieren gesehen, die zwischen fünf und acht Jahren alt sind.«
Nachdem er weggeritten war, um einen anderen Teil der Ranch zu inspizieren, ging Carol in die Schmiede, um mit Pat Flood zu reden. Er war ein alter Seemann mit einem Holzbein, den Onkel George pleite am Strand von San Francisco aufgelesen hatte. Pat Flood hatte sich als meisterhafter Handwerker entpuppt.
Als sie vor der Werkstatt stehenblieb, sah er sie unter seinen buschigen Augenbrauen hervor an. Er besohlte gerade ein Paar Stiefel. Noch ehe sie etwas sagen konnte, meinte er: »Der neue Boss da, Latch, der ist doch zur See gefahren, oder?«
Überrascht fragte sie: »Wie kommst du auf diese Idee?«
»Ich hab' gesehen, wie er gestern einem Pferd eine Schlinge übergeworfen hat. So 'ne saubere Arbeit hab' ich nich' mehr gesehn', seit ich an Land gegangen bin. Mit dem Seil ist er so flink umgegangen, als hätt' er das schon jahrelang gemacht.«
»Ich vermute, dass es viele Männer gibt, die mit einem Seil gut umgehen können«, entgegnete Carol.
»Aber nich' auf die Art, wie's 'n Matrose macht. Er hat es auch Tau genannt. Gib' mir das Tau!, hat er gesagt. Selbst ich, der ich schon so lang an Land bin, ich nenn' es immer noch Tau. Aber bei ihm is' das was and'res. Ich verwett' mein Abendessen, dass er zur See gefahren is'.«
Jed Asbury ritt in die Stadt. Er wollte herausfinden, was die Leute aus der Stadt von der Ranch, George Baca und Walt Seever hielten. Vielleicht ergab sich die Möglichkeit, mit ein paar Leuten zu sprechen, ehe sie herausfanden, wer er war. Außerdem verunsicherte es ihn, dass es noch zu keiner endgültigen Auseinandersetzung mit Seever gekommen war. Sein Erscheinen in der Stadt könnte das beschleunigen oder Seever eine gute Gelegenheit dafür geben, wenn er einen solchen Anlass brauchte. Wenn eine Auseinandersetzung sein musste, dann wollte er sie möglichst schnell hinter sich bringen, damit er mit der Arbeit auf der Ranch weitermachen konnte.