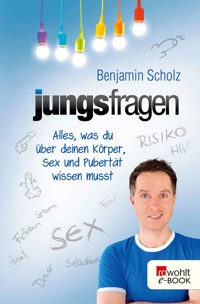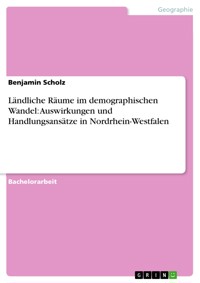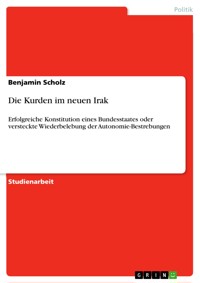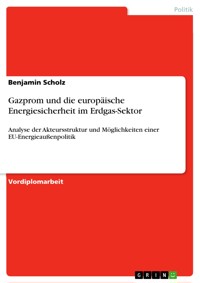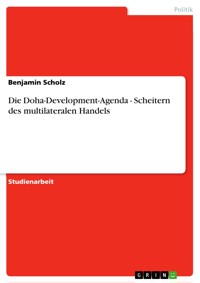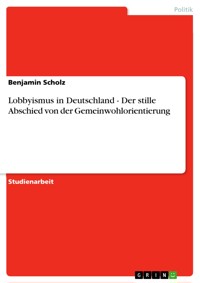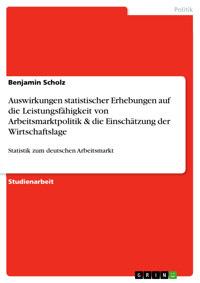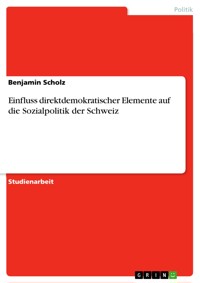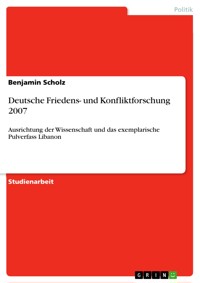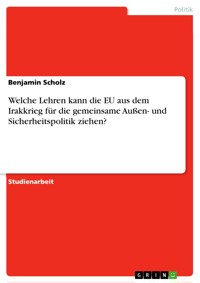
Welche Lehren kann die EU aus dem Irakkrieg für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ziehen? E-Book
Benjamin Scholz
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Politik - Region: Naher Osten, Vorderer Orient, Note: 2,3, Freie Universität Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG 1.1 THEMA UND RELEVANZ, BETRACHTETE ZEIT 1.2 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN 1.3 THEORIE 1.4 METHODIK UND GLIEDERUNG 2. HAUPTTEIL 2.1 HISTORISCHER ABRISS - DEFINITION DER AKTEURE 2.2 DIE NEUE QUALITÄT KRIEGERISCHER AUSEINANDERSETZUNGEN AM BEISPIEL IRAK 2.3 DIE SICHERHEITSINTERESSEN DER USA UND EUROPAS 2.4 DER IRAK - STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER USA NACH KRIEGSENDE 2.5 DIE BEDEUTUNG DES ÖLGESETZES FÜR DIE STABILITÄT DES IRAK 3. FAZIT 4. QUELLENVERZEICHNIS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
FUBerlin,OttoSuhrInstitutfürPolitikwissenschaft Sommersemester2009
Hauptseminar: Sicherheitspolitische Konfliktfelder in und um Europa
Der Irak
Welche Lehren kann die EU aus dem Irakkrieg für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ziehen?
BenjaminScholz Politikwissenschaft-Diplom
1
Page 3
1.1 Thema und Relevanz
„Im Falle Iraks verfügen Europa und die Arabischen Golfstaaten über die Möglichkeiten, dem Land bei der Überwindung der Altlasten Saddam Husseins und der US-Invasion zu helfen und zur Konsolidierung und regionalen Integration des neuen Irak beizutragen.“
Über sechs Jahre nach dem Irakkrieg ist die Stabilität des Landes immer noch nicht gewährleistet. Mehr noch, die Vereinigten Staaten holen ihre Soldaten nach Hause oder verlagern Truppenkontingente nach Afghanistan, Großbritannien hat sich als Hauptverbündeter - ähnlich wie viele andere Staaten der „Koalition der Willigen“ - bereits komplett zurückgezogen. Mit der Verringerung der militärischen Präsenz wird zwar immer mehr Souveränität an das irakische Volk bzw. die neue Regierung übergeben. Doch ob diese bereit ist, nach innen einen Ausgleich zwischen den Bevölkerungsgruppen und so Sicherheit herzustellen, ist kritisch zu sehen. Der Krieg sowie die Art und Weise, in der die unmittelbaren Probleme nach dem Krieg angegangen worden sind, haben tiefe Veränderungen in der sozialen und politischen Verfasstheit des Iraks ausgelöst, deren Folgen noch schwer abzuschätzen sind. Der Einmarsch der Alliierten hat zum Zusammenbruch des sunnitischen Machtzentrums geführt und zu einer Zunahme der peripheren Kräfte, vor allem der Schiiten und der Kurden.1Die zwischen Zentralregierung und der Autonomen Region Kurdistan entstandenen Kompetenzstreitigkeiten in Hinblick auf die Entwicklung des Ölgesetzes wie auch die Spannungen in Territorialfragen (Kirkuk und andere Bezirke) sind Ausdruck der Instabilität des Staates. Die latente Bedrohung durch Anschläge verschiedener extremistischer und religiös-fundamentaler Gruppierungen wirkt darüber hinaus massiv destabilisierend. Zudem dürfte Bagdad außenpolitisch in der Region solange skeptisch wahrgenommen werden, wie die Amerikaner politisch und militärisch Einfluss ausüben. Zu groß ist das Misstrauen, welches in der aggressiven Hegemonial-Rhetorik der alten Bush-Administration ihren Ursprung hat. Genau dies sind Altlasten der US-Invasion von denen eingangs im Zitat gesprochen wird.
Die Europäische Union hat in diesem Kontext tatsächlich die Möglichkeit eine eigene erfolgreiche, strategische Sicherheitspolitik zu gestalten. Im Konzert der internationalen Mächte kann der Erfolg dabei zwei Gesichter haben. Entweder kann dieser in der Profilierung gegenüber den USA begründet sein, indem die Europäer wenig Einfluss auf die Neuordnung des Landes ausüben. Oder die Europäer übernehmen eine aktive Rolle beim Wiederaufbau des Landes, erkennen die Fehler der USA (sowie Großbritanniens), und setzen die Erfahrungen in eine eigene neue Strategie um. Grundvoraussetzung für letzteres ist allerdings, dass ein Mechanismus gefunden wird, der den Ausgleich der außenpolitischen Interessen innerhalb der EU garantiert. Die bisherigen Erfahrungen lassen eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik vermissen. Zum einen ist das erkennbar an der Spaltung der EU im Vorfeld des Krieges in das Lager der Unterstützer (insbesondere GB, Polen, Spanien, Italien und die Niederlande) und das der Gegner (insbesondere Deutschland, Frankreich und
1Neugart, Felix: Die Zukunft der europäischen Politik im Nahen Osten nach dem Irakkrieg -Diskussionspapier der VIII. Kronberger Gespräche, S. 7; München 2003; Bertelsmann-Stiftung
Page 4
Belgien). Zum anderen erfolgte nach dem Krieg bislang keine öffentliche Aufarbeitung der diplomatischen Geschehnisse, die zu dieser Spaltung führten. Eine Diskussion über Prinzipien und Positionen einer europäischen Außenpolitik muss zwangsläufig dort scheitern, wo die diplomatische Gesichtswahrung Vorrang hat. Im Klartext heißt dies, dass eine klare Verurteilung der gefälschten auf irakische Massenvernichtungswaffen hinweisenden US-Geheimdienst-Dokumente durch die am Krieg beteiligten europäischen Staaten nicht stattfand. In der Konsequenz müssten letztere sich zusätzlich verpflichten, künftig, in einem Fall der unklaren Bedrohung durch ein Land, den Weg multilateraler Institutionen zu wählen. Diese Institutionen können die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein.
Dabei stellen sich jedoch neue Fragen, insbesondere solche der institutionellen Ausgestaltung. So stellen die USA durch den Sicherheitsrat innerhalb der Vereinten Nationen ein Schwergewicht dar, wobei andere Nationen nicht repräsentiert sind. Nach Ende des Kalten Krieges und dem folgenden US-Unilateralismus erfolgt nun global ein langsamer Emanzipationsprozess. In diesem Prozess kann es zu einer Machtverschiebung bei zentralen außenpolitischen Akteuren kommen, weg von national orientierten Realisten, hin zu multilateral und kooperativ orientierten Institutionalisten. Das setzt allerdings auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem bislang üblichen Primat militärischer Dominanz voraus. Zweifellos sind die Vereinigten Staaten in Fragen der Militärtechnik weltweit führend. Und oft wird nicht ganz zu Unrecht bemängelt, dass die Europäer nicht über einen ähnlich effizienten Militärapparat verfügen um bei der Verteidigung und Durchsetzung westlicher Interessen selbst Verantwortung zu übernehmen.2Die Nachkriegszeit im Irak aber hat gezeigt, dass ein langfristiger Erfolg der Außenpolitik nicht allein auf trivialer militärischer Dominanz basiert. Der Grund für eine Intervention muss bewiesen und nicht unilateral motiviert sein, zivile Opfer müssen verhindert werden, Kooperation mit der Bevölkerung und anderen Staaten beim Wiederaufbau ist unerlässlich. Das heißt zum einen: der Einsatz militärischer Mittel muss gezielt sein. Zum anderen: es ist zwingend notwendig mit historischen Konflikten zu brechen und die Interessen verschiedener Akteure zu berücksichtigen. Beides ist schwierig zu gewährleisten aber Bedingung für Stabilität. Letztere ist erforderlich für Investitionen und das Erreichen von Wohlstand und dauerhaften Frieden.3Dies gilt insbesondere für den Irak.
1.2 Fragestellung und Hypothesen
Die soeben angerissenen Herausforderungen in der internationalen Sicherheitspolitik sollen nun näher untersucht werden, um folgende Frage klären zu können: Welche Lehren kann die EU aus dem Irakkrieg für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ziehen? Dafür werden folgende Hypothesen der Reihe nach geprüft:
1. Die neue Qualität kriegerischer Auseinandersetzungen liegt nicht nur in der Asymmetrie der eingesetzten Mittel, sondern auch in der zwangsläufigen Selbstaufgabe demokratischer
2Anm.: Beispiel Bosnien
3Vgl. dazu Czempiels Erweiterung des Demokratischen Friedens (Theorie)