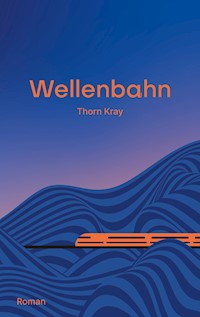
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Unaufhaltsam rollen sie seit Jahren über das Schienennetz der Deutschen Bahn: wässrige Kolosse, meterhohe Wellen. Ruth Gaz, eine junge Personalerin der DB, wird magisch von ihnen angezogen und begibt sich auf die Suche: Woher kommen die Wellen? Und wer sind jene Lebensmüden, die darin tauchen? Zusammen mit drei Mitstreitern wird sie tiefer und tiefer in den Strudel des Rätsels gezogen und gerät so ins Fadenkreuz einer geheimen Abteilung innerhalb der Bahn, die nur ein Ziel kennt: die völlige Vernichtung der Wellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Leila
Alle Figuren, Ereignisse und Institutionen in diesem Text sind frei erfunden. Sie haben mit den Wirklichkeiten, um eine Analogie von Uwe Tellkamp zu verwenden, genauso viel zu tun wie Ton mit der fertigen Skulptur.
Nähere Informationen zum Autor finden sich auf:
www.thornkray.de
INHALT
BITTE EINSTEIGEN
RISOS ZWERGIN
TRÜFFEL IN DER WALDSAMKEIT
LEBENSLOGISTIK
WAS MICH ERNÄHRT…
BERECHTIGTE GEHEIMNISSE
PILZE SAMMELN
AUF DER DEMO
IM WELLENHERZ
AM ÜBERGANG
SPITZKEGELIGE KAHLKÖPFE
TREFFEN UNTER TANNEN
MANN UND MAUS
GRUPPENRITT
JEDER IST SEINES GLÜCKES SCHMIED
ZWEI UNGLÜCKE
MARKOVS KETTE
MÜHLENPARTY I
DIE KUGEL IN DER MITTE DES SEES
MÜHLENPARTY II
WIEDERBELEBT
DIE LOSUNG DER HYPERBOREER
KRANKE SPIONIN
OPHIOCORDYCEPS UNILATERALIS
IN DER STIFTUNG
UNFÄLLE
UNTER WASSER ATMEN
DIE INNERE HEIMAT ALLES GROSSEN
ANNES ENTSCHEIDUNG
EINE NEUE AUFGABE
VERRAT
AUFBRÜCHE, „GEH NICHT“
VIPASSANA
SCHEISS INDIEN
SHELDRAKES HYPOTHESE
ANKUNFT DER LEHRERIN
ASURA
DAS SCHWÄCHSTE GLIED DER KETTE
DIE TOTGEWEIHTEN GRÜSSEN DICH!
WORAUF DER FINGER ZEIGT
SCHMERZEN OHNE LEIDEN
HILF MIR
SIE WISSEN, WO IHR SEID
DIE PASSENDE ZIELSCHEIBE
INFINITY-POOL
DAS WESEN DER WELLE
WIEDER AUFWACHEN
EPILOG
1. BITTE EINSTEIGEN
Die Kante war nah, zu nah. Von der gelben Schraffur ging keine Warnung mehr aus. Die Markierung fühlte sich inzwischen an wie eine Einladung, ihre Rillen liefen als winzige, zu überquerende Täler durch den Stahlbeton. Geräusche und Gespräche klangen fern, mussten aber nah sein. Um sie herum schwitzte man in T-Shirts und kurzen Hosen, obwohl es erst halb acht war. Die Leute am Bahnsteig hielten in kleinen Nuschelgruppen höflich Abstand voneinander oder starrten abgelenkt von irgendwelchen Bildern auf flackernde Displays. Nur einige schauten in Richtung Norden, davon ehrlich fasziniert nur zwei junge Mädchen mit braunen Zöpfen, nicht älter als sechs oder sieben, die an der Hand ihrer Mutter zappelten.
Mochte die bannende Bedrohlichkeit verflogen sein, die die Wellen einst gehabt hatten – niemand stand hier näher als nötig an der Bahnsteigkante.
Niemand außer Ruth Gaz.
Sie trug ihre dünnen Ballerinas. Ihre Füße taten noch weh vom gehetzten Laufen vorhin. Das Symbol an der Anzeigetafel leuchtete auf und eine blecherne Durchsage dröhnte aus den Lautsprechern.
„Halten Sie Abstand von der…“
Wenige Berufspendler beachteten die Routinestimme, zogen sich stattdessen einen Snack am Automaten oder nippten an bedruckten Pappbechern mit schwarzen Plastikkappen.
Ein dumpfes Schweben in ihren Fußsohlen hatte Ruth noch näher an die gelb schraffierten Streifen mit den runden Rillen gebracht.
Das Rauschen war bereits zu hören. Der Kamm der Welle reflektierte die montagsmüden Sonnenstrahlen. Unaufhaltsam bewegte sich das Wassermonument auf silbrigen Schienen vorwärts.
Ruth machte einen weiteren Halbschritt und hatte die Fußspitze auf der mittleren Linie.
Mit hoher Geschwindigkeit legte sich der Zweieineinhalbmeterberg in die letzte Kurve. Die Flüssigkeit hielt zusammen, unbeeindruckt von der Schwerkraft, als hätten die Moleküle sich gegen überall sonst gültige Naturgesetze verschworen.
Die letzte Furche, das letzte Tal. Ruth konnte nun über die Kante sehen. Dort lag grober, grauer Schotter, Zigarettenkippen, ein verlorener Haarreif, achtlos weggeworfene Kaugummipapierchen in weiß-rot, wahrscheinlich Wrigley’s Spearmint.
Das Rauschen hatte sich mit einer unterschwelligen Vibration gemischt. Sie war gleich da, gleich da.
Gedanken flimmerten vorbei, als säße Ruth im Kino. Was wollte sie hier? Wer bewegte ihre Hüfte? Ihr Kopf hatte das Gewicht einer Daune. Am liebsten hätte sie auch die Hände nach vorne gestreckt und die Luft umarmt. Sie zählte abwärts, ein Countdown tickte unsichtbare Zahlen herunter. Gleich würde sie eingehüllt, verschluckt, gefressen. Für einen Moment sah sie sich als Wasserleiche, deren zerbrochene Glieder, blutig und kaum noch identifizierbar, hunderte Meter als traurige Überreste auf den Schienen verteilt lagen.
Der Block, geschmeidig wie ein rennender Elefant, rauschte auf den Schienen heran. Gleich war es soweit, gleich, jeden Moment…
…jemand griff Ruth an die Schulter, zog sie ruckartig zurück. Fast wäre sie gestolpert und nach hinten gefallen. Sie schwindelte, Schwärze in den Augenwinkeln.
Die Welle floss vorbei. Ein tonnenschwerer Koloss auf leisen Sohlen. Magisch klar und rein und erschreckend. Niemand sah noch auf‘s Handy, alle folgten der durchsichtigen Gestalt wie Zuschauer dem Ball bei einem Tennisfinale.
Es roch nach Regen, der auf heißen Asphaltstraßen verdampfte.
Sogleich kam Ruth wieder zur Besinnung und sah in das breite Gesicht einer sonnengegerbten Mittfünfzigerin, die ihren Ärmel festhielt.
„Junge Frau, geht es Ihnen gut?“
Ruth wusste nicht, was sie antworten sollte, brachte aber ein „Ja, alles in Ordnung“ heraus und wurde näher herangezogen.
„Das war sehr knapp, junge Dame“, flüsterte die Alte, deren überschminkte Lippen sich streng zu einem Strich verengt hatten. „Sie hätten sich eben fast umgebracht“.
Trotzdem ließ sie Ruths Kleidung los.
„Ich wollte nur den Geruch besser wahrnehmen”, log Ruth. „Aber danke, das war sehr geistesgegenwärtig von Ihnen, danke vielmals.“
„Gern geschehen”, nickte ihre Retterin. „Und passen Sie auf sich auf. Das nächste Mal bin ich vielleicht nicht da.“
***
Als der RE verspätet eintraf, stieg Ruth schnell in den Zug und suchte sich einen Fensterplatz. So zerstreut sie auch sein konnte, eine derartige Abwesenheit war ihr bisher fremd gewesen. Sie versuchte sich zu erinnern, ob etwas derartiges schon einmal passiert war, fand aber nichts. Alles, was ihr deutlich vor Augen stand, war das Gesicht der alten Frau, die sie gerettet hatte.
Das satte Grün der Lahnberge drückte sich am Glas vorbei und sie zwang sich über ihren Tag nachzudenken. Wahrscheinlich würde es heute vor allem um die Planung der Seminare von DB-Training gehen. Geistig ging sie die Lehrpläne der Fahrdienstleiter durch. Notfallprotokolle und Richtlinien, wie mit Unfällen bei Wellenkontakt umzugehen sei. Ein ironisches Grinsen kaperte ihre Mundwinkel. Die meisten Schulungen waren im Verzug. Geplante Seminare würden nicht stattfinden, weil man – sie – keine Dozenten fand. Ein gutes Dutzend Teilnehmer musste über ganz Deutschland verteilt werden, um die jeweilige Ausbildung beenden zu können. Ihrer Rechnung nach konnten einige der Sicherungstechniker keine Ahnung haben, was zu tun war, wenn wirklich mal ein großräumiger Unfall passierte. Und das nur, weil jemand – unter anderem ihr eigenes Team, zuständig für die Region Mitte – es nicht auf die Kette bekam, die Qualifikationsbausteine modular zu organisieren. Und sie nannten sich „Experten“? Ja, dachte Ruth, Experten in Form von Windgebäck.
Nach einer guten Stunde kam Ruth am Hauptbahnhof Frankfurt an und nahm die U-Bahn zum Pfarrer-Perabo-Platz. Der Gebäuderiese bestand aus von Autoabgasen schmutzig gewordenen Beton und passte gut in den Gallus, dem heruntergekommen Teil der Innenstadt. Hier blieben die Mieten noch günstig. Das berühmte Drogenumschlagsviertel um die Münchner Straße war nicht weit. Erst neulich hatte sie auf dem Nachhauseweg gesehen, wie eine Bande nordafrikanisch aussehender Männer von Polizisten an die Wand gestellt und nach und nach durchsucht worden war. Irgendwie hatte sie Mitleid mit den schäbig aussehenden Typen gehabt, die meisten kaum älter als Dreißig waren, hier wahrscheinlich nur mit Duldung und ohne Arbeitserlaubnis.
Hinter der digitalen Stechuhr für den Konzernausweis hob der Aufzug sie in den sechsten Stock. Einige aus ihrem Team waren schon da. Anne, ihre Lieblingskollegin, war bereits tief versunken. Bedarfsplanung für die LST-W-NAQ des zweiten Quartals. Die Liebe der Bahn zu Abkürzungen war nicht umsonst intern legendär. Auf Annes Bildschirm sah sie eine jener endlosen Excel-Listen mit endlosen Querbezügen unzähliger Reiter, alle mit Abkürzungen benannt. Im Vorbeigehen wuschelte Ruth Anne durch den wilden out-of-bed-Look und wurde mit einem herzhaft grimmigen Grunzen zurechtgewiesen. Gegenüber, am anderen Ende des Flurs, stand ihre Chefin Simone, eine leicht rundliche Brünette Mitte vierzig, heute konzernkonform in rot-grauen Business-Kostüm. Mit ihrer Fachaufsicht war sie meistens überfordert, da sie aus einem anderen Ressort zu den Grundsätzen gewechselt war. Dafür hatte sie Ahnung von Führung und die Arbeitsethik eines Bienenschwarms während der ersten Sommertage. Vor ihren drei Bildschirmen angekommen, setzte Ruth sich an den Rechner und begrüßte flüchtig Margarete zwei Reihen weiter, die rentennahe Veteranin des Teams. Das ein oder andere Mal war Ruth mit ihr aneinandergeraten, da sie selbst Langsamkeit in jeder Beziehung nicht ausstehen konnte und die ruhige Kugel der fast-grauen Kollegin sich nur mit Gewalt beschleunigen ließ. Automatisch poppte Outlook auf. Einer der endlosen E-Mail-Threads mit Dutzenden von Empfängern, die niemand je zu Ende las.
Hallo Frau Wiedegrund,
für die Inspektionsabarbeitung der Wetterschutzprüfungen der elektrischen Energieanlagen im Netz Mainz benötigen wir dringend für 50TP das Seminar TB80766, Wetterschutzfachkraft. Die verlinkte Liste an Kollegen liegt auf dem Sharepoint, siehe anbei. Wir müssen hier dringend handeln! Zurzeit haben wir keinen Kollegen in der 50TP zur Bearbeitung, und die Elternzeitvertretung hat noch keine Ahnung, was sie tun soll (sorry Henrike, im Cc). Wir haben schon versucht, die Ausbildung auf dem freien Markt einzukaufen. Leider bisher kein Erfolg. Geht das auch Inhouse über DB-Training?
Grüße
Wiedegrund
Hallo Frau Richter,
leider sind für den LG keine Kaps seitens DB-T mehr frei. Die DB-T geht noch mal auf Ihre Dispo zu; finale Klärung, ob wir outsourcen können, kommt nach – aber eine Realisierung der Schulung im Wunschzeitraum sehe ich bislang kritisch. Der Markt ist momentan angespannt. Bitte melden Sie daher die Bedarfe namensscharf mit entsprechender Mitarbeiterprio in der diesjährigen Bildungsbedarfsplanung, um einen Engpass wie im letzten Jahr zu vermeiden!
Viele Grüße
Marina Gupo
Hallo Herr Herbert,
gibt es für Seminare bei externen Anbietern die Positivliste, in der Sie zunächst prüfen können, ob das Seminar bereits zum externen Einkauf freigegeben wurde? Sollte das Seminar hier nicht enthalten sein, gehen Sie bitte auf meine Kollegin Frau Friedrich hinsichtlich des Prozesses zur Beantragung externer Maßnahmen zu. Das Fiasko vom letzten Jahr sollte sich wirklich nicht wiederholen.
Beste Grüße
Archi Walding
Und so weiter und so weiter.
Selbst nach vier Jahren in diesem Konzern konnte Ruth sich nicht vom dem Gefühl befreien, dass über ihrem Kopf mit Mails Tischtennis-Rundlauf gespielt wurde. Nach dem Chaos der Reorganisation vorletztes Jahr wusste niemand mehr allzu genau, wer wann was warum wissen musste. Der Fluch reiner Interna, wie Anne es nannte. Die Stirn in Falten schickte sie der weiterhin versunkenen Kollegin über den MS Teams-Chat einen Facepalm-Emoji und klickte in ihren heutigen Terminkalender. Teamsitzung, verschiedene Jour Fixe mit HR-Business-Partnern, Quali-Steuerern und sogar einem Ressortleiter standen auf der Tagesordnung. Es lief gerade eine Klagewelle, weil DB-Training mal wieder die Ausbildungsplanung versemmelt hatte und nun viele Azubis nicht rechtzeitig fertig werden würden. Aber damit sollten sich die Rechtsabteilung und dann der Vorstand beschäftigen.
Langsam trudelte der Rest ihres Teams ein. Robert, Mira, Jan. Die anderen waren im Home-Office und würden sich bei der ersten Besprechung in MS-Teams dazuschalten. Für Ruth hatte es eine lächerliche Note, wenn Menschen, die keine vier Meter Luftlinie voneinander entfernt saßen, sich in einem Videochat trafen und über Kopfhörer miteinander sprachen. Ab und zu gab es dabei Echos, weil einige die Sache mit der Rückkopplungsschleife nicht verstanden.
Ein Vorteil an dieser Form von Meetings war jedoch, dass Ruth viele Dinge gleichzeitig tun konnte. Sie mochte die Geschwindigkeit ihres Jobs, hatte immer zehn Tabs gleichzeitig offen, schrieb Notizen in OneNote, füllte ihr digitales KanBanBoard, setzte noch eine Mail ab und hörte halb einer übervollen Projektgruppe zu, bei der niemand den Lead übernehmen wollte.
Sie loggte sich in MS Teams ein. Simone begrüßte alle und stellte die Punkte der Wochenagenda vor. Wie schon letztes Mal ging es vorrangig um das neueste Change-Management-Projekt: Verteilung von Berechtigungen in einem der drei SharePoints, die Starke Schiene, die Ende-zu-Ende-Landkarte 2030. Alle hielten sich mit Beiträgen zurück. Ruth chattete nebenbei mit Anne. Nachdem alle sich ausgetauscht und kaum etwas geklärt hatten, gab es für sie keine konkreten 2Dos. „Corporate Bullshit-Bingo“, erschien im privaten Chat mit Anne, gefolgt von noch mehr Facepalm-Emojis und einer scharfsinnigen Meta-Analyse. „Schnittstellen, die noch geklärt“ werden sollten, wo „man“ – wer auch immer das war – „das“ – möglichst vage gehalten – „nochmal mit den Fachbereichen abstimmen muss“, und zu erfragen hätte „was die Regionen dazu sagen“. Phraseologisch gesehen ein normaler Montagmorgen.
Umfassende Kenntnis davon, was Ruth den ganzen Tag tat, welche Termine sie wahrnahm, in welchen Meetings sie saß und welche Datensätze sie bearbeitete, hatte eigentlich niemand. Hauptsache, am Ende gab es genug Trainer für den LST-W-Lehrgang.
LST-W stand für Leit- und Sicherungstechnik Wellen. Jungen Azubis wurde hier beigebracht, wie genau die Bahn ihre technische Infrastruktur für den Umgang mit den Wellen einrichtete, sie verwaltete und instand hielt. Das System war komplex, was vor allem für das Erkennungsnetz beim Auftreten der Wellen galt, das aus einem bundesweiten Cluster an Sensoren, Lichtschranken, Kameras und anderen Technologien bestand, die extra für diesen Zweck entwickelt worden waren. Einiges davon hatte die DB ausgelagert, weil sie mit Forschungsinstituten wie dem Fraunhofer oder der Max-Planck-Gesellschaft zusammenarbeiten musste. Hiermit hatte Ruth nicht mehr viel zu schaffen. Trotzdem ergab sich so ein plausibler Grund, die Ränder des Themas zu erkunden. Sicher, sie war keine Wissenschaftlerin, dafür hatte ihr mathematisches Talent nie gereicht. Umso mehr beneidete sie all jene, die sich in auf diese Art mit dem Phänomen beschäftigen durften. Teilchenphysiker, Meeresgeologen, Biochemiker, sogar Ozeanographen und K.I.-Spezialisten versuchten herauszubekommen, woher die Wellen kamen. Der Aufwand zur Klärung dieser Frage hatte sich zusehends in ein Mammutprojekt verwandelt, dem Stück für Stück das Geld entzogen worden war. Forschungseinrichtungen und private Firmen widmeten sich weiterhin der Modellierung der Wellen in Bezug auf Häufigkeit, Größe, Masse, Geschwindigkeit, geographischer Konzentration, und so weiter. Sie alle übermittelten ihre Daten an die zuständigen Abteilungen bei der Bahn. Jene verwandelte die DB dann in nutzbare Vorhersagen.
Unglücke, die vor dieser technologischen Einkesselung gelegen hatten, wurden zu Gedenktafeln, an die immer weniger Blumen gelegt wurden, je weniger sie sich wiederholten. Zeitungsartikel einigten sich auf den Begriff einer „zunehmend harmlosen Naturkatastrophe“. Damit wurden die Wellen immer mehr an die Seitenlinie medialer Aufmerksamkeit geraten, auf deren Bühne das Licht zu tagesaktuell dringlicheren Ereignissen geschwenkt wurde. Sicherungssysteme für Züge, das Spannungsnetz, die Bahnhöfe, geschultes Personal, all das hielt vor allem der Berufspendlerschaft die Angst weitestgehend vom Hals. Von Stilllegung der Bahn war heute keine Rede mehr. Einzelne Mahner, deren Kassandrarufe kaum noch jemand hören wollte, ließen sich bei kleineren Unfällen schnell mit dem Argument abkanzeln, der Autoverkehr sei ja auch gefährlich, wenn nicht gefährlicher. Die Wellen zählten – fast – zur Normalität des Bahnreisens in Deutschland.
Zusätzlich hatten einige Unternehmen begonnen den ökonomischen Nutzen der Wellen zu erkennen, die weltweit einzigartig waren. Je besser die Forschung in der Lage war sie zu beschreiben, umso sicherer schien ihre touristische Vermarktung. Von überall her kamen Menschen, um an Bahnhöfen darauf zu warten, dass sie von einer großen oder zumindest mittleren Welle nassgespritzt wurden. Spezielle Züge – Doppeldecker, eingerichtet für eine spektakuläre 360° Ansicht – mit verstärkten Frontscheiben aus Panzerglas fuhren durch Gebiete, in denen gerade besonders viele Wellen auftauchten und kollidierten absichtlich mit ihnen. Kinder hatten besondere Freude daran und Tickets waren günstiger als solche für Freizeitparks. Aus unerfindlichen Gründen liebten besonders Asiaten das Schauspiel.
Gleichzeitig wusste Ruth, dass der dünne Firnis technologischer Berechenbarkeit und das Lachen chinesischer Halbwüchsiger eine bestimmte Tatsache lediglich zudeckte, dessen Kontur weiter sichtbar blieb. Was fehlte, war schlicht die Erklärung der Wellen. Sicher, sie wusste, dass es mittlerweile genug Forschungsarbeiten gab, die sich mit unzähligen Einzelaspekten befassten. Laufzeiten, regionales Erscheinen, bevorzugte Routen, sogenannte „swells“ nach intensiven Regenperioden, geologische Beschaffenheiten, und so weiter. Von alledem hatte sie schon öfter etwas gehört oder in populärwissenschaftlichen Büchern gelesen. Allein, warum sie es taten, darauf gab es ihres Wissens bisher keine letztgültige Antwort. Wieso traten die Wellen ausschließlich in Deutschland und nicht in Frankreich, Belgien, Namibia, China oder sonst wo auf? Warum hatten sie bestimmte Laufzeiten? Natürlich war es möglich, dass gewisse Forschungsergebnisse nicht veröffentlicht worden waren. Woran sie nicht glaubte, war, dass, wenn solche Erkenntnisse existieren sollten, sie nie durchgedrungen wären.
Damals an der Uni in Konstanz hatte einen Mathematiker namens Meno gedatet, der eine der wenigen plausiblen Antworten auf diese Frage gegeben hatte.
„In der Mathematik gibt es ein eine Handvoll Beweise – wie die der Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung, die Gleichungen von Yang-Mills, das Confinement aus der Quantendynamik – , die bisher ungelöst sind und es auch vermutlich noch lange bleiben werden. Die meisten Wissenschaftler arbeiten sich an kleineren, einfacheren Axiomen ab. Mit denen lässt sich besser Karriere machen. Die großen Rätsel brauchen zuviel Zeit. Und wenn wir keine praktischen Anwendungen haben, warum sich dann eine solche Forschungsfrage für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte aufhalsen, an der sich schon so viele die Zähne ausgebissen haben?“
„Selbst wenn dafür der Nobelpreis winkt?“, hatte Ruth ihn gefragt.
„Die Fields-Medaille in meinem Fall. Mögen auch einige darauf hoffen, diese harte Nuss zu knacken und den Preis zu kriegen, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Wir sind da wie andere Leute auch: lieber den Spatz in der Hand…“
„Dann seid ihr viel kleingeistiger, als ich gedacht hätte.“
„Sag mir Bescheid, wenn Du die Poincaré-Vermutung durchdrungen hast“, hatte der nackte Meno in ihrem Bett überheblich gewitzelt. „Ich bin kein Physiker, aber meine Ahnung ist, dass die Lösung zufällig herauskommen wird, sie einem Außenseiter begegnet, der mit anderen Augen auf das ganze Phänomen schaut. Und, wer weiß, vielleicht ist es ja trivialer, als wir alle annehmen.“
„Oder Aliens“, hatte Ruth ihm geantwortet.
„Oder Aliens.“
Viel später, als Meno sie schon lange für eine Informatik-Doktorandin von Professor Rade verlassen hatte, war Ruth erstaunt, als sie bei einem nächtlichen Klickmarathon im Urlaub entdeckte, wie viele Menschen tatsächlich an derartigen Unsinn glaubten. Eine schwer zu überblickende Online-Community war von den Wellen nahezu besessen und hing allen möglichen esoterischen Theorien an. Neben Aliens vermutete man eine geheime Kabale von Freimaurern, sah die Wellen als eine Strafe oder ein Geschenk Gottes, beschuldigte Bill Gates, Schattenministerien, pädophile Wissenschaftler, die das Blut von Kindern tranken. Kaum eine „Theorie“, die zu spekulativ, unplausibel, irrational oder lächerlich war, als dass nicht irgendwo ein YouTube-Video dazu existierte.
Glauben konnte sie nichts davon. Verständnis hatte sie trotzdem für all jene, die unbedingt den Sinn, die Bedeutung der Wellen aufdecken wollten und dafür nach jedem Strohhalm griffen, der ihnen angeboten wurde. Ihr selbst ging es ja so. Es war, als würde eine bestimmte Gesteinsart irgendwo nach oben statt nach unten fallen und damit so all den neunmalklugen Geistern lachend ins Gesicht spucken, die die normale Physik für der Wahrheit letzten Schluss hielten.
Als sie sich nach ihrer Kollegin umsah, um mit ihr eine kleine Mittagspause einzulegen, waren schon alle in die Kantine gegangen. Sie selbst kochte meistens vor. Das war günstiger und meistens auch leckerer. Außerdem hatte die Kantine so gut wie keine veganen Gerichte, alles nur „Beilagen“. So blieb sie vor ihrem Rechner sitzen, packte ihre Glastupperware aus und begann geistesabwesend ihr Bohnenrisotto mit Cashewkernen in sich hineinzuschaufeln.
Die Deadline für die Bedarfsplanung stand diese Woche an und sie wusste, dass es ihre einzig wichtige Aufgabe war. Abwesend klickte sie durch eine der vielen Reiter.
Plötzlich bemerkte sie, dass einige Spalten ausgeblendet waren. Eine Spalte hieß „Tauglichkeitsprüfung“ und die andere „Verschwiegenheitserklärung“. Was sollte das? Tauglichkeitsprüfungen wurden nicht von den Fachbereichen durchgeführt. Noch seltsamer war die „Verschwiegenheitserklärung“. Bei einigen Namen gab es ein Kreuzchen, bei anderen nicht. Alles, was mit Datenschutz zu tun hatte, sollte mit den Arbeitsverträgen längst geklärt sein. Ruth runzelte die Stirn. Sie kannte ihren Bereich mittlerweile besser als die meisten anderen im Team, die entweder zu neu oder bereits zu betriebsblind waren, um die Feinheiten der Konzernstruktur und das vierzig-seitige Organigramm zu verstehen. Wieso waren ihr bisher weder diese beiden Spalten aufgefallen? Sie entschied sich nachzubohren. Die zuständige Quali-Steuerin antwortete im Chat nicht. Weder Arne noch Mariana noch Erik fühlten sich zuständig beziehungsweise hatten keine Ahnung von den Details des Lehrgangs und verwiesen zurück auf die Quali-Steuerin. Lagen die Dokumente etwa bei der Zentrale? Kam sie da überhaupt ran? Nach einer halben Stunde erfolgloser Sucherei und zwei aufgeschobenen Meetings war es genug.
Während ihr Blick durch die verschiedenen Kanäle von MS Teams flog, bemerkte sie in einem Chat, der „Berechtigungen“ hieß, eine Nachricht von Carola, einer Kollegin im Home-Office.
Liebe Leute,
ich habe hier (Dokumentlink) etwas Seltsames gefunden. Hat jemand eine Ahnung, wer das ist und woher dieser Ordner kommt? Und wieso heißt er nur PPP? Komisch. Hat keine hohe Prio, aber ich dachte, ich frage mal, wer was darüber weiß.
Liebe Grüße
Carola
Ruth klickte auf den Ordner und hatte ebenfalls keine Berechtigung. Da hatte wahrscheinlich jemand was falsch eingestellt, einen Haken nicht gesetzt. Beides keine Seltenheit. Gerade dabei, den genannten Namen einzuwerfen, blinkten drei Erinnerungen auf, die Ruth sich früher am Tag gesetzt hatte.
Nachdem sie aus ihrem letzten Meeting kam, bei dem auch Herr von Lübke dabei gewesen war, war es bereits 17:30 und ihr Team größtenteils verschwunden. Nur Simone war noch da und laut ihrem Terminkalender in einer Führungstelko.
Mit gepackten Sachen verließ Ruth das Gebäude und bemerkte eine Meldung auf ihrem Smartphone: Es hatte einen Unfall gegeben. Jemand war beim Kontakt zu den Wellen verunglückt – im Zusammenstoß mit einem Zug? Die Reporter hielten sich mit Details zurück, aber der Tote, hieß es in dem Bericht, war merkwürdig bekleidet gewesen, hatte einen Taucheranzug getragen.
Auf der Höhe von Friedberg Richtung Marburg schwappte auf dem anderen Gleis eine Welle vorbei. Klein, keinen Meter hoch. Sie glitzerte in der Abendsonne. Winzige Konfetti-Streifen schienen sich darin zu bewegen. Ruth schüttelte sich. Viele Wellen waren schön, manche sogar majestätisch – alle unverständlich, und einige tödlich.
2. RISOS ZWERGIN
Riso Kelich suchte die Umgebung der Schienen ab. Wonach er fahndete, wusste er selbst nicht genau. Mit seiner winzigen Lupe, kaum mehr als daumennagel-groß, pflückte er hier und da ein Moosblättchen ab. Er betrachtete und bestimmte es, packte prägnante Exemplare in ein für Medikamente gedachtes Dosenfach. Dabei war er besonders vorsichtig, wenn es sich um rare Spezies handelte. Gefundene Pilze legte er in ein Weidenkörbchen, das mit einem Hanfgurt an seiner linken Schulter herabhing und schon einige dickbäuchige und feinhütige Fruchtkörper enthielt. Früher war er mit Renni im Westerwald unterwegs gewesen. Sie hatten Steinpilze, Maronen, Austernseitlinge und netzstielige Hexenröhrlinge gesucht. Heute war er interessiert an jenen Spezies, die um die Schienen herumwuchsen. Hochgewachsen, schlaksig, mit langen, braun-blonden Haaren, trug er seinen pfaugrünen Vintage-Mantel. Er liebte dieses ihm viel zu große Kleidungsstück, das nie um eine Tasche verlegen war, in deren Gesamtzahl alle möglichen Utensilien untergebracht werden konnten. In seinem kleinen Feldrucksack transportierte er neben dem Skizzenbuch seinen indischen Schal sowie Proviant und Gefäße für Proben.
Was ihn interessierte, waren nicht direkt die Wellen, sondern das Biotop, welches um sie herum entstanden war. Die Idee, sich genau diesen Typ von Umgebung auszusuchen, entstammte Gesprächen mit Professor Sheldrake in Oxford und Professor Palme in Freiburg, bei dem Riso gerade seinen Master in Biologie beendet hatte. Beide Profs hatten darüber spekuliert, ob das Phänomen der Wellen eine „biologische Komponente oder sogar Basis“ haben könnte. Bisher waren es vor allem Physiker und Geologen gewesen, die sich um die naturwissenschaftliche Erklärung des Phänomens bemüht hatten. Vereinzelte Papers aus seinem Fachgebiet, publiziert in nur echten Spezialisten bekannten Journals, analysierten ob und welche Pflanzenteile sich in Proben des Wellenwassers finden ließen. Neben mikrobiologisch unauffälligem Gerümpel waren auch Pilzsporen darin entdeckt worden, was das Interesse der beiden Forscher und ein paar anderer Kollegen geweckt hatte. Bisher war nicht viel daraus geworden. Nichtsdestoweniger hatten sowohl Sheldrake wie Palme bei einem gemeinsamen Forschungskolloquium des BIOSS-Exzellenz-Clusters die Frage diskutiert, wie diese Sporen in derartigen Mengen in die Wellen hineingeraten konnten. Daraufhin hatte Riso beschlossen, über dieses Rätsel zu promovieren und suchte nun jene Orte auf, an denen die Wellen am häufigsten entlangliefen. Seine Studentenbude, die er in Sachsenhausen angemietet hatte, war voll von Proben, die er mal mehr und mal weniger säuberlich katalogisiert hatte.
Riso wusste, dass es nicht ungefährlich war, sich so dicht an den Scheinen zu bewegen. Einerseits wegen der vorbeifahrenden Züge und andererseits wegen der Möglichkeit einer mittleren oder sogar großen Welle, die ihm schnell zu nahekommen und mitreißen konnte, wenn er nicht vorsichtig genug war.
Nur einige Meter von den Schienen entfernt begann ein Waldstück, das an ein kleines Naturschutzgebiet grenzte. Riso hatte vor, es nach seinen Recherchen an den Gleisen zu durchwandern. Er hatte über seine Uni Zugriff auf Karten, die alle Naturschutzgebiete Deutschlands genau verzeichneten. Rechts lag der Hang leicht abschüssig neben der Zugstreckte. Man musste vorsichtig sein. Er beugte sich zu den Schienen hinunter. Es war schon erstaunlich, wie viele Arten von Flechten hier wuchsen. Kein Wunder, dass diese ganze Gattung zum Widerstandsfähigsten gehörte, was der Planet zu bieten hatte, dachte Riso. Er kniete neben den massiven Metallbändern und stellte fest, dass sie nicht die geringste Spur von Rost zeigten. Sollte das Wasser nicht zumindest so viel Feuchtigkeit zurücklassen, so dass der Rost stärker ansetzte? Mit einem Wattestäbchen strich daran entlang, beschriftete das Dösen, in welches er die Probe hineinlegte mit Ort und Zeitpunkt. Gleichzeitig hatte ihn ein Geruch neugierig gemacht. Sporen? Hätten diese nicht schon lange weggeschwemmt sein müssen? Er lief gebückt weiter und beobachtete genau, was da zwischen den Steinen alles wuchs. Auf den ersten Blick wenig Besonderes. Ein paar blaugraue lecanora muralis (Mauerflechten), vereinzelte, weißgrüne lecidella stigmatea (Fleck-Schwarznapfflechten) und hier und da eine gelbe caloplaca citrina (der Zitronen-Schönfleck). Als Feldökologe, der seine Zeit auf Wiesen und in Wäldern anstatt im Labor verbrachte, waren es nur die seltenen Exemplare, die ihn begeistern konnten. Das Gewöhnliche wurde nur dann faszinierend, wenn es sich in einem Kontext aufhielt, wo es eigentlich nichts zu suchen hatte, und damit seine eigene Definition als ‚gewöhnlich‘ durchbrach. Lungenflechten zum Beispiel mochten in Andalusien häufig vorkommen, auf der Brandenburgischen Seenplatte wurde ihr Fund erklärungsbedürftig. Das war ihm erst vor vier Monaten passiert und noch gab es keine Erklärung für die Wanderbewegung.
Riso hielt sich gerade ein Stück caloplaca unter seine Minilupe, die wie ein zu klein geratenes, überdickes Monokel aussah, als er ein leichtes Vibrieren verspürte. Er blickte hinter sich, auf die Gleise, die in ungefähr hundert Metern Entfernung eine Kurve machten.
Er wusste, was das zu bedeuten hatte. Nur zwei, drei Sekunden später hörte er in der entgegengesetzten von Norden kommend ein lautes Tuten – der RE30 nach Frankfurt. Riso musste die Zeit falsch eingeschätzt haben. Instinktiv bewegte er sich von den Schienen weg, nach rechts, in Richtung des Schutzgebietes.
Er stolperte und fiel hin. Hinter sich sah er, wie die Welle gerade um die Kurve bog. Sie war von mittlerer Größe, schätzungsweise zwei Meter, noch riesiger, wenn man von unten hochsah. Fast war ihm, als sei er ein Reh, das von einem Scheinwerfer geblendet wurde. Erneut tutete der Zug und weckte ihn aus seiner Erstarrung. Abbremsend hörte Riso das schrille Pressen von Metall auf Metall. Die Welle musste erst kürzlich entstanden sein, wenn der Zug immer noch diese Geschwindigkeit draufhatte. Er sprang auf die Füße und spurtete in Richtung Waldrand. Zug und Welle rasten aufeinander zu. Das Knirschen der Bremsen wurde immer lauter, während die Welle keine Anstalten machte, ihre Geschwindigkeit zu verringern. Riso hatte mit fünf, sechs weiteren großen Schritten den Waldrand erreicht. Das Adrenalin hatte seinen Magen zusammengezogen, die Härchen auf Armen und Nacken waren aufgestellt wie kleine Antennen.
Er drehte sich um, legte sich flach auf den Boden und robbte nach hinten. Hinter ihm begann die Böschung und so krallte er sich in den Boden, blickte über den Hang.
Die Welle rauschte an ihm vorbei, direkt auf den bremsenden Zug zu. Keine zwanzig Meter von ihm entfernt explodierte die Welle bei Aufprall. Die Lautstärke überraschte ihn, ein knallendes Wuusch wie an einer steilen Küste, wo Ozean und Fels unaufhörlich aufeinanderstießen. Wasser spritze zu beiden Seiten längs des Zugs und explodierte wie ein plötzlich aufgespannter Schirm. Mit seiner Restgeschwindigkeit schob und schüttelte der Regionalexpress die Wassermasse ab und verteilte sie sprühend auf die umliegende Vegetation. Auch Riso bekam eine gehörige Portion ab, als das Nass über die Blätter nach unten floss und für einige Sekunden einen wolkenlosen Platzregen erzeugte. Der Zug hatte beim Aufprall leicht gewackelt, was Riso erschreckt und gleichzeitig gelähmt hatte. Er drückte sich weiter nach hinten. Zitternd am ganzen Leib, nass, die Hände ins matschige Wurzelwerk gekrallt, als könne er immer noch hinweggespült werden. Ohne die nötigen Verstärkungen und Modifikationen an den Loks war es undenkbar, dass sie einer solchen Kraft standhalten konnten.
Der Zug, welcher zu keinem Zeitpunkt vollständig zum Stillstand gekommen war, begann nach dem kurzen Schock wieder an Fahrt aufzunehmen. Und auch Riso traute sich wieder zu ausladenderen Bewegungen. Er sah sich nun zum ersten Mal bewusst in seiner Umgebung um. Er lag im Unterholz, von der Brust abwärts in einem zwanzig Grad Neigungswinkel nach unten. Mehr, als er vorher angenommen hatte. Über ihm war ein gewölbter Giebel dessen Blätter wie lebendig wogende Smaragde schimmerten.
Er robbte ein wenig hervor, um sich die Situation und den Zug besser ansehen zu können, der stand, jetzt aber langsam nach vorne rollte. Solche Zusammenstöße kamen vor, und die Fahrgäste waren wahrscheinlich rechtzeitig gewarnt worden, hatten sich festgehalten. Hoffentlich war niemand zu Schaden gekommen.
Der Zug nahm wieder Fahrt auf und rollte an ihm vorbei. Riso versuchte, durch die Fenster zu spähen. Er drückte sich einige Zentimeter vom Boden ab, um zu sehen, was im Inneren vor sich ging, gleichzeitig aber vermeiden, entdeckt zu werden. Es klappte, er stützte sich ab und konnte erkennen, wie einige der Fahrgäste sich angestrengt unterhielten. Eine Reisegemeinschaft von Rentnern plapperte tonlos vor sich hin, eine junge Mutter fauchte ihre beiden Kinder an und platzierte sie rabiat auf den Sitzen vor ihr.
In dem Moment, da er sich wieder flach auf den Boden legen wollte, fiel ihm auf, dass er doch beobachtet wurde. Eine junge Frau sah ihn unverwandt an. Riso erstarrte, als ihre Blicke sich trafen. Es dauerte nur zwei, drei Sekunden, und das Blickverhältnis riss wieder ab.
Nachdem sein Oberkörper wieder auf dem Waldboden lag, musste er sich einem Fluchtimpuls widersetzen. Wenn Sie in Frankfurt anrief, würde er längst hier weg sein. Besser, sich auf seine Umgebung zu konzentrieren, immerhin war er für die Wissenschaft hier.
Beim ersten Abrastern des Waldbodens bemerkte er, dass er in einem Hexenring aus Pilzen lag. Er kannte sie von seinen ausgiebigen Waldwanderungen. Sie rochen stechend, leuchtgasartig, und waren zwischen einem und drei Zentimeter groß, gold- bis orange-braun. Ihre weit gerieften Ränder endeten in einer feucht glänzenden Haut mit Füßen milchig weiß. Hunderte mussten auf diesem Streifen stehen. Von außen hatte man sie nicht sehen können, da die Population von den dichten Blutbuchen verdeckt wurde. Riso griff nach einem der kleinen Geschöpfe, pflückte es vorsichtig ab, strich über den leicht schleimigen, zarten Hut und bemerkte sofort das Blau im abgerissenen Fuß. Riso ahnte, was das Bläuen bei diesem filigranen Lamellenpilz bedeutete, auch wenn man für Gewissheit die Sporen untersuchen musste. Ein Samthäubchen wahrscheinlich. Riso zog sein kleines Taschenmesser hervor und schnitt behutsam weitere Exemplare aus dem Boden. Das Myzel würde nicht nachhaltig beschädigt, befand es sich doch tiefer unten in der Erde. Er verstaute sie in seiner Sammlertasche, verschloss den Deckel und rappelte sich auf. Während er versuchte aufzustehen, schwindelte es ihn kurz.
Der Boden war feucht und bot keinen Halt.
Riso rutschte nach hinten weg, ruderte mit den Armen, fiel rückwärts hinten über und kugelte den Hang hinunter.
Während sich die Welt wie in einer Waschmaschine drehte, versuchte er seine Hängetasche und den Rucksack festzuhalten, damit nicht etwas herausfallen würde, was er so sorgsam gesammelt hatte. Um die eigene Achse gekullert, landete er endlich auf ebenem Terrain. Seine ohnehin schon feuchten Kleidungsstücke waren völlig verdreckt. Überall klebten Buchenblätter vom letzten Jahr, seine Jeans war mit Erde verschmiert und auch auf seinem Gesicht nesteten Vorjahresreste. Er rappelte sich auf, wischte die Überbleibsel seines Falls ab und blickte in den Laubwald hinein. Die Buchen waren noch nicht so hoch, dass sie über fünfzig Jahre alt sein konnten. Es lag viel Totholz herum. Gutes Zeichen für einen gesunden Wald. Bei jedem Schritt sank er um eine Fußbreite in dicke Humusschicht. Eindeutig Naturschutzgebiet, dachte er und fand sich mit seinem verdreckten Zustand ab. Das Nachmittagslicht fiel durch das Blattwerk und zeichnete kleine, sich bewegende Muster auf den laubbedeckten Waldboden. Riso trat vorsichtig, um keine aufkeimenden Sprösslinge zu zerknicken. Es machte ihm Freude langsam und leise zu laufen. Nach zwanzig Minuten lag die Lichtung, auf die er gefallen war, schon ein ganzes Stück hinter ihm. Einige hundert Meter entfernt, öffnete sich eine Wiese. Ihre Konturen waren scharf gezogen, als habe jemand ein Grundstück abzäunt und die Ränder von Setzlingen befreit. Warme Strahlen fielen großzügig in das kleine Idyll und Riso hatte nichts gegen ein kleines Sonnenbad abseits von der sonstig menschenzerplagten Zivilisation.
Nach ein paar Schritten in Richtung Wiesenmitte fiel ihm eine Struktur auf, die in den Boden eingelassen war. Sie lief von Norden nach Süden und ragte einige Meter in den Wald hinein. Seine Verwunderung nahm schnell ab, als er erkannte, dass es Schienen waren. Ein verlassenes Gleis. Wahrscheinlich hatte im Zweiten Weltkrieg hier eine Trasse entlanggeführt, die zerstört und dann verlassen worden war. Das würde sich auch mit dem Alter der Buchen decken. Komisch war nur, dass auch diese Schienen geradezu glänzten. Kein bisschen Rost. Sonst wäre das nicht allzu ungewöhnlich, weil die Bahn ihre Strecken instand hielt. Aber hier so mitten im Wald? Riso hörte auf, über solch unnötige Details nachzudenken und zog stattdessen seine Schuhe aus, über die er seine feuchten Socken legte. Die Sonne war hell und warm. Sie flackerte durch die im leichten Wind wogenden Baumkronen. Neben dem Ende der Schiene legte er seinen Rucksack hin, breitete den Schal unter sich aus und nahm Wasserflasche und Käsebrot zur Hand. Zwei Schlucke und einen Bissen später hatte er den Kopf auf den Rucksack gelegt. Wohlige Müdigkeit machte sich in seinen Gliedern breit. Er legte ein Bein über das andere, lächelte in den blauen Himmel, ließ die Ränder der Minuten in den melodischen Tönen des Waldes ausfranzen und schlief ein.
Die Augen wieder offen, schrak er zusammen. Wie lange hatte er hier gelegen? Erleichtert, dass die Sonne noch nicht untergegangen war, schaute er auf seine Armbanduhr. Nicht mehr als eine dreiviertel Stunde war vergangen und so legte er sich wieder mit dem Hinterkopf auf seinen Rucksack, wo eine angenehme Kule entstanden war. Entspannt fühlte er in seine Glieder hinein und bemerkte, dass sich seine Nackenhaare aufstellten als würden sie von einem elektrischen Feld geladen. Es war dasselbe Gefühl, wie wenn jemand in den persönlichen Raum eindrang, man ihn nicht visuell wahrnehmen und trotzdem die Präsenz des anderen Körpers spüren konnte. Riso sah sich um, bemerkte aber niemanden. Er hörte das Zirpen einiger Grillen, leichtes Gurren von Waldtauben. Entfernt raschelten Amseln durch das Laub. Es waren meistens Amseln. Marder und andere pelzige Jäger würden erst in der Dämmerung oder dem Morgengrauen auf Beutezug gehen. Riso schloss die Augen wieder, um seine Umgebung noch bewusster wahrzunehmen. Zwischen den Waldgeräuschen wogte noch etwas anderes. Ein Vibrieren, subtil, fast scheu. Es entfernte sich von ihm und rückte Stück für Stück näher heran. Feine Ohren, die über viele Naturwanderungen in ihrer Unterscheidungsschärfe trainiert worden waren, ertasteten das sanfte Wummern, dessen Frequenz einer in niedrigschwelle Bewegung versetzen Drahtspule glich. Nach weiteren Fühlminuten spähte Riso auf die ins Nichts laufenden Gleise.
Und dann sah er das Glitzern.
Sie kam langsam auf ihn zugekrochen. Zart von Sonnenstrahlen geküsst, bewegte sie sich auf der Schiene in seine Richtung. Nicht höher vom Boden als zehn Zentimeter, floss sie auf ihn zu und fast genau vor seine Nase. Am Ende hielt sie eine kurze Weile inne, gab Riso Gelegenheit, sie zu betrachten, und machte sich auf den Rückweg. Sie kam Riso vor wie ein Laufstegmodell, das kurz posiert, sich elegant mit einem Hüftschwung umdreht und wieder in die andere Richtung läuft, während ihm alle Blicke folgen.
Riso stand der Mund offen. Sie war wahrlich winzig. Eine Zwergin ihrer Gattung. Langsam vor sich hinschleichend, mitten im Nirgendwo, weit ab von ihren großen Brüdern und Schwestern. Gänzlich ungefährlich und zart kam sie ihm vor ein Entenküken, das vorsichtig aus dem Nest hüpfen wollte, aber nicht wusste, ob die Luft rein war, sich dann doch entschloss und nun die Welt erkundete. Am liebsten hätte er sofort sein Handy gezückt und alles dokumentiert. Mit der Befürchtung, dass die Strahlung die Welle auf wundersame Weise zum Verschwinden bringen könnte, griff er kopfschüttelnd in seinen Rucksack, um seinen Skizzenblock hervorzuholen. In seinem Mäppchen fand er einen olivgrünen Faberkastell Bleistift in 2b, seine Lieblingshärte, und begann er sofort zu zeichnen. Mit geübten Strichen hielt er die Szene aus genau dem Winkel fest, wie er gerade lag, den Bauch in der grasigen Lichtung. „Alle Biologen müssen zeichnen können“, hatte Professor Palme gesagt und besonders kritisch zu den angehenden Molekularbiologen hinübergeschaut, die das für altbacken hielten und ihre präzisen Photographien bevorzugten. Bedachten Schrittes folgte Riso dem durchsichtigen Wasserhügel auf seiner Bahn. Er schlich leise, als könne ein unvorsichtiger Tritt sie wieder ins Grundwasser absickern lassen. Ganz Unrecht hatte er damit nicht. In diesem Moment, die Miniwelle fixiert, mit dem Notizbuch in der Hand, wollte er nichts verpassen. So genau wie möglich messen, kein Detail undokumentiert lassen. In paralleler Bewegung versuchte er, die ungefähre Geschwindigkeit zu eruieren. Es konnten nicht mehr als zwei oder drei km/h sein, ungefähre Schildkrötengeschwindigkeit. Mit einer Höhe von geschätzten fünfzehn Zentimetern hatte sie eine Breite, die die Schienen noch knapp bedeckte und kroch elegant auf dem toten Gleis hin und her. Er hatte keine Ahnung, wie stabil die Zwergwelle war. Ob sie hier schon lange vor sich hinglitt oder erst in den letzten Minuten entstanden war? Riso wusste, dass ihre großen Gegenstücke kaum je mehr als eine Stunde überlebten. Die niedrige Geschwindigkeit gab ihm zusätzlich Gelegenheit, sich die Form genauer anzusehen, welche er bereits aus verschiedenen Perspektiven in sein Notizbuch übertragen hatte. Floß die Zwergwelle an einem bestimmten Punkt vorbei, an dem Lichtstrahlen durch sie hindurchfielen, konnte Riso mit bloßem Auge gerade noch so wahrnehmen, dass die Welle nicht ganz leer war. Etwas trieb in ihr. Von der Größe her hätte es Plankton sein können, winzige Krebstierchen, Blauwalnahrung. Was dort herumtrieb, hatte eine Farbe. Im Lichtstrahl blitzten diese mikroskopischen Teilchen wie eine geschrumpfte Version von grünblauem Konfetti. Algen? Keime? Winzige Käfer? Flusskrebseier? Samen? Blattreste? – Er wollte es unbedingt wissen. Ich kann sie sowieso nicht mitnehmen, dachte er und fasste sich ein Herz. Wenigstens musste es eine Probe sein. Postiert linksseitig in der Mitte der Schienen, zückte er die Pipette, welche immer Teil seiner Ausrüstung war, und legte ein Reagenzglas bereit. Die Zwergwelle kam auf ihn zu, wie er dort auf den Knien und mit der Pipette über die Schiene gebeugt saß, in Hab-Acht-Stellung vergeistigt. Sie glitzerte noch einmal kurz für ihn, als sie den Lichtstrahl passierte, und kam dann in Reichweite seines langen Armes. Er führte die am Gummiende zusammengedrückte Pipette parallel zu ihrem höchsten Punkt. Der so erzeugte Unterdruck würde eine kleine Menge aus ihr heraussaugen. So vorsichtig wie er konnte, drang er in sie ein. Es war nur ein halber Zentimeter. Am liebsten hätte er lediglich etwas von ihr „abgeschabt“ und sie so wenig wie möglich gestört. Trotz einem kleinen konzentrischen Kreisen, die das Eindringen der Pipette erzeugt hatte, behielt sie ihr Tempo bei. Es schien sie nicht zu stören. Als Riso das Gummiende losließ und die Pipette ein klein wenig Flüssigkeit aufsog, veränderte sich etwas.
Die Zwergwelle blieb stehen.
Vor Schreck zog Riso sofort heraus, was er in sie eingeführt hatte. Still vor ihm blieb sie stehen und Riso war, als würde nun er von dem kleinen Wasserhaufen beobachtet. Je länger er hinsah, umso deutlicher wurde das Schütteln, welches über ihre Grenzschicht lief, wie bei einer Membran, die zu zittern begann. In dem Augenblick, als Riso sich entfernte, zerbrach die Zwergwelle. Ihre Flüssigkeit ergoss sich über die Mitte der Schienen, machte Riso Hose nass und versickerte währenddessen im Gras, welches sie dankbar aufzunehmen schien.
Er stand auf und stieß einen Jubelschrei aus. Riso wollte springen, tanzen, jauchzen. Mein Gott, er hatte wirklich etwas entdeckt, etwas Neues, etwas Unbekanntes! Okay, gut, etwas Neues, kann sein, flüsterte die skeptische Stimme, die Professor Sheldrake so gründlich in ihn hineingedrillt hatte, etwas Neues insofern ich noch nichts davon gehört oder gelesen habe. Konnte auch ein Mangel an Literaturkenntnissen sein. Der Gedanke dämpfte seine Entdeckerfreude. Der Wunsch, Sheldrake oder Palme zu kontaktieren, den er eben noch mit Dringlichkeit verspürt hatte, wich wie die damit verbundene Freude und er bemühte sich um Ruhe, mit der er seinen Geist ordnen konnte.
Oh nein, die Pipette!
Er hielt sie noch immer in der Hand. Nichts durfte verloren gehen! Zum Glück, sie war immer noch halbvoll. Er hob das Reagenzglas auf, beschriftete es mit Zeit, Ort und Datum, und verstaute es sorgfältig in seinem Rucksack mit den anderen Proben. Wie bei den vorherigen Gleisen nahm er außerdem einen Abstrich vom Metall der Schienen. Man konnte nie wissen.
Leichter Regen setzte ein und Riso begann, seine Sachen zusammenzusuchen und sich auf den Heimweg zu machen. Jetzt konnte er wieder sein Handy herausnehmen und nachsehen, wo genau er sich befand. Vielleicht war die Befürchtung, die elektromagnetische Strahlung könnte die Wellen destabilisieren, auch ganz unbegründet gewesen? Er befand sich zwischen Butzbach und Kirchgöns, und entschied sich für den nächstgrößeren Bahnhof, der von hier aus südlich liegen musste. Wer weiß, vielleicht würde seine Zwergwelle – seine Zwergwelle – wieder auftauchen? Und selbst wenn nicht, konnte er die Umgebung ohne jedes Risiko weiter untersuchen. Sollte sie doch wieder entstehen, wäre das eine einzigartige Gelegenheit, ein Forschungsobjekt mit unglaublichem Potential. Egal, selbst wenn es nicht geschah, gab es immer noch genug zu tun. Immerhin war da noch diese riesige Pilzkolonie in der Nähe der genutzten Schienen. Mit diesen Funden würde seine Basis vorerst hier in Hessen bleiben. Es schauderte ihn bei dem Gedanken, dass seine Zwergin morgen nicht mehr da sein könnte. Noch mehr zuckte es in ihm, wenn er sich vorstellte sie dort wiederzufinden.
3. TRÜFFEL IN DER WALDSAMKEIT
Merlin Isenbergs Nerven bewegten sich auf dem Kontinuum, das er am meisten genoss. Jedes Mal, wenn er mit seinem Bass jenes magische Wort „Service!“ einer der Kellnerinnen zurief, nachdem er einen Teller zusammen mit seinem Sous Chef Erik angerichtet hatte, machte er einen mentalen Strich auf seiner Liste.
Karamellisierte Entenbrust an einem kaminhaft aufgeschichteten Kunstwerk aus grünen Spargelspitzen, dünne Linien versprenkelter Zitronen-Hollandaise. Steinpilzrisotto, angerichtet auf drei, in Kleeblattform aneinander liegenden Schalen von Jakobsmuscheln, umrandet von einer Minz-Basilikum Creme.
„Tisch sechs - Service!“
Seebarsch auf fermentiertem Algensalat mit am Rand drapierten Orangenschalen, kross gebacken. Leicht angebratenes Angus-Steak, rosarot in kleine Streifen geschnitten, Thymian-Kartoffeln und ein kleines, im Eisbad schwimmendes Stück Schweizer Heumilchbutter.
„Tisch drei – Service!“
Crème brûlée an Mandelpaste, um den kleinen Kuchen in Form einer Ingwer-Knolle sich verzweigend. Mousse à la Vanille, umkränzt von Tahitianischen Schoten und ihrer Orchideen-Blüte.
„Tisch sieben – Service!“
So wie komplizierte Gedanken sich auch in einfachen Sätzen ausdrücken ließen, ging es darum, das Simple zur Geltung zu bringen. Star-Allüren waren fehl am Platz, sie machten nur alles kaputt, soviel wusste Merlin aus erster Hand.
Sein Vorgänger Jacques hatte das Restaurant auf diese Weise beinah zugrunde gerichtet. Der hagere Franzose hatte – angeblich – bei einigen der Großen in Paris gearbeitet und war mit einem für die Provinz untypisch glamourösen Lebenslauf aufgetaucht, von dem sich Rafael, Besitzer der Waldsamkeit, hatte zu sehr beeindrucken lassen. Hoffnungen, große Erwartungen. Ein französischer Star-Koch in der hessischen Provinz! Er hatte es allen erzählt, zum ersten Mal, seit er den Laden aufgemacht hatte, sogar einen PR-Menschen engagiert. „Jacques Deloux, Zauberer am Herd“, hatte die Lokalpresse getitelt. Ja, die Gäste waren gekommen, die feinen Leute mit Sinn für und Sehnsucht nach „Kultur“. Der Flair Frankreichs lag in den fünf bis sieben Gänge-Menüs mit ihren winzigen Portiönchen, ausgebufften Saucen-Arrangements, mehrstufigen Garverfahren, beinah molekulare Küche. In der Tat hatte Jacques behautet, er habe in Paris bei Hervé This gelernt. Merlin und Erik, damals beide noch Chefs de Partie – Merlin Beilagen, Erik Soßen – hatten ihm das von Anfang an nicht abgekauft. Seine Arroganz war ihnen früh ein Dorn im Auge gewesen, seine Geschichten über die verschiedenen Städte, in denen er gekocht hatte, die „Härte“ der Küchen, in denen er „unterdrückt“ worden sei. Roy und Vanessa, damals noch Jungköche, hatten ihn immer mit großen Augen angesehen und waren regelmäßig beeindruckt von den Anekdoten in gebrochenem Deutsch. Merlin konnte nie ganz den Verdacht abschütteln, dass sie entweder massiv übertrieben oder ganz gelogen waren. Doch wie in jeder Küche herrschte eine strikte Hierarchie und so hatte er versucht, so viel von Jacques zu lernen wie er konnte und ansonsten „Ja, Chef!“ zu brüllen.
Nach vier Monaten bekam Merlin zum ersten Mal den Streit zwischen Rafael und Jacques mit. An einem Sonntagabend, als die meisten Gäste schon gegangen und der klägliche Rest nur noch an seinen Cocktails nippte, war Rafael ins Restaurant gefahren. Er hatte Jacques aus der Küche gezogen und Merlin die Stellvertretung zugeraunt, während der mit den Armen fuchtelnde Jacques ins kleine Office neben der Küche geschleift wurde. Die halbe Brigade konnte mitanhören, um was es ging.
„Wie bitte schön kann man denn in einem einzigen Monat für zweitausend Euro Beluga verbrauchen, wenn es nur zwei Gerichte auf der ganzen Karte dafür gibt? Für fast tausend Kobe-Rind? Und wofür um Gottes Willen hast Du für sechshundert Euro Wyke-Cheddar eingekauft?“, sagte Rafael so laut, dass man es in der ganzen Küche hörte und schlug – wahrscheinlich das Rechnungsbuch – auf den Tisch.
Merlin und Erik gingen in die Umkleide neben dem kleinen Büro, das wollten sie sich nicht entgehen lassen. Sie hatten mit diesen Zutaten gekocht, ja. Besonders das Kobe-Rind war ein Genuss. Und der Cheddar eine Delikatesse, die allerdings in dieser Gegend nur wenige, willige Gaumen fand. Ähnliches galt für den Kaviar, von dem nie und nimmer ein halbes Kilo im Kühlraum gewesen war.
„Eine Küsche hangt an der qualité der Zutaten ab, mon chér“, entgegnete der hochnäsige Pseudo-Starkoch. „Isch kann nischt dafür garantieren, dass meine art culinaire funktioniert, wenn isch sie nischt habe. Und die réservations sind doch da, oder Rafael? Machen wir etwa nicht genug de l’argent, mon ami?“
Wohl leicht entmutigt und etwas eingeschüchtert von den französischen Begriffen, gab Rafael zu: „Ja, Jacques, wir machen genug Geld, stimmt. Aber nur ganz knapp. Und ich habe mal eine Auswertung gemacht. Die Gäste werden weniger. Die Preise, ich finde die Preise sind einfach zu hoch. Dreihundertfünfzig Euro für fünf Gänge? Wir sind hier nicht in Paris! Und von dem, was ich im Inventar gesehen habe, müsste die Hälfte von dem Beluga noch da sein. Aber als ich gestern nachgesehen habe, habe ich nur noch gut fünfzig Gramm gefunden. Wie kommt das? Außerdem ist mir aufgefallen, dass Du in letzter Zeit häufiger zu spät kommst.“
Merlin konnte sie nicht sehen, aber er hätte schwören können, dass Jacques seine typische, wegwerfende Handbewegung machte, als er mit fast desinteressierter Gleichgültigkeit zugab: „Ja, kann sein, dass isch ein paar Gramm mitgenommen habe, um meiner petite amie eine Freude zu machen.“
„Du hast was getan?“, brüllte Rafael, in dessen Tonfall scharfe Empörung lag.
„Ah, mon ami, Du weißt schon, manschmal muss man den Frauen eine kleine joie machen, um sie freundlisch zu halten. Zieh es mir von meinem salaire ab, ja? Und was die Gäste angeht, mon Dieu, mach Dir mal nischt ins Hemd, mon chér. Sowas ist überall absolument normal. Genauso wie meine début des travaux. Und isch brauche eben mien phase de récupération.“
Merlin und Erik, die sich mit einem halb lächelnden, halb leidenden Gesichtsausdruck immer wieder gegenseitig voller Unverständnis angesehen hatten, konnten sich denken, was jetzt passieren würde. Rafael war ein ruhiger, gefasster Mann, der nur selten wütend wurde.
Mit gefährlich leiser Zischstimme antwortete Rafael: „Jacques, wenn ich strenger wäre, als ich es bin, würde ich sagen: Du hast das Restaurant bestohlen. Wenn Leute hier mal ein Brot mitnehmen, das sonst weggeschmissen würde, okay. Aber Beluga-Kaviar? Das geht zu weit. Ja, ich ziehe Dir das auf jeden Fall vom Lohn ab, darauf kannst Du Dich verlassen. Und ich warne Dich, sowas passiert nicht noch einmal, nicht in meinem Restaurant. Ab jetzt wirst Du jede Bestellung über zweihundertfünfzig Euro mit mir abstimmen. Die Preise gehen runter. Finde einen Weg, Deine Kreativität mit normaleren Zutaten auszuleben. Und was die Gäste angeht, mal sehen, ob das ‚absolument normal‘ ist. Außerdem wirst Du ab jetzt pünktlich sein, verstanden? Ich werde das im Blick haben, glaub mir.“
„Ja, Chef“, antwortete Jacques mit mehr als nur einem Quäntchen Ironie in der Stimme, stand auf und verließ den Raum. Merlin und Erik, sahen ihn durch den Türspalt davonstolzieren, sich die Schürze abbinden und, kurz darauf, den Hinterausgang nehmen.
„Tut uns leid, wie das gelaufen ist“, sagte Erik zu Rafael, der jetzt auch aus dem kleinen Büro kam. „Wir konnten nicht anders, als mitzuhören.“
„Schon gut, Jungs. Ihr könnt ja nichts dafür.“
Vier Wochen später erschien Jacques zum ersten Mal angetrunken auf der Arbeit. Er hörte auf, die Gerichte abzuschmecken, verwendete nur noch billigste Zutaten und hörte ebenfalls auf, die Karte zu variieren. Natürlich bemerkten die Gäste – insbesondere die Stammgäste – diese Veränderung und waren immer weniger bereit, die hohen Preise für mittelmäßiges Essen zu bezahlen, Starkoch hin oder her. Auch im Team wurde die Stimmung schlechter. Jacques, der vorher streng gewesen war, wurde nun geradeheraus grausam und demütigte vor allem die beiden Azubis vor versammelter Mannschaft mit Beschimpfungen, die völlig aus dem Blauen zu kommen schienen. Und er kam zu spät, wieder und wieder. Krisengespräche blieben fruchtlos. Auf Rafaels Aufforderung, Jacques solle sich in eine Entzugsklinik begeben, folgten zwei Tage „Krankheit“. Kurz danach, an einem feuchten Herbstabend, hatte Rafael den entscheidenden Satz gesagt: „Merlin, bitte übernimmt die Gestaltung des Menüs für nächste Woche.“
Seit er aus Berlin in seine Heimat zurückgekehrt war, hatte Merlin sich diesen Satz herbeigesehnt.
„Ja, Chef!“
Der Besitzerblick war ernst gewesen. „Aber enttäusch mich nicht, Isenberg. Du weißt, was es heißt, dass ich Dir das gebe – und nicht Erik?“
„Ja, Chef“, hatte Merlin so stoisch er geantwortet, wie es ihm möglich gewesen war
„Gut. Jacques werde ich für die nächsten drei Wochen freistellen. Er hat eine Kündigungsfrist und ich weiß nicht, wie wir uns einigen werden. Aber so kann es nicht bei uns weitergehen, das wissen wir alle. Ich sage der Brigade, dass Du sein Stellvertreter wirst, bis ich endgültig jemanden zu seinem Nachfolger bestimmt habe. Und jetzt an die Arbeit!“
„Ja, Chef. Nur eine Bitte noch.“
„Die wäre?“
„Wenn Du es dem Team sagst, dann frag sie auch, ob sie damit einverstanden sind. Sie müssen ehrlich sein, weil wenn sie es nicht sind, dann krieg ich das nicht hin. Besonders Erik. Er kann nachtragend sein. Ich meine das nicht böse, er ist einfach so. Wenn Du raushörst, dass sie murren und zu viel meckern, dann stelle ich die Menüs zusammen, gerne, aber dann kann ich nicht Chef sein.“
„Ohne die Unterstützung der anderen geht es nicht, das stimmt. Die Waldsamkeit hat jetzt einen Namen, wenn Jacques ihn mit seinem Scheiß in den letzten Wochen nicht komplett ruiniert hat,“ sagte Rafael und legte dem einen Kopf größeren Merlin seine Hand auf die Schulter.
„Gut, machen wir es so. Aber, wenn ich das für Dich tun soll, habe ich noch drei Bedingungen. Die sind mit gerade eingefallen“, sagte Merlin schelmenhaft.
„Na gut, dann lass mal hören“, sagte Rafael etwas genervt.
„Erstens“, sagte Merlin mit einem schelmischen Lächeln, „ich will eine Gehaltserhöhung.“
„Wieviel?“
„30“
„Puh, ich dachte, Du sagst was Höheres“, witzelte Rafael.
„35?“
„Jetzt hast Du Dich schon auf 30 eingeschossen, Isenberg. Und wenn die anderen das rauskriegen, kündigen die mir sofort. Daher, abgemacht.“
„Zweitens will ich, dass Du mir Gemüse aus dem Garten abkaufst. Mein Vater zieht es.“
„Einverstanden. Wenn Dein Zeug Qualität hat, nehme ich alles, was Du über das Jahr hast. Und jetzt raus mit der letzten… Bedingung.“
„Jacques hat immer viel zu Unsinn eingekauft, das haben wir alle schnell gemerkt. Ich werde mit einfacheren Zutaten auskommen. Eine Sache hat er allerdings eingekauft, die absolut top ist. Teuer, aber vom Aroma, vom Geruch her einfach… unnachahmlich.“
„Und das wäre?“, wollte Rafael wissen.
„Trüffel. Weiße Alba-Trüffel.“
„Jacques hat etwas Ähnliches gesagt wie Du, Merlin. Und er hat sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben.“
„Rafael, Jacques ist ein verlogener Bastard, wenn Du mich fragst. In dieser einen Sache hatte er leider recht“, sagte Merlin.
„Wegen mir, ich bin gewillt, das auszuprobieren“, lenkte Rafael ein. „Sag mir aber eine Sache, aus der ich nicht so recht schlau werde: Warum Trüffel? Warum ist Dir das überhaupt wichtig?“
„Es hat mit ihrem Geruch zu tun“, sagte Merlin. „Als ich zum ersten Mal dabei war, als Jacques einen Alba hobelte… ich kann es Dir nicht beschreiben. Als ich ihn dann probieren durfte, war es wie eine kleine Explosion. Sie war aber bei weitem nicht so stark wie dieser Duft. Und ich habe die Gäste gesehen, die dabei waren, wenn ein gutes Exemplar angeschnitten wurde. Rafael, die Leute waren wie verzaubert! Es ist wie eine Sucht. Als hätten diese Dinger einen Weg gefunden, uns zu verhexen. Und wir können auch noch Geld damit verdienen, wenn wir klug einkaufen, uns die besten Produzenten in Italien suchen. Ich fahre da auch gerne in meiner Freizeit hin und sorge dafür, dass wir die beste Ware bekommen.“
„Du bist ganz schön begeistert von diesen… Pilzen.“ Nach einem kurzen Zögern und einem kühlen Blick sagte Rafael: „Einverstanden. Aber es wird keine teuren Einkäufe ohne mein Wissen und Einverständnis mehr geben. Und ich suche den Wein aus.” Sein Chef schüttelte den Kopf. „Jacques... dieses französische Arschloch hätte mich fast in den Ruin getrieben. Vor allem nervlich.“
„Das dürfte ja jetzt vorbei sein. Rede einfach mit den anderen, Rafael. Und wenn sie akzeptieren können, dass ein Kollege Chef wird, kann ich es auch.“
Manchmal erinnerte sich Merlin an dieses Gespräch, das ihm nun vorkam, als habe es vor einer Ewigkeit stattgefunden. Er wusste, warum gerade heute die alten Bilder nach oben getrieben waren. Erstens würde er eine alte Tradition bespielen, die Jacques eingeführt hatte. Und zweitens würde er sie benutzen, um eine Ankündigung zu machen, auf die er sich schon die ganze Woche gefreut hatte.
Er sah sich um. Die Küche war ein Wirbelsturm der Betriebsamkeit. Alle waren mit ihren Aufgaben beschäftigt. Erik stand rechts von ihm an den verschiedenen Saucen und rührte mit seinen dicken Bodybuilder-Armen in den Töpfen, schmeckte ab, fügte hier ein Gewürz, dort eine Flüssigkeit hinzu. Seine Hauptaufgabe war, die Pasta im Auge zu behalten. Vanessa drapierte Vanilleschoten, Roy filetierte Zander. Mira, eine der beiden Auszubildenden pausierte mit einer Zigarette am Hintereingang und Daniel, der andere Azubi ließ gerade eine Ente anbrennen und wurde sofort von seinem Nebenmann getadelt.
„Leute!“, rief Merlin.
Keiner reagierte. Es brodelte in Töpfen, Besteck klirrte, Eieruhren surrten. Merlin nahm Daumen und Zeigefinder in den Mund und pfiff so laut er konnte. Schlagartig drehte sich die Brigade ihm zu.
„Ich gehe jetzt raus und kündige an, dass wir gleich unsere Lieferung öffnen“, sagte er mit in die Hüften gestemmten Armen.
Um ihn herum flitzte der Service. Sogar Viola, die gerade die Küche betreten hatte, war mit ihrer Aufmerksamkeit bei ihm. „Wenn ich wiederkomme, fangen wir sofort an. Ich schätze, dass mindestens drei Tische sofort bestellen werden. Wir haben ein kurzes Zeitfenster. Wenn die Tüte einmal auf ist und die Albas geputzt, dauert es, wie ihr wisst, keine zwei Stunden, bis der intensivste Zauber verflogen ist.“
„Ja, Chef!“, riefen sie ihm zu, die Gesichter erwartungsvoll, und wendeten sich dann wieder ihren Aufgaben zu.
Merlin ging hinaus, schnappte sich das Mikro, welches ihm von Rafael vorbereitet worden war und das Jacques aus reiner Rampengeilheit fast jeden zweiten Abend benutzt hatte. Er stellte sich mitten unter die Gäste, fast zwei Meter groß, ganz in weiß gekleidet. Es war Punkt acht, zwei Stunden nachdem die Waldsamkeit ihre Pforten geöffnet hatte und die reservierten Tische besetzt wurden, die Gäste kurz davor, ihre Menüs zu wählen. Genau der Punkt, auf den Merlin gewartet hatte. Als er auf das Mikrofon tippte, drehten sich jene Gäste, die zu seiner Rechten im quadratischen Teil saßen, zu ihm um, wendeten aus verstummenden Gesprächen ihre Stühle. Die gleiche Bewegung passierte zu seiner Linken, im halb muschelförmigen Atrium, wo die Gäste an der Nordwest-Seite der Fensterfront ihn nun ebenso gespannt ansahen. Selbst die Cocktailbar hatte nun seine Aufmerksamkeit. Im schummrigen Licht der gedimmten Kronleuchter begann seine Ansprache.
„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
mein Name ist Merlin Isenberg, ich bin Ihr Chef de Cuisine. Wie einige von Ihnen wissen, kommt es nicht oft vor, dass ich die Küche verlasse und mich derart vor Sie hinstelle. Reden halten ist nicht meine Stärke. Heute Abend jedoch möchte ich Sie auf eine Besonderheit aufmerksam machen. An diesem Morgen haben wir eine spezielle Lieferung weißer Alba-Trüffel aus dem Piemont bekommen, die wir Mitte der Woche auf einer Auktion ersteigert haben. Sie sind auf eine ausgeklügelte Weise verpackt, um ihr einzigartiges Aroma zu konservieren. Wenn wir die Verpackung einmal geöffnet haben, empfiehlt es sich, die Pilze innerhalb weniger Stunden zu verzehren. Nach unserer Schätzung haben wir heute Abend genug, ich würde sagen, für vierzig bis fünfzig Portionen. Die Trüffel werden ausschließlich zu einer vegetarischen Pasta gereicht und, wenn Sie es wünschen, von mir persönlich am Tisch gehobelt. Es ist das einzige Gericht, bei dem wir wegen der hohen Einkaufskosten von unserer allgemeinen Preisgestaltung abweichen. Doch glauben Sie mir, dieses saisonale Highlight ist es mehr als wert! Der weiße Alba-Trüffel gehört zu den seltensten Pilzen auf dem Planeten und hat im Laufe der Evolution einen einzigartigen Geruch entwickelt, der… Entschuldigen Sie, ich schweife ab. Sollten Sie eine Portion bestellen wollen, teilen Sie ihren Wunsch unserem Service mit, der Sie auch über den Preis informieren wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und guten Appetit!“
Einige der Gäste fingen an zu klatschen, was sofort ansteckend wirkte. Zwei Sekunden später gab es einen großen Applaus, der schnell wieder abflachte und einem gespannten Gemurmel Platz machte. Das Restaurant war eines der größten in der Umgebung und bot, wenn man alles zusammenzog, gut dreißig Tischen Platz, an denen zwischen zwei und vier Personen sitzen konnten. Sie hatten hundertelf Plätze, die aber fast nie alle besetzt waren. Daher hatte die Cocktailbar mehr Raum bekommen, eine Entscheidung Rafaels, als er merkte, dass die Waldsamkeit sonst zu leer aussehen würde. Heute allerdings waren sie fast voll besetzt und mit zwei Reservierungsrunden würden sie heute gut zweihundert Menschen bekochen. Auf Merlins Weg in die Küche folgten ihm neugierige Augen. Im Vorübergehen bemerkte er zufrieden, dass bereits einige Arme in die Höhe gingen.
Zurück in der Küche, hatte Erik schon einen der für Merlin besten Momente des Abends vorbereitet. Mit einer kleinen, gespielten Verbeugung reichte ihm sein Sous Chef den Plastikbeutel, durchsichtig und, wie Merlin wusste, dreifach vakuumiert. Die Innenseiten des Plastiks waren ebenfalls speziell behandelt, aber er hatte aus Valery, seinem Händler, nie herausbekommen können, wie sie es angestellt hatten, dass die Pilze so dermaßen frisch blieben. Mit dem Stiehl voran reichte Erik Merlin ein kleines Messer. Merlin nahm es in die Hand, legte den festen Beutel auf die Anrichte im Zentrum der Küche und schnitt. Sofort strömte ein erster Schwall des unverwechselbaren Aromas in den Raum. Es waren drei beige Knollen, jede wog circa dreißig Gramm und hatte einen Wert von zweitausend Euro. Prachtstücke. Vielleicht würden sie doch noch mehr Portionen machen können. Mit jedem der Trüffel vielleicht fünfzehn bis zwanzig. Wenn ihnen das gelang, würde Rafael sehr zufrieden sein.
„Erik, geh sie waschen und bürsten. Aber vorsichtig, hörst Du!“
„Für wen hältst Du mich!“
Nur wenige Minuten später, die Merlin damit verbracht hatte, einen ganz durch die Küche zu machen und zu prüfen, ob auch nichts anbrannte, kam Erik zurück, die vanillefarbenen Knollen in der Hand. Merlin musste es einfach tun. Er nahm einen der Pilze in die Hand. Sie verloren kurz ihren Geruch, wenn sie geputzt und in Wasser gelegt worden waren, gewannen diesen jedoch schnell wieder. Er setzte den Hobel an. Der erste Schnitzer. Alle besseren Gaumen um ihn herum schlossen die Augen und sogen ein. Ja, genau das war es, genau dieser betörende Duft.
Schalotten, leichte Knoblauchnote, zarter Brie.
Wandern durch den italienischen Mischwald, die Augen auf den Labrador, das Rascheln der Buchen. Immer, wenn er diesen Geruch wahrnahm, imaginierte Merlin sich kurz in einem anderen Leben, draußen, in den Wäldern.
„Ist die Puttanesca soweit?“, fragte er Erik.
„Natürlich, Chef“, antwortete sein Freund mit gespielter Untergebenheit.
„Gut, wir werden gleich wahrscheinlich drei, vier Bestellungen haben. Viola? Wie sieht’s aus, wie viele haben wir?“





























