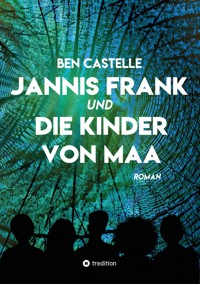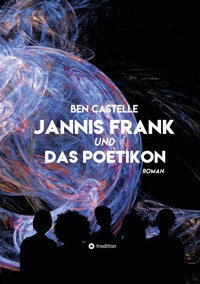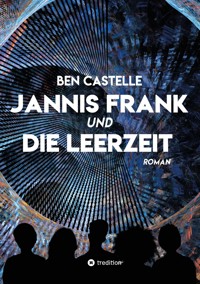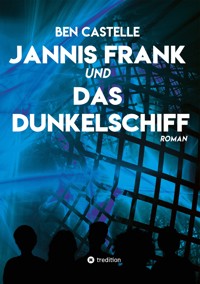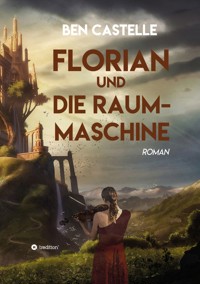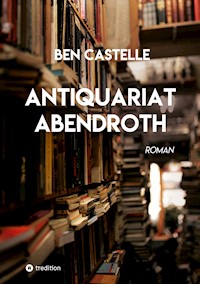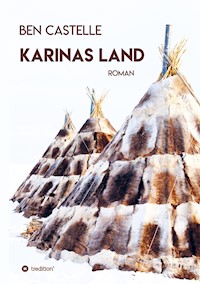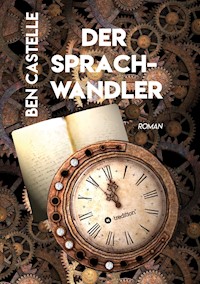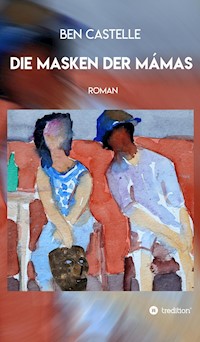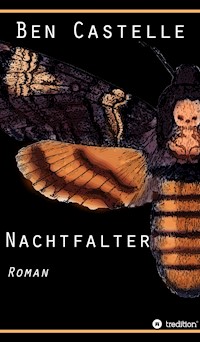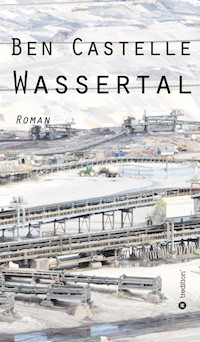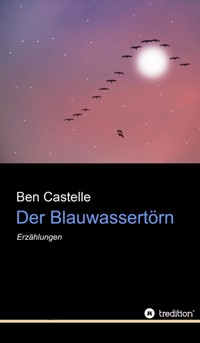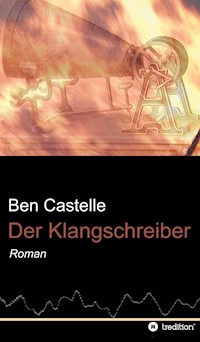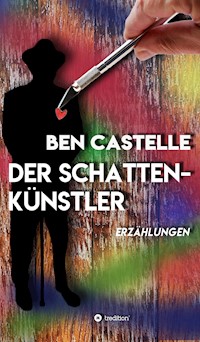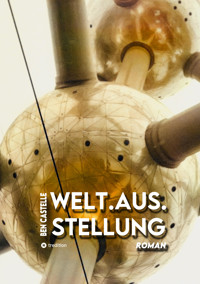
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem plötzlichen Tod seines Kollegen wird ein junger Mitarbeiter einer Kölner Sicherheitsfirma 1958 zur Weltausstellung nach Brüssel entsandt, um dort die Stelle seines Vorgängers zu übernehmen und den Deutschen Pavillon zu bewachen. Schon bald macht der junge Wachmann die Bekanntschaft eines sprachgewandten Österreichers namens Robert Seller, von allen nur Rose genannt, der im Krieg zwischen die Fronten geriet, mehrmals die Grenze zwischen Ost und West passierte und an einem schweren Kriegstrauma leidet. Rose drängt sich dem Wachmann auf und bringt in den Nächten seine Freunde, die Amerikanerin Emily und den Russen Kusma, mit in den Deutschen Pavillon, um sich dort die Zeit mit Alkohol und Albernheiten zu vertreiben. Schon bald glaubt der junge Deutsche zu erkennen, dass seine drei neuen Bekannten mehr verbindet als nur der Zufall. Als er schließlich von Rose gebeten wird, für eine ungewöhnliche Antikriegskampagne eine Seite aus Mozarts Requiem zu stehlen, das im Österreichischen Pavillon ausgestellt wird, fragt er sich, ob er Rose trauen kann, zumal als er erfährt, dass dieser bereits mit seinem Vorgänger im Amt Kontakt hatte, der, so mehren sich die Anzeichen, einen düstren Plan hegte. »Welt.Aus.Stellung fragt neben all den erinnerten Kuriositäten der Zeit und ihren ungewöhnlichen Bauwerken, wie beispielsweise dem Corbusier und dem darin beheimateten elektronischen Gedicht, auch nach einer möglichen Objektivierbarkeit von Geschichte, liest sich nicht zuletzt als Antikriegsroman und ist darüber hinaus eine spannende, tiefgründige und streckenweise auch komische Nachkriegserzählung.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ben Castelle
Welt.Aus.Stellung
Roman
Impressum
© 2025 Ben Castelle
Umschlag, Illustration unter Verwendung einer Fotografie meines Vaters aus dem Jahr 1958.
ISBN
Softcover 978-3-384-71337-7
Hardcover 978-3-384-71338-4
E-Book 978-3-384-71339-1
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Eifeler Presse Agentur, Abteilung »Impressumservice«, Keldenicher Straße 19, 53925 Kall, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Über dieses Buch:
Nach dem plötzlichen Tod seines Kollegen wird ein junger Mitarbeiter einer Kölner Sicherheitsfirma 1958 zur Weltausstellung nach Brüssel entsandt, um dort die Stelle seines Vorgängers zu übernehmen und den Deutschen Pavillon zu bewachen. Schon bald macht der junge Wachmann die Bekanntschaft eines sprachgewandten Österreichers namens Robert Seller, von allen nur Rose genannt, der im Krieg zwischen die Fronten geriet, mehrmals die Grenze zwischen Ost und West passierte und an einem schweren Kriegstrauma leidet. Rose drängt sich dem Wachmann auf und bringt in den Nächten seine Freunde, die Amerikanerin Emily und den Russen Kusma, mit in den Deutschen Pavillon, um sich dort die Zeit mit Alkohol und Albernheiten zu vertreiben. Schon bald glaubt der junge Deutsche zu erkennen, dass seine drei neuen Bekannten mehr verbindet als nur der Zufall. Als er schließlich von Rose gebeten wird, für eine ungewöhnliche Antikriegskampagne eine Seite aus Mozarts Requiem zu stehlen, das im Österreichischen Pavillon ausgestellt wird, fragt er sich, ob er Rose trauen kann, zumal als er erfährt, dass dieser bereits mit seinem Vorgänger im Amt Kontakt hatte, der, so mehren sich die Anzeichen, einen düstren Plan hegte.
»Welt.Aus.Stellung fragt neben all den erinnerten Kuriositäten der Zeit und ihren ungewöhnlichen Bauwerken, wie beispielsweise dem Corbusier und dem darin beheimateten elektronischen Gedicht, auch nach einer möglichen Objektivierbarkeit von Geschichte, liest sich nicht zuletzt als Antikriegsroman und ist darüber hinaus eine spannende, tiefgründige und streckenweise auch komische Nachkriegserzählung.«
Meinem Vater
1927-2022
Mein Onkel erreichte Brüssel mit dem Nachtexpress aus Köln. In der kalten weitläufigen Bahnhofshalle roch es nach verbranntem Kaffee. Fünf Amerikaner, die teure Anzüge unter ihren geöffneten dicken Mänteln trugen, saßen auf Holzstühlen rund um einen kleinen Bistrotisch und warteten auf das Frühstück. Sie unterhielten sich angeregt und sagten nach fast jedem Satz: »You know?«
Nein, so war es sicher nicht. Mein Onkel hatte nämlich einmal zu mir gesagt: »Du musst wissen, Lena, die großen Bahnhöfe waren damals Kathedralen der Mobilität, in denen es keine schnöden Imbisse oder Bistros gab, sondern meist eine sehr ausgezeichnete und vornehme Lokalität.« Nehmen wir also besser an, mein Onkel ging durch eine leere Bahnhofshalle, in der sich an diesem kühlen Spätjulimorgen außer ihm und einigen anderen, die im Nachtexpress gesessen hatten, kein einziger weiterer Mensch aufhielt, zumal die gehobene Lokalität, sollte es sie gegeben haben, wohl noch geschlossen hatte. Kurz darauf drückte er eine der schwergängigen Schwingtüren auf und trat hinaus auf den Bahnhofsvorplatz.
Vielleicht huschten in diesem Moment zwei Hostessen Europas vorüber, die auf dem Weg zu ihrem Dienst auf dem Ausstellungsgelände waren. Wenn es so war, dann trugen sie helle, knielange Mäntel über ihren Uniformen und waren an ihrer flotten Kopfbedeckung, einem blauen Schiffchen, zu erkennen sowie an ihren weißen Handschuhen und schwarzen Handtaschen. Die jungen Frauen, dies hatte mein Onkel bestimmt zuvor schon in deutschen Zeitungen gelesen, unterlagen strengen Verhaltensregeln. So war es ihnen, solange sie in ihrer Uniform steckten, untersagt, Kaugummi zu kauen, zu rauchen oder sich gar mit unbegleiteten Männern zu treffen.
Aber mein Onkel hatte an diesem Morgen nicht vor, eine der jungen Damen anzusprechen, die laut zahlenbegeisterter Presse zusammen dreizehn Sprachen beherrschten und aus sechs Ländern stammten. Vielleicht waren da aber auch zu dieser frühen Stunde gar keine Hostessen zu sehen, sondern er traf nur auf einen älteren Stadtbediensteten mit einer Schirmkappe, der pfeifend den Unrat zusammenfegte, der sich in jeder großen Stadt Tag für Tag und Nacht für Nacht aus dem Nichts zu bilden scheint.
Zugegeben: Das Einzige, was ich über die Ankunft meines Onkels in Brüssel als gesichert berichten kann, ist, dass er kurz nach seinem Eintreffen am Bahnhof mit einem Taxi nach Laken zu seiner Pension in die Nähe des Ausstellungsgeländes fuhr. Ich kenne sogar den genauen Fahrpreis für die Strecke, jeden Franc und jeden Centimes. Denn mein Onkel hat den fast vollständig verblassten Beleg aufgehoben. Nach seinem Tod fand sich das Zettelchen in einem großen Pappkarton, den er mir drei Wochen vor seinem Ableben mit dem Hinweis übergab, dass ich in diesem Karton den Beweis dafür fände, dass alles, was er mir über die Ereignisse auf der Weltausstellung von 1958 erzählt habe, wahr sei. »Schau es dir an, Lena, und du wirst keine Zweifel mehr haben«, hatte er mir – schon bettlägerig – mit rauchiger Stimme zugeflüstert. Es erkläre sich alles von selbst. Aber als ich ein Jahr nach seinem Tod – solange hatte ich mir Zeit gelassen beziehungsweise keine Zeit gefunden – den Pappkarton öffnete, erklärte sich rein gar nichts von selbst. Im Gegenteil, ich stieß auf ein wirres Sammelsurium bestehend aus Zeitungsausschnitten, kleinen Notizzetteln, albernen Souvenirs, darunter ein Atomium im Schüttelglas samt Schneegestöber sowie eine abgegriffene Matrjoschka. Des Weiteren fand ich Prospekte, Ansichtskarten, ein paar grob kartonierte wissenschaftliche Veröffentlichungen von Pascual Jordan, Werner Heisenberg und einigen anderen Physikern und dazu noch allerlei altertümlichen Unrat, den ich in einer schwachen Minute fast in den Müll gegeben hätte, bevor ich ihn mir in einer weiteren schwachen Minute genauer betrachtete und, ehe ich es noch selber begriff, damit begann, aus all diesen disparaten Überbleibseln einer längst vergangenen Zeit wieder die Zusammenhänge herzustellen, wie sie mir mein Onkel in den letzten Jahren seines Lebens mehrfach darzulegen versucht hatte.
Von der Pension im Stadtteil Laken aus war das Ausstellungsgelände für meinen Onkel zu Fuß rasch zu erreichen. Er machte sich außerhalb seines spartanisch eingerichteten Zimmers, in dem sich nur ein Bett, ein Schrank, ein Stuhl, ein Tisch und ein kleiner Cocktailsessel befanden – alles recht abgenutzt und angestoßen – in der Gemeinschaftstoilette auf der Etage etwas frisch, nahm ein ausgiebiges Frühstück zu sich und begab sich sodann auf den Weg zum Expogelände. Bis gegen Mittag hatte er sich in der Deutschen Sektion einzufinden, wo er erwartet wurde.
Es ist möglich, dass er sich zunächst den langen Gang über das Riesengelände ersparte und direkt durch das Belvedere-Tor das Weltausstellungsgelände betrat, um nach kurzer Strecke auf der Königlichen-Park-Allee nach rechts in die Dynastie-Allee einzubiegen und sich dann am Monument Leopold I. vorbei direkt zur Deutschen Sektion zu begeben, die quasi vom Haupteingang aus gesehen am Ende des Geländes lag und daher durch das Belvedere-Tor weitaus rascher zu erreichen war.
Aber nein, ich will ihn mir lieber vorstellen, wie er durch das von 1935 stammende Eingangsgebäude eintrat und wie sein erster Blick dem Atomium in der Mitte des Geländes galt, dessen große miteinander verbundene Kugeln von überall her zu sehen waren. Es habe sich angefühlt, als ob man eine für Kinder gestaltete Zukunft betreten hätte, hat er mir später einmal erzählt. Nicht nur das Atomium habe wie ein Bauwerk auf einem fremden Planeten gewirkt, sondern auch all die anderen Gebäude mit ihren Glasfassaden und ungewöhnlichen Formen, die zum Teil der Phantasie betrunkener Baumeister entsprungen zu sein schienen. Er bat mich, daran zu denken, dass dreizehn Jahre zuvor Europa noch eine Trümmerwüste gewesen sei. Und quasi erst vor kurzem Auschwitz befreit und Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki niedergegangen waren. Und jetzt das! Als ob die Zeit ihren Kontext verlassen hätte. Diese Sauberkeit. Diese Transparenz. Die Menschen modisch gekleidet, die Frauen selbstbewusst mit Mänteln in zarten Pastelltönen und extravaganten Hütchen. Eine ganze Stadt wie aus einem Science-Fiction-Bilderbuch. Und mittendrin schwarze Limousinen mit getönten Fensterscheiben, die leise zu den Ausstellungshallen glitten und in denen man internationale Gäste von einem architektonischen Höhepunkt zum anderen chauffierte. Wo war nur die Vergangenheit hin? Es schien, so sagte mein Onkel, oder vielleicht erinnere ich es auch nur so, es schien, als habe die Welt eine neue Idee geboren, die sich inmitten des Geländes symbolisch als die 165-milliardenfache Vergrößerung der kristallinen Elementarzelle des Eisens zeigte, sich einhundertundzwei Meter hoch in den Himmel erhob und zweitausendvierhundert Tonnen schwer war. In diesem Jahr 1958 habe in den Köpfen der Zeitgenossen eine neue Ära begonnen. Man habe damals geglaubt, eine niemals versiegende Energiequelle gefunden zu haben. Und dieses neue Zeitalter, so sei einem überall suggeriert worden, sei sauber, friedlich und freundlich. Ein Zeitalter, in dem man sich fortan über Grenzen hinweg die Hände reichen wollte, um gemeinsam einer hellen Zukunft entgegenzugehen. Zumindest auf diesem Gelände sollten die alten Konflikte zwischen Ost und West schweigen und eine mögliche gemeinsame Zukunft bereits beispielhaft realisiert sein.
Und unter dieser neuen Idee, die sich in neun Kugeln mit je achtzehn Metern Durchmesser materialisierte, befand sich der Herzschlag der neuen Bewegung: der Reaktor AGN-211-P. Zwar hätte der Reaktor, so betonte mein Onkel, mit seiner Nennleistung von zwei Kilowatt nicht einmal mehr genügend Energie erzeugen können, um die Beleuchtung des Restaurants zu gewährleisten, das sich in der oberen aluminiumverkleideten Kugel des Atomiums befunden habe. Doch habe dieser Reaktor immerhin knapp zwei Kilogramm hochangereichertes Uran enthalten, so dass sich im Zentrum der Weltausstellung Neutronenstrahlung erzeugen ließ.
Aber ich will nicht abschweifen. Mein Onkel begab sich, egal auf welchem Weg und nachdem er an der Einlasskontrolle seinen besonderen Status nachgewiesen hatte, der ihn quasi über den gemeinen Touristen erhob, geradewegs in die Deutsche Sektion. Möglich, dass er einen der Busse oder eines der seltsamen Fahrzeuge nahm, die angeboten wurden, um nicht den ganzen Weg bis dorthin zu Fuß gehen zu müssen, falls er durch den Haupteingang gekommen sein sollte. Es ist anzunehmen, dass er dabei aber so oder so schon einen ersten Blick auf die Bauwerke um ihn herum warf. Ich weiß nicht, ob er bemerkte, wie die Architekten der Ausstellung bemüht waren, Wände als deutliche Außenbegrenzungen zu vermeiden und wie sie die Dächer der Ausstellungsbauten oft nur an Stützkonstruktionen aufgehängt hatten. Ob er also begriff, dass es sich bei dem, was er sah, vielfach um Produkte der architecture suspendue – der sogenannten Schwebearchitektur handelte, die den schweren Bauwerken aus Beton und Glas eine ungezwungene Leichtigkeit andichten wollte. Bestimmt war ihm nicht einmal mehr dieser Begriff geläufig. Aber er wird gespürt haben, dass trotz der Monumentalität mancher Gebäude diese gleichzeitig so luftig wie eine überdimensionale Orangerie wirkten.
Nein, jetzt erinnere ich mich, das Urteil meines Onkels fiel noch in späteren Jahren eher banal und ignorant aus. Der sowjetische Pavillon habe ihn an einen auf einem deutlich zu großen Betonfundament aufgestellten Hamsterkäfig erinnert, die amerikanische Ausstellungshalle hingegen an eine Waschmaschinentrommel, in die man aus einem Hubschrauber dreckige Wäsche hätte einfüllen können, und der Philips-Pavillon von Le Corbusier sei ihm gar vorgekommen wie ein zusammenbrechendes Zirkuszelt aus Stein.
Mein Onkel konnte moderner Architektur nie viel abgewinnen. Das Problem, so sagte er einmal, sei, dass Bauwerke ja immer eine Funktion haben müssten und daher niemals gänzlich frei in ihrer Gestaltung sein könnten wie beispielsweise ein abstraktes Gemälde. Je mehr Freiheit sich der Architekt aber herausnehme, je abstrakter er gestalte, desto weniger funktionell sei sein Gebäude und für desto weniger sinnvoll würden es die Nutzer folglich erachten. Architektur könne daher niemals Kunst sein, weil sie niemals vollständig von ihrem Nutzwert abstrahieren dürfe. Deshalb wirke manches moderne Bauwerk nur wie eine künstlerische Fassade, die im Inneren nicht halte und nicht halten dürfe, was sie, von außen betrachtet, doch so aufdringlich verspreche.
Mein Onkel traf schließlich bei der Deutschen Sektion ein. Dreizehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs präsentierten sich seine Landsleute auf der Weltausstellung mehr als bescheiden. Die Klotzbauten eines Alfred Speer, besonders das anmaßende Deutsche Haus, das noch 1937 in Paris für Furore gesorgt hatte, schienen dem neuen deutschen Zeitgeist der Zurückhaltung nicht mehr angemessen zu sein. Acht flache, im Quadrat angeordnete und durch überdachte, zum Teil zweistöckige Stege miteinander verbundene Gebäude mit transparenten Außenwänden aus Spiegelglas passten sich geduckt und durch variierende Geschosszahlen harmonisch an die vorhandene Hanglage an. So heißt es jedenfalls in einer der Broschüren, die ich im Nachlass meines Onkels fand. Selbst einige alte Bäume des ehemaligen Heysel-Parks, der jetzt mit zum Ausstellungsgelände gehörte, seien nicht gefällt, sondern in das Gesamtkonzept des Sektors mit eingebunden worden. Fast schon, so könnte man heute denken, erschien es, als bedauerten die Deutschen, überhaupt irgendetwas gebaut zu haben und damit öffentlich in Erscheinung getreten zu sein. Nach dem großkotzigen Weltbeherrschungsgeschrei von Paris nun also besonnene Schlichtheit im architektonischen Ausdruck und nur hier und da ein paar leichte Bauhaus-Akzente, welche noch nicht selbstbewusst nach außen traten oder es nur so aussehen lassen sollten, als ob man sich mit solcherlei Selbstbewusstsein noch gern zurückhielte.
Denn bedenke, Lena, sagte mein Onkel, bedenke, während man sich hier im Scheinwerferlicht der Welt am Boden duckte, als trage man das schwere Gewicht der historischen Schuld, das einem nicht einmal mehr eine Mehrstöckigkeit erlaubte, die über drei Etagen hinausging, hatten Bundeskanzler Adenauer und sein Verteidigungsminister Strauß schon ein Jahr zuvor die atomare Aufrüstung der Bundeswehr befürwortet. Nur fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs trafen sich führende deutsche Militärs im Eifelkloster Himmerod, um eine Bundeswehr noch ganz nach dem Vorbild der Wehrmacht zu planen. Und der Kanzler ließ bereits in bester Politikerrhetorik verkünden, Atomwaffen seien nur eine »Fortentwicklung der Artillerie« und also »beinahe normale Waffen«.
Eine Waffe nach zwei schrecklichen Weltkriegen als normal zu bezeichnen, sei doch an sich schon Ausdruck eines pervertierten Denkens gewesen, echauffierte sich mein Onkel noch in späteren Jahren, aber eine Kernwaffe für beinahe normal zu halten, hätte augenblicklich Zweifel am Geisteszustand des Kanzlers hervorrufen müssen. Und so sei es ja dann auch gewesen. Es habe nicht lange gedauert und die »Göttinger Achtzehn«, unter denen sich auch die Nobelpreisträger Otto Hahn, Max Born, Max von Laue und Werner Heisenberg befanden, hätten jede Mitwirkung am Bau von Atomwaffen abgelehnt und für die Bundeswehr den Verzicht auf Atomwaffen gefordert. Einzig an der friedlichen Nutzung der Kernenergie wollten die Forscher weiterhin mitwirken.
Während man auf dem Weltausstellungsgelände diese friedliche Nutzung der Atomenergie propagierte und in den globalen Medien als wirtschaftliche Wendezeit feiern ließ, so mein Onkel weiter, seien Amerika und die Sowjetunion längst dabei gewesen, ihre atomare Bewaffnung weiter auszubauen, beziehungsweise, wie im Fall Deutschlands, einzuleiten, um damit den Kalten Krieg auf eine neue Eskalationsstufe zu hieven. Das habe dem Ausstellungsgeschehen von 1958 eine merkwürdige Irrealität verliehen. So, als ob dort nur ein weiteres Disneyland eröffnet worden sei, wie man es drei Jahre zuvor das erste Mal in Kalifornien in Betrieb genommen hatte, ein Disneyland einzig und allein für unkritische Erwachsene.
Doch wir wollen hier nicht politisieren. Mein Onkel war zeit seines Lebens in keiner Partei und hat sich nie viel aus Politik gemacht. Er vertrat den Standpunkt, dass Politik nur eine Art besseres Unternehmensmanagement zu sein und sich um das soziale und wirtschaftliche Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern habe. Alles andere sei Geschwätz drumherum. Und politische Ideologien, die von einer besseren Zukunft faselten, seien nur hochtrabende Ausreden für das konkrete Politikversagen in der Gegenwart.
Als mein Onkel das erste der acht flachen Gebäude im Deutschen Sektor betrat, war er allerdings noch nicht so selbstbewusst wie in späteren Jahren. Auf einer kleinen Brücke, die zum Eingang führte, stand ein Herr im dunkelgrauen Anzug, der ihn zu erwarten schien.
»Ich befand mich in einem fremden Land in einer fremden Welt und ging auf einen fremden Menschen zu, der offensichtlich der Hausherr dieser Anlage war. Das war zugegeben sehr aufregend.«
Doch die gespannte Erwartungshaltung sei dann, wie sich rasch herausgestellt habe, gänzlich unnötig gewesen.
»Na, da kieck an!« sagte der Herr, als mein Onkel ihn erreicht hatte. »Wann dat nit unsre neue Naachsüül is.« Mein Onkel nickte nur, da er im Laufe seines Aufenthalts in Köln genügend Dialekterfahrungen gesammelt hatte, um den Mann als Rheinländer zu identifizieren und sogar zu verstehen, was er sagte. Er stellte sich nur die Frage, woran dieser sein Nachtwächterdasein auf Anhieb erkannt hatte. Kaum hatte er dem Fremden seinen Namen genannt, da klopfte ihm dieser generös auf die Schulter und sagte: »Na, dann kum ens met! Wir jonn en mal d’römme üm de Klüngel.«
Mein Onkel wurde daraufhin durch alle acht Ausstellungsgebäude geführt. Doch konnte er sich bis ins hohe Alter nicht mehr erinnern, was in diesen Räumlichkeiten ausgestellt worden war. Er erinnerte sich nur daran, dass sein Begleiter die Ausstellungsartefakte, Schautafeln und Prospekte überwiegend als »Jedöns« bezeichnet hatte.
»Was es auch war, es war langweilig«, sagte mein Onkel stets, wenn man ihn bat, sich zu erinnern, und es ärgerte ihn nur ungemein, dass Adenauer in einer Kabinettssitzung dasselbe Urteil gefällt und die Ausstellung ebenfalls als langweilig bezeichnet hatte. Aber wahrscheinlich waren die Ausstellungsinhalte, die sich laut anderen Quellen um Leben und Arbeit in Deutschland drehten, nur der größte gemeinsame politische Nenner gewesen, den man für die Weltausstellung gefunden hatte. Aufgrund der Zweiteilung Deutschlands schien es nicht angeraten, das Wirtschaftswunderland des Westens zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Andererseits wollte man aber niemanden an die Apokalypse erinnern, für die beide Teile des Landes gleichermaßen die historische Verantwortung trugen. So einigte man sich auf brave Belanglosigkeiten, die garantiert kein Skandalpotenzial besaßen. Wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, ohne es zu wissen, zeigte man Einblicke in das Ruhrgebiet samt Bildern von kohlegeschwärzten, mit weißen Zähnen lächelnden Kumpelgesichtern, obwohl das in Bezug auf den sauberen Neustart in eine Atom-Zukunft, die man in der großen Schau doch allüberall propagierte, etwas verstaubt und antiquiert gewirkt hätte. Aber vielleicht sollte es das auch. Vielleicht wollte man gar nicht zeigen, wie weit man schon wieder war, und dass man bald an der ein oder anderen Nation stolz vorbeizöge und das, obwohl man den Krieg nicht nur verloren, sondern ihn auch noch begonnen hatte. Wo blieb da für die anderen Völker die historische Gerechtigkeit?
Das Einzige, woran sich mein Onkel gut erinnern konnte, war der Stuhl, auf dem er von da an viele Nächte lang saß und von dem es in allen Ausstellungsräumen und draußen auf den Terrassen unendlich viele Exemplare zu geben schien. Es handelte sich nicht um irgendeinen Stuhl, sondern um den SE 68. Entworfen worden war dieser Allzweckstuhl vom deutschen Architekten und Designer Egon Eiermann, der auch für den Deutschen Pavillon mitverantwortlich gezeichnet hatte. Als konsequenter Vertreter des Funktionalismus, so steht es in einer weiteren Broschüre, die ich im Pappkarton meines Onkels fand, soll es Eiermann bei diesem Stuhl darum gegangen sein, minimalistische, elegante Formen mit Ergonomie und Komfort zu verbinden. Dabei seien die ergonomisch gebogenen Sitz- und Rückenflächen eine Besonderheit der Zeit und die Verbindung von organisch geformtem Schichtholz und einem schlichten Gestell aus Stahlrohr äußerst innovativ gewesen.
Mein Onkel selber war nicht so begeistert von diesem Designer-Meisterstück, das man heute zuweilen noch auf Auktionen ersteigern kann. »Denn weißt du«, sagte er, »wenn du eine halbe Nacht auf diesem Eiermann verbracht und in die Stille hinein gelauscht hattest, dann spürtest du nichts mehr von seiner ausgetüftelten Sitz- und Rückenergonomie, sondern dann taten dir einfach nur Hintern und Rücken weh, und du warst froh, wenn du deinen nächsten Kontrollgang erledigen durftest.«
Der Rheinländer ließ sich dann doch noch von meinem Onkel die Papiere zeigen und überprüfte, ob es sich um den richtigen Mann handelte, den man ihm da aus der fernen Domstadt entsandt hatte, und sagte schließlich erleichtert: »Joot, dat de do bes!« Daraufhin erklärte er, dass der Vorgänger meines Onkels es mit einem »Hätzjeschäft« zu tun bekommen habe. Dabei sei bislang kaum »Brimmel« und »Radau« gewesen. Aber die Leute ließen sich nicht mehr so »beloste«, vor allem, wenn sie im »Kreech« gewesen seien. Dann zeigte er meinem Onkel, wo man das Funkgerät versteckte, mit dem man bei einem nächtlichen Überfall (»wenn en Tünnes versöök, enzubreche«) die belgische Polizei alarmieren könne, und schlug ihm vor, sich »ene schöne Daach ze maache«, denn Arbeitsbeginn sei erst gegen 18 Uhr, dann schlössen die Pavillons, das Gelände habe aber bis Mitternacht geöffnet, danach heiße es Ausmarsch für die Besucher und für meinen Onkel: »d’r Lusch spitze un vürsich sinn bes en d’r Morgend.«
So wurde mein Onkel der nächtliche Hüter von acht flachen Gebäudewürfeln, die er bei Dunkelheit vor drohender Unbill zu beschützen hatte. Zwar hielten weder er noch der Rheinländer es für möglich, dass irgendjemand bei Nacht in die Räumlichkeiten der Deutschen Sektion einsteigen könnte, zumal es dort ja rein gar nichts zu holen gab, was man nicht tagsüber ohnehin kostenlos hätte mitnehmen dürfen. Doch darum ginge es gar nicht, erklärte ihm der Rheinländer im Vertrauen. Es ginge vielmehr um die »Värsicherong«. Denn die zahle bei einem Einbruch nicht, wenn kein Wachmann vor Ort gewesen sei. Womit sich die Argumentation im Kreis drehte, denn ein Einbruch schien ja eben nicht vorstellbar. Doch, so argumentierte der Rheinländer, »wat nit es, dat kann noch wäde«, und so sei ein Wachmann nun einmal die sicherere Option.
Letzten Endes sollte meinem Onkel die Gefahreneinschätzung der Versicherung aber gleichgültig sein. Denn er wurde ja für seine Arbeit bezahlt. Und wenn es sich dabei um so eine entspannte Angelegenheit handelte, dann durfte man erst recht zufrieden sein. Wer konnte schon während seiner Arbeitszeit seinen eigenen Gedanken nachgehen?
Heute ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich meinen Onkel um seine Zeit als Nachtwächter beneide. Denn anders als er damals, kann ich keinesfalls meine Gedanken schweifen lassen, sondern muss mich während meiner Arbeitszeit konzentrieren. Als Ärztin muss ich mir diesen Luxus für meine privaten Stunden aufheben. Im Sanatorium ist dafür kein Platz. Stattdessen wandele ich stundenlang mit meinem Laptop in der Hand und einigen Krankenpflegerinnen zu meiner linken und rechten von Tür zu Tür, um mich nach dem Genesungszustand unserer Patienten zu erkundigen. Da diese Menschen aus aller Welt zu uns kommen, ist eine Verständigung manchmal schwierig. Nicht immer gelingt es, klar zu eruieren, welche Probleme sie haben. Bei fast allen von ihnen spielen neben den körperlichen Beeinträchtigungen, die meistens offensichtlich sind, immer auch psychische Leiden eine große, oft sogar die größte Rolle, die zu diagnostizieren selbst für unseren promovierten Hauspsychologen nicht immer leicht sind. Früher hat mein Onkel sich um all diese Leute gekümmert. Er hatte einen besonderen Draht zu ihnen. Da war es fast unwichtig, dass er ihre Sprache nicht beherrschte. Er fand immer eine Ebene, auf der er sich mit ihnen verständigen konnte. Wahrscheinlich benötigt man für dieses fast wortlose Verständnis Kriegserfahrung, über die wir jüngeren Leute nicht mehr verfügen.
»Wenn man das Grauen einmal selbst erlebt hat«, sagte mein Onkel, »dann ist es sehr leicht, diese Menschen zu verstehen. Ich blicke in ihre Augen und weiß, was sie durchgemacht haben. Ich sehe selbstverständlich nicht ihre unterschiedlichen Geschichten, sondern nur die Verformungen, die diese Geschichten in ihrer Psyche hinterlassen haben.«
Unser Sanatorium, das muss ich vielleicht dazu sagen, kümmert sich um Kriegsverletzte aus aller Welt. Mein Onkel hat es Mitte der 1960er Jahre gegründet. Viele Jahre lang galt es als Vorzeigeprojekt friedenspolitischer Arbeit. Mein Onkel war das öffentliche Sprachrohr dieser Friedensarbeit. Sein Wort hatte Gewicht, und sein Name ist bis heute in der ganzen Welt bekannt. Doch der Zuspruch, den das Sanatorium viele Jahrzehnte lang vor allem in Deutschland fand, ist nach dem Tod meines Onkels im Schwinden begriffen. War es ihm zeit seines Lebens wichtig, die Folgen eines Krieges für all diejenigen sichtbar zu machen, die immer mal wieder glauben, Krieg sei zuweilen ein gangbarer politischer Weg, so hört man heute solcherlei Warnungen nur noch ungern. Nach Jahrzehnten, in denen es fast so aussah, als ob der Frieden nicht verhandelbar wäre, beginnt die Friedensliebe langsam zu bröckeln. Für mehr und mehr Politiker ist eine kriegerische Auseinandersetzung plötzlich wieder denkbar, auch in Mitteleuropa. Es erscheint fast, als ob eine ganze Gesellschaft an einem paradoxen Alzheimersymptom litte, paradox, weil es nicht die Alten sind, die die Schrecken des Kriegs zu vergessen beginnen, sondern die Jungen, denen man jahrzehntelang von ihnen erzählt hat.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle einschieben, wie mein Onkel mit dreißig Jahren an diese doch eher ungewöhnliche Aufgabe eines Nachtwächters auf der Weltausstellung in Brüssel überhaupt gekommen ist, zumal er doch, so hieß es in der Familie, immer Physiker hatte werden wollen.
In der Tat zeigte er sich, wie alte Zeugnisse beweisen, während seiner Schulzeit in den Naturwissenschaften durchaus beschlagen, wenngleich seine schlechten Rechenkünste meist eine gute Note auf dem Zeugnis verhinderten. Aus heutiger Sicht betrachtet interessierte er sich mehr für die erkenntnistheoretischen Folgen der modernen Physik als für ihre mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Dennoch setzte er alles daran, um nach dem Abitur Physik zu studieren. Er hatte jedoch die Rechnung ohne die kriegstüchtige Politik seiner Zeit gemacht. So wurden er und die meisten seiner 1927 geborenen Mitschüler aus der 7. Gymnasialklasse im Februar 1943 als Luftwaffenhelfer eingezogen. Mein Onkel wurde zusammen mit drei seiner engeren Freunde einer Flakartillerieeinheit vor den Toren Münsters zugeteilt, die bereits am 10. Oktober 1943 ihren persönlichen Doomsday erlebte.
An diesem Tag flogen die Alliierten einen ihrer ersten Angriffe am Tage. Mehr als 200 Bomber der United States Army Air Forces waren seit dem Vormittag mit düstrem Gebrumm Richtung Ruhrgebiet unterwegs gewesen. Auf der Höhe von Haltern drehten sie aber plötzlich ab und steuerten, als hätten sie es sich anders überlegt, Münster an. Mittlerweile war es Sonntagnachmittag, und in der Stadt hielten sich viele Ausflügler auf, um einen sonnigen Oktobertag rund um den Prinzipalmarkt und den Friedenssaal zu genießen, in dem 1648 der Dreißigjährige Krieg beendet und der Westfälische Frieden ausgerufen worden war, der, so steht es in den einschlägigen Lexika, als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer europäischen Friedensordnung und zur Entwicklung des heutigen Völkerrechtes gilt. Exakt zweihundertundfünfundneunzig Jahre später jagten der europäischen Friedensordnung zum Trotz amerikanische Bomber im Tiefflug und mit hoher Geschwindigkeit durch den Abwehrbereich der Flakartillerie und warfen kurz darauf über zweitausend Sprengbomben sowie zwanzigtausend Stabbrandbomben und weitere sechhundertsechzig Phosphorbomben auf die in der Oktobersonne liegende Stadt. Nach offiziellen Angaben starben an diesem Tag vierhundertdreiundsiebzig Zivilisten und knapp zweihundert Soldaten, nicht eingerechnet die ums Leben gekommenen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, die weder als Lebende noch als Tote mitgezählt wurden.
Die Flakartillerie, bei der mein Onkel seinen Dienst tat, bekam einen Volltreffer ab, wahrscheinlich war das gar nicht beabsichtigt gewesen, und es handelte sich um einen Zufallstreffer, aber was macht das schon für einen Unterschied? Drei seiner Schulfreunde wurden vor seinen Augen in Stücke gerissen. Er selbst kam mit dem Leben davon, weil er ein paar Meter entfernt von der Flak den Flakscheinwerfer, der seinem persönlichen Verantwortungsbereich unterlag, für den Nachteinsatz vorbereitete, genauer: Er polierte gerade den Glasparabolspiegel, der sich über der Hochleistungslampe wölbte und eineinhalb Meter Durchmesser besaß, als der Sprengkörper in die Flak neben ihm einschlug, an der zu diesem Zeitpunkt sechs Menschen ihren Dienst verrichteten, die bis zuletzt nicht glauben wollten, dass die Amerikaner am helllichten Tag angreifen würden. Der Parabolspiegel bekam bei der Explosion genau wie mein Onkel keinen einzigen Kratzer ab, und die Lampe darunter funktionierte auch nach dem Tod von sechs jungen Gymnasiasten seiner Einheit weiterhin einwandfrei, wie mein Onkel durch das Betätigen des Lichtschalters so lange schreiend demonstrierte, bis ein Trupp Sanitäter sich seiner annahm und ihm eine Beruhigungsspritze verpasste.
Wenn ich behaupte, dass mein Onkel unverletzt blieb, dann ist das nicht ganz richtig. Er trug bei diesem Angriff zwar keine körperlichen Schäden davon, doch riss ihm der Anblick seiner toten Schulfreunde eine so große seelische Wunde, dass diese zeit seines Lebens nicht mehr heilen wollte. Im Mai 1944, er galt nach dem Unglück als angstgestört und daher nicht mehr flaktauglich, bekam er sein Abgangszeugnis ausgehändigt, mit dem er sich nach dem Krieg um einen Studienplatz in Physik bemühte. Doch die Hochschule erkannte sein während des Zweiten Weltkriegs unter besonderen Bedingungen abgelegtes Abitur nicht als vollgültiges Abitur an. Dafür hätte er mehr die Schulbank als den Lichtschalter der Flak drücken müssen. Und sein altes Gymnasium konnte ihm nicht mehr helfen, da es 1944 nach einem Treffer durch eine verirrte Phosphorbombe der Alliierten bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Man legte ihm nahe, an einem Realgymnasium einen Lehrgang zur Anerkennung der Hochschulreife zu absolvieren. Das aber lehnte mein Onkel kategorisch und entschieden ab. Er fühlte sich ungerecht behandelt, protestierte vergeblich, resignierte schließlich und verzichtete zuletzt mit einem gewissen Anflug von Stoizismus auf sein Physikstudium.
»Das war dumm«, urteilte er in späteren Jahren. »Ich habe damals wirklich geglaubt, dass eine Urkunde, die man schwarz auf weiß besitzt, von dauerhaftem Wert ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Welt sich um ein Stückchen Papier herum so sehr verändern kann, dass dieses Stückchen Papier jegliche Bedeutung verliert, so als ob es niemals beschrieben und gestempelt worden wäre.«
Für meinen Onkel begann daraufhin eine Zeit der Orientierungslosigkeit, wie man es heute nennen würde. Er nahm eine Ausbildung zum Kurbelwellenschleifer an, die er nach drei Monaten wieder abbrach. Daraufhin versuchte er sich ebenso vergeblich als Bäcker und Postbote. Doch begriff er eines Tages, dass das frühe Aufstehen ihm nicht lag, und so wurde er Klavierspieler in einer kleinen Tanzband, die sich primär dem Swing verschrieben hatte und überwiegend nachts arbeitete. Sein Klavierspiel war zwar nicht herausragend – als junger Mann hatte er Akkordeon gespielt und diese Fähigkeit dann auf die Klaviertastatur übertragen –, aber nach dem Krieg war man froh um jede kleine Musikband, die einem für wenig Geld den Abend oder eine Familienfeier versüßte.
»Wir haben zunächst nur deshalb Swing gespielt, weil man dadurch weniger Scherereien hatte«, erzählte mein Onkel. »Bei Schlagertexten benötigte man eine Freigabe von der englischen Besatzungsmacht. Das war unter Umständen kompliziert oder man war Missverständnissen ausgesetzt. Aber der Swing war ideologiefrei. Das machte ihn für uns interessant. Daher imitierten wir ihn nach bestem Vermögen und ließen keine Jazzsendung im Radio aus, um uns musikalisch weiterzubilden.« Allerdings habe man mit dieser Musik nicht allzu viel Geld verdient. Und wahrscheinlich sei man auch nicht allzu gut gewesen. Irgendwann hätten ihnen die Könner den Rang abgelaufen.
Ihre besten Nummern, so erzählte mein Onkel, seien abgespeckte Varianten von Lionel Hamptons »Air Mail Special« und »Rumors Are Flying« von Frankie Carle gewesen, allerdings zunächst ohne Gesang, da niemand das Englische beherrschte. Später dann hätten sie »The Gypsy« von »The Ink Spots« einstudiert, eine melancholische Nummer, die angeblich nach dem Krieg gut ankam.
»Ich verstand nicht alles, was ich da sang, und hatte mir daher den englischen Text in Lautschrift in das Innere meines Klavierdeckels geklebt«, erzählte mein Onkel. »Und so sang ich herzzerreißend: In a quaint Caravan, there’s a lady they call The Gypsy. She can look in the future and drive all away your fears.«
Mein Onkel gab zu, dass er damals immer quiet statt quaint gesungen habe, was aber erst aufgefallen sei, nachdem sie den Titel mal in einem Frankfurter Hotel während einer Hochzeitsfeier spielten und ein schwarzer GI ihn auf den Irrtum aufmerksam gemacht hätte. Auch die »Mondnacht auf Cuba« habe zum festen Programm gehört, wobei mein Onkel das Klavier stets gegen sein altes Akkordeon eintauschte. Komm, komm in den Garten / komm, schön ist die Nacht. Dieses Gedudel sei besonders breitentauglich gewesen, wenn auch komplett albern. Aber nach dem Krieg hätten die Leute auf Banalitäten gestanden sowie auf einfache naive Liebeslieder. Je unverfänglicher, desto besser. Nur kein Wort mehr von Krieg, Tod und Leid, stattdessen Gesänge von Sonnenuntergängen in Italien, fernen Stränden auf Hawaii, kleinen Fräuleins, dem Theodor im Fußballtor oder Maria aus Bahia.
»Nicht zu glauben«, sagte mein Onkel, »dass diese Nation, die jetzt von den blauen Bergen kam und angeschwipst ja ja jippie jippie yeah sang, erst vor kurzem mit Inbrunst gegrölt hatte: Die Straße frei den braunen Bataillonen, die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!«
Doch zurück ins Jahr 1958 und in die acht miteinander verbundenen Glasboxen in hügeliger Landschaft, die für ein paar Wochen das neue Nachtquartier meines Onkels werden sollten. Ich vergaß zu erwähnen, dass der Rheinländer ihm auch eine Uniform für seinen Nachtdienst aushändigte, so als ob, falls es doch einmal zu einer unverhofften nächtlichen Begegnung mit einem Eindringling käme, diese einer gewissen Etikette nicht entbehren sollte. Doch in dieser Uniform, so stellte mein Onkel rasch fest, nachdem ihm auf Veranlassung des Rheinländers bis zum Abend die Hosenbeine ein wenig gekürzt und der Hosenbund verengt worden waren, verließ er vollständig die Kategorie der Schaulustigen, die aus aller Welt angereist kamen, und wechselte auf die Ebene der Macher, die die Schau vor der Weltöffentlichkeit zu verantworten hatten. Und das fühlte sich nicht nur sogleich anders an, man wurde auch augenblicklich anders behandelt. Sogar die »Hostessen Europas« lächelten ihm jetzt nicht mehr ihr Was-kann-ich-für-Sie-tun-Lächeln zu, das sie jedermann spendierten, der ihnen hilfesuchend in die Augen sah, sondern sie schenkten ihm von nun an ein kollegiales Schmunzeln, das nicht selten mit dem Anflug eines leichten Augenzwinkerns wie mit einem Geheimzeichen der Verbundenheit gepaart war.
Doch noch war es Nachmittag, und mein Onkel musste bis 18 Uhr so manche Stunde verbringen, bevor er das erste Mal in seine Uniform schlüpfen durfte. Er ging dahin, wohin alle als Erstes hingingen: in die großen Pavillons der Supermächte. Er betrat die Wäschetrommel der Amerikaner, die der New Yorker Architekt Edward D. Stone für einen »Kristall- und Goldpalast« hielt. Mit einem Durchmesser von 104 Metern sollte es sich um den größten Rundbau der Welt handeln. Alles andere wäre für die amerikanische Nation und ihre hegemonialen Ansprüche auch nicht hinnehmbar gewesen. Während die architektonischen Formen monumentale Züge annahmen, waren die vermittelten Inhalte doch eher bescheiden. So stand mein Onkel längere Zeit vor einer Maschine, die auf elektronische Weise Wahlzettel auszählen konnte, und zwar in einer so höllischen Geschwindigkeit, dass man geradezu Sorge um die Demokratie bekam, statt, wie beabsichtigt, in seinem Vertrauen zu ihr und ihren technischen Wunderwerken bestärkt zu werden.
Der sowjetische Pavillon, der mit einer Länge von 150 Metern und einer Breite von 72 Metern ebenfalls auf Größe setzte, hatte neben einem gigantischen Leninstandbild, um das die Halle drumherum genäht zu sein schien wie ein Mantel um ein Knopfloch, zwei Sputnik-Satelliten zu bieten, die die Massen unwiderstehlich anzogen. Den Sowjets schien es noch wichtiger, die kostspieligen Erzeugnissen ihres Staates zu zeigen als den Amerikanern. So hatten sie exakt doppelt so viel Geld für die Weltausstellung bereitgestellt wie ihre Kontrahenten.
An diesem seinem ersten Tag auf dem Heysel-Gelände saß mein Onkel am Nachmittag im sogenannten Folkloreviertel Belgien 1900, einer Stadtattrappe, die überwiegend aus Holz, Stuck und Pappe gefertigt worden war. Inmitten des Vergnügungsviertels, so hieß es in seinem Ausstellungsführer, habe der Tourist die Möglichkeit, ins Anonyme abzugleiten. Doch um diese Uhrzeit verfing der Zauber noch nicht. Es war zu hell, um nicht zu bemerken, dass der Marmor auf dem Tresen in einem der Lokale, die mein Onkel besuchte, nur mit dem Pinsel aufgetragen worden war, und dass das bunte Mosaik auf den Bistrotischchen nicht aus Granitsteinchen, sondern aus einer Klebefolie bestand. Eine historisch gewandete Dame schenkte ihm in einem langen blaugemusterten Kleid und einer altmodischen mit Bommeln versehenen Kopfbedeckung heißen Kaffee ein. Als sie wieder verschwunden war, wurde mein Onkel von einem Mann angesprochen, der nur ein paar Jahre älter als er zu sein schien und der vor einigen Minuten hereingekommen war, sich an einem der Nebentische niedergesetzt hatte und jetzt ein großes belgisches Bier trank:
»Sie müssen abends wiederkommen«, sagte der Mann, da er wahrscheinlich den irritierten Blick meines Onkels bemerkt hatte, nachdem dieser zunächst in den Ausstellungsführer und dann zur Überprüfung des Gelesenen einmal durch das Lokal geschaut hatte.
»Gestern Nacht war in diesem Viertel noch bis vier Uhr in der Früh Remmidemmi. Speziell, sage ich Ihnen, sehr speziell. Und es gibt gewisse Damen, Sie begreifen schon. Man muss sie nur zu erkennen verstehen. Aber meist geben sie sich Ihnen zu erkennen.«
Der Mann lachte übertrieben laut, und meinem Onkel war das Gespräch peinlich. Doch er hatte von seinem heißen Kaffee erst ein einziges Mal genippt, so dass er wenig Lust verspürte, das Lokal bereits wieder zu verlassen.
»Gestern war hier eine Rothaarige, hat zur Klavierbegleitung gesungen, Was machen die Mädchen in Rio, ich sage Ihnen, der ganze Saal stand kopf. Kommen ja fast nur Deutsche hierher. Sie ist dann mit Generaldirektor Scholzen abgedackelt, von Scholzen & Krause aus München, die machen in Eternitverkleidung. Ihn haben Sie bestimmt schon gesehen, so ein aufgeblasener Gartenzwerg, trägt immer Melone, selbst bei diesem Wetter.«
Mein Onkel zuckte nur mit den Achseln.
»Und Sie?« wandte sich der Fremde direkt an meinen Onkel. »Darf ich fragen, ob Sie als Tourist oder geschäftlich vor Ort sind?«
»Weder noch«, sagte mein Onkel, »ich arbeite als Sicherheitskraft im Deutschen Pavillon. Allerdings nur nachts. Jetzt habe ich frei.«
»Ah, einer von den Internen«, sagte der Mann und zündete sich eine Zigarette an, wobei er die Schachtel, die in einem Lederetui steckte, zunächst meinem Onkel hinhielt, der aber lehnte ab und zückte seine eigene.
»Oh, Sie Ärmster«, sagte der Mann, als er die orangenfarbene Schachtel meines Onkels erblickte, »da werden Sie sich wohl bald an eine andere Marke gewöhnen müssen.«
Mein Onkel sah den Fremden verständnislos an.
»Das Kölner Unternehmen Overstolz wird gerade an die R. J. Reynolds Tobacco Company verkauft«, erklärte er. »Sie wissen schon, das sind die, die ein Dromedar für ein Kamel halten.«