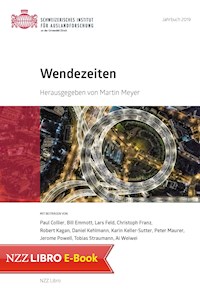
Wendezeiten E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: SIAF
- Sprache: Deutsch
In unserer Wahrnehmung beschleunigt sich die Welt immer mehr. Nicht nur politische und wirtschaftliche Entwicklungen laufen schneller und vermehrt ins Ungewisse, auch die wissenschaftlich-technologischen Revolutionen verändern die moderne Wirklichkeit auf mitunter dramatische Weise. Wohin dies alles führen wird und welche Risiken und Krisen dabei zu beachten sind, haben kompetente Redner thematisiert und diskutiert. Mit Beiträgen von Daniel Kehlmann, Sir Paul Collier, Lars Feld, Tobias Straumann, Bill Emmott, Jerome Powell, Robert Kagan, Karin Keller-Sutter, Ai Weiwei, Christoph Franz und Peter Maurer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE STUDIENDES SCHWEIZERISCHEN INSTITUTS FÜRAUSLANDFORSCHUNGBAND 46 (NEUE FOLGE)
Begründet vonProf. Dr. Dr. h.c. Friedrich A. Lutz (†)
www.siaf.ch
Wendezeiten
Herausgegeben von Martin Meyer
Mit Beiträgen von Daniel Kehlmann, Paul Collier,Lars Feld, Tobias Straumann, Bill Emmott, Jerome Powell,Robert Kagan, Karin Keller-Sutter, Ai Weiwei,Christoph Franz, Peter Maurer
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG.Der Text des E-Books folgt der gedruckten1. Auflage 2020 (ISBN 978-3-03810-474-2)
Lektorat: Jens Stahlkopf (deutsch) und Ashley Curtis (englisch)
Gestaltung, Satz: Mediengestaltung Marianne Otte, Konstanz
Datenkonvertierung: CPI Books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsan-lagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Verviel-fältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN 978-3-03810-474-2
ISBN 978-3-03810-490-2 (E-Book)
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Inhalt
Vorwort
DANIEL KEHLMANNWie Literatur die Welt spiegelt
PAUL COLLIERThe Future of Capitalism
LARS FELDWirtschaftskrisen der Zukunft
TOBIAS STRAUMANNHitlers Aufstieg und die Aktualität der 1930er-Jahre
BILL EMMOTTEurope in an Age of Trump, Salvini and the Gilets Jaunes
Panel Discussion with GovernorJEROME POWELL and Governor THOMAS JORDAN
ROBERT KAGANWhere are the US heading?
KARIN KELLER-SUTTERZwischen Zusammenarbeit und Grenzen
AI WEIWEIAll is Art. All is Politics.
CHRISTOPH FRANZWas verspricht die Digitalisierung für das Gesundheitswesen?
PETER MAURERDie Transformation humanitären Handelns
Vorwort
Lässt man das Programm des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung im Jahr 2019 noch einmal Revue passieren, was auch Sinn und Zweck eines Jahrbuchs sein soll, so fällt zweifellos auf, dass der Spannungsbogen weit gezogen war. Abwechslung war angesagt, nicht nur für die Themen der Vorträge, sondern auch für die Speaker, die zwischen dem 5. März und dem 18. November ihre Auftritte an der Universität Zürich hatten und dabei vor grossem und interessiertem Publikum referieren konnten.
Den Auftakt im Frühjahrssemester machte der berühmte deutsche Schriftsteller Daniel Kehlmann mit einem bemerkenswerten Vortrag zum Verhältnis zwischen Welt und Literatur. Es folgte der Auftritt des britischen Ökonomen Sir Paul Collier, der die Zukunft des Kapitalismus mit Anschauungsmaterial insbesondere aus dem Vereinigten Königreich spiegelte. Weiter ging es mit ökonomischen Themen und Fragestellungen in den Referaten von Professor Lars Feld («Wirtschaftskrisen der Zukunft» - «Corona» konnte noch nicht auf dem Radar des Verdachts stehen…), von Professor Tobias Straumann («Hitlers Aufstieg und die Aktualität der 1930er-Jahre») und Bill Emmott («Europa im Zeitalter von Trump, Salvini und den Gilets jaunes»). – Aus allen Vorträgen wurde ersichtlich, dass das Wort vom Primat der Politik für die Zeitgeschichte längst zu ergänzen ist durch dasjenige von der Vorherrschaft der Wirtschaft und insbesondere der Weltwirtschaft, die ihrerseits vielfältigen Formen von Politik und Politisierung immer neue Nährstoffe liefert.
Das Herbstsemester begann mit einer besonders spannenden Ouvertüre, hatten wir doch das Privileg, den Chef der Notenbank der Vereinigten Staaten von Amerika, Jerome Powell, in Zürich willkommen heissen zu dürfen. Powell diskutierte mit Thomas Jordan, dem Präsidenten des Direktoriums der SNB, und dem Unterzeichnenden über aktuelle Fragen der Geldpolitik. Ebenfalls aus Amerika stiess der Politologe Robert Kagan zu uns, der die gegenwärtige Politik der USA einer kritischen Analyse unterzog. Bundesrätin Karin Keller-Suter, Vorsteherin des EJPD, hielt einen viel beachteten Vortrag zum Verhältnis zwischen Kooperationen und Grenzen in Europa, während sich Christoph Franz, Chairman von Roche, zu aktuellen Fragen des Gesundheitswesens äusserte und Peter Maurer, Präsident des IKRK, über Transformationsprozesse im humanitären Handeln referierte.
Am 30. Oktober war der weltberühmte chinesische Künstler und Zeitdiagnostiker Ai Weiwei beim Siaf zu Gast. Er erhielt im Kontext seines Auftritts den zum fünften Mal verliehenen Frank-Schirrmacher-Preis und wurde von alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey mit einer ebenso eloquenten wie substanziellen Laudatio geehrt. Anschliessend diskutierte Ai Weiwei mit dem Unternehmer und Kunstsammler Uli Sigg sowie Micheline Calmy-Rey über die politischen Aufgaben von Gegenwartskunst im Rahmen einer zunehmend schwieriger «lesbaren» Welt.
Sämtliche Anlässe waren hervorragend besucht. Die Möglichkeit, jeweils nach dem Vortrag noch mit den Referentinnen und Referenten zu diskutieren, wurde ebenfalls rege wahrgenommen.
Gute Vorträge von klugen Gästen bieten nicht nur Momentaufnahmen. Sie sind nicht nur Schlaglichter auf aktuelle Vorkommnisse und Entwicklungen. Sie lassen immer auch Tiefenstrukturen und langfristige Prozesse der Zeit sichtbar werden. Insofern mag die Lektüre dieses Jahrbuchs zu weiteren Reflexionen anregen.
Wir wünschen ergiebige Lektüre.
Dr. Dr. h.c. Martin Meyer
Präsident des Vorstands
Schweizerisches Institut für Auslandforschung
(Alle Texte geben mündlich gehaltene Vorträge wieder und sind in diesem Sinn als niedergeschriebene Reden zu verstehen.)
Wie Literatur die Welt spiegelt – ungeordnete Bemerkungen über literarische Gattungen
DANIEL KEHLMANNVeranstaltung vom 5. März 2019
I
Gattungen sind keine willkürlichen Erfindungen. Es gibt sie schon lange, es wird sie geben, solange Menschen Sätze zu Geschichten zusammensetzen. Wer von ihnen spricht, muss bei der ältesten, der ursprünglichsten anfangen, beim Gedicht.
Das Gedicht stammt direkt vom Zauberspruch ab, von den ältesten Versuchen unserer Vorfahren, das Chaos der Welt zu bannen und zu meistern. Ein Gedicht ist etwas Innerliches. Es handelt davon, wie es sich anfühlt, ein bestimmter Mensch in einem bestimmten Moment zu sein, sogar wenn es von Dingen der Aussenwelt handelt, handelt es eigentlich davon, wie es ist, die Person zu sein, die diese Dinge in einem Moment eines bestimmten begrenzten Menschenlebens wahrnimmt. Ein «objektives» Gedicht wäre ebenso ein Unding wie ein «allgemeingültiges». Ein Gedicht, das Ereignisse berichtet, wäre schon keines mehr, es wäre, wenn es lang ist, ein Epos, wenn es kurz ist, eine Ballade.
Das Gedicht zeigt den Menschen, der darin spricht, als Vereinzelten in der Welt. Und es zeigt ihn dabei, sich Rechenschaft abzulegen. Deshalb ist es kein Wunder, dass die klassische deutsche Literatur mehr grosse Gedichte als grosse Romane hervorgebracht hat. Die Literatur deutscher Sprache im 18. und 19. Jahrhundert ist ein Produkt der protestantischen Pfarrhäuser. Es ist immer wieder verblüffend, wie viele romantische Poeten Pastorensöhne waren – aber was ist denn der Protestantismus, wenn nicht eben dies: die Idee, dass du auf die Zwischenhändler verzichten kannst? Dass du alleine vor Gott stehst, der dich bis ins Innerste kennt und dem du dich zu erklären hast. Für das protestantische Pfarrhaus ist die Gesellschaft eine unnötige Ablenkung von der bitter notwendigen Seelenerforschung, die die Aufgabe jedes einzelnen Menschen ist. Man verliert sich nicht in der Welt. Man hat bei sich zu sein. Das eben ist die fundamentale Wahrheit des Gedichtes.
II
Aber es gibt eben nicht nur den Einzelnen, es gibt auch die Gesellschaft. Es gibt Cocktailpartys, Business Meetings und Parlamentssitzungen. Es gibt also Politik, und es gibt Familien, mit all ihren Streitigkeiten und zähen Verwicklungen. Was wäre der Mensch ohne sie? Die Wahrheit des Gedichtes ist noch nicht die ganze. Die Welt der Menschen ist eine des Mit- und Gegeneinanders, eine Welt des Strebens und Scheiterns, eine Welt, wo wir einander helfen und einander im Weg stehen, eine Welt der Verstrickungen! Davon spricht der Roman. Die beiden Pole Politik und Familie überspannend, ist er eine bürgerliche Gattung, dessen grosse Zeit nicht zufällig mit dem Siegeszug der Demokratie anhebt und daher auch in Frankreich und England stattfindet, während der deutsche Sprachraum unterdessen eine Hochzeit der höfischen Form erlebt, nämlich des Dramas.
Drama und Roman, beide handeln davon, dass Menschen einander im Weg stehen, ohne dass eine Seite dabei eindeutig recht oder unrecht haben müsste. Ein religiöser oder politischer Fanatiker könnte theoretisch ein gutes Gedicht schreiben, denn auch ein zutiefst in Ideologie Verstrickter könnte in ergreifenden Worten beschreiben, wie es ist, eine Liebe zu verlieren oder eine Blume oder Wolke zu sehen. Aber einen gelungenen Roman schreiben, in dem per definitionem jede einzelne Figur auf ihre Art recht haben, unser Mitleid erregen und unser Verständnis besitzen muss – das kann er nicht, und könnte er es, er wäre kein Fanatiker. Der Roman ist zugleich die Form der Empathie wie auch der Ironie – in seiner klassischen Ausprägung stellt er die Verwebungen der Gesellschaft dar und relativiert so jeden absoluten Wahrheitsanspruch.
Und das Theaterstück? Ich habe es eine höfische Form genannt – dass dem so ist, hat schon mit seinen Produktionsbedingungen zu tun. Ein Gedicht zu schreiben kostet weder viel Zeit noch Geld, man braucht nicht einmal Papier und Bleistift dafür, es lässt sich im Kopf machen. Für die Abfassung eines Romans braucht es immerhin einen einzelnen Menschen und einige Monate oder Jahre, das kostet nicht die Welt, aber es ist doch ein Luxus, den man sich leisten können muss; ebenso sind der Druck, die Herstellung, der Vertrieb eines Romans zwar nicht umsonst, aber auch nicht kostspielig verglichen mit anderen Formen – für ein Stück aber braucht es einen Mäzen. Selbst kommerzielles Theater hat Investoren und Förderer; Theater ist nicht denkbar ohne einen reichen Fürsten im Hintergrund, so ist es entstanden, und in demokratischen Umständen wird diese Rolle vom Steuerzahler übernommen – das Gedicht ist eine ganz und gar individuelle, der Roman eine demokratische, das Theater eine höfische Form, es benötigt Ermöglicher. Wie der Roman, so ist auch das Drama eine Form, in der niemand ganz recht und niemand ganz unrecht hat, aber im Roman führt diese Haltung zu einer gewissen Abgeklärtheit, einer ironischen Distanz des Erzählers. Im Drama führt sie vielmehr dazu – und nichts anderes besagt das Wort dramatisch in der Umgangssprache –, dass wir den Konflikt miterleben und -erleiden. Das Drama lässt uns die Menschenwelt als ein aus Widerstreit erbautes Gebilde erleben; ein Stück erzählt eine Geschichte gewissermassen immer von einem Konflikt zum nächsten, ohne sich mit Äusserlichkeiten aufzuhalten, die Schönheit der Natur, die physische Textur der Aussenwelt ist ihm gleichgültig, jede Szene auf einer Bühne ist ein Streit. Es muss kein offener oder lauter Streit sein, er kann auch versteckt und im Verborgenen stattfinden, aber es bleibt der seltsame Umstand, dass jeder Moment in einem Theaterstück, der nicht einen Konflikt entweder exponiert oder weiterentwickelt, schlicht und einfach langweilig ist. Das gilt für Schnitzler, Ibsen und Shaw ebenso wie für Ionesco, Beckett und Yasmina Reza, es ist eine Regel, von der sich nicht abweichen lässt, und tut man es doch, ist alles, was auf der Bühne geschieht, im gleichen Moment leblos, blass, tot.
III
Ich merke es auch an mir selbst. Wenn ich an einem Roman schreibe, und die Arbeit geht gut voran, fühle ich mich seltsam ausgeglichen, ich fühle mich im Griff einer ironischen Klarheit, ich fühle mich den Menschen gleichzeitig nahe und fern; einen Roman schreiben ist, wenn es gut läuft, ein angenehmer Zustand. Wenn ich an einem Theaterstück schreibe, und es geht gut, bin ich nervös. Ich fühle mich reizbar und angegriffen, ich denke in Konflikten. Es ist kein Zufall, dass wir in der Literaturgeschichte so viele Beispiele von Dramatikern haben, die, um es vorsichtig zu sagen, schwierige Leute waren – von Alkoholikern, von Streithähnen, von Menschen, die ständig hilflose Beute ihres Zorns wurden. Die Form des Dramas bringt es mit sich, dass es nicht angenehm ist, ein Dramatiker zu sein. Mir persönlich sind meine Stücke ebenso wichtig wie meine Romane, aber was den tatsächlichen alltäglichen Prozess des Schreibens angeht, so bin ich lieber der, der an einem Roman, als der, der an einem Stück arbeitet.
IV
Der Lyriker und der Romancier sprechen direkt. Die Stimme, die wir hören oder lesen, ist die Stimme des Autors – sie mag verstellt sein, aber sie gehört ihm. Der Dramatiker wie auch der Autor eines Drehbuchs sprechen durch andere, nämlich die Schauspieler. Aber hier endet auch schon die Gemeinsamkeit. Film und Drama sind kollaborative Formen, die nicht eine Person allein, sondern eine Gruppe realisiert, aber der Film ist kein fotografiertes Theater! Er unterliegt anderen Gesetzen und steht dem Roman näher als dem Theaterstück.
Überhaupt, der Film. Im Augenblick sieht es ja so aus, als ob er die Gattung ist, die in der zeitlich ausgestreckten Form der Fernsehserie alle anderen Gattungen vertilgend überrollt. Wir alle sehen mehr Filme als wir lesen oder ins Theater gehen. Wir alle sind mit Filmen aufgewachsen und, ob wir es wollen oder nicht, stärker von Filmen geprägt als von Büchern, Dramen, Erzählungen, Gedichten. Für mich gilt das in besonders starker Weise, auch aus familiären Gründen: Mein Vater war Regisseur, meine Mutter ist Schauspielerin, und die Prägung erfolgte nicht nur in äusserlicher, sondern auch innerlicher Weise. Ich war etwa fünf Jahre alt, als ich den Tod meiner Mutter erlebte. Nicht in Wirklichkeit, Gott sei Dank, sie befindet sich bei guter Gesundheit, sondern in einem Fernsehfilm. Die Figur, die meine Mutter darstellte, starb keineswegs vor meinen Augen, ihr Ableben wurde nur von einer anderen Figur gegen Ende des Films kurz erwähnt, und vermutlich hatten auch deswegen meine Eltern nicht daran gedacht, dass etwas so Fernes und Abstraktes mich tatsächlich würde erschrecken können – aber es erschreckte mich, und zwar sehr. Meine Mutter sass neben mir auf dem Sofa, und dennoch regte ihr Tod in der Handlung des Films mich so sehr auf, dass ich gar nicht mehr zu mir finden konnte vor Weinen und Verunsicherung. Meine Mutter ist ein einfühlsamer Mensch, aber nun wusste sie doch nicht recht, wie sie umgehen sollte damit, dass sie ihren kleinen Sohn zu trösten hatte über ihren eigenen Tod – in einem Moment, wo sie doch gesund und munter neben ihm sass. Und auch ich selbst begriff natürlich, dass das alles keinen Sinn hatte, dass meine Traurigkeit völlig unangebracht war und dass es bloss um eine Fiktion ging. Und doch konnte ich mir nicht helfen und weinte hemmungslos. – Diese Geschichte ist vielleicht symptomatisch für viele Dinge – ich weiss nur nicht genau, wofür. Für das komplizierte Verhältnis von Fiktion und Leben womöglich, für die Seltsamkeit des Schauspielerberufs, und sicher auch für die eigentümliche Lage eines Kindes, dessen Eltern im Illusionsgewerbe tätig sind. Auf seltsame Weise kamen mir seit dieser Kindheit alle anderen Berufe … nun ja, unwirklich vor.
Mein Vater war Regisseur, er inszenierte Fernsehfilme, die ich kannte, lange bevor ich sie eigentlich sehen konnte. Mein Vater hatte die Angewohnheit, Drehbücher zu diktieren, er sass an seinem Schreibtisch, vor Bergen gekritzelter Notizen, die nur er allein lesen konnte, und sprach das Drehbuch, zum Beispiel seiner Verfilmungen der grossen Romane von Joseph Roth, auf ein Tonband. Das wurde dann von seiner Sekretärin abgetippt und kam als säuberlich geschriebenes Skript zurück, das er dann wieder mit Kritzeleien versah, aus denen er eine zweite Fassung diktierte. Und wenn er das tat, sass ich oft dabei, reglos, stumm, zuhörend, und die merkwürdige Mischung aus Nummern, Szenenanweisungen, knappen Handlungsbeschreibungen und natürlich Dialog liess vor meinen Augen, nun ja, vielleicht nicht einen Film, aber doch eine Handlung, eine Geschichte entstehen. Es war zugleich abstrakt und konkret, zugleich erzählend und eigentümlich schematisch, und als ich viele Jahre später selbst anfing, nun auch Drehbücher zu schreiben, hatte ich nicht das Gefühl, etwas völlig Neues zu versuchen, sondern kehrte vielmehr zu etwas Vertrautem zurück: jener schmucklosen Prosa, die das Innerste eines Films ausmacht, die sozusagen sein Gerüst aufbaut und seine Form erzeugt.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer überzeugt war von der tiefinnerlichen Verwandtschaft von Film und Roman. Der Film ist eine epische Gattung mehr als eine dramatische; obgleich er mit Schauspielern, Szenen und Dialogen arbeitet, steht er dem Roman näher als dem Theaterstück. Er lebt von Atmosphäre, von genauer Einrichtung der Details, von Bildern, Übergängen, An- und Zusammenklängen, von Farben und Formen, natürlich auch von kleinen Gesten, Blicken, Haltungen und Bewegungen; von all diesen Dingen mehr als von Dialogen. Deswegen werden Romane so oft in Filme übersetzt und Theaterstücke so selten.
V
Romane sind in Filme übersetzbar, und wer etwas anderes behauptet, halten zu Gnaden, spricht ein Klischee nach. Mit kaum einem Satz erntet man mehr Zustimmung auf Partys als mit der Feststellung: «Ein guter Roman ist immer unverfilmbar.» Auf diesen Satz hin wird stets genickt, egal wann er geäussert wird, egal wo, egal von wem, und niemand antwortet: Ja, aber was ist mit Tarkowskijs Solaris? Was ist mit Viscontis Tod in Venedig? Was mit Bondartschuks Krieg und Frieden, was mit Hanekes Klavierspielerin, was mit allen Filmen Stanley Kubricks? Was ist mit den Wahlverwandschaften der Taviani-Brüder, was ist mit Sam Mendes’ Revolutionary Road, was mit Schlöndorffs Verwirrungen des Zöglings Törless oder seiner Blechtrommel, was mit David Leans Passage to India, was mit Robert Altmanns Short Cuts? Ja, kann man nicht so viele Gegenbeispiele zu der beliebten Party-These von der Unverfilmbarkeit guter Romane aufzählen, dass sich fast schon der gegenteilige Verdacht aufdrängt – der nämlich, dass einem Grossteil aller wirklich bedeutenden und künstlerisch innovativen Filme gute, wenn nicht sogar bedeutende Romane zugrunde liegen? Dass es oft daneben geht, beweist nichts, die meisten Dinge gehen schliesslich daneben, die meisten Romane sind schlecht, und ebenso sind es die meisten Filme, also wie sollten die meisten Filme, die auf Romanen basieren, nicht schlecht sein – das ist selbstverständlich und muss nicht weiter analysiert werden. Nebenbei gesagt, es sind auch die meisten Restaurants schlecht, die meisten Kuchen, die meisten Konzerte und die meisten Tänzer. Selbst guter Kaffee ist schwer zu bekommen.
VI
Die Adaption ist die Übersetzung einer Gattung in eine andere. Gedichte werden niemals adaptiert, sie bestehen in und an sich und wollen nie zu etwas anderem werden, so wie nichts anderes zum Gedicht wird, darin liegt ihre Schönheit. Alle anderen Gattungen werden ständig ineinander übergeführt, am häufigsten natürlich der Roman in den Film. Hier gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Eine Filmadaption kann zum Beispiel eine implizite Kritik des Romans sein, der ihr zugrunde liegt, indem der Regisseur wie ein guter Lektor darüber entscheidet, was verzichtbar ist und was noch fehlt, um einen Stoff zu seiner maximalen Wirkkraft zu führen.
Ein faszinierendes Beispiel dafür ist Stanley Kubricks Shining, vielleicht der beste aller Gespensterfilme in seiner Mischung aus tiefem Schrecken der Bilder und der höheren Komödie im Spiel des begnadeten Jack Nicholson. Einer der wenigen fast perfekten Filme. Wer aber den zugrunde liegenden Roman liest, ist schon mal verblüfft über eine solche Mischung von Genialem und unfreiwilliger Komik. Kraftvoll und schonungslos stellt Stephen King den Alkoholismus dar, von tiefstem psychologischem Einfühlungsvermögen ist es, wie er der Wut, ja dem verdrängten Hass der Hauptfigur, Jack Torrance, auf seine Frau nachgeht, und wie der Spuk aus der Vergangenheit des Gebäudes entsteht, ja eigentlich aus dem beunruhigenden Prinzip, dass alle unsere Häuser eine Vergangenheit haben, die präsent bleibt, auch wenn wir sie nicht kennen, die uns eben dadurch erschreckt und ängstigt, dass wir über sie nur Ahnungen und bestenfalls Hypothesen haben, und die ein überdurchschnittlich rezeptiver Mensch wie Jacks Sohn gewissermassen erst aus der Tiefe der Zeit hervorholt, sodass Spuk nicht ein objektiver Umstand ist, sondern etwas, das jeder Einzelne nach Massgabe seiner Sensibilität erst um sich schafft und erzeugt – all das wären die Zutaten zu einem grossen Roman, einem wahrhaftigen Kunstwerk. Auf der anderen Seite aber gibt es in dem Buch auch das Heckenlabyrinth mit den aus Bäumen geschnittenen Figuren, die nachts lebendig werden und angreifen. Heckenfiguren sind auf der Skala des metaphysischen Schreckens neben Waschmaschinen oder Killer-Luftballons angesiedelt, sie beängstigen niemanden. Im Roman erfahren wir auch, dass die Geister des Overlook-Hotels «ganger» aus Chicago sind, die in der Zeit der Prohibition im Hotel abgestiegen und dort Opfer des einen oder anderen Mafia-Blutbads geworden sind. Stephen King meint, dass die Anordnung durch diese «ganger» einen Zuwachs an Realität und damit auch an Schrecken bekommt, indem er uns ausführlich darüber informiert, dass die geisterhaften Präsenzen im Overlook-Hotel einst böse Gangster mit Maschinenpistolen und Schlapphüten waren – in Wahrheit vernichtet diese Information auf das Merkwürdigste all die Unheimlichkeit, die der Autor zuvor so kunstvoll zu beschwören wusste. Wesen, die aus dem Totenreich zurückkehren, sind eine fürchterliche Vorstellung, aber wenn es sich bei diesen Wesen mit einem Mal konkret um alkoholschmuggelnde Gangster handelt, wird das Ganze zur Folklore. Hierin liegt seltsamerweise ein dramaturgisches Grundprinzip unserer Urangst: Ein Gespenst darf im herkömmlichen Sinn nichts tun. Wenn es spricht, dürfen es nur rätselhafte Sätze sein, in schroffer Knappheit, sobald aber eine Unterhaltung entsteht, wie in Oscar Wildes Canterville Ghost, haben wir es nicht mehr mit Grauen, sondern mit Komödie zu tun. Ein Gespenst, vor dem wir Angst haben sollen, kann nicht handeln, seine Tätigkeit erschöpft sich in der Präsenz, in einer schlichten Tatsächlichkeit, die einen Spalt in die Kausalität der Welt reisst. Packt es einen aber am Hals und prügelt einen gar, so wie es einer der Geister in Kings Shining tatsächlich mit dem seherisch begabten Jungen macht, so wird die beabsichtigte Steigerung zu einer Abschwächung, und der Nebeneffekt der scheinbar drastischen Gewalt ist metaphysische Harmlosigkeit.
All das weiss Kubrick, und sein Drehbuch ist ein Beispiel für effektive und durchdachte Kritik des Adapteurs an der Vorlage. Kubricks Gespenster sind klar sichtbar, aber sie haben wenig Vergangenheit, und dort, wo sie eine haben, ist diese widersprüchlich und ergibt keinen rechten Sinn. Es gibt zwar noch ein Labyrinth, aber es gibt keine zum Leben erwachenden Heckenfiguren bei ihm, und auch Jack Torrances Vorgeschichte – sein Alkoholismus, seine Neigung zur Gewalt – wird zurückgedrängt in Andeutungen im Spiel des Hauptdarstellers. Alles Eindeutige, alles zu sehr zu Ende Erzählte, das Stephen Kings Roman belastet, ist im Film mitleidlos ausgespart.
VII
Ich habe letztes Jahr ein Sachbuch fürs Theater adaptiert: Voyage of the Damned von Gordon Thomas und Max Morgan-Witts. Das akribisch recherchierte Buch aus dem Jahr 1976 behandelt die Reise der «St. Louis» – jenes berühmten Kreuzfahrtschiffes, auf dem die Nazis 1939 etwa 1000 Juden die Ausreise aus Deutschland erlaubten – ein grosser Propagandatrick von Doktor Joseph Goebbels. Dem Schiff wurde die Landung in Kuba verwehrt, wochenlang lag es vor Havanna, aber alle Verhandlungen scheiterten, da man in Kuba meinte, das Land sei zu klein, um 1000 Juden aufnehmen zu können – und ausserdem, das Argument klingt uns wahrscheinlich bekannt, wenn man jetzt 1000 aufnehme, müsse man nachher 10000 annehmen, und so weiter und so fort. Auch die USA verweigerten der «St. Louis» die Landung, das Schiff musste nach Europa zurück. In letzter Minute nahmen Belgien, Holland, Frankreich und England die Passagiere auf. Die wenigen, die es ins Vereinigte Königreich geschafft hatten, überlebten, der Grossteil der anderen verschwand in den Wirren des bald darauf den Kontinent überziehenden Weltkriegs.
Als das Theater in der Josefstadt in Wien mich bat, dieses Buch zu einem Theaterstück zu machen, war mir sofort klar, dass das Wichtige an dieser Geschichte eben darin liegt, dass sie wirklich passiert ist. Nur der Umstand, dass dies alles skandalöse Wahrheit ist, rechtfertigt, dass man sie überhaupt erzählt – und somit verbot es sich für mich, die Vorlage zu behandeln, wie ich es sonst vielleicht mit historischen Quellen gemacht hätte, nämlich einfach als Sammlung interessanten, vielseitigen, brauchbaren Materials.
Mein Stück Die Reise der Verdammten, das immer noch in Wien gezeigt wird, enthält darum keine Erfindung. Aber es reichte nicht, so dachte ich, nicht zu erfinden, es musste ausserdem noch erklärt werden, und zwar ausdrücklich, dass in dem Stück nicht erfunden wird. Aus diesem Grund griff ich zum erprobten Mittel des Dokumentartheaters, die Figuren regelmässig aus den Rollen treten zu lassen. Selbst der führende Nazi an Bord, ein Mann namens Otto Schiendick, ein Stewart, NSDAP-Ortsgruppenleiter und regelrecht widerlicher Sadist, der die Passagiere mit Freude schikanierte, muss bei mir immer wieder dem Publikum erklären, dass diese oder jene höhnische Tat oder Aussage nicht eine Erfindung des Autors ist – denn als solche wäre sie ziemlich klischeehaft und schlecht –, sondern dokumentiertes Faktum, dass also er, Otto Schiendick, tatsächlich solch ein Mensch gewesen sei. Wenn die amerikanischen Minister Morgenthau und Hull in zwei Telefongesprächen entscheiden, den Flüchtlingen nicht zu helfen, weisen sie vorher das Publikum darauf hin, dass allem, was man jetzt hören werde, ein wörtliches Protokoll zugrunde liegt. Denn der Dialog ist als dramatische Szene ziemlich mittelmässig – nur wenn man weiss, dass er nicht erfunden ist, ist er interessant, und man verfolgt mit Schaudern die kodiert antisemitischen Formulierungen des Aussenministers und späteren Friedensnobelpreisträgers Cordell Hull. Und wenn im Sachbuch von Thomas und Morgan-Witts die beiden unterschiedlichen Versionen der abschliessenden gescheiterten Verhandlung zwischen dem kubanischen Präsidenten und dem Chefunterhändler des Joint Jewish Welcome Committee geschildert werden, dann finden bei mir auf der Bühne diese beiden Versionen gleichzeitig statt, und das Publikum wird darüber instruiert, dass keiner weiss, welche von ihnen die zutreffende ist. Für kein anderes Stück, kein anderes Thema wäre ich auf derartige postmoderne Spiele verfallen, hier aber lag genau darin der Reiz des Unternehmens ebenso wie auch eine moralische Notwendigkeit. Wäre ich von den Fakten abgewichen, hätte ich keinen Grund mehr gehabt, die Geschichte zu erzählen; hätte ich die Fakten vereinfacht, hätte ich zwar einen Grund gehabt, aber meine moralische Berechtigung verloren. Das Resultat ist trocken, allerdings. Das muss es auch sein. Schliesslich geht es hier um ein ästhetisches Erlebnis, es geht aber auch um Information.
VIII
Erzählen bedeutet: Information kontrollieren. Das war so bei den Geschichtenerzählern am Lagerfeuer, und das hat sich nicht geändert bei den Drehbuchautoren in Hollywood. Der Unterschied zwischen einem Bericht und einer Geschichte liegt darin, dass der Erzähler uns in ein kunstvolles Spiel von vorausgeschickter, zurückgehaltener, nachgelieferter, vorenthaltener Information verwickelt, Erzählen bedeutet immer, im gleichen Mass etwas zu übermitteln wie etwas zu verschweigen. In diesem Sinn übermittelt ein Film immer Unzähliges, das ein Buch oder ein Drama gar nicht enthalten kann: Gesichtsausdrücke, Kleidungsstücke, Zimmereinrichtungen, Hintergründe, kurz: eine Welt. Deshalb sind Filme so teuer. Wer einen Film produziert, muss eine zwar nur partiell ausgeführte, aber doch in sich vollständige Welt errichten. Wo der Roman eine Kutsche erwähnt, muss der Film eine Kutsche herbeischaffen.
Aus diesem simplen Grund ist übrigens die teuerste Gattung überhaupt … nein, nicht der Film, sondern das Computerspiel. Ein Regisseur kann ja wenigstens Umgebungen, Dinge, Teile der Welt nutzen, die er nur mehr zu fotografieren braucht. Weiters kann er sich auf die Gesetze der Physik verlassen, sie sind unabhängig von ihm da. Die Spielprogrammierer aber müssen jedes Ding erst erschaffen, sie müssen alles erzeugen, also nicht bloss eine partielle, sondern eine innerhalb der Spielgrenzen totale Wirklichkeit, nicht nur die Figuren und ihre Gesichtszüge, sondern auch die Häuser, die Bäume, die Kutschen und Autos, den Himmel und die Wolken, aber dazu noch die newtonsche Physik, die Gravitation, die Gesetze der Lichtbrechung. Deshalb kostet die Entwicklung eines Spiels so viel Geld, und deshalb kann man sich bei Computerspielen so gar keine ästhetischen Experimente erlauben.
Adaption ist also in mehrfacher Hinsicht die Kunst des Weglassens. Gute Schauspieler können mit einer Geste, einer Bewegung, einem Blick oder einem Schwanken ihrer Stimme Dinge vermitteln, für die ein Prosaautor viele Seiten der feinsten psychologischen Analyse benötigt. Erzählende Prosa gibt es seit einigen Jahrhunderten, aber die Analyse von Menschen und ihrer Körpersprache hat unsere Spezies seit einer Million Jahren perfektioniert: Selbst der beste und menschenscheueste Leser ist besser darin, Menschen zu lesen als Literatur.
IX
Ich habe gerade ein Drehbuch für eine Neuverfilmung von Thomas Manns Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull abgeschlossen. Es war ein Auftrag, natürlich, niemand adaptiert etwas einfach so aus Lust und Laune, aber zugleich habe ich selten bei der schriftstellerischen Arbeit eine so unverstellte Freude empfunden. Wer Felix Krull adaptieren darf, der fliegt gewissermassen auf den Schwingen von Thomas Manns Genie, und doch wirft die Aufgabe, wie jede Unternehmung, die sich lohnt, Probleme auf. Felix Krull ist ein unfertiger Roman, er endet in einem merkwürdigen Halbschluss in Portugal; noch dazu geht es am Ende 100 Seiten lang um die Verführung eines «spröden» jungen Mädchens – es wäre schwierig, sich ein Thema auszudenken, das weniger zeitgemäss ist. Ähnlich die beliebte Szene, in der Felix bei der Musterung Epilepsie simuliert – ein Highlight des Romans, aber finden wir es heute wirklich so lustig, wenn ein Schauspieler mit dem Gesicht zuckt? Bei Thomas Mann ist die Szene eine sprudelnde Symphonie sprachlichen Witzes, dieser aber liegt in dem, wie geschildert wird, und nicht, was. Denn äusserlich geschieht nur Folgendes: Ein junger Mann fällt zu Boden und zuckt. Ich habe also versucht, den Witz und die Sprachkraft des Erzählers Felix Krull zu jener des gemusterten Felix Krull zu machen. In meiner Drehbuchfassung hält Felix vor der Kommission einen wilden, uferlosen, improvisierten Wahnsinnsmonolog darüber, wie sehr er sich darauf freut, sein Gewehr in der Hand zu halten, zu zielen, zu schiessen, zu töten. In jeder gut organisierten Armee wird man für solche Äusserungen untauglich geschrieben, so geht es bei mir auch Felix. Um also die Atmosphäre des Romans zu erhalten, an die so viele Leser sich liebevoll erinnern, musste ich von der Handlung des Romans abweichen – und viele, so hoffe ich jedenfalls, werden das nicht einmal bemerken.
Später, wenn Felix im Hotel Saint James in Paris arbeitet, erst als Liftboy und später als Kellner, gibt es da einen anderen Kellner, einen Mann der Unterwelt, der Felix zunächst bedroht und ihm dann gegen eine Gewinnbeteiligung hilft, einen Hehler zu finden, um die Schmuckstücke zu verkaufen, die ihm ein reicher Hotelgast, Madame Houpflé, für amouröse Dienste geschenkt hat. Im Roman erweist sich dieser Stanko dann aber bald als harmloser netter Kerl, der seine Drohgesten gleich wieder zurücknimmt und für den Thomas Mann danach nicht viel Verwendung hat. Im Drehbuch habe ich nun das, was bei Mann angelegt und gleich wieder zurückgenommen ist, einfach beibehalten: Stanko bleibt hier Verbrecher, er leitet die Unterwelt des Hotels wie ein Mafiaboss, mit dem man sich gut stellen und an den man wöchentlich Schutzgeld abführen muss. Ich bezweifle, dass viele Zuseher die Änderung bemerken werden, aber für die Struktur des Films, für die Aufrechterhaltung von Spannung und Druck, war sie überaus hilfreich. Oder ein letztes Beispiel: Felix als Kind, das bei einem Kurkonzert Geigenspiel vortäuscht und die Zuschauer entzückt – eine wunderbare Szene im Roman, aber kann sie im Film funktionieren, wo ja jeder geigenspielende Schauspieler sein Geigenspiel nur vortäuscht? Ich meine, das könnte sie nicht, ganz von selbst würde sie ihre Überzeugungskraft verlieren, einfach deswegen, weil sie nicht in einem Roman, sondern eben in einem Film vorkommt und man daher ja ohnehin weiss, dass der Darsteller nicht selbst musiziert.
Eine Adaption entsteht natürlich auch immer in kritischer Auseinandersetzung mit ihren Vorgängern; so mancher von Ihnen wird wohl die Verfilmung aus dem Jahr 1957 gesehen haben, inszeniert von Kurt Hoffmann, mit Horst Buchholz in seiner ersten Rolle. Horst Buchholz ist grossartig, und doch: Wenn sein Felix lügt, dann sieht man ihn lügen. Er verzieht das Gesicht, er blickt schelmisch, er lacht, um gewissermassen dem Zuschauer zu signalisieren, dass der Hochstapler Felix Krull jetzt gerade seinem Handwerk nachgeht. Das sieht man gerne, aber meiner Meinung nach ist es eigentlich falsch. Das Handwerk des Hochstaplers besteht schlicht und einfach darin, dass er besonders ehrlich wirkt. Eben deshalb glaubt man ihm ja. Deswegen kann er die Menschen selbst von den aberwitzigsten Dingen überzeugen; weil er gerade im Lügen ganz bei sich, ganz einfach, ganz überzeugend ist. Das eben ist seine Kernkompetenz.
X
Der Film kann zeigen, er muss sogar zeigen, ob er will oder nicht. Was der Film nicht kann, ist – im ursprünglichen Sinn – denken. Alles sonst, was ein Roman vermag, vermag das visuelle Medium ebenfalls; in Gestalt der Netflix-Serie hat der Film sogar ebenso viel Zeit wie ein umfangreiches Buch, um sich zu entwickeln, Nebenhandlungen auszubreiten, andere Schauplätze aufzusuchen. Alles, was ein Mensch im Roman tun kann, kann er auch im Film tun. Ausser eben denken. Das dem Film letztlich wesensfremde Mittel des Voiceovers kann die denkende Stimme eines Romans manchmal simulieren, aber es vermag nichts daran zu ändern, dass wir da nur jemanden sprechen hören, während das Denken sich beim Lesen selbst in unseren Gedanken vollzieht – wenn der Roman denkt, so denken wir selbst mit ihm, so denkt er in uns.
Roman und Film sind die beiden innerlich am engsten verwandten Erzählgattungen, verbunden durch eine flexibel bewegliche Dramaturgie, die sehr viel mehr erlaubt als zum Beispiel die strengen Gesetze des Theaters. Das Drama als Form ist gnaden- und kompromisslos, in ihm geht es um Konflikte, immer und unablässig und nur um sie. Ein Stück duldet keine Entspannung, keinen Schritt zurück, keine Abschweifung; das ist wohl auch der Grund dafür, dass Adaptionen von Stücken seltener gelingen als solche von Romanen. Ebenso sperren sich Romane gegen die Bühne – auch wenn die deutschen Theater seit einigen Jahren hartnäckig darauf bestehen, Romanadaptionen zu zeigen, es hilft nichts, es funktioniert fast nie, und der Grund dafür sind die Gesetze der Gattung. Das beste Theaterstück, erklärt Peter Szondi in seiner Theorie des Dramas, ist jenes, das sich gleichsam ganz von selbst ereignet, das von Anfang an unausweichlich seinem Ende entgegenstrebt – im Idealfall ohne Ortswechsel oder Zeitsprünge, denn diese verraten ja immer die Intervention eines Autors. Das Theaterstück ist im optimalen Fall ganz interventionslos, es strebt danach, reines Ereignis zu sein. «Der Dramatiker», so Szondi, «ist im Drama abwesend. Das Drama wird nicht geschrieben, sondern gesetzt. Die im Drama gesprochenen Worte sind allesamt Entschlüsse, sie werden aus der Situation heraus gesprochen und verharren in ihr; keineswegs dürfen sie als vom Autor herrührend aufgenommen werden.»





























