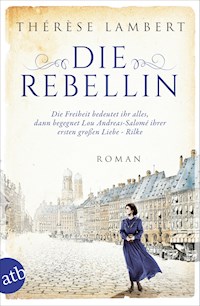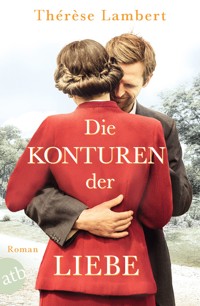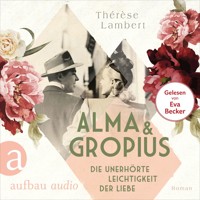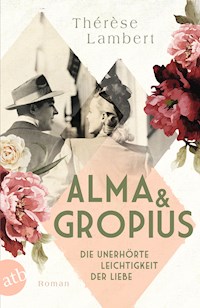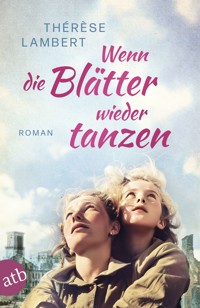
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau und Mutter im Widerstand.
Im Berlin zur Zeit des Nationalsozialismus ist Neinsagen lebensgefährlich. Aber Ruth schreibt es nachts an die Wände der Stadt. Nein. Die junge Frau ist gegen das Regime, versteckt mit ihrer Widerstandsgruppe jüdische Freunde, klaut Lebensmittelmarken, verbreitet Flugblätter – auch das letzte der Weißen Rose. Tochter Karin ist immer an ihrer Seite und wahrt zugleich tapfer die unschuldige Fassade nach außen. Doch als sie zu bröckeln droht, muss Ruth erfahren, was es heißt, nicht nur als Frau im Widerstand zu sein – sondern auch als Mutter ...
Nach einer wahren Begebenheit – die bewegende Geschichte einer unnachgiebigen und mutigen Frau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Ruth arbeitet für ein Berliner Magazin und erlebt den Aufstieg des Nationalsozialismus hautnah mit. Für sie ist schnell klar: Gemeinsam mit ihren Freunden will sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um Menschen vor Verfolgung und Tod zu bewahren. Ruth und ihr Lebensgefährte Leo verstecken jüdische Bekannte bei sich zu Hause. Ein gefährliches Unterfangen, riskieren sie doch täglich nicht nur ihr Leben, sondern auch das von Ruths Tochter Karin. Und dennoch: Kommt ihnen ein Flugblatt in die Hände, tippen sie es Hunderte Male ab und verbreiten die Botschaften in der Stadt. Mit geklauten Stempeln fälschen sie Lebensmittelkarten und Ausweise. Im Widerstand sind sie ein gutes Team, doch ihre Beziehung leidet unter dem Druck, der auf ihnen lastet. Schon bald muss sich Ruth fragen: Wie weit darf sie gehen als Widerstandskämpferin, wenn sie gleichzeitig Mutter ist?
Über Thérèse Lambert
Hinter Thérèse Lambert verbirgt sich die Autorin Ursula Hahnenberg, die in München aufgewachsen ist und mit ihrer Familie in Berlin lebt. Als Schwester von vier Brüdern und spätere Studentin der Forstwissenschaft hat sie früh gelernt, unter Männern ihre Frau zu stehen. Nicht zuletzt deshalb gilt auch beim Schreiben ihre besondere Leidenschaft starken Frauen.
Im Aufbau Taschenbuch liegen bereits ihre Romane »Die Rebellin«, »Alma und Gropius – Die unerhörte Leichtigkeit der Liebe« und »Die Konturen der Liebe« vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Thérèse Lambert
Wenn die Blätter wieder tanzen
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
1. Kapitel — 27. September 1938
2. Kapitel — 27. Oktober 1938
3. Kapitel — 10. November 1938
4. Kapitel — 13. November 1938
5. Kapitel — 22. November 1938
6. Kapitel — 19. Dezember 1938
7. Kapitel — 24. Dezember 1938
8. Kapitel — 16. Januar 1939
9. Kapitel — 24. Februar 1939
10. Kapitel — 6. März 1939
11. Kapitel — 16. März 1939
12. Kapitel — 20. Juni 1939
13. Kapitel — 8. Juli 1939
14. Kapitel — Ende Juli 1939 · Zinnowitz (Usedom)
15. Kapitel — 17. August 1939
16. Kapitel — 1. September 1939
17. Kapitel — 3. September 1939
18. Kapitel — Oktober 1939
19. Kapitel — März 1940
20. Kapitel — Juni 1940
21. Kapitel — Juli 1940
22. Kapitel — 16. Dezember 1940
23. Kapitel — 3. April 1941
24. Kapitel — 19. September 1941
25. Kapitel — Ende Januar 1942
26. Kapitel — 30. April 1942
27. Kapitel — 15. Juni 1942
28. Kapitel — 28. Juni 1942
29. Kapitel — Juli 1942
30. Kapitel — August 1942
31. Kapitel — 11. Oktober 1942
32. Kapitel — Ende Dezember 1942
33. Kapitel — Ende Januar 1943
34. Kapitel — März 1943
35. Kapitel — März 1943
36. Kapitel — Mai 1943
37. Kapitel — Anfang August 1943
38. Kapitel — Mitte August 1943
39. Kapitel — 24. August 1943
40. Kapitel — 30. August 1943
41. Kapitel — 7. September 1943
42. Kapitel — 18. September 1943
43. Kapitel — 14. Oktober 1943
44. Kapitel — 24. November 1943
45. Kapitel — 24. Norvember 1943
46. Kapitel — 13. Januar 1944
47. Kapitel — 4. Februar 1944
48. Kapitel — 07. März 1944
49. Kapitel — 30. März 1944
50. Kapitel — 15. Mai 1944
51. Kapitel — 07. Juni 1944
52. Kapitel — 20. Juni 1944
53. Kapitel — 3. Juli 1944
54. Kapitel — 20. Juli 1944
55. Kapitel — 31. Juli 1944
56. Kapitel — 5. August 1944
57. Kapitel — 29. August 1944
58. Kapitel — 11. September 1944
59. Kapitel — 24. November 1944
60. Kapitel — 19. Dezember 1944
61. Kapitel — 31. Dezember 1944
62. Kapitel — 4. Januar 1945
63. Kapitel — 6. Januar 1945
64. Kapitel — 10. Januar 1945
65. Kapitel — 15. Januar 1945
66. Kapitel — 3. Februar 1945
67. Kapitel — 3. Februar 1945
68. Kapitel — 18. März 1945
69. Kapitel — 22. März 1945
70. Kapitel — 23. März 1945
71. Kapitel — 27. März 1945
72. Kapitel — 4. April 1945
73. Kapitel — 15. April 1945
74. Kapitel — 21. April 1945
75. Kapitel — 27. April 1945
76. Kapitel — 26. Mai 1945
Nachwort
Personenverzeichnis (alphabetisch)
Literatur
Zitate
Quellen
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Zu Hause ist dort, wo man geliebt wird.
(Ruth Andreas Friedrich)
1. Kapitel
27. September 1938
Nur nicht zu laut denken. Ruth bemühte sich um einen gleichmütigen Gesichtsausdruck, während sie sich, eingehakt bei ihrer besten Freundin Susanne Simonis, durch die Menschenmenge auf der Wilhelmstraße schob. Vielleicht zweihundert Leute standen vor der Reichskanzlei, vermutlich um wenigstens einen kurzen Blick auf den ach so geliebten Führer zu erhaschen.
Ruth musste einen Schauder unterdrücken. Eine seltsam verkrampfte Stimmung lag in der Luft, dabei war die spätsommerliche Hitze längst einer lauen Abendstimmung gewichen. Es hätte ein wunderbarer Tagesabschluss sein können, wenn … ja, wenn nicht diese undurchdringliche Anspannung auf den Gesichtern der Menschen gelegen hätte.
Wenn man sich noch hätte sicher fühlen können zwischen den Berlinern.
»Komm«, murmelte Susanne. Sie hatte ein gezwungenes Lächeln aufgesetzt. »Wir haben uns für einen Feierabendschnaps verabredet, wir sind nicht zum Gaffen hier. Ich brauch jetzt was Starkes.«
Das brauchte Ruth auch. Trotzdem … was war wohl der Grund für diesen Auflauf?
Sie steuerten auf den Kaiserhof zu, der schräg gegenüber der Reichskanzlei lag. Das Hotel hatte eine anständige Bar, auch wenn es ein Naziloch war. Aber wenn man heutzutage in Berlin einen Ort ohne Nazis finden wollte, durfte man nicht in eine Bar gehen. Oder überhaupt irgendwohin. Ruth hätte fast laut geseufzt. Restaurants wie das Romanische Café, in dem sie vor 1933 mit Leo lange ausgelassene Nächte verbracht hatte, gab es nicht mehr. Oder besser: Es gab die ausgelassenen Nächte, in denen getanzt, gefeiert, getrunken, geküsst und diskutiert wurde, nicht mehr. Jedenfalls nicht für Menschen, die keine Nazis waren.
Sie ließen sich in eine Ecke der Bar fallen und bestellten einen Martini, der schnell kam; der Barkeeper hatte kaum etwas zu tun.
»Hier ist ja gar nichts los«, bemerkte Susanne prompt.
Ruth sah zum Fenster, hinter dem sich immer noch mehr Menschen versammelten. »Ich nehme an, Herr Hitler wird gleich irgendwas verkünden.« In diesem Moment rumpelte draußen ein Militärfahrzeug vorbei. Ruth reckte den Hals, bis sie Susannes Hand auf ihrer fühlte.
»Lass uns einfach einen trinken und ein bisschen plaudern, ja?«
Ruth ließ die Schultern sinken und seufzte. »Du hast ja recht. Aber informiert zu sein …«
»… ist besser, als überrascht zu werden«, beendete Susanne den Satz. »Ich weiß, das sagst du oft. Und es stimmt. Aber was sollen sie heute schon groß tun? Doch wohl das Gleiche wie gestern und morgen. Erzähl mir lieber, welche Neuigkeiten es in der Redaktion gibt.«
Ruth lächelte. Die Freundin kannte sie einfach zu gut. Sie hatte Susanne vor ein paar Jahren kennengelernt, als sie angefangen hatte, als freie Redakteurin für den Ullstein Verlag zu arbeiten. Kurz darauf waren die Ullstein-Brüder gezwungen worden, ihr Unternehmen zu verkaufen, das nun Deutscher Verlag hieß. Als Kolleginnen hatten Susanne und sie sich sofort gut verstanden und waren Freundinnen geworden. Susanne hatte das Herz auf dem rechten Fleck, und das war in diesen Zeiten wichtiger als je zuvor. Sie hatte auch dafür gesorgt, dass Ruth zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als freie Redakteurin für »Frauenthemen« eine Viertelstelle als Übersetzerin im Verlag bekam – eine wichtige Einnahmequelle für eine alleinerziehende Mutter.
»Ich werde nie verstehen, warum du keine Journalistin mehr sein willst.« Ganz ernst meinte Ruth den Satz nicht, aber sie vermisste den regelmäßigen Austausch über die Arbeit mit Susanne.
»Ich glaube, du verstehst mich sogar sehr gut. Ich bin immer eine politische Journalistin gewesen und werde es bleiben. Wie sollte ich da unter diesen Bedingungen arbeiten?« Susanne sprach schnell und leise, damit niemand sie belauschen konnte.
»Und du bist tatsächlich eine lausige Schreiberin, was Frauenthemen betrifft.« Ruth zwinkerte ihr zu. Sie selbst hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, mit ihrer Arbeit etwas zu erreichen. Menschen zu erreichen. Und sei es über Kochrezepte.
Susanne lachte verhalten. »Das stimmt. Frag Frau Ilse! Ich bin so froh, dass ich das los bin. Auch wenn es manchmal ziemlich langweilig ist, einfach nur einen Haushalt zu führen. Ich hoffe, du weißt eure Freiheit zu schätzen.«
»Freiheit? Eine schöne Freiheit ist das. Erst gestern habe ich gehört, dass eine ganze Fotostrecke in ›Die Dame‹ ersetzt werden musste, weil die Augen des Modells etwas zu schräg standen. Nicht mal ihre blonde Haarpracht konnte das wettmachen.«
Susanne verdrehte die Augen, und Ruth sah sich noch einmal unauffällig um. Einsame Orte waren oft gefährlicher, als man erwartete. Sie hatte es zwar noch nicht selbst erlebt, aber durchaus schon gehört, was mit Menschen passierte, die sich in der Öffentlichkeit abfällig über die Regierung äußerten. Sie verschwanden für Monate im Gefängnis.
»Wie geht es denn unserem Fritz?«
Fritz Kroner war der Hauptschriftleiter einer der Illustrierten, für die Ruth arbeitete. Mit ihm hatten Susanne und Ruth nach der Arbeit manchmal im Romanischen Café gesessen. Früher. In besseren Zeiten.
»Er hält sich tapfer, tut, was er kann. Aber was soll er tun, seine Frau ist schon wieder schwanger.«
Susanne prustete los, versuchte vergeblich, ihr Lachen als Hustenanfall zu tarnen, und winkte dem Barkeeper für zwei weitere Martinis. »Das wievielte ist das? Das fünfte?«
Ruth nickte schmunzelnd. Sie beneidete Fritz nicht; ihr fiel es schwer genug, ein Kind durchzubringen, selbst wenn dessen Vater ihr Unterhalt zahlte.
Als Susanne sich beruhigt und vom Martini genippt hatte, sagte sie: »Ich bin mir sicher, dass man zwischen Fritz’ Zeilen lesen kann, was er wirklich denkt. Er wird sich nicht mit diesen Leuten gemeinmachen.«
Ruth musterte Susanne ernst. »Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er es versucht, so wie ich es auch versuche, weil ich die Hoffnung nicht aufgeben will. Wenn ich mich umschaue, wenn ich lese, was geschrieben wird, dann finde ich es schwierig, zwischen den Zeilen noch irgendwas zu entdecken. Ich weiß ja, es liegt daran, dass wir alle schreiben müssen, was man uns vorgibt. Im Moment bin ich wirklich dankbar, dass ich mich um Beziehungsfragen, um Mode und Kochrezepte kümmern darf. Dabei wird man am wenigstens kontrolliert.« Ruth hatte leise und eindringlich gesprochen, jetzt presste sie die Lippen zusammen. Wenn ihnen nur niemand zugehört hatte! Doch abgesehen vom Barkeeper und einem sehr ineinander vertieften Pärchen in einer anderen Nische war die Bar leer.
Susanne schlug die Augen nieder. »Ich verstehe, was du meinst. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben.«
Ruth ruckte mit dem Kopf, was Susanne als Zustimmung auslegen mochte. Nein, sie würde natürlich nicht aufgeben, auch wenn es ihr oft schwer genug fiel, ihre Artikel so zu schreiben, dass sie genehmigt wurden, ohne dabei ihre Ideale und Überzeugungen zu sehr zu verraten. Sie hätte buchstäblich nicht gewusst, wie sie da noch eine oppositionelle politische Botschaft hineinschmuggeln sollte.
Einen kleinen Moment lang herrschte Stille. Dann fragte Susanne nach Heinrich Mühsam; er war 1933 vom Verlag entlassen worden, weil er Halbjude war.
»Er hält sich wacker – was auch sonst? Er hat sich mit Karin angefreundet, die besonders seine Bibliothek zu schätzen weiß. Da sitzt er nun meistens und schreibt Briefe. Dir ja sicherlich auch.«
»Ja, er schreibt mir, wie wohl allen Leuten, die er gut kennt, wunderbare eloquente Briefe – nur nicht, wie es ihm wirklich geht.«
Ruth setzte ein schiefes Lächeln auf. »Ach, Susanne, du kannst es dir doch denken. Wenn ich ihn besuche, bringe ich ihm eine Flasche Cognac mit, selber kann er sich die vermutlich nicht leisten. Manchmal geht er mit Karin in den Zoo oder ins Kino.«
Es war wirklich rührend, wie sich Mühsam um Ruths Tochter kümmerte. Obwohl sie manchmal den Verdacht hatte, dass er sich eigentlich mehr für die Mutter als für die Tochter interessierte. Doch so nett und belesen er war – und so leid ihr seine Situation auch tat –, als Mann fand sie ihn so gar nicht attraktiv. Keine Konkurrenz für Leo.
Sie plauderten noch eine Weile. Erich Kordt, Susannes Vetter, für den sie ein wenig schwärmte, hatte gerade eine neue Stelle als Büroleiter von Ribbentrop angetreten, dem Außenminister.
»Und hast du ihm jetzt endlich mal gesagt, was du für ihn empfindest?«, fragte Ruth.
Susanne winkte ab. »Das wird nie passieren. Er ist ein großartiger Mensch, aber fürchterlich vergeistigt. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen sollte.«
»Er ist dein Verwandter, ihr habt doch bestimmt ein gewisses Vertrauensverhältnis. So lange, wie ihr euch schon kennt.«
Susanne strich sich die braunen Locken aus dem Gesicht. »Wir kennen uns ewig, genau. Das ist ja gerade das Problem. Wie soll ich denn nach dreißig Jahren Freundschaft plötzlich mit Liebe um die Ecke kommen?«
Ruth überlegte. »Schwierig, geb ich zu. Aber vielleicht ergibt sich mal eine Situation, bei der du feststellen kannst, ob er dich auch mag. Vielleicht könntest du so eine Situation sogar herbeiführen …«
Susanne lachte. »Du bist doch immer noch die beste Liebesberaterin weit und breit. Apropos: Wie läuft es denn mit Leo?«
Ruth stockte. Was sollte sie sagen? Sie legte den Kopf schief. »Ach, du weißt doch, wir sind wie ein altes Ehepaar, fast schon sieben Jahre zusammen, das ist mehr, als ich mit Karins Vater hatte. Leo ist so was wie mein bester Freund. Wenn er nicht so viel unterwegs wäre, wären wir wohl schon längst so was wie ein sehr altes Ehepaar.«
In guten wie in schlechten Zeiten.
Wie um sie an die schlechten Zeiten zu erinnern, rumpelten nun vor dem Gebäude schwere Lastwagen über die Straße und machten eine vertrauliche Unterhaltung unmöglich. Als der Strom der Fahrzeuge auch nach fünf Minuten noch nicht versiegt war, beschlossen Ruth und Susanne, den Abend zu beenden.
Sie bezahlten und traten vor die Tür des Kaiserhofs. Inzwischen war es fast dunkel. Vor der Reichskanzlei waren Wagen, Panzer, Pferde und Soldaten postiert wie für eine Parade. Auch ziviles Publikum fehlte nicht, wahrscheinlich die gleichen Menschen, die sich hier schon vor zwei Stunden die Beine in den Bauch gestanden hatten. Die Luft war noch immer von gespannter Erwartung erfüllt, bestimmt erschien Hitler gleich auf einem der Balkone. Dann würden alle, die hier so eifrig warteten, den rechten Arm zum Hitlergruß heben, und wer es nicht tat, würde sehr schnell von der SS abgeführt werden.
Ruth warf Susanne einen Blick zu, die nickte stumm, und dann drängten sie sich erneut durch die Menge.
Nur weg hier.
2. Kapitel
27. Oktober 1938
Ruth hatte den ganzen Tag zu Hause an einem neuen Artikel gearbeitet und war gerade damit beschäftigt, das Mittagessen zu kochen, als Karin aus der Schule kam. Es gab Suppe – heute nur eine klare Brühe –, dann etwas Fleisch mit Kartoffeln und zum Nachtisch Pudding, den Ruth schon gestern vorbereitet und im Eisschrank aufbewahrt hatte. Wenn sie eines von ihrer geliebten Großmutter Helene gelernt hatte, dann dass gutes Essen eine Gemeinschaft zusammenhält. Und die wichtigste Gemeinschaft in Ruths Leben war nun einmal die Verbindung mit ihrer Tochter. Das gemeinsame Essen mit ihr war zum Ritual geworden. Vielleicht mochte sie ja deswegen ihre Artikel über Kochrezepte so gern, obwohl sie sonst lieber über Kultur und Psychologie schrieb.
Die Wohnung war brandneu und mit allem modernen Komfort ausgestattet – es gab sogar so etwas wie eine Frankfurter Küche, praktische Einbauten mit vielen Schränken –, nur der Eisschrank funktionierte noch wie früher. Zweimal in der Woche wurde ein Eisblock geliefert, der Speisen und Getränke kühl hielt.
Die Wohnung hatte zweieinhalb Zimmer, eines für Karin sowie ein Wohnzimmer mit Balkon; und in dem halben Zimmer standen Ruths Bett und ihre Sachen, wie zum Beispiel die geliebte Reisetruhe ihrer Großmutter.
»Setz dich, mein Schatz. Wie war’s in der Schule?« Ruth musste sich ein Lächeln verkneifen, als sie sich reden hörte wie eine Mutter aus »Das Blatt der Hausfrau«, eine der Illustrierten, für die sie schrieb.
Karin verdrehte die Augen, wie es sich für eine Vierzehnjährige gehörte. Und obwohl Ruth sie eigentlich dafür hätte ermahnen müssen, war sie erleichtert über diese kindliche Reaktion. Dieses Kind war meist viel zu brav.
Nach dem Essen räumten sie zusammen die Küche auf, und Karin ließ sich am Küchentisch nieder, um ihre Hausaufgaben zu erledigen. Ruth setzte sich dazu, sie wollte sich ein paar Notizen für einen neuen Artikel machen. Verfassen würde sie ihn später am Nachmittag oder morgen an ihrem Schreibtisch, der im Arbeitszimmer stand. Das hatte sie sich in Leos Wohnung eine Etage höher in dessen halbem Zimmer eingerichtet.
Für diesen Artikel entwickelte sie ein Kochrezept; die Aufgabe, aus Steckrüben zumindest theoretisch ein wohlschmeckendes Mahl zu zaubern, war nicht ganz einfach. Doch Ruth hatte das Gefühl, es ihren Leserinnen schuldig zu sein, ihnen mit Rat zur Seite zu stehen, gerade in diesen Zeiten, in denen nicht jeder immer genug zu essen hatte. Ihr selbst und Karin ging es nicht schlecht. Otto, Karins Vater, zahlte Ruth monatlich eine kleine Summe, die für Karins Unterhalt bestimmt war. Und Ruth verdiente mittlerweile genug, um sich und Karin angenehm zu versorgen. Natürlich hätte alles noch bequemer sein können, jedoch bekam Leo schon seit 1933 in Deutschland keine Engagements als Dirigent mehr. Er hatte gerade seine Stelle bei den Berliner Philharmonikern angetreten, als sich einige Mitglieder des Ensembles weigerten, weiter mit ihm zu arbeiten. Angeblich habe er im April des gleichen Jahres beim Spielen des Deutschlandlieds in Königsberg unwillig den Taktstock weggelegt, außerdem sei er Ausländer und bevorzuge jüdische Kollegen.
Ruth hatte selten etwas so Dummes gehört, aber da war nichts zu machen gewesen. Leo war – obschon in Moskau geboren – Sohn deutscher Eltern, er hatte lange in Finnland gelebt, seit vielen Jahren war er in Berlin, und auch seine Mutter und seine Schwester lebten hier. Ausländer war er also nicht wirklich. Dass für ihn die Qualität der Musiker mehr zählte als Nationalitäten oder gar so etwas wie rassische Überlegungen – das stimmte natürlich. Zum Glück war nicht mehr passiert, als dass Leo einen »Politisch unzuverlässig«-Stempel neben seinem Namen kassiert hatte, was eben bedeutete, dass er hier keine Engagements mehr bekam. Glücklicherweise konnte er welche im Ausland annehmen. Außerdem gab er Unterricht und übersetzte hin und wieder ein Buch aus dem Russischen, wenn Ruth ihm ein Projekt aus dem Verlag vermitteln konnte. Seit fast vier Wochen war Leo nun bereits unterwegs, und heute würde er nach Hause kommen. Ach, sie vermisste ihn! Ruth schielte zur Küchenuhr, dann konzentrierte sie sich seufzend wieder auf ihre Unterlagen.
Als sie am Abend auf Leos Rückkehr anstießen – er hatte echten Whisky einschmuggeln können und sage und schreibe zwölf ganze Schachteln Camel –, waren sie wie so oft alles andere als allein. Ruth liebte es, in der Gesellschaft vieler Freunde zu sein, aber sie bedauerte es, keine Zeit mit Leo allein zu haben. Susanne war mit Erich gekommen, Günther Brandt, der ehemalige Richter am Landgericht, der seit 1933 nicht mehr arbeiten durfte, war da, natürlich auch Mühsam, außerdem Hans Peters, die Levys, die Hirschbergs, Dr. Jakob, der Zahnarzt, und Dr. Weißmann, ein Rechtsanwalt. Ruths Wohnzimmer platzte aus allen Nähten, aber das fiel gar nicht auf, weil der Zigarettenrauch wie dichter Nebel im Zimmer stand, ein Nebel, dem der süße Duft des Auslands, der Freiheit, beigemischt war. Und wer keine Zigarette in der Hand hielt, der hatte ein Glas Whisky – oder eben beides. Doch Leos wichtigstes Mitbringsel war weder das eine noch das andere. Es waren die Nachrichten, Neuigkeiten, an die in Deutschland nicht zu kommen war, nicht einmal, wenn man in dem Verlag arbeitete, der die wichtigsten Tages- und Wochenzeitungen herausgab.
»Thomas Mann hat ein neues Buch geschrieben, und er ist endgültig ausgewandert in die USA. Und Bruno Walter dirigiert in Frankreich, er feiert einen Erfolg nach dem anderen.«
Ruth konnte die leise Wehmut in Leos Stimme hören, als er von Walter erzählte. Früher einmal, da hatten sie zusammengearbeitet. Das Herz tat ihr weh für ihn, aber sie wusste, dass er es hasste, bemitleidet zu werden.
»Haben die Leute da überhaupt eine Ahnung, was hier vor sich geht? Dass wir wie Gefangene unserer eigenen Regierung sind?«, fragt Susanne.
Leo runzelte die Stirn. »Nein, ich fürchte nicht. Thomas Mann hat angeblich gesagt, wo er ist, ist Deutschland, und das helfe ihm beim Gedanken an alles Schreckliche, das in Deutschland vor sich geht. Aber da hat er natürlich leicht reden, er ist ja Tausende Kilometer weit weg. Georg Bernhard …«
»Das ist der Mann, der das Pariser Tageblatt herausgibt, die Exilzeitung, und der früher die Voß’sche Zeitung geleitet hat«, warf Susanne überflüssigerweise ein. Zwar waren Ruth und sie die einzigen Journalisten im Raum, Georg Bernhard war aber recht bekannt gewesen in Berlin, bevor er 1933 emigriert war.
Ruth zündete sich eine Camel an.
Nach einer kurzen Pause sprach Leo weiter: »Ja, also, bisher war das Tageblatt wohl eine Informationsquelle für die Emigranten, selbst wenn nur hin und wieder Leute wie ich befragt werden konnten – ihr wisst ja, wie vorsichtig man sein muss. Nun scheint sich Bernhard aber mit seinem Herausgeber überworfen zu haben. Mit dem Ergebnis, dass es jetzt zwei Zeitungen gibt, die ähnlich heißen, und niemand genau weiß, ob man noch glauben kann, was drinsteht.«
Der Qualm war nicht so dicht, dass Ruth die betroffenen Gesichter der Freunde nicht hätte erkennen können. »Und unsere Freunde? Du hast dich doch auch mit den Rosenbaums getroffen und einigen anderen.«
Leo sah Ruth direkt an und schüttelte traurig den Kopf. »Es ist, als würden die Leute alles vergessen. Spätestens nach vier Wochen im Ausland können sie nicht mehr nachvollziehen, wie schwierig es ist, hier zu leben. Dass man hier nicht mehr sagen oder schreiben darf, was man will. Dass man aufpassen muss. Selbst wie sie den hier Verbliebenen helfen könnten, interessiert sie nicht, scheint es.«
Ruth seufzte. Als Hitler im Januar 1933 Kanzler geworden war, hatten viele gedacht, dass auf diese fünfte Regierung innerhalb von zwei Jahren bald die sechste folgen werde. Doch unterdessen hatten die Nazis das Dritte Reich ausgerufen, und von einem vierten auch nur laut zu denken, konnte einem das Leben kosten. Es war ein Jammer, dass die ausgewanderten Freunde das so schnell zu vergessen schienen.
»Es sieht so aus, als müssten wir uns selbst helfen«, sagte Ruth besorgt und stieß eine Wolke Zigarettenrauch aus.
3. Kapitel
10. November 1938
Dass etwas Schreckliches passieren würde, das hatte Ruth schon geahnt, als am Nachmittag des 7. November im Verlag die Anweisung eingegangen war, eine Meldung mit dem Titel »Frecher jüdischer Überfall in der deutschen Botschaft in Paris« gleich am nächsten Tag in allen Zeitungen auf der ersten Seite zu publizieren. Früher wäre es nur eine kleine Notiz wert gewesen, wenn in Paris ein Mann einen recht unwichtigen Botschaftsangehörigen verletzte. Doch Ruth war sofort klar, dass Ernst vom Rath die Schusswunde, die ihm der junge Jude Herschel Grynszpan mit einem Revolver zugefügt hatte, nicht überleben würde. Das hätte einfach nicht ins Konzept der Nationalsozialisten gepasst. In den Tagen danach hatte jede noch so kleine Veränderung des Gesundheitszustands vom Raths eine Meldung produziert, und Leo hatte weitsichtig festgestellt, dass dessen Tod so einigen sehr gelegen kommen dürfte.
Als Ruth morgens um sieben aus dem Bett geklingelt wurde und Rechtsanwalt Dr. Weißmann zitternd vor der Tür stand, reagierte sie sofort. »Dr. Weißmann? Kommen Sie rein!«
Noch bevor sie ausgeredet hatte, drängte sich Weißmann an Ruth vorbei in die Wohnung und schlug die Tür hinter sich zu. »Verstecken Sie mich, Ruth, bitte! Sie sind hinter mir her.«
»Was? Wer ist hinter Ihnen her?« Wer sollte denn diesem unbescholtenen, immer korrekten Rechtsanwalt etwas tun?
Weißmann war weiter ins Wohnzimmer gestolpert und sah sich nun hektisch um, als suchte er ein Versteck. Jetzt, da Ruth Gelegenheit hatte, einen genaueren Blick auf ihn zu werfen, wurde ihr plötzlich selbst ganz anders. Sein Mantel war zerrissen, er war überall mit Dreck besudelt und blutete aus einer Wunde über dem Auge.
Er starrte sie an, und Ruth wurde sich bewusst, dass sie nur den Morgenmantel über ihrer Nachtwäsche trug. Sie zog den Mantel mit dem Gürtel zu.
Doch derlei schien ihn gar nicht zu kümmern. »Draußen ist die Hölle losgebrochen, der Teufel persönlich geht um in Berlin! Die Synagogen brennen, die SA marschiert brüllend durch die Straßen, schlägt Scheiben ein und ist auf Menschenjagd. Judenjagd! Wie kann es sein, dass Sie nichts davon wissen?«
Für einen langen Moment war es still, ganz still. So still, wie es nur an einem Herbstmorgen sein kann, wenn der drückende Nebel sowohl das Licht als auch jedes Geräusch verschluckt. Ruth spürte das Blut in ihren Ohren rauschen. Im nächsten Moment hörte sie es. Splitterndes Glas, grölende Männerstimmen von der Bismarckstraße her. Weißmann fuhr zusammen.
»Also ist er tatsächlich gestorben«, murmelte Ruth. Ihr Nackenhaare stellten sich auf.
»Vom Rath? Natürlich ist er gestorben«, erwiderte Weißmann. Er zitterte jetzt noch heftiger.
Ruth rieb sich die Arme, die ein kalter Schauer überlief. Mit einem Mal schien sie kaum noch Luft zu bekommen. »Wir … wir haben befürchtet, dass die Nazis die Situation ausnutzen würden. Aber dass es so schlimm werden würde … Setzen Sie sich doch.« Fahrig wies sie auf einen Sessel. »Ich mache Kaffee.« Ruth flüchtete in die Küche. Das Entsetzen, das bei Weißmanns Bericht in ihr aufgestiegen war, drohte sie fast zu überwältigen. War er hier denn überhaupt sicher? Sie öffnete das Küchenfenster, nahm ein paar Atemzüge von der kühlen Morgenluft. Dann schloss sie das Fenster schnell wieder, überwältigt von der irrationalen Angst, jemand könnte sehen, dass sich Dr. Weißmann bei ihr verbarg.
Als Ruth den Kaffee vorbereitet hatte, steckte Karin blinzelnd den Kopf in die Küche. »Warum bist du denn schon auf? Und warum sitzt Dr. Weißmann im Wohnzimmer und schlottert am ganzen Leib?«
Ruth musterte ihre Tochter besorgt. Mit ihren blonden Locken, den strahlend blauen Augen und dem offenen Gesicht hätte Karin gut auf ein Werbeplakat für den Bund Deutscher Mädel gepasst. Jeder Nazi wäre begeistert gewesen. Dabei war Karin innerlich weit davon entfernt. Sie war viel zu unschuldig für Zeiten wie diese.
Ruth drückte Karin zwei Tassen Kaffee in die Hand und goss in eine davon ein bisschen Milch. »Sei so gut und bring Dr. Weißmann schon mal eine Tasse. Du kannst dich zu uns setzen, bis du in die Schule musst.«
Drüben nahm Ruth, nachdem sie ihm eine Decke angeboten hatte, angespannt neben dem Rechtsanwalt auf dem Sofa Platz und nippte an ihrem Kaffee, während Weißmann wiederholte, wie er spätabends aus dem Theater hatte nach Hause gehen wollen und kaum seinen Augen trauen konnte, als er sah, dass Menschen in der Uniform der SA brandschatzend über den Ku’damm zogen. Und wie er sich plötzlich selbst als Gejagter wiederfand. Wie er nur durch pures Glück entkam und dann vermutlich ein anderer armer Kerl die Schläge einstecken musste, die für ihn vorgesehen waren. Ruth, der das Herz im Halse schlug, spürte, wie mehr und mehr Übelkeit in ihr aufstieg – vor Zorn, vor Abscheu, vor allem zusammen. Sie warf ihrer Tochter einen nervösen Blick zu. Wie nahm sie diesen Bericht auf? Verstand sie, was passiert war? Karin hörte sehr aufmerksam zu, wirkte dabei aber vollkommen ruhig.
Als Karin aufbrechen musste, begleitete Ruth sie an die Wohnungstür, um ihr noch ein paar warnende Worte mit auf den Weg zu geben. Nie zuvor hatte sie sich Sorgen wegen Karins Schulweg gemacht. Aber nun …
Doch Karin sah sie an und sagte: »Ich weiß schon, Mama. Kein Wort zu niemandem und ganz normal verhalten.« Sie verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln.
»Du bist eben meine kluge Tochter. Ich hab dich lieb.« Ruth küsste Karin zum Abschied und drückte sie kurz an sich – was sie morgens sonst nie tat.
Bevor sie zu Weißmann ins Wohnzimmer zurückkehrte, hielt sie noch einen Moment inne, um sich zu sammeln. Rasch überlegte sie, wo sie ihn am besten unterbringen konnte. Die Wohnung war klein. Dennoch, Weißmann könnte sicher eine Nacht, vielleicht auch ein paar Nächte, auf dem Sofa schlafen, ohne dass es jemandem auffiel. Es gab nur ein einziges Zimmer, das so richtig hellhörig war, und das war Karins Kinderzimmer mit dem Balkon. Das sollte Weißmann am besten gar nicht betreten; die Wände mochten in diesen Zeiten Ohren haben.
Sie versuchte, Dr. Weißmann mit einer Tasse Kamillentee und ein wenig Frühstück weiter zu beruhigen, und gönnte auch sich selbst eine Tasse. Sie musste in die Redaktion, wollte ihn aber in diesem Zustand eigentlich nicht allein lassen. Auch Weißmann erklärte sich erst bereit, zu schlafen, als sie Leo aus der oberen Wohnung geholt und zu seiner Bewachung im Wohnzimmer platziert hatte. Außerdem musste Ruth ihm versprechen, seiner Frau Bescheid zu geben, dass er in Sicherheit sei.
In der Zeitung war die Stimmung heute besonders gedrückt. Ruth kannte die meisten Kollegen seit Ewigkeiten, auch die freien Mitarbeiter, wie sie selbst eine war. Sie kannte auch jene, die erst nach 1933 in den Verlag gekommen waren, weil nun in jeder Redaktion und in jedem Verlag parteitreue Redakteure zu arbeiten hatten. Einige, wie Dr. Mühsam, hatten gehen müssen, weil sie als ganz oder halb jüdisch eingestuft worden waren, egal, ob sie gläubig, evangelisch getauft oder unverblümt atheistisch waren. Als Redakteur hatte man einen Ariernachweis vorlegen müssen, um weiterarbeiten zu dürfen. Auch Ruth hatte das getan. Ihr ging es da nicht anders als vielen Kollegen, die eine Familie zu versorgen hatte. Trotzdem waren die wenigsten von ihnen überzeugte Nazis, jedenfalls soweit Ruth wusste. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass heute anscheinend alle den Blickkontakt untereinander vermieden.
Ruth beschloss, bei Fritz Kroner vorbeizuschauen. Kroner hatte sie zur Journalistin ausgebildet, und als Hauptschriftleiter hatte er ein Zimmer für sich allein. Als Ruth die Tür aufdrückte, saß er wie ein Häufchen Elend hinter seinem Schreibtisch. Er sah Ruth an, und sie erkannte in seinen Augen die gleiche Fassungslosigkeit, die sie seit heute Morgen empfand.
»Ruth, komm rein, setz dich.« Kroner nahm seine kalte Pfeife vom Tisch, steckte sie sich in den Mund und kaute sorgenvoll auf dem Mundstück herum.
»Schlimm, oder?«, fragte Ruth mit leiser Stimme.
»Das ist gar kein Ausdruck, Ruth. Man muss sich ja schämen. Brennende Synagogen! Tote und Verletzte, viele entführt und verschleppt. Schaufenster eingeschlagen, diese verfluchte Bande. Und alles wird als spontane Volkswut ausgegeben. So ein Zimt!« Er schob Ruth ein paar Blätter Papier zu, die sie aufnahm und las.
DNB-Korrespondenz prangte ganz oben auf der ersten Seite, das Ganze kam also vom deutschen Nachrichtenbüro, dem zentralen Dienst – ZD –, der diktierte, was heute in der Zeitung zu stehen hatte. Das hieß, dass alle Zeitungen die Artikel drucken mussten, allerdings jeweils in eigenen Worten. Als Hauptschriftleiter trug Kroner die Verantwortung, musste also einerseits dafür sorgen, dass der Artikel gedruckt wurde, andererseits auch für den Inhalt geradestehen. Und er musste die Meinung, die darin vertreten wurde, Kollegen und Lesern gegenüber als seine eigene ausgeben.
»Antijüdische Aktionen in Berlin und dem Reich«, las Ruth. »Nachdem bekannt geworden war, dass der deutsche Diplomat Pg. vom Rath durch einen feigen jüdischen Mörder getötet wurde, haben im ganzen Reich spontane judenfeindliche Kundgebungen stattgefunden. Die tiefe Empörung des deutschen Volks über diese schändliche Tat machte sich in starken antijüdischen Aktionen Luft. An vielen Stellen Berlins wurden Schaufensterscheiben von jüdischen Geschäften eingeschlagen und die Schaukästen demoliert. Als die jüdischen Ladenbesitzer die Frechheit besaßen, ihre arischen Angestellten zu zwingen, die Glasscherben mit den bloßen Händen aufzusammeln, wurde leidenschaftlicher Protest von Passanten deutlich. In vielen Synagogen, den Stätten, in denen staat- und volksfeindliche Lehren des Talmud und des Schulchan Aruch verbreitet werden, wurde Feuer gelegt, das die Inneneinrichtung zerstörte. In der Synagoge am Wilhelmsplatz sollen Waffen gefunden worden sein. Die jüdischen Tempel in Eberswalde, Cottbus und Brandenburg sind abgebrannt.«
Ruths Mund war trocken, als sie das Blatt umdrehte, um auch noch den Rest zu lesen. Die Synagoge in Wilmersdorf brannte, in Nürnberg hatte es Demonstrationen gegeben, genauso wie in vielen anderen Städten: Essen, Düsseldorf, Krefeld, Leipzig … die Liste war endlos. Empörung, Feuer, Scherben. Die Worte wiederholten sich wieder und wieder in der gleichen Reihenfolge. In Ruths Magen rumorte es. Der Krieg gegen Jüdinnen und Juden hatte endgültig begonnen.
Auf dem Weg zurück zu ihrem Platz begegnete Ruth ihrem Chef vom Dienst, der eigentlich für seine nazistischen Ansichten bekannt war. Dennoch glaubte Ruth, ihn vor sich hin murmeln zu hören: »Antisemitismus – gut; Boykott der Juden – gut; aber doch nicht so …«
Ruth fragte sich unwillkürlich, was er sich wohl vorgestellt hatte, wie viel Wut und Gewalt gegenüber Juden noch angemessen waren und wo genau er die Grenze gezogen hätte. Aber natürlich behielt sie diesen Gedanken für sich.
Später, als sie ihre Arbeit an der Rezepteseite unterbrach und sich einen Kaffee holte, traf sie auf Meyer, der offenbar unerhört gute Laune hatte.
»Endlich zeigt es dem Pack mal jemand. Das war lang überfällig.« Er hielt Ruth eine Packung Pralinen hin, als hätte er etwas zu feiern.
Ruth schüttelte den Kopf. Dann sagte sie, wie einem spontanen Einfall folgend: »Ist es nicht merkwürdig, dass im ganzen Reich die Leute gleichzeitig auf die Idee gekommen sind, es denen mal so richtig zu zeigen?« Kaum waren die Worte heraus, biss sie sich auf die Lippe; hoffentlich war sie nicht zu weit gegangen.
Meyer starrte sie perplex an, dann verzog er das Gesicht. »Ach, was Sie wieder haben. Der Führer wird schon wissen …«
»Das ist es ja gerade, der Führer weiß genau, was er tut.« Damit ließ Ruth den Mann stehen.
Als sie in ihr Zimmer zurückkehrte, fuhr dort eine kleine Ansammlung von Menschen auseinander, in deren Mitte Susanne stand. Offenbar hatte sie die Neuigkeiten zum Anlass für einen Besuch genommen. Als die Kolleginnen erkannten, dass es nur Ruth war, schienen sie kollektiv aufzuatmen.
»Kannst du nicht anklopfen?«, fragte Susanne, halb im Scherz.
Ruth verdrehte die Augen, und Susanne fuhr fort: »Komm her, ich kann nicht so laut sprechen. Ich habe gerade erzählt, dass sie den Sohn unserer Wirtin um zwei Uhr nachts aus dem Bett geholt haben. Befehl vom SA-Sturm: Sofort antreten. Also war das mit den Anschlägen und so weiter natürlich die SA.«
»Wer denn sonst?«, fragte Ruth. Resignation legte sich über sie wie ein Bleimantel.
»Ich hab mit eigenen Augen gesehen, wie sie in voller Montur die Kleiststraße entlangmarschiert sind«, sagte eine Kollegin, in deren Miene sich eine Mischung aus Abscheu und Fassungslosigkeit spiegelte. »Das war definitiv gesteuert und lang vorbereitet.«
»Und vor dem Aufstehen fällt es schwer, Kirchen anzuzünden«, ergänzte Susanne grimmig. »Ich bin gekommen, um dich zum Essen abzuholen, Ruth. Gehen wir ein bisschen an die frische Luft.«
Ein paar Minuten später waren Ruth und Susanne unterwegs, sie fuhren in Richtung Innenstadt. Dort stiegen sie aus der Tram und liefen zu Fuß durch die Straßen, an zerstörten Schaufenstern vorbei, immer weiter, bis sie am Hausvogteiplatz seltsame Geräusche bemerkten. Ein dumpfes Klirren, wieder und wieder. Sie warfen einander einen kurzen Blick zu, ehe sie darauf zueilten. Ruth beschlich eine dunkle Ahnung – von der sie sich wünschte, dass sie nicht wahr würde.
In der Mohrenstraße vor den Schaufenstern eines Bekleidungsgeschäfts hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Ruth und Susanne drängelten sich nach vorne durch. Fünf Burschen in verknautschten Kleidern und Schirmmützen standen vor dem Laden, jeder eine schwere Eisenstange in der Hand, die Gesichter vor Anstrengung oder Anspannung verzogen. Offenbar sollten die Burschen einen Teil des sogenannten Volkszorns darstellen, auch wenn sie schlicht wie ein verkleideter Parteitrupp wirkten. Sie schlugen mit großem Bedacht die Scheiben der Fenster klein und kleiner, selbst die Reste in den Rahmen ließen sie nicht stehen. Die Scherben auf dem Boden zertraten sie noch mit ihren schweren Stiefeln. Schließlich besah sich einer der Burschen das Werk, nickte ohne jede Gefühlsregung und rief: »Fertig!«
Der Rest der Gruppe hielt inne, formierte sich zu einem Trupp, und dann marschierten sie im Stechschritt ein paar Meter weiter zum nächsten jüdischen Geschäft, wo der Anführer brüllte: »Stillgestanden!« Kurz darauf setzten sie ihr Zerstörungswerk fort.
Ruth hatte ja gewusst, was sie sehen würden, trotzdem konnte sie schier nicht glauben, was hier geschah. Wieso in aller Welt durften diese Burschen vollkommen unbehelligt von der Polizei, aber auch von diesen ganz normalen Menschen, den Schaulustigen ringsumher, so ein Verbrechen begehen? Die Frage schnürte ihr die Kehle zu.
»Das ist also dieser außer Rand und Band geratene Volkszorn«, raunte Susanne.
Ruth war der Appetit vergangen. Sie zog Susanne am Ärmel weg aus der Menschenmenge, weg von diesem Ort. Heißer Zorn, vermischt mit brennender Scham, wütete in ihrem Inneren.
»Wir müssten uns selber anspucken oder wenigstens im Boden versinken, weil wir nichts unternehmen«, fauchte Ruth, sobald sie außer Hörweite waren.
»Das wäre das Mindeste«, antwortete Susanne. »Aber was nützt es, wenn wir dagegen protestieren, im nächsten Moment verhaftet werden und dann in aller Stille einen Kopf kürzer gemacht werden?«
Auf dem Heimweg dachte Ruth über Susannes Worte nach. Sie hatte natürlich recht. Sie konnten nichts oder nur wenig tun. Märtyrer starben für ihre Überzeugung – und waren nur deshalb imstande, etwas zu bewirken, weil man über sie und ihren Tod sprach. Hätten Susanne und sie sich gegen diesen Trupp gestellt, sie wären vermutlich einfach verprügelt oder sogar verhaftet worden, und niemand, abgesehen von ihnen selbst, hätte darüber ein Wort verloren. Dafür zu sorgen, dass sich die Leute für irgendetwas interessierten oder gar einsetzten, war auch ohne Zensur schon schwer genug. Mit den drückenden Auflagen hingegen war es geradezu unmöglich, sich kritisch über Hitlers Regime zu äußern, außer hinter vorgehaltener Hand zu sehr guten Freunden.
Trotzdem, irgendetwas musste man doch tun! Das alles konnte doch nicht einfach passieren, ohne dass irgendjemand etwas dagegen unternahm!
Zu Hause bei Ruth saßen mehr von ihren Freunden, als sie erwartet hatte. Dr. Weißmann war natürlich immer noch da, doch außerdem auch Dr. Levy und Jochen Cohn. Alle drei hatten es sich in Ruths Wohnzimmer bequem gemacht und spielten Karten, auch wenn ihre angespannten Gesichter dem scheinbar friedlichen Bild widersprachen. Karin hockte in der Küche und machte ihre Hausaufgaben.
»Guten Abend, die Herren.« Ruth bemühte sich, möglichst gelassen zu klingen. Sie verkniff sich jede Frage, es lag auf der Hand, was die Männer hergeführt hatte. Und obwohl sie sich eben noch so ohnmächtig gefühlt hatte, als sie das Zerstörungswerk der Nazis hatte mitansehen müssen, fühlte sie jetzt tatsächlich ein klein wenig Trotz und Stolz in sich aufkeimen. Sie konnte doch etwas tun. Sie konnte ihren Freunden helfen.
»Entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie so überfallen …«
Ruth winkte freundlich ab. »Wo ist denn Leo?«
»Der ist losgefahren, um nach Dr. Hirschberg zu schauen. Er geht nicht ans Telefon, und wir befürchten, dass man ihn … dass man ihn abgeholt hat.«
»Abgeholt?«, fragte Ruth verwirrt. Sie war sich nicht sicher, ob sie die Antwort wirklich hören wollte. Das konnte nichts Gutes sein. Und was war mit Leo, war er ebenfalls in Gefahr?
Dr. Levy wirkte gequält, als er antwortete: »Abgeholt und abtransportiert. Direkt in den Judenhimmel, Eilpost in preußischen Lastwagen. Wer sich nicht rechtzeitig verstecken konnte, braucht sich um sein Testament keine Sorgen mehr zu machen.«
Ruth starrte ihn entgeistert an. So schlimm konnte es doch nicht stehen, das wäre einfach zu grauenhaft!
Kurz darauf stand sie wie betäubt in der Küche und wälzte den Gedanke immer wieder hin und her, während sie das Abendessen vorbereitete. Sie schabte gerade Möhren, als das Telefon klingelte. Franz Wolfheim. Auch er war auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf, und Ruth lud ihn sofort zu sich ein. Sie legte zusätzliche Möhren bereit und öffnete fünf Minuten später die Tür.
Dann überlegten sie alle zusammen, wer wo schlafen sollte. Zwei auf ihrer Couch, zwei auf der von Leo, einer im Sessel, was zugegebenermaßen nicht bequem, aber vermutlich lebensrettend war, wenn Levy wirklich recht hatte. Dr. Levy erklärte, dass er auch auf dem Boden schlafen konnte. Ruth schätzte, dass das mit vielen Kissen und zwei Teppichen gehen müsste, und stimmte zu. Tatsächlich schienen diese praktischen Überlegungen ihr etwas gegen den ersten Schock zu helfen.
Als sie Geräusche an der Wohnungstür hörte, stockte für einen Moment ihr Herz, doch es war Leo. Ruth eilte auf ihn zu, drückte ihn an sich und hätte ihn am liebsten gar nicht mehr losgelassen. Da erst wurde ihr bewusst, wie viel Angst sie in den letzten Stunden um ihn gehabt hatte. »Wo ist Hirschberg?«, fragte sie und spähte hinter ihn ins Treppenhaus.
Leo schüttelte traurig den Kopf, schloss die Tür und nahm den Hut ab. »Ich war zu spät. Sie waren vor mir da. Sperling haben sie auch und Peter Tarnowsky, Ernst Angel und den kleinen Schwarz. Alle weg. Ich habe beobachtet, wie drei Männer der SS Hirschberg aus seiner Wohnung holten und auf einen Lastwagen scheuchten. Da standen schon siebzehn andere, die ich allerdings nicht kannte. Und bei den anderen haben mir ihre Frauen und Kinder erzählt, dass sie abgeholt worden sind.« Er stieß ein erschöpftes Keuchen aus. »Ich brauch einen Schnaps.«
Es war mucksmäuschenstill im Raum, als sie eintraten. Leo war offenbar nicht der Einzige, der angesichts seiner Erlebnisse einen Schnaps brauchte. Ruth brachte, was sie in ihrer Küche fand, Karin servierte kurz darauf die Suppe. Während des Essens und bei einer weiteren Runde Schnaps holte Leo eine Zeitung aus der Tasche. Dann las er vor: »Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei hat folgende Anordnung erlassen: Personen, die nach den Nürnberger Gesetzen als Juden gelten, ist jeglicher Waffenbesitz verboten. Zuwiderhandelnde werden in Konzentrationslager überführt und für die Dauer von 20 Jahren in Schutzhaft genommen.«
Ruth folgte seinem Blick zu Dr. Levy. War der etwa bewaffnet?
Doch Dr. Weißmann sagte in dem Moment: »Kommt doch gar nicht drauf an. Wenn man uns hier erwischt, ist es sowieso vorbei.«
Ruth schluckte. Was geschah in diesen Lagern? Und was würde man mit ihr, Leo und Karin tun, falls man sie dabei erwischte, wie sie ihren Freunden halfen?
4. Kapitel
13. November 1938
Ruth hatte beschlossen, heute zu Hause zu arbeiten. Ihr Bedürfnis, die Untergetauchten zu beschützen, war einfach zu groß – obwohl ihr klar war, dass sie gegen eine Horde SS-Leute an der Wohnungstür nichts würde ausrichten können. Der Gedanke saß wie ein unangenehmer Kloß in ihrem Magen und verursachte eine andauernde leichte Übelkeit. Die Männer rauchten und spielten Karten im Wohnzimmer; dabei sprachen sie über alles Mögliche … nur nicht über Politik.
Als Karin von der Schule zurück war, ging Ruth aus.
Sie hängte sich einen Einkaufskorb an den Arm und steckte ihr Portemonnaie ein. Vor dem Haus lenkte sie ihre Schritte nach rechts durch den Hünensteig am Friedhof entlang in Richtung Munsterdamm, um einen kleinen Markt zu erreichen, den sie in den letzten Tagen nicht besucht hatte. Es war wichtig, abzuwechseln, damit nicht auffiel, wie viel Fleisch und Gemüse sie täglich einkaufte. Danach beeilte sie sich, um Frau Levy wie verabredet in einer stillen Seitenstraße nicht weit von ihrer Wohnung zu treffen.
Auch bei diesem Treffen erschrak sie, als sie Frau Levy sah. Das Entsetzen darüber, ihren Mann in so großer Gefahr zu wissen, hatte sich buchstäblich in ihr Gesicht gegraben. Ruth hätte sie am liebsten in den Arm genommen. »Wie geht es Ihnen?«, fragte sie.
Frau Levy starrte sie mit Verzweiflung in den Augen an. »Wie soll es mir gehen? Ich werde erst wieder schlafen, wenn mein Mann in Sicherheit ist und wir wieder zusammen sind.« Ihre Augen wurden feucht, und sie legte Ruth eine Hand auf den Arm. »Wie geht es ihm? Isst er genug?«
Ruth war erleichtert, dass sie die Frau wenigstens darüber beruhigen konnte. »Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Für sein leibliches Wohl ist gesorgt, nur vermisst er Sie und lässt Sie grüßen.«
Frau Levy verzog den Mund im Versuch zu lächeln. Dann drückte sie Ruth ein in Papier eingeschlagenes Paket in die Hand. »Geben Sie ihm das, bitte. Es ist frische Wäsche, mehr kann ich ihm nicht – « Sie ließ den Kopf hängen.
Ruth zerriss es fast das Herz. »Es …«, sie zögerte, »es wird bestimmt alles gut. Vielleicht kann er in ein paar Tagen schon zu Ihnen zurück.«
Frau Levy musterte sie zweifelnd, dann nickte sie kurz. »Gott gebe, dass Sie recht behalten. Ich danke Ihnen.« Damit wandte sie sich um und huschte davon.
Kaum war sie wieder zu Hause, klingelte das Telefon. Ruth lief zum Apparat im Flur und nahm ab. Die Telefonverbindung war einer der Vorzüge, die das Leben in diesem Neubau aus den 20er Jahren mit sich brachte. Die meisten ihrer Freunde hatten Telefon, wenn nicht zu Hause, dann doch auf der Arbeit.