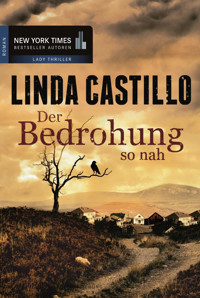9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Sie leben wie vor hundert Jahren. Sie sind gottesfürchtig und rechtschaffen. Doch auch sie trifft der Hass. Der dritte Band der Bestseller-Serie über die Amisch-Gemeinde in Painters Mill Die Eltern waren rechtschaffene Leute, gottesfürchtig und in der Amisch-Gemeinde von Painters Mill sehr angesehen. Doch nun liegen sie tot in der Güllegrube. Schlimmer noch: Der Vater, Solomon Slabaugh, wurde ermordet. Warum wollte der Mörder die Familie zerstören und die vier Kinder zu Waisen machen? Oder stehen diese Morde in einem Zusammenhang mit den Tätlichkeiten gegen Amische, die in letzter Zeit immer häufiger vorgekommen sind? Für Polizeichefin Kate Burkholder hat dieser Fall höchste Priorität und gemeinsam mit ihrem Freund John Tomasetti kommt sie einem dunklen Geheimnis auf die Spur, das die Idylle der kleinen Amisch-Gemeinde in Painters Mill für immer zerstören wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Linda Castillo
Wenn die Nacht verstummt
Thriller
Über dieses Buch
Die Eltern waren rechtschaffene Leute, gottesfürchtig und in der Amisch-Gemeinde von Painters Mill sehr angesehen. Doch nun treiben sie tot in der Güllegrube. Schlimmer noch: Der Vater, Solomon Slabaugh, wurde ermordet. Warum wollte der Mörder die Familie zerstören und die vier Kinder zu Waisen machen? Oder stehen diese Morde im Zusammenhang mit den Hassdelikten gegen Amische, die in letzter Zeit immer häufiger vorgekommen sind? Für Polizeichefin Kate Burkholder hat dieser Fall höchste Priorität und gemeinsam mit ihrem Freund John Tomasetti kommt sie einem dunklen Geheimnis auf die Spur, das die Idylle der kleinen Amisch-Gemeinde in Painters Mill für immer zerstören wird.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie sich der Schriftstellerei zuwandte. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind nicht nur ein internationaler Erfolg, die ersten beiden Bände ›Die Zahlen der Toten‹ und ›Blutige Stille‹ standen auch wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in Texas.Besuchen Sie auch die Website von Linda Castillo: www.lindacastillo.com
Inhalt
[Widmung]
Dies sind
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Dank
Dieses Buch ist meiner Familie gewidmet: Meinem Mann Ernest, der auch im wirklichen Leben mein Held ist, sowie Debbie und Jack Sargent als Dank für die vielen schönen Zeiten. Ich liebe euch alle.
Dies sind
Drei stille Dinge:
Der fallende Schnee … die Stunde
Vor Sonnenaufgang … der Mund eines
Gerade Verstorbenen.
Triade, von Adelaide Crapsey
Prolog
Die Hunde würden ein Problem sein.
Letzte Woche war er zweimal hier vorbeigefahren, ohne Licht und mit offenem Fenster, beobachtend, lauschend – planend. Von der Straße aus hatte er sie bellen hören und das obere Ende des Maschendrahtzauns um ihren Zwinger gesehen. Verdammte Beagle, ein ganzer Sack voll heruntergekommener bellender Köter. Doch alte Weiber sammelten nun mal verwahrloste Tiere. Sie hauste ja selber wie ein Schwein. Wenn die glaubte, die Hunde könnten sie von ihrem Vorhaben abhalten, hatte sie sich getäuscht.
Und zwar gründlich.
Der Wind war in der letzten Stunde stärker geworden. Er rüttelte an den Bäumen und würde alle anderen Geräusche übertönen. Die Kälte machte ihm nichts aus, und vielleicht würde es sogar regnen oder schneien. Das gäbe zwar eine Sauerei wegen des Matsches, aber der war wiederum gut, wenn man nicht erwischt werden wollte.
Die Scheinwerfer hatte er schon vor einer Meile ausgemacht, jetzt drehte er das Fenster runter und fuhr ein letztes Mal langsam an der Farm vorbei. Kein Licht im Haus, die Hunde still und der Mond eine verschwommene Kugel hinter dichten Wolken, ein weiteres Plus für ihr Vorhaben. Er wusste, was zu tun war, kannte die Örtlichkeiten und konnte zur Not mit geschlossenen Augen agieren.
Mit Blick zum Beifahrersitz nickte er. »Die Party kann losgehen.«
Er parkte den Pick-up in der Kurve eines Feldwegs, einhundert Meter von der Einmündung in die Schotterstraße entfernt. Die Innenbeleuchtung war mit Isolierband abgeklebt, damit sie beim Öffnen der Tür keinen Lichtschein warf. Sie stiegen aus, grauweiße Atemwölkchen vor dem Mund. Um sie herum herrschte winterliche Stille. Äste knackten im Wind, vom Bach drang der Schrei einer Eule herauf; die trockenen Stängel des abgeernteten Maisfelds tuschelten wie ungehorsame Kinder.
Neben der Beifahrertür zog er die Winterstiefel aus und stieg in kniehohe Gummistiefel. Die würde er heute Nacht brauchen, und nicht nur des Matsches wegen.
Als Nächstes legte er die lederne Scheide wie einen Pistolengürtel um die Hüfte. Das Bowie-Messer auf dem Rücksitz schimmerte eisblau. Es war aus Deutschland – die besten auf dem Markt –, hatte eine fünfzehn Zentimeter lange dicke Klinge und einen absolut rutschfesten epoxidbeschichteten Ledergriff. Das imponierte ihm besonders. Wegen des schmalen Handschutzes konnte man nicht allzu oft zustechen, aber das Messer war insgesamt so schwer, dass wenige Stiche reichten, um eine Menge Schaden anzurichten. Er hatte das gute Stück vor vier Jahren bestellt und einen Schleifstein gratis dazu bekommen.
Als er das Messer vom Rücksitz nahm, verspürte er einen Kitzel im ganzen Körper. Wie angenehm die Waffe in der Hand lag, tödlich und schön, ein wahres Kunstwerk in den Augen eines Kenners. Er schob sie in die Lederscheide und schloss die Tür.
Sie durchquerten den Wassergraben und gingen über das Maisfeld zu dem Maschendrahtzaun südlich des Hofes. Während die Nylonhosen zischend aneinander rieben, waren ihre Gummistiefel auf dem kalten, feuchten Grund nahezu lautlos. Zwanzig Meter von den Pferchen entfernt hörte er die Tiere umherlaufen. Sie erreichten den Zaun.
Als sie sich zwischen den Stahlstreben des Tores hindurchduckten, schossen ein Dutzend Schafe davon. Von Schweinen mal abgesehen, war alles Schlachtvieh blöde, und Schafe führten die Liste an – hirnlose Herdentiere, genau wie ihre menschlichen Gegenstücke. Dämlich, vertrauensvoll und schwach ließen sie sich zur Schlachtbank führen. Aber er nicht. Er wusste, wie der Hase lief, und hatte es satt, immer alles zu schlucken. Es war Zeit, sich zur Wehr zu setzen.
Inzwischen hatten sich seine Augen an die schwarze Dunkelheit gewöhnt. Die aufgescheuchten Schafe versuchten, sich unter den Rest der Herde zu mischen, um der Bedrohung zu entgehen, doch auch in der Menge würde es heute Nacht keine Sicherheit geben.
Sein Partner stand auf der gegenüberliegenden Seite des Pferches, wählte gerade sein Opfer aus und stürzte sich auf es. Die Schafe drumherum stoben hufeknallend davon. Ein Messer blitzte auf, und er hörte den erstickten Schrei des todgeweihten Tieres, sah schwarzes Blut spritzen. Die alte Hexe würde morgen früh eine böse Überraschung erleben.
Den Ledergriff rau und angenehm in der Hand, fiel sein Blick auf ein fettes Mutterschaf in der Ecke. Sofort musste er an das alte, stinkende Weib denken. Menschlicher Abschaum. Mit ein paar Sätzen war er bei dem Schaf, schlang ihm den Arm um den Hals und riss es an sich. Das blökende Tier fing heftig an zu strampeln und versuchte wegzulaufen. Fluchend packte er das Fell und machte kurzen Prozess. Ein einziger Schnitt, und feuchtwarme Flüssigkeit überzog seine Hand, befleckte den Ledergriff. Das Todesröcheln des Schafes klang wie knirschender Schotter, es zuckte und wurde schlaff.
Gerechtes Töten.
Er ließ das Schaf fallen. Jetzt bellten die Hunde. Das Haus war zwar immer noch dunkel, aber bestimmt nicht mehr lange. Zeit genug für ein zweites.
Er sah sich um. In der Ecke stand ein weiteres Mutterschaf, blickte wie betäubt. Er ging auf das Tier zu, und als es versuchte, an ihm vorbeizuschießen, versenkte er das Messer kraftvoll in seinem Rücken. Ein Knochen knackte, und das Schaf sank zu Boden.
Den Rest erledigte er automatisch, ohne zu denken. Er packte das Schaf am Ohr, riss den Kopf nach hinten und schnitt ihm die Kehle durch. Warmes Blut spritzte auf seine Hand, seine Kleider – den Teil hatte er noch nie gemocht …
»Sie ist wach«, rief sein Partner. »Lass uns abhauen.«
Er drehte sich um, sah gelbes Licht durch die Bäume schimmern. Die Hunde im Zwinger spielten verrückt. »Verdammte Köter.«
Sie liefen los, der matschige Pferchboden wie Saugnäpfe an den Stiefeln. Er duckte sich zwischen den Torstreben durch und setzte zum Spurt an, die Arme angewinkelt, der Körper adrenalingepeitscht.
Sie erreichten den Pick-up, rissen die Türen auf und kletterten rein.
»Wie viele hast du erwischt?«, fragte er.
»Zwei.« Sein Mitfahrer zog japsend die Kappe vom Kopf. »Und du?«
»Zwei.« Die Erinnerung ließ ihn lächeln. »Dreckiges amisches Miststück.«
1.Kapitel
Um Mitternacht begann es zu regnen. Kurz darauf riss der einsetzende Wind die letzten Blätter von den Ahornbäumen und Platanen und fegte sie wie kopflose Krebse über die Main Street. In nur einer Stunde war die Temperatur um fünf Grad gefallen, ein Vorbote der Kaltfront aus dem Norden. Morgen früh würde es schneien.
»Scheißwetter.« Roland »Pickles« Shumaker schwang seinen vierundsiebzig Jahre alten Körper in den Streifenwagen und zog etwas zu heftig die Tür zu. Wie ein Anfänger hatte er sich die Nachtschicht aufs Auge drücken lassen, dabei wurde er auch nicht jünger. Aber der verfluchte Skidmore hatte sich krank gemeldet, und die Chefin hatte ihn gebeten, für seinen Kollegen einzuspringen. In dem Moment war die Vorstellung, um vier Uhr morgens in Painters Mill rumzufahren, noch ganz nett gewesen, doch jetzt zweifelte er an seinem Verstand.
Früher war das anders gewesen, da hatte er die Nachtschicht geliebt. Denn wenn es dunkel war, kamen die Unruhestifter aus ihren Löchern gekrochen wie Vampire auf der Suche nach Blut. Fünfzig Jahre lang hatte er auf den nicht ganz so gefährlichen Straßen dieser Stadt patrouilliert, wobei sein Polizistenherz stets hoffte, dass irgendein Depp wenigstens ein bisschen das Gesetz übertrat und er aktiv werden konnte.
Doch in letzter Zeit brachte er kaum noch eine Acht-Stunden-Schicht hinter sich, ohne von seinem Körper daran erinnert zu werden, dass er nicht mehr vierundzwanzig war. Entweder schmerzte der Rücken, der Nacken, oder die verdammten Beine taten weh. Herr im Himmel, alt werden war ein Fluch.
Beim Blick in den Spiegel starrte ihm ein schrumpliger Mann mit blödem Gesichtsausdruck entgegen, und jedes Mal dachte er: Wie zum Teufel ist das denn passiert? Er hatte nicht die leiseste Ahnung. Nur in einem war er sich sicher, nämlich dass die Zeit ein hinterlistiger Mistkerl war.
Er bog gerade in die Dogleg Road ab, als das Funkgerät knisternd zum Leben erwachte. »Pickles, bist du da?«
Es war Mona Kurtz, die nachts in der Telefonzentrale arbeitete. Mona war eine quirlige junge Frau mit roten Ringellocken. Sie trug Kleider, die der Chefin bestimmt Albträume bereiteten, und hatte das Temperament eines überdrehten Cola-Freaks. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wollte sie Polizistin werden. Pickles hatte noch nie eine Polizistin mit schwarzen Strümpfen und Stöckelschuhen gesehen – höchstens vielleicht als verdeckte Ermittlerin. Er bezweifelte, dass Mona für die Polizeiarbeit geschaffen war, sie schien ihm zu jung und zu wild und zu sehr mit dem Kopf in den Wolken. Er hatte sowieso eine eigene Meinung, was Polizistinnen betraf, doch die war nicht gerade populär, und so hielt er lieber den Mund.
Für die Chefin zu arbeiten war natürlich kein Problem. Zwar hatte er anfangs seine Zweifel gehabt – eine Frau und noch dazu eine ehemalige Amische –, doch über die letzten drei Jahre hatte Kate Burkholder sich als verdammt fähig erwiesen. Sein Respekt für sie hatte allerdings wenig dazu beigetragen, an seiner Meinung über Frauen im Polizeidienst zu rütteln.
Er nahm das Funkgerät. »Wo zum Teufel soll ich denn sonst sein?«, knurrte er.
»Skid ist dir echt was schuldig, wenn er zurückkommt.«
»Da hast du verdammt recht. Der Hurensohn lässt sich wahrscheinlich gerade volllaufen.«
In den letzten beiden Nächten hatten Mona und er über Funk Smalltalk betrieben, hauptsächlich um die Monotonie des Polizeialltags in einer Kleinstadt zu durchbrechen. Heute war sie jedoch ziemlich wortkarg, woraus Pickles schloss, dass sie irgendetwas auf dem Herzen hatte. Weil sie bestimmt bald damit rausrücken würde, wartete er.
»Ich hab mit der Chefin geredet«, sagte sie kurz darauf.
Pickles verzog das Gesicht. Mona tat ihm leid, denn die Chefin würde ihr niemals eine volle Stelle als Polizistin geben. »Was hat sie gesagt?«
»Sie denkt drüber nach.«
»Immerhin.«
»Ich glaube, sie mag mich nicht.«
»Ach komm, natürlich mag sie dich.«
»Ich stecke jetzt schon drei Jahre in der Telefonzentrale fest.«
»Ist ’ne gute Erfahrung.«
»Sie holt bestimmt jemanden von einer anderen Dienststelle her.«
Das glaubte Pickles auch, sagte aber nichts. Man konnte nie wissen, wie eine Frau auf die Wahrheit reagierte. Die Nacht würde lang genug werden, auch ohne dass Mona sauer auf ihn war. »Halt durch, Kleine, es wird schon klappen.«
Er hörte ein Piepen am anderen Ende der Leitung.
»Gerade kommt ein Notruf rein«, sagte sie und brach die Verbindung ab.
Pickles seufzte erleichtert und stellte das Funkgerät aus. Der Anruf würde Mona hoffentlich eine Weile beschäftigen – und ihn aus dem Spiel lassen. Als er jung war, hatte er immer geglaubt, die Frauen mit den Jahren besser zu verstehen, was nur wieder zeigte, wie sehr sich ein Mann irren konnte: Das weibliche Geschlecht war ihm ein größeres Rätsel denn je. In neunzig Prozent aller Fälle verstand er nicht mal seine eigene Frau, und das nach dreißig Jahren Ehe.
Schneeregen klatschte auf die Windschutzscheibe, und er drehte die Scheibenwischer eine Stufe höher. Sein rechtes Bein war eingeschlafen, er wollte eine Zigarette, und sein Hintern tat vom Sitzen weh.
»Ich bin zu alt für den Scheiß«, knurrte er.
Er war gerade in die Township Road 3 gebogen, als wieder Monas knisternde Stimme ertönte. »Pickles, ich hab einen 10–11 auf der Humerick-Farm in der Folkerth Road.«
Er griff zum Funkgerät. »Was für Tierprobleme?«
»Laut der alten Frau Humerick sind ein paar ihrer Schafe tot, und überall liegen Eingeweide rum.«
»Das ist ein Witz, oder?«
»Sie glaubt, es war wieder irgend so ein Tier.«
»Wahrscheinlich Bigfoot persönlich.« Knurrend machte Pickles eine Kehrtwende und fuhr zur Folkerth Road. »Wie lautet die genaue Adresse?«
Mona nannte ihm die Hausnummer, wonach die Humerick-Farm nicht allzu weit weg vom Millers Pond und dem Grünstreifen am Painters Creek lag.
»Ich bin dran«, sagte er, was hieß, dass er auf dem Weg zum Schauplatz war, und machte das Blaulicht an.
Wenige Minuten später erreichte er die Humerick-Farm, die im Schein eines riesigen Flutlichtstrahlers, der an der Scheunenfassade angebracht war, wie ein Footballstadion erstrahlte.
June Humerick war seit zwanzig Jahren Witwe, groß wie ein Linebacker und ebenso bösartig. Humerick behauptete, eine Amische zu sein, was man jedoch weder ihrem Äußeren noch ihrem Verhalten anmerkte. Vor einem Jahrzehnt hatte sie dem Bischof eine lange Nase gemacht und Strom auf ihre Farm legen lassen. Sie fuhr einen alten Dodge Pick-up, schnupfte Tabak und fluchte wie ein Bierkutscher, wenn sie sauer war. Die Amisch-Gemeinde betrachtete sie nicht mehr als eine der Ihren, doch Witwe Humerick schien das nicht zu stören.
Sie stand in Flanellnachthemd, Parka und kniehohen Gummistiefeln neben dem alten Dodge, die Doppelflinte ihres toten Mannes in der einen und eine Taschenlampe in der anderen Hand. »Ich bin hier!«, brüllte sie.
Pickles nahm die Stablampe und stieg aus. Er ließ den Motor des Streifenwagens laufen, die Scheinwerfer auf den schattigen Pferch hinter der Scheune gerichtet. »Guten Abend, June«, rief er ihr auf halbem Weg zu.
Ohne zurückzugrüßen, zeigte sie auf den zehn Meter entfernten Zaun. »Scheißabend. Vier meiner Schafe sind in Stücke gerissen.«
Er blickte in die gezeigte Richtung. »Lämmer?«
»Das waren ausgewachsene Mutterschafe.«
»Irgendwas gesehen oder gehört?«
»Hab sie schreien hören, und das Gebell der Hunde hätte Tote aufwecken können. Aber als ich dann kam, waren die Schafe tot, und überall lagen Eingeweide.«
»Könnten Kojoten gewesen sein. Hab gehört, die haben gerade ein Comeback in dieser Gegend von Ohio.«
»So was machen Kojoten nicht.« Die Witwe sah ihn an, als wäre er blöd. »Ich weiß, wer das war, und wenn Sie auch nur ein bisschen Hirn hätten, wüssten Sie’s auch.«
»Ich hab die Schafe noch nicht gesehen, wie zum Teufel soll ich da wissen, wer’s war«, erwiderte er entrüstet.
»Weil so was wie das nicht zum ersten Mal passiert ist.«
»Meinen Sie die Anschläge, die jemand aus Hass auf die Amischen verübt hat?«
»Ganz genau.«
»Schafe zu töten scheint mir nicht unbedingt ins Muster zu passen, finden Sie nicht?«
»Quatsch! Manche Leute können uns einfach nicht leiden, Pickles. Wir Amischen werden seit nahezu hundert Jahren verfolgt.« Die Witwe starrte ihn wütend an. »Und was machen Sie jetzt dagegen?«
Pickles wusste nur zu genau, dass die Gewalt gegen Amische in letzter Zeit zugenommen hatte, wobei es sich aber meistens um geringfügige Delikte handelte: ein zertrümmerter Briefkasten, eine eingeworfene Fensterscheibe oder Eierwürfe auf Buggys, die Pferdewagen der Amischen. Früher waren solche Vergehen von der hiesigen Polizei und dem Sheriffbüro von Holmes County als harmloser Unfug abgetan worden, doch vor ein paar Monaten hatten die Vorfälle eine bedenkliche Wendung genommen. Es war noch keine zwei Wochen her, dass ein Buggy von der Straße abgedrängt und dabei eine schwangere Amische verletzt wurde. Die Chefin und der Sheriff von Holmes County hatten daraufhin beschlossen, eine Sonderkommission zu bilden. Das Problem dabei war, dass die Amischen, die Opfer eines Verbrechens wurden, sich stets weigerten, Anzeige zu erstatten, und zwar mit der immer gleichen Begründung: »Gott wird uns behüten.«
»Bevor wir jemanden lynchen, sollten wir uns vielleicht erst mal die Schafe ansehen und sicherstellen, dass es keine wilden Hunde oder so was waren«, sagte Pickles. Die Vorstellung, dass seine neuen Cowboystiefel von Lucchese gleich ein Schlammbad nehmen würden, ließ ihn innerlich aufstöhnen.
Er folgte June, die mit wehendem Nachthemd unter dem Parka über den Schotter zum Pferch ging und das knarrende Stahltor öffnete. Die Herde bestand aus einigen Dutzend Schafen, die alle auf einmal anfingen zu blöken. Auch der erdige Hammelgeruch vermischt mit Mist und Kot war gewöhnungsbedürftig. Sie durchquerten den Pferch, wobei seine Stiefel in Matsch und Schafscheiße versanken und die ängstlichen Tiere vor ihnen flüchteten.
»Tolle Nacht, um hier draußen rumzustolpern«, sagte Pickles und wünschte sich, zu Hause im warmen Bett zu liegen. Als er mit dem Strahl der Taschenlampe den Holzzaun entlang wanderte, stolperte er und wäre um ein Haar hingefallen. Fluchend leuchtete er auf den Boden und sah, dass dort der abgetrennte Kopf eines Schafes lag.
»Großer Gott«, sagte er. »Wo kommt der denn her?«
»Das war mal Bess.« Jane Humerick senkte die Stimme. »Armes altes Mädchen.«
Der Kopf des Mutterschafs lag in einer Pfütze aus Blut und Dung. Das aufgerissene Maul offenbarte eine Reihe winziger weißer Zähne und eine rosa Zunge, die wie ein kaputter Luftballon halb raushing. Pickles richtete den Strahl seiner Lampe auf den Hals. Er hatte keine Ahnung, wie der Kopf vom Körper getrennt worden war, doch das hier sah nicht aus wie das Werk eines ausgemergelten Kojoten. Das Fleisch war sauber durchschnitten, rotes Gewebe und der rosa Knochen vom Rückgrat ragten aus dem Schädel.
»Sieht mir nicht nach einem Kojoten aus.« Pickles Nackenhaare stellten sich auf wie die eines Stachelschweins. »Scheint mit einem Messer abgetrennt.«
»Das hätte ich Ihnen auch sagen können.« Sie leuchtete mit der Taschenlampe die nähere Umgebung ab. »Wenn ich schneller gewesen wäre, hätte ich dem Scheißkerl eine Ladung Blei verpasst.«
Pickles machte einen großen Schritt über den Kopf hinweg und ging zu einem zweiten Kadaver, der im Schein ihrer Lampe aufgetaucht war. Der Anblick von Blut hatte ihm nie etwas ausgemacht, doch als er jetzt die rosa Eingeweide neben dem von oben bis unten aufgeschlitzten Bauch sah, wurde ihm leicht übel.
»Meine Scheiße.« Die derben Worte gebrauchte er nur, weil er wusste, dass auch die Witwe mit Kraftausdrücken nicht zimperlich war. Sie trat neben ihn, und beide betrachteten sie das tote Schaf. »Das ist einfach nur sinnlos«, sagte sie.
»Wenn’s nicht geregnet hätte, gäbe es wenigstens Spuren«, meinte Pickles und leuchtete nach rechts und links. »Und Sie haben bestimmt keine Lichter gesehen?«
»Ich hab nix gesehen.«
Er richtete den Lampenstrahl auf den Kadaver. »Könnten die Teufelsanbeter aus dem Süden gewesen sein.«
Die hünenhafte Frau neben ihm zeigte auf den kopflosen Kadaver. »Sie haben aber keine Opfergabe mitgenommen.«
Die Witwe kaufte ihm das mit den Teufelsanbetern offensichtlich nicht ab, und er hatte nicht vor, hier draußen im Schneeregen mit ihr darüber zu diskutieren. »Also gut, ich fahr hinterm Wald entlang zurück und schreibe einen Bericht.«
Sie sah ihn ungläubig an. »Und wenn die zurückkommen? Was ist, wenn die sich da im Wald verstecken und warten, bis Sie weg sind, und dann den Rest meiner Schafe niedermetzeln?«
»Hier ist niemand mehr, die sind weg.«
»Sie könnten im Wald suchen.«
»Dazu ist es zu dunkel, besonders bei dem Wetter.«
»Sie reden ’n Haufen Kinderkacke, Pickles.«
Er seufzte; vor zwanzig Jahren hätte er begeistert den dunklen Wald durchforstet, um ein paar Amisch-Hasser am Wickel zu kriegen. Doch heute Nacht taten ihm die Knie weh, er fror bis auf die Knochen und war froh, den Schlamassel bei Tagesanbruch an die nächste Schicht weitergeben zu können.
»Ich rede gleich morgen früh mit dem Chief, dass sie mit der Sonderkommission in die Gänge kommen muss«, erwiderte er nur und machte sich auf den Weg zu seinem mollig warmen Streifenwagen. »Sie können die Schafe ja für den Rest der Nacht in den Schuppen sperren.«
Doch die Witwe ließ nicht locker. »Der baufällige Schuppen ist für die Verrückten, die das hier gemacht haben, bestimmt kein Hindernis.«
»Gute Nacht, June.« Pickles war schon fast am Wagen, als sich knisternd sein Ansteckmikro meldete. »Was ist denn nun schon wieder?«, knurrte er.
»Pickles, ich hab einen Notfall draußen auf der Slabaugh-Farm. Gerade hat David Troyer angerufen, dort liegen drei Leute in der Jauchegrube.«
»Mist.« Pickles tastete am Kragen nach dem Knopf des Mikros. Früher gab es nur Funkgeräte im Streifenwagen, und man konnte entscheiden, ob man drangehen wollte oder nicht. Heutzutage trug man das verfluchte Ding wie einen bizarren Körperteil mit sich herum, ein Ende am Gürtel festgeklemmt, das andere im Ohr, und das Mikrophon hing am Revers wie ’ne verdammte Medaille. »Hast du schon den Notarzt benachrichtigt?«
»Ist unterwegs. Ich dachte, du willst dir das mal ansehen.«
Pickles seufzte erneut; eigentlich hatte er für heute Nacht genug von Matsch und Scheiße, doch Jauchegruben waren gefährlich. Da wurden schädliche Gase freigesetzt, die einen schneller ausknocken konnten, als man glaubte, wenn man unvorsichtig war. »Wie ist die genaue Adresse?«
»364 Township Road 2.«
Pickles kannte die Straße, ein Feldweg südlich der Stadt, auf dem er mit einem Auto ohne Allradantrieb bestimmt seinen Spaß haben würde. Er verabschiedete sich innerlich von seinen Lucchese-Stiefeln und sagte fluchend: »Vielleicht solltest du die Chefin anrufen.«
»Mach ich.«
»Bin unterwegs«, sagte er und legte einen Gang zu.
2.Kapitel
Schlaflosigkeit ist eine heimtückische Krankheit. Leise und unsichtbar raubt sie den Betroffenen nicht nur den Schlaf, sondern auch den Seelenfrieden, und das manchmal monatelang. Sie trübt den Verstand, zermürbt den Geist und führt schließlich zu körperlichen und seelischen Schäden.
Ich hatte noch nie einen guten Schlaf, doch in den letzten Monaten haben sich meine gelegentlichen Schlafstörungen zu einer chronischen Insomnie ausgewachsen. Manchmal liege ich wach im Bett, beobachte die tanzenden Schatten am Fenster und frage mich, wie lange ein Mensch ohne Schlaf auskommen kann, bevor die Auswirkungen spürbar werden – wie und wann dieses Beil auf mich niedergeht.
Ich starre gerade die roten Leuchtziffern meines Weckers an, als das Telefon auf dem Nachttisch schrillt. Ich schrecke hoch und sage mir, dass es bestimmt John Tomasetti ist, der wissen will, wie es mir geht. Er ist mein Freund, Liebhaber und schlafloser Leidensgenosse, wobei Letzteres nicht die einzige Gemeinsamkeit ist.
Doch auf dem Display ist die Nummer des Reviers. Angesichts der Tatsache, dass ich Polizeichefin bin und wir fünf Uhr morgens haben, erwarte ich keine guten Nachrichten vom anderen Ende der Leitung. Doch ich bin froh, dass mich der Anruf aus der dunklen Höhle meiner eigenen Gedanken holt.
»Chief Burkholder, hier ist Mona. Tut mir leid, Sie zu wecken.«
»Kein Problem, was gibt’s?«
»Ich hab einen Notruf von Bischof Troyer bekommen. Einer der Slabaugh-Jungen hat ihm erzählt, auf ihrer Farm wären drei Leute in die Jauchegrube gefallen.«
Sofort läuten bei mir die Alarmglocken. Da ich selbst als Amische geboren und aufgewachsen bin, kenne ich die Gefahren einer schlecht gesicherten Jauchegrube nur zu gut – Methangas, Ammoniak, Ertrinken. Die Slabaughs sind Amische mit einer Schweinezucht außerhalb der Stadt. Wenn ich gelegentlich dort vorbeifahre, erkenne ich am Geruch, dass sie mit Jauche eher nachlässig umgehen. »Haben Sie schon den Notarzt hingeschickt?«
»Ist auf dem Weg, und Pickles auch.«
»Die Opfer sind noch am Leben?«
»Soviel ich weiß.«
»Sagen Sie im Krankenhaus Bescheid, dass mehrere Verletzte zu ihnen gebracht werden.« Inzwischen bin ich aus dem Bett gestiegen und suche meine Klamotten zusammen. »Ich bin in zehn Minuten da.«
Die Farm der Slabaughs liegt ein paar Meilen außerhalb der Stadt an einer unbefestigten Straße. Als ich in die Township Road 2 einbiege, fällt so starker Schneeregen, dass ich auf Allradantrieb umstelle und heftig Gas gebe. Nach kaum einhundert Metern treffe ich auf einen unserer Streifenwagen, der im Matsch feststeckt, fahre rechts ran und halte.
Die Fahrertür geht auf, und Pickles, mein ältester Mitarbeiter, schleppt sich durch knöchelhohen Matsch zu meinem Wagen. Er steigt auf der Beifahrerseite ein, mit mehreren Pfund Matsch an den Schuhen. »Das County sollte endlich die verdammte Straße asphaltieren lassen«, meint er knurrend.
»Ist der Notarztwagen durchgekommen?«, frage ich.
»Ich hab keinen gesehen.«
»Das ist die einzige Straße zur Farm.« Als ich das Gaspedal durchtrete, schlingert der Explorer, dann greifen die breiten Reifen, Matsch fliegt in den Radschacht, und wir machen uns holpernd auf zu der knapp einen Kilometer entfernten Farm. Das menschliche Gehirn kommt nur etwa vier Minuten ohne Sauerstoff aus und ist danach permanent geschädigt, weshalb ich viel zu schnell fahre und ein paar Mal fast im Graben lande.
Ich habe die schlimmsten Befürchtungen, was wir bei den Slabaughs vorfinden werden. Je nach Belüftungssystem können die ausströmenden Gase einer Jauchegrube tödlich sein. Oder man fällt rein und ertrinkt. Vor zwei Jahren war der Schweinefarmer Bud Lathy frühmorgens in seinem Stall gestorben. Da es sehr kalt gewesen war, hatte er am Vorabend alle Türen und Fenster geschlossen, doch ohne anständige Belüftungsanlage hatten sich über Nacht Gase gebildet und mehrere Schweine waren verendet. Als er dann zum Füttern in den Stall kam und das Unglück sah, war er nach wenigen Minuten in Ohnmacht gefallen und erstickt.
»Vorsicht!«
Urplötzlich war im Licht des Scheinwerfers die schmale Gestalt eines Jungen aufgetaucht, ich steige adrenalingepeitscht in die Bremsen und reiße das Lenkrad rum. Der Wagen schlittert nur Zentimeter an dem Jungen vorbei und kommt quer über der Straße zum Stehen. »Verdammt.«
Pickles und ich stoßen die Türen auf und laufen durch den Schneematsch zu dem Jungen, der mitten auf der Straße steht. Er wirkt verloren und verängstigt und trägt trotz der Kälte keine Jacke. Sein flachkrempiger Hut und die Hosenträger sagen mir, dass er amisch ist. »Was ist passiert?«, frage ich ihn.
Er ist ungefähr zwölf Jahre alt, bis auf die Knochen nass und wird von einem Weinkrampf geschüttelt. »Wir brauchen Hilfe! Mamm und Datt …« Er zeigt auf die lange Schotterstraße hinter sich. »Sie sind in die Grube gefallen!«
Mehr Informationen brauche ich nicht. Ich nehme ihn am Arm mit zum Explorer und schiebe ihn auf den Rücksitz. Pickles und ich steigen gleichzeitig ein, ich trete aufs Gas und fahre los.
Im Rückspiegel sehe ich den Jungen an. »Sind sie wach?«, frage ich.
»Nein!«, stößt er schluchzend aus. »Sie schlafen, schnell!«
Nach vierhundert Metern mündet der Weg auf einen weiträumigen Kiesplatz. Rechts liegt ein großes weißes Schindelhaus, geradeaus ist die Scheune. Erst kurz davor nehme ich den Fuß vom Gas und trete voll auf die Bremse. Die Räder blockieren, graben tiefe Furchen in den Boden. Der Wagen ist noch nicht zum Stehen gekommen, da stoße ich die Tür auf, schnappe meine Taschenlampe und springe hinaus. Im Schneeregen laufe ich zum Kofferraum, reiße die Klappe auf, schnappe mir das sechs Meter lange Seil und sprinte zum Scheunentor, schiebe es mit beiden Händen auf.
»Polizei!«, rufe ich. Der Gestank von Ammoniak und faulen Eiern, typisch für feuchten Tierdung, nimmt mir im ersten Moment die Luft, doch ich bleibe nicht stehen und laufe auf die brennende Laterne zu. Irgendwo rechts von mir höre ich ein junges Mädchen jammern. Ein kleiner Junge und ein Teenager stehen mit gesenktem Kopf hinter dem Holzgatter eines großen Pferches. Ich stoße das Tor auf und gehe zu ihnen. »Wo sind sie?«
Sie zeigen in die Richtung, doch ich weiß es auch so schon, denn der Betonboden fällt leicht ab, damit Urin und Kot in das etwa zwei mal zwei Meter große Loch fließen können. Jemand hat den Gitterrost abgenommen, wahrscheinlich um die Grube zu reinigen, denn nur wenige Schritte entfernt sehe ich eine Schneeschippe und einen Schlauch. Ich leuchte mit der Taschenlampe in das Loch: In etwa einem Meter achtzig Tiefe liegen drei Menschen bewegungslos in einer Lache aus flüssigem schwarzen Dung.
»Wie lange sind sie schon da drin?«, frage ich barsch.
Der älteste Junge scheint ungefähr siebzehn zu sein. Er wirft mir einen verängstigten Blick zu. »Ich weiß nicht. Zehn Minuten«, stößt er zwischen klappernden Zähnen hervor, kreidebleich im Gesicht. Seine Hose ist an den Knien mit Jauche durchtränkt.
Ich deute mit dem Finger auf ihn. »Mach sämtliche Türen und Fenster auf, verstehst du? Hier muss Luft rein.«
»Ja.« Er nickt und läuft los.
Wieder leuchte ich in das Loch. Es sind zwei Männer und eine Frau, und der Kleidung nach sind es Amische. Die beiden Männer liegen mit dem Gesicht nach unten. Da ist nichts mehr zu machen, denke ich. Die Frau liegt auf dem Rücken und lebt vielleicht noch. »Wir kommen runter und holen Sie!«, rufe ich. »Können Sie mich hören?«
Keine Reaktion.
»Halten Sie durch!« Hinter mir höre ich Geräusche, drehe mich um und sehe Pickles und den Jungen kommen. »Wo zum Teufel bleibt der Krankenwagen?«, fluche ich.
Pickles schüttelt den Kopf und drückt auf sein Ansteckmikro.
Ich wende mich an den Jungen. »Hilf deinem Bruder die Fenster und Türen zu öffnen. Wir brauchen frische Luft hier drin. Wenn die Fenster nicht aufgehen, schlagt die Scheiben ein. Schnell, geht!«
Mit tränennassen Augen dreht er sich um und läuft los.
Fluchend blicke ich auf das Seil in meiner Hand. Ich habe keine Lust, da runterzusteigen, und schon von Menschen gehört, die beim Helfen selber umgekommen sind. Aber ich kann auch nicht hier stehen bleiben und zusehen, wie eine Mutter von vier Kindern an den Gasen erstickt.
Die Vorstellung setzt mir so zu, dass ich mich nach etwas umsehe, woran ich das Seil festmachen kann. Drei Meter von mir entfernt ist ein dicker Stützbalken in den Beton eingelassen. Ich mache das Seil am Balken fest und bin gerade dabei, mir das andere Ende um die Hüfte zu binden, als Pickles kommt. »Sie wollen doch nicht etwa da runtergehen?«, fragt er.
Ich ignoriere seine Frage und setze mich so an den Grubenrand, dass meine Beine hineinbaumeln. »Sie müssen mir helfen.«
Pickles wirkt alarmiert. »Chief, bei allem Respekt …«
»Holen Sie Ihre Handschuhe und lassen Sie mich am Seil runter.«
Er sieht mich an, als hätte man ihm gerade mitgeteilt, dass er von einem Erschießungskommando exekutiert wird. »Wenn Sie ohne Atemschutzmaske da reinsteigen, können Sie sich gleich zu den anderen dazulegen.«
»Haben Sie eine bessere Idee?«, blaffe ich ihn an.
»Nein, verdammt nochmal.« Er macht keine Anstalten, das Seil zu nehmen. »Vielleicht können wir das Seil wie ein Lasso um sie schlingen und einen nach dem anderen rausziehen.«
»Verdammt nochmal, Pickles. Sie stirbt.« Ich rutsche bis vor zum Rand.
Er packt meinen Arm. »Chief, es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als auf die Feuerwehr zu warten.«
Unwirsch schüttele ich seine Hand ab, obwohl er natürlich recht hat. Es ist waghalsig, da runterzusteigen, man könnte auch sagen dumm. Aber ich treffe nun mal nicht immer die richtigen Entscheidungen, und schon gar nicht, wenn das Leben eines Menschen auf dem Spiel steht. Oder wenn Kinder involviert sind. Ich bin zwischen der gebotenen Eile und meiner Unentschlossenheit hin- und hergerissen, denke an die Kinder, die ohne ihre Eltern aufwachsen müssen, und finde das so ungerecht, dass ich schreien möchte. In den letzten Monaten habe ich zu oft mit ansehen müssen, wie guten Menschen schlechte Dinge passiert sind.
»Wir ziehen sie hoch«, sage ich schließlich.
Erleichtert löst Pickles das Seil vom Balken, reicht mir den größten Teil und behält das Ende in der Hand. Ich stehe auf, streife die Schlinge von meinen Hüften, vergrößere sie und werfe sie wie ein Lasso in die Grube. Vage nehme ich fernes Sirenengeheul wahr, doch ich mache unbeirrt weiter, denn jede Sekunde entscheidet hier über Leben und Tod.
Ich muss versuchen, die Schlinge um die Frau zu kriegen. Wenn sie nicht den Gasen erlegen ist, besteht noch immer die Chance …
Sie liegt dicht an der Wand, fast direkt unter mir. Ich stelle mich breitbeinig an den Rand der Grube, beuge mich vor und strecke den Arm mit dem Seil aus, versuche, die Schlinge um ihren Oberkörper zu legen. Ein festes Kabel wäre besser, doch ich hab keines zur Hand und will nicht zum Auto gehen und noch mehr Zeit verschwenden. Das Seil muss reichen.
Nach mehreren Fehlversuchen gelingt es mir, die Schlinge um den Arm der Frau zu legen, zur Schulter hochzuziehen und über den Kopf und die andere Schulter zu manövrieren. Das wird für sie keine bequeme Reise, aber ein paar Hautabschürfungen sind sicherlich angenehmer als der Tod.
»Ich habe sie!«, rufe ich. »Ziehen.«
Pickles winkt den ältesten Jungen zu sich, der das Ganze von der anderen Grubenseite aus mit angesehen hat. »Komm, hilf uns!«
Der Junge eilt zu ihm, packt das Seil und wickelt es sich ein paarmal um die Hand, Hoffnung in den Augen. »Okay.«
Wir fangen an zu ziehen, das Seil strafft sich, und der Arm der Frau geht hoch, als die Schlinge sich fest um sie schließt. Obwohl wir zu dritt sind, ist es nicht leicht, einhundertzwanzig Pfund aus flüssiger Jauche zu ziehen. Ich höre Pickles und den Jungen hinter mir ächzen. Der verdreckte Boden bietet keinen festen Stand, und sie rutschen immer wieder weg. Mit aller Kraft ziehe ich an dem Seil, spüre, wie mir die Handflächen brennen, denn ich habe keine Handschuhe an. Doch das spielt jetzt keine Rolle.
Es geht furchtbar langsam voran, Zentimeter um Zentimeter lösen wir die Frau aus der schlammigen Jauche. Als sie schließlich aufrecht am Seil hängt, trete ich vom Rand zurück, um einen festeren Halt unter den Füßen zu bekommen, und höre nur noch, wie ihr Körper an der Wand nach oben schleift.
Als ihr Arm sowie ein Stück des Kopfes aus dem Loch ragen, drehe ich mich zu Pickles um: »Jetzt gut festhalten.«
Sein Gesicht ist vor Anstrengung puterrot, doch er nickt, und ich hangele mich mit den Händen am Seil entlang zu der Frau, packe sie unter den Schultern und rufe: »Ziehen!«
Als sie dann auf dem Betonboden liegt, fällt mir sofort auf, wie kalt ihre Haut ist. Ihre Kleidung ist jauchegetränkt, ihre Lippen sind blau, und teefarbenes Wasser steht in ihrem Mund. Ich knie mich neben sie und will sie auf die Seite drehen, als ich Schritte hinter mir höre. Jemand berührt meine Schulter, ich schrecke zusammen und blicke zu einem uniformierten Feuerwehrmann und einem jungen Rettungssanitäter auf. Beide halten Reanimationsausrüstung in der Hand.
»Wir übernehmen jetzt«, sagt der Rettungssanitäter.
Mein Blick wandert zurück zum Opfer. Verschleierte Augen starren mich an, und mir ist auf einmal klar, dass die Frau tot ist. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag ins Gesicht, und ich möchte die Faust auf den Beton hauen, doch der Junge tritt gerade neben mich und sieht auf seine Mutter hinab. Nahebei höre ich das Mädchen weinen, ein weiteres Kind sinkt auf die Knie und schreit nach seiner Mamm. In dem Moment wird mir bewusst, dass diese amischen Kinder jetzt Waisen sind.
Der Rettungssanitäter umfasst meine Schultern und zieht mich auf die Füße, denn ich bin ihm im Weg. Mir ist kalt, ich bin wacklig auf den Beinen und frage mich, ob die Gase aus der Grube daran schuld sind oder aber mein Gefühl der Ohnmacht.
Der Sanitäter kniet neben der Frau und drückt ihr die Beatmungsmaske aufs Gesicht, pumpt mit der anderen Hand Sauerstoff in ihre Lungen. An der Jauchegrube stehen zwei Feuerwehrleute mit Sauerstoffmasken und lassen Rettungsgeräte hinab.
Ich sehe auf meine Hände, die mit einem widerlichen, klebrigen Gemisch aus Wasser, Blut, Dung und Matsch überzogen sind. Das Blut ist offensichtlich mein eigenes, denn das Seil hat mir die Handflächen aufgerissen, doch Schmerzen spüre ich nicht. Momentan rieche ich nicht einmal die Jauche. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Sanitätern bei ihrem verzweifelten Versuch zuzusehen, die bewegungslose Frau zu retten.
Wenige Schritte entfernt stehen die vier amischen Kinder dicht beieinander gedrängt, Hoffnung in den Augen, dass die Englischen mit ihren modernen Geräten das Leben ihrer Mamm und ihres Datts retten. Der Glaube, den ich in ihren jungen Gesichtern sehe, schmerzt mich, weil dieser Glaube sie nicht vor Enttäuschungen schützen wird.
»Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen frische Luft gebrauchen.«
Ich drehe mich um. Officer Rupert »Glock« Maddox sieht mich an wie einen Hund, der gerade von einem Auto angefahren wurde – und zwar so schlimm, dass er zubeißen könnte, wollte man ihn berühren. Ich habe keine Ahnung, warum er schon hier ist, denn seine Schicht beginnt erst um acht Uhr. Aber das ist auch egal, ich bin froh über seine Anwesenheit.
»Sie ist tot«, sage ich.
»Sie haben alles Menschenmögliche getan.«
»Erzählen Sie das den Kindern dort.«
Er verzieht das Gesicht. »Kommen Sie, wir gehen an die Luft.«
Glock gehört nicht zu den Menschen, die anderen in emotionalen Situationen zu nahe treten. Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren mit ihm zusammen und kann die persönlichen Gespräche in dieser Zeit an zwei Fingern abzählen. Umso überraschter bin ich, dass er meinen Arm nimmt.
»Gottverdammt …«, murmele ich.
»Ja.« Mehr sagt er nicht, aber das ist auch nicht nötig. Er versteht es, versteht mich. Das genügt.
Er führt mich durch die Scheune nach draußen, und erst dort merke ich, dass mir ganz schummrig ist. Obwohl inzwischen alle Türen und Fenster offen stehen, gibt es kaum Durchzug, und die Luft ist getränkt von Ammoniak und anderen üblen Gasen. Ich war zwar höchstens zehn Minuten da drin, doch spüre ich schon einen klopfenden Schmerz im Kopf.
Eine volle Minute stehe ich im Schneeregen und atme die saubere, kalte Luft ein. Das tut mir gut, wie kühles Wasser auf heißer Haut. Ich sehe Glock an: »Es geht mir schon besser.«
»Gut.« Mit Blick zur Scheune stößt er einen Seufzer aus. »Wirklich schlimm, was da passiert ist.«
Ich denke an die Kinder, und mir graut davor, was mich erwartet. »Das Schlimmste kommt doch erst noch.«
»Soll ich Ihnen bei den Aussagen der Kinder helfen?«
»Dafür wäre ich wirklich dankbar.«
»Sollen wir sie hier auf der Farm aufnehmen?«
Ich sehe mich um. Wir stehen ungefähr sechs Meter von dem großen Scheunentor entfernt, in das ständig Feuerwehrleute und Sanitäter hinein- und hinausgehen. Rotes und blaues Licht von Feuerwehrautos und zwei Krankenwagen flackert über die Fassade. Das hübsche weiße Farmhaus rechts von mir wirkt kalt und leer, die Fenster sind dunkel, als wäre ein inneres Licht für immer erloschen.
»Ja, im Haus. Das ist angenehmer für die Kinder, und außerdem müssen sie etwas essen.« Ich weiß, es scheint banal, doch selbst angesichts einer solchen Tragödie muss der Mensch Nahrung zu sich nehmen. »Ich rufe Bischof Troyer an, er soll herkommen.«
Falls Glock von meinen Worten überrascht ist, zeigt er es nicht. Ich bin wirklich nicht der mütterliche Typ, doch diese Kinder möchte ich beschützen. Alle Kinder sind unschuldig, doch amische Jungen und Mädchen auf eine besondere Weise – wenn ihre Unschuld zerstört wird, fallen sie noch tiefer als andere. Ich war vierzehn Jahre alt, als das Schicksal mir übel mitspielte. Ich weiß, wie es sich anfühlt, in eine Welt gestoßen zu werden, die der eigenen – und somit einzig bekannten – vollkommen fremd ist.
Pickles taucht mit den vier Kindern vor dem Scheunentor auf, unbeachtet von Feuerwehrleuten und Sanitätern, die weiter ihre Arbeit tun. Ich verspüre wirklich keinerlei Bedürfnis, sie über das Grauen zu befragen, das sie vielleicht sogar mit angesehen haben. Doch wie bei den meisten Bällen, die einem das Leben gleichmütig zuspielt, kann man sich nicht davor wegducken.
3.Kapitel
Zehn Minuten später stehe ich mit Glock und Pickles in der großen Küche der Amisch-Familie. Die vier Kinder sitzen am wuchtigen Holztisch, die bleichen Gesichter vom Schein der Petroleumlampe erhellt. Im Haus ist es warm, und es riecht nach Schweineschmalz und Lampenöl.
Ich zünde eine zweite Laterne auf der Ablage neben der Spüle an. Es gab einmal eine Zeit, da hätte mir die düstere Beleuchtung nichts ausgemacht, denn bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr habe ich nichts anderes gekannt. Doch heute Morgen fehlt mir das helle Licht einer Glühbirne, ich habe das Gefühl, halbblind zu sein.
Der altmodische Petroleumherd neben der Spüle ist noch warm. In der gusseisernen Bratpfanne am Rand schwimmt Scrapple, ein amisches Grundnahrungsmittel, in einer Lache aus langsam fest werdendem Schweineschmalz. Auf dem Tisch steht unberührt das übrige Frühstück: ein Korb mit Brot, eine kleine Schale Apfelbutter, ein Krug mit – wahrscheinlich – frischer Milch, sieben Teller, sieben Gläser, drei Kaffeetassen.
Ich schiebe die Pfanne in die Herdmitte, um das Scrapple aufzuwärmen, und gehe zum Tisch. Als ich Milch in die vier Gläser schenke, spüre ich die Blicke von Glock und Pickles auf mir ruhen. Diese Rolle ist mir fremd, doch ich werde sie spielen. Ich lege jedem der Kinder eine Scheibe Brot auf den Teller – Brot, das ihre Mutter gestern oder vorgestern gebacken hat. Eine Mutter, die ihnen nie wieder Frühstück machen wird.
Die Kinder sind bestimmt viel zu verstört, um zu essen, doch ich stelle das warme Scrapple trotzdem in die Mitte des Tisches. Als mir nichts weiter zu tun einfällt, setze ich mich an den Tisch und falte die Hände vor mir. »Das mit euern Eltern tut mir sehr leid«, beginne ich.
Das jüngste Kind, ein Junge von ungefähr zehn Jahren, sieht mich an. »Kommt Mamm bald her?«, fragt er.
»Es tut mir leid, aber eure Mamm und euer Datt sind verschieden.« Da ich nicht sicher bin, ob sie den Ausdruck kennen, füge ich hinzu: »Sie sind jetzt bei Gott.«
»Aber ich hab gesehen, wie Sie sie gerettet haben. Ich hab es gesehen.«
»Ich konnte sie nicht mehr retten. Es tut mir leid.«
Der Junge sieht auf seinen Teller und fängt an zu weinen. »Ich will meine Mamm.«
»Das weiß ich, mein Kleiner.« Ich strecke die Hand aus und tätschele seine, die sich klein und weich und kalt in meiner anfühlt. Eher hilflos und unbeholfen wende ich mich dem ältesten Jungen zu. Er starrt mich trotzig an, und ich frage mich, ob er dem Tod die Stirn bieten will oder sich seinen Kummer nicht eingestehen kann. »Sagt ihr mir eure Namen?«
»Ich heiße Salome.« Das Mädchen mir gegenüber ist ungefähr fünfzehn Jahre alt, hat mausbraunes Haar und eine bleiche Haut mit rosa Flecken vom Weinen; ihre Augen sind dunkelgrün. Sie weicht meinem Blick aus, ist aber die Einzige, die die Gabel genommen und sich etwas Scrapple aufgetan hat.
Ich nicke ihr zu und wende mich an den Jungen neben mir.
»Ich heiße Samuel«, sagt er.
»Wie alt bist du, Samuel?«, frage ich.
»Zwölf.«
Ich schenke ihm ein Lächeln, das hoffentlich echt wirkt, und sehe das kleinste Kind an, das zwei Stühle weiter sitzt. Es hat blonde Haare, einen stumpf geschnittenen Pony und Sommersprossen auf der Stupsnase. »Und wie heißt du?«
»Ich heiße Ike, und ich bin zehn.« Kaum, dass die Worte raus sind, bedeckt er das Gesicht mit seinen pummeligen Händen und bricht in Tränen aus. »Ich will meine Mamm.«
Ich würde am liebsten auch weinen, doch das geht natürlich nicht. Derlei Emotionen sind ansteckend wie ein Virus, und ich darf sie nicht in meine Psyche lassen. So berühre ich stattdessen die Schulter von Ike und wende mich dem ältesten Jungen zu. »Wie heißt du?«
»Moses, aber ich werde Mose genannt.«
Er ist hochgewachsen, dünn, mit speckigen blonden Haaren und rosa Akneflecken auf den Wangen. Doch das ist auch alles, was er noch mit einem Teenager gemein hat. Die kristallblauen Augen unter dem stumpfen Pony sind hellwach und verraten mir, dass er intelligent genug ist, um zu wissen, dass sich ihrer aller Leben fundamental ändern wird.
»Wie alt bist du, Mose?«
»Ich bin ein Mann.« Seine Stimme ist brüchig, straft ihn Lügen, und er richtet sich etwas im Stuhl auf. »Ich bin siebzehn.«
»Ich heiße Kate. Ich bin Polizeichefin, und ich muss euch ein paar Fragen stellen über das, was passiert ist.« Keines der Kinder sagt etwas oder blickt mich an. »Wie heißen eure Eltern?«
Es dauert einen Moment, dann sieht Mose mich an. »Datt heißt Solomon, aber er wird Solly genannt. Mamm heißt Rachael.«
»Und der andere Mann?«
»Das ist Onkel Abel.«
»Sein Nachname ist auch Slabaugh?«
»Ja. Er ist auf Besuch aus Lancaster County.«
Ich sehe mir die jungen Gesichter an, eins nach dem anderen, und fühle mich uralt. Unschuldige Kinder, unberührt und unbeschädigt von den Verwüstungen, die einem das Leben manchmal zufügt. Mein Blick bleibt an Mose hängen. »Ich möchte, dass du mir erzählst, was heute Morgen passiert ist«, sage ich.
Sein Blick wandert zu dem noch unberührten Teller vor ihm, und einen Moment lang sieht es aus, als müsste er sich übergeben. Doch es gelingt ihm, sich zu sammeln, und ohne aufzusehen beginnt er zu sprechen. »Datt und Onkel Abel haben die Schweine gefüttert und die Ställe ausgemistet. Mamm und wir anderen waren im Haus. Sie hat Samuel rausgeschickt, um die beiden zu holen, damit Datt das Essensgebet spricht und wir frühstücken können.« Er schließt kurz die Augen. »Samuel kam schreiend zurückgerannt.«
Ich wende mich an Samuel. »Was ist passiert?«, frage ich sanft.
Der Junge blickt hinab auf seinen Teller. Seine Hände sind schmutzig und verschorft und die Fingernägel abgekaut. Typische amische Jungenhände, mit denen gleichermaßen gearbeitet und gespielt wird. »Datt und Onkel Abel waren in der Grube. Ich wusste nicht, was ich tun soll.«
»Waren sie wach?«
Samuel sieht Mose an. Mose nickt, was ihm anscheinend Mut macht, dann treffen sich unsere Blicke, und er verzieht das Gesicht. »Ja. Datt konnte nicht sprechen, aber Onkel Abel … er hat geschrien, ich soll Hilfe holen.«
»Was hast du getan?«
»Ich bin ins Haus gerannt, um Mamm zu holen.«
Ich nicke, versuche mir vorzustellen, wie schlimm das alles gewesen sein muss, und wende mich an Mose. »Was ist dann passiert?«
»Wir sind in die Scheune gerannt, um zu helfen«, erwidert er.
»Wer ist in die Scheune gerannt?«
»Wir alle. Mamm, meine Brüder und meine Schwester.«
»Wie ist eure Mamm in die Grube gefallen?«
Ike reibt sich mit seinen kleinen, dreckigen Fäusten die Augen. »Sie wollte Datt retten.«
Mose kommt ihm zu Hilfe. »Sie hat sich auf den dreckigen Boden gelegt und wollte, dass Datt ihre Hand ergreift. Sie hat ihn angeschrien, er solle aufwachen, aber das ist er nicht. Sie wollte Onkel Abel retten, aber der war da auch schon eingeschlafen. Mamm fing an zu weinen und hat sich immer weiter über den Rand vorgebeugt, bis sie auch reingefallen ist.«
Ich frage mich, ob ihr von den Gasen schwindlig geworden ist. »Was habt ihr gemacht, als eure Mamm reingefallen ist?«
»Wir hatten Angst. Es war wie ein böser Traum, zu schlimm, um wahr zu sein.« Mose hebt die Schultern, lässt sie wieder sinken. »Ich wusste, dass die Luft schlecht ist, deshalb haben wir das Tor aufgemacht. Wir haben Mamm angeschrien, um sie aufzuwecken, aber sie wurde nicht wach, und meine kleinen Brüder haben furchtbar geweint.« Er sieht Samuel an. »Ich hab dann das Pferd aufgezäumt und Samuel zu Bischof Troyer geschickt, weil der Bischof ein Telefon hat.«
»Und was hast du gemacht, nachdem dein Bruder weg war?«
»Ich hab selber versucht, Mamm und Datt und Onkel Abel aus der Grube zu holen, mit dem Wasserschlauch als Seil.«
Ich erinnere mich an den Schlauch auf dem Betonboden und nicke. »War zu der Zeit noch jemand bei Bewusstsein?«
Mit tränennassem Gesicht meldet sich Salome zu Wort. »Sie sind einfach nicht aufgewacht, wir haben geschrien und geschrien, aber sie wurden nicht wach.«
»Warum sind sie nicht aufgewacht?«, jammert Ike.
Ich sehe den Jungen an. Ich hatte immer den Eindruck, dass amische Kinder etwas stoischer sind als »englische«. Aber Kinder sind Kinder, egal welcher Kultur sie angehören, und die meisten besitzen noch nicht die Fähigkeit, mit so einer Situation umzugehen. Mancher Kummer ist einfach zu groß für so ein kleines Herz. »Wegen der Gase, die haben sie schläfrig gemacht«, sage ich.
»Ich will meine Mamm!«, schluchzt Ike. »Ich will sie wiederhaben. Warum ist sie nicht einfach aufgewacht? Warum haben Sie sie nicht gerettet?«
Seine anklagende Stimme trifft mich wie eine Ohrfeige. Ich weiß zwar, dass er das aus Kummer sagt, aber irgendwo tief in mir drin fühle ich mich schuldig, dass ich sie nicht gerettet habe.
Salome steht auf und geht zu dem Jungen, legt ihre schmale Hand auf seine knochige, bebende Schulter und drückt das Gesicht an seine Wange. Der Anblick ist so herzzerreißend, dass ich wegsehen muss. »Pssst, Ike«, sagt sie sanft, »Mamm und Datt sind jetzt bei Gott, das darfst du nicht vergessen, wenn dir dein Herz wegen ihnen weh tut.«
Die Hintertür geht knarrend auf, und ich drehe mich auf dem Stuhl um. Mein jüngster Officer, T. J. Banks, steckt den Kopf durch die Tür. »Der Coroner kommt gerade, Chief.«
Ich hatte gehofft, dass der Bischof vor ihm eintrifft, damit ich ihm die Kinder anvertrauen kann, während ich mit dem Coroner rede. Die Farm des Bischofs ist zwar nur wenige Meilen entfernt, aber er ist nicht mehr der Jüngste und braucht mehr Zeit, um sein Pferd anzuschirren und hierher zu kommen. »Können Sie bei den Kindern bleiben, bis Bischof Troyer da ist?«, frage ich T. J.
»Ähm … klar.« Mit einem beklommenen Blick auf die drei Jungen und das Mädchen betritt er die Küche.
Ich bedeute Glock und Pickles, mir zu folgen. Wir machen uns auf zur Scheune, vor der Dr. Ludwig Coblentz, der Coroner, gerade aus seinem Escalade steigt. Mit der großen Arzttasche in der Hand wartet er auf uns.
»Ich hatte gehofft, Ihre Telefonistin hätte sich verhört«, sagt er, als ich bei ihm bin. »Aber Ihr Gesichtsausdruck sagt mir etwas anderes.«
»Ich wünschte, es wäre nicht so.« Ich zeige auf das Haus. »Da drin sind vier Kinder, die ihre Eltern nie wiedersehen werden.«