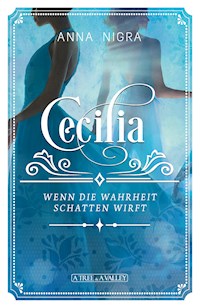
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A TREE & VALLEY
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Cecilia
- Sprache: Deutsch
Manchmal ist es besser, sein Leben zu riskieren, als sich seinem Schicksal zu ergeben. Betrogen und verraten! So fühlt Cecilia sich, als sie in Amerika ankommt. Ohne ihre Familie, ohne Noran und Elias. Ihr eigener Onkel hat sie in das amerikanische Königshaus verschleppen lassen. Doch dann erfährt sie, was es mit ihrer Entführung wirklich auf sich hat. Und was die wahren Gründe für ihre Verlobung mit dem Kronprinzen von Europa waren. Wussten die Brüder von der Intrige? War ihre Liebe nur eine große Lüge? Cecilias Herz ist gebrochen, doch das hält sie nicht davon ab, für ihre Familie zu kämpfen. Wenn es sein muss, an vorderster Front …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Anna Nigra
Wenn die Wahrheit Schatten wirft
Cecilia Band 2
1. Auflage 2019
© 2019 by Verlag A TREE & A VALLEY
Inh. Stefan Funcke
Hannah-Arendt-Str. 3–7
35037 Marburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Formlabor
Umschlagbilder: shutterstock.com/ © IvaFoto; Mayer George;
YoPixArt; lyeyee; Petrovich Igor; chuckstock
ISBN: 978-3-947357-13-0
ISBN Print: 978-3-947357-12-3
www.verlag-atav.de
Prolog
Sie war nicht mehr da. Sie war weg und ihre Abwesenheit bohrte sich wie eine Klinge in mein Herz.
Die Leere, die sie hinterlassen hatte, begann mich von der ersten Sekunde an aufzufressen.
Wie war es so weit gekommen? Wieso hatte ich nichts unternommen?
War ich nun für den Rest meines Lebens dazu verdammt, sie zu vermissen?
Ihr Haar, ihren Duft, ihre leuchtend blauen Augen?
Ich wusste, was von mir erwartet wurde.
Doch konnte ich wirklich alles vergessen? Alles, was geschehen war?
Konnte ich vergessen, dass ich sie liebte?
Ich hatte keine Antworten.
Nur eines wusste ich: Ich musste sie wiedersehen.
Kapitel 1
Marissa 16. Oktober
Es klingelte in meinen Ohren. Noch immer. Seit dem Angriff an jenem Abend war dieser Ton mein ständiger Begleiter. Er erinnerte mich in jedem Moment daran, dass meine Schwester nicht mehr bei mir war.
In den ersten Tagen nach ihrer Entführung hatte ich mein Zimmer im Palast in Vienna kaum verlassen. Es tat zu weh. Was machte sie gerade durch? Würde ich sie jemals wiedersehen? Und jeden Tag sah ich die schmerzliche Sorge um Cecilia auch in den Augen meiner Eltern. Onkel Dan hatten wir noch nicht informieren können – er war einfach nicht zu erreichen! Aber vielleicht war das ja auch besser so. Es würde ihm das Herz zerreißen, wenn er wüsste, dass Lia von den Amerikanern verschleppt worden war. So blieb er zumindest von den schrecklichen Gedanken verschont, die uns verfolgten.
Die Angst um sie lähmte uns alle. Besonders Dad. Ich beobachtete, wie er verbissen mit den Kiefern mahlte oder seine Hand so fest in den Stoff seiner Hose krallte, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten. Er strahlte etwas ungewohnt Düsteres aus. Mom fragte den König ständig, ob es neue Nachrichten von den Suchtruppen gäbe. Aber es gab nichts. Keine Spur von Lia.
Es klopfte an der Tür und kurz darauf trat meine Zofe Anna ins Zimmer.
„Wie geht es Ihnen, Miss?“, fragte sie leise und stellte einen Teller mit Obst auf meinen Nachttisch. Als ich nicht reagierte, fuhr sie fort: „Gerade habe ich mit Prinz Noran gesprochen. Der Arme muss noch eine ganze Weile im Rollstuhl sitzen wegen des angeschossenen Beins. Und er ist genauso in Sorge wie Sie.“
Ich sah sie an. Natürlich war auch Noran krank vor Sorge um seine Verlobte … genau wie sein Bruder Elias. Spätestens jetzt hatten alle im Palast bemerkt, dass Elias‘ Gefühle für Lia weit tiefer gingen, als sie es sollten. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, wurde mir klar, wie dumm ich gewesen war, zu glauben, er könne an mir Interesse haben. Und jedes Mal bohrte sich dann irgendetwas sehr Spitzes in meine Brust.
Elias hatte sich von dem Überfall der Amerikaner erholt. Lediglich die gelblich grünen Male unter seinen Augen ließen noch erkennen, dass seine Nase gebrochen gewesen war. Aber er lächelte nicht mehr. Und da war nichts Schelmisches mehr in seinem Blick. Unbeteiligt und völlig stumm saß er mir bei den Mahlzeiten gegenüber.
Ein Schluchzer entfuhr mir. Ich sprang auf, ließ Anna stehen und floh vor den Gedanken an Elias nach draußen. Im weißen Pavillon verkroch ich mich in einen der Korbsessel und starrte ins Leere. Es war frisch. Der Herbstwind wehte leichten Nieselregen unter den Pavillon, der sich auf meine Wangen setzte wie feuchter Nebel. Nur noch wenige Blumen blühten im Garten, und von früh bis spät rechten grün gekleidete Männer das Laub vom Rasen. Ich umschlang meine Knie und versuchte, mich auf das Gurren der Wildtauben zu konzentrieren, die irgendwo in den Baumkronen saßen. Doch das Bild von Cecilia in ihrem wunderschönen Verlobungskleid schob sich in meine Gedanken. Was hatten die Amerikaner nur mit ihr gemacht?
Jemand betrat den Pavillon und ich sah auf.
„Kleines?“, sagte Dad und kam näher. Mom folgte ihm. Sie hatte rot geränderte Augen und trug ein schlichtes Kostüm. Mit einem Mal schien es ihr völlig gleichgültig zu sein, was unsere Gastgeber König Julius und Königin Jocelyne von uns dachten. Sie warf einen sorgenvollen Blick auf mich, doch da war noch etwas anderes in ihren traurigen braunen Augen zu erkennen. Ärger? Irgendetwas musste geschehen sein!
„Mom? Dad? Was ist los?“, fragte ich und schluckte. Sorge krabbelte meine Wirbelsäule hinauf. „Gibt es Neuigkeiten von Lia?“
Dad setzte sich neben mich und holte tief Luft. Ein dicker Kloß bildete sich in meinem Hals.
„Marissa, wir müssen reden.“ Seine Stimme klang gefasst, doch seine Augen sprachen eine andere Sprache. Sie blickten nervös umher, während er seine Hand sanft auf meine legte.
„Was ist passiert? Geht es Lia gut? Dad! Sag schon!“ Ich hatte Mühe, die aufsteigenden Tränen zurückzuhalten. Dad nickte verhalten und es fiel ihm sichtlich schwer, die richtigen Worte zu finden. Mom schluchzte auf. Mein Magen machte einen Satz.
Dad erhob sich. „Marissa, hör zu! Was ich dir jetzt sage, ist sehr wichtig.“
Mom schluchzte erneut. Dad warf ihr einen kurzen Blick zu, sah dann aber sofort wieder zu mir. Ich stand auf und trat mit zitternden Knien zu ihm.
„Was ist mit Lia, Dad?“ Meine Stimme klang heiser. Mein Vater hatte Mühe, mir in die Augen zu sehen.
„Deine Schwester ist in Sicherheit“, sagte er. „Es geht ihr gut. Aber wir … wir sind hier nicht mehr sicher. Das mit Lia … die Situation hat sich auch für uns geändert.“
„Dad! Was bedeutet das? Was heißt, wir sind hier nicht mehr sicher?“ Panik überkam mich.
„Marissa, bitte hör doch …!“
„Werden sie wiederkommen? Werden die Amerikaner noch mal angreifen? Was haben sie mit Lia vor?“ Meine Stimme brach und ich musste schlucken. „Dad, was zum Teufel ist hier los?“
Noch einmal atmete er tief ein. Er schloss die Augen, hielt sie noch für einen kurzen Moment geschlossen, und als er wieder ausatmete und die Augen öffnete, war sein Blick klar und seine Worte eindringlicher denn je. „Marissa“, sagte er, und nun war es seine Stimme, die in meinen Ohren klingelte: „Wir sind Amerikaner!“
Kapitel 2
Cecilia 22. Oktober
Verrat. Ich hatte nicht gewusst, wie sich echter Verrat anfühlt. Mein Kopf schmerzte seit Tagen und meine Kiefer taten weh von dem ständigen Druck, mit dem ich sie fortwährend aufeinanderpresste. Und mein Herz? Es fühlte sich an, als wäre es zerbrochen. Kaputtgegangen bei dem Versuch, den Schmerz zu verkraften. Es schlug ohne Rhythmus. Ohne den geringsten Funken von Freude oder Aufregung, Spannung oder Glück. Es pumpte nur noch Blut durch meinen lädierten Körper.
Am Fenster meines Zimmers sitzend, starrte ich auf den grauen Horizont. Der Wind wehte die gelben Blätter von den großen Linden durch den Innenhof.
Ich war Amerikanerin. Keine Europäerin. Amerikanerin! Ich hatte einen amerikanischen Vater. Und er hatte mich mein Leben lang belogen. Ebenso wie Onkel Dan. Das Gefühl des Verrats kroch durch meinen Körper wie Gift. Es lähmte mich. Blendete mich. Ließ mich stumm bleiben, seit Dan in dieses Zimmer getreten war und mir seine Geschichte erzählt hatte. Eine Geschichte, die nun auch meine war, denn sie bestimmte mein Schicksal.
Ich war Amerikanerin. Aber nicht nur das. Immer wieder ließ ich im Kopf Revue passieren, was Onkel Dan mir erzählt hatte:
Vor 24 Jahren, kurz vor Ende des Krieges, hatte es eine geheime Operation der Amerikaner gegen Europa gegeben. König Matayo, der afrikanische König, sollte gerettet werden, bevor Julius und seine Truppen in den Palast von Kairo einmarschieren würden. König Lucas ließ die ranghöchsten Offiziere, seine beiden jüngeren Brüder, die Operation leiten: Und das waren Dan und Dad.
Ja, mein Vater war der Bruder des amerikanischen Königs. Royales Blut floss in meinen Adern! Genau wie bei Noran und Elias.
Beim Gedanken an die Prinzen fühlte ich sofort einen Stich in meinem Herzen. Hatten sie Bescheid gewusst? Das mussten sie doch, oder? Julius war schließlich ihr Vater. Bestimmt hatten sie gewusst, dass ihr Vater vorgehabt hatte, über mich an die amerikanische Krone zu gelangen! Und das bedeutete, dass jeder liebevolle Blick, jede Zärtlichkeit, jeder Kuss von ihnen eine Lüge gewesen war. Aber war das überhaupt möglich? Konnte man Liebe vorspielen? Über diese Frage nachzudenken war pure Folter. Es musste einfach so sein. Alles eine Lüge. Ich war dumm gewesen. So dumm. Eine andere Erklärung gab es nicht.
Dieser verdammte König Julius! Damals war er noch Kronprinz gewesen und hatte sich – genau wie Dan und Dad – nicht gescheut, selbst in den Krieg zu ziehen. Und er war es gewesen, der die amerikanische Operation zur Rettung von Matayo durchkreuzte.
Er erkannte sie. Gordon und Daniel, die Prinzen von Amerika. Mit seinen besten Männern bombardierte Julius das Versteck der Einheit meines Vaters und meines Onkels. Ihre Kameraden starben. Einer nach dem anderen. Dads Hand wurde von herabfallenden Steinbrocken eingeklemmt. Auf Julius‘ Befehl hin trennten die europäischen Soldaten meinem Vater die Hand ab. Onkel Dan war überwältigt worden und musste tatenlos zusehen. Dann wurden sie beide nach Vienna verschleppt.
Von wegen Freundschaft zwischen meinem Vater und Julius! Das war alles nur Theater gewesen. Ich ballte die Fäuste.
König Nathan, Julius‘ Vater, hatte König Lucas damit gedroht, seine Brüder umzubringen, wenn er nicht anerkennen würde, dass Afrika – um das es eigentlich in diesem fürchterlichen Krieg ging – fortan zu Europa gehöre. Lucas stimmte zu und unterzeichnete sogar ein Friedensabkommen, doch die beiden blieben dennoch in Gefangenschaft. Als Nathan wenig später starb, war die Zeit seines Sohnes Julius gekommen.
Dan hatte mir erzählt, was Julius zu ihm und Dad gesagt hatte: „Irgendwann wird es nur noch eine einzige Großmacht geben. Und einen einzigen Herrscher.“
Sein Plan war es, die Königshäuser von Amerika und Europa durch eine arrangierte Hochzeit seines Sohnes zu verbinden. Er holte Dan und Dad aus dem Kerker, stellte ihnen ein Haus und Geld zur Verfügung und wartete auf royalen Nachwuchs. Auf mich.
Wieder schüttelte es mich bei dem Gedanken: Unser Haus in Vaduz war überwacht worden! 24 Stunden am Tag. 365 Tage im Jahr. Bei dieser Vorstellung bekam ich eine Gänsehaut. Das Telefon war abgehört, die Post kontrolliert worden. Kontakt nach Amerika war unmöglich gewesen. Und das galt noch immer – für das ganze Land! Deshalb hatten wir zu Hause keinen Internetzugang gehabt. Deshalb war Dad jeden Tag zum Nachrichtenamt gelaufen, um die Post zu holen. So viele Details meiner Kindheit erschienen plötzlich in einem ganz anderen Licht. Und Mom, Marissa und ich hatten keine Ahnung gehabt!
Dan hatte gesagt, dass Dad sich zu Beginn gegen seine Gefühle für Mom gesträubt hatte. Er hatte keine Kinder bekommen wollen, um Julius‘ Erstgeborenen nicht durch eine Heirat zum Herrscher von Amerika zu machen. Wie in allen Königshäusern der Welt würde die Krone des amerikanischen Königs bei seinem Tod an den erstgeborenen Nachkommen gehen und Dad wusste, dass sein Neffe, Lucas‘ einziger Sohn, schwer krank war. Wenn er sterben würde, wäre seine eigene Tochter – ich! – die nächste in der Thronfolge – denn schon seit Jahrzehnten galt das Gesetz, dass die Krone an die nachfolgende Generation vergeben werden musste. Julius‘ eigener Sohn würde dann an meiner Seite der Herrscher eines gigantischen Imperiums werden. König Noran.
Aber Mom überzeugte Dad dann doch irgendwann, sie zu heiraten und Julius drängte ihn, Kinder zu zeugen. Er drohte ihm, ansonsten Dan und Mom zu töten. Mom hatte keine Ahnung, wer Dad wirklich war. Sie hielt ihn für Gordon Feyer, einen engen Freund des Königs. All die Jahre hatte sie nichts geahnt.
Onkel Dan, der unverheiratet war, stand nun nicht mehr im Fokus von König Julius und schließlich war es ihm irgendwie gelungen, heimlich Kontakt mit einem ehemaligen amerikanischen Kaufmann aufzunehmen. Über Jahre hinweg hatte er die Flucht unserer Familie geplant! Doch Dad sträubte sich dagegen. Seine Sorge um uns war zu groß. Er hatte Angst vor Julius‘ Verfolgung und seiner Rache.
Erst vor einigen Wochen, als es bereits beinahe zu spät gewesen war, hatte Onkel Dan sich dazu entschlossen, auch ohne das Einverständnis meines Vaters die Flucht in die Wege zu leiten. Doch nur ich war bei dem Angriff, der also eigentlich eine Rettungsaktion gewesen war, nach Amerika gebracht worden. Meine Familie war nach wie vor in den Fängen des machthungrigen Julius und die Angst um sie schnürte mir die Kehle zu. Mein Leben war ein Trümmerhaufen, und ich wusste nicht, welches der vielen Gefühle in mir am schmerzhaftesten war. Die unumgängliche Sehnsucht nach den Prinzen von Europa, die Enttäuschung über den Verrat oder die Angst um meine Familie. Aber so groß diese Angst auch war, ich war auch unbeschreiblich zornig. Der Zorn fraß sich auf eine hinterhältige Art und Weise durch meinen Körper. Ich wollte nichts kaputtmachen oder jemanden anschreien. Ganz im Gegenteil. Es war eine andere Art von Zorn. Er schien mich regelrecht auszusaugen. Er befiel nach und nach jede einzelne Zelle meines Körpers und hatte mich zu einer dünnen, blassen, kraftlosen Gestalt gemacht, die keinen Sinn darin sah, jemals wieder die Lippen zu öffnen. Seit fast zwei Wochen war ich nun stumm, und von Tag zu Tag glaubte ich weniger daran, dies jemals wieder ändern zu wollen.
Am ersten Tag hatte ich nur am Fenster gesessen. Am zweiten auch. Und an allen folgenden. Täglich kam Onkel Dan zu mir, doch ich beachtete ihn nicht. Ebenso wie ich nur spärlich aß. Viermal am Tag kam eine ältere Dame in Zofentracht mit einem Tablett voller Essen in mein Zimmer und nahm es eine halbe Stunde später meist unberührt wieder mit.
Auch heute klopfte sie wieder leise an und wartete vor der Tür auf eine Antwort, die nicht kam. Wie immer kam sie dann herein, wünschte mir einen guten Tag, machte einen Knicks und stellte das Tablett auf den kleinen Tisch vor dem Sofa. Dann ging sie wieder. Ich hatte nicht einmal aufgesehen. Ich starrte weiter auf die herumwirbelnden Blätter und hätte mich am liebsten einfach in Luft aufgelöst. Schwalbenschwärme überflogen die Dächer des amerikanischen Königspalastes. Sie schlugen Haken und trennten sich in mehrere kleine Gruppen, nur um kurz darauf wieder zu einer einzigen schwarzen Wolke zu verschmelzen. Ich beobachtete die Vögel wie hypnotisiert und wünschte mir, einer von ihnen zu sein, als plötzlich König Lucas im Raum stand. Ich hatte nicht einmal bemerkt, wie er hereingekommen war. Hatte er geklopft?
Onkel Lucas. Er war es gewesen, der mich nach meiner Ankunft als Erster hier im Zimmer aufgesucht hatte. Jetzt war mir klar, wieso er mir damals so bekannt vorgekommen war. Er sah Dad und Dan sehr ähnlich. Die gleichen Gesichtszüge und vollen Lippen. Dieselbe große, schlanke Statur und die gleichen blauen, von einem dunklen Ring eingefassten Augen wie mein Dad. Und wie ich.
„Hallo, Cecilia“, sagte er weich und kam ein paar Schritte näher. Als ich ihn nicht beachtete, stellte er sich zu mir ans Fenster und schob die Hände in die Taschen seiner Uniformhose. „Schön, nicht wahr? Die Schwalben sammeln sich jedes Jahr im Herbst über den Schlossgärten, um nach Süden zu ziehen.“
Ich antwortete nicht.
„Daniel, dein Dad und ich haben als Kinder versucht, sie zu zählen. Aber so richtig hat das nie geklappt.“ Aus dem Augenwinkel sah ich, dass er lächelte. „Dein Vater meinte immer, er hätte die meisten gezählt. Aber so war er nun einmal. Immer der Lauteste, immer das letzte Wort und immer schon der Mutigste von uns dreien.“
Ich runzelte die Stirn. Diese Beschreibung meines Vaters stand im völligen Gegensatz zu dem Mann, den ich kannte. Der mich aufgezogen hatte. Die vielen Jahre unter Julius‘ grausamer Hand mussten ihn verändert haben.
Ich spürte Lucas‘ Blick und presste wieder die Kiefer aufeinander. Ich wollte jetzt nicht hören, dass mein Vater nicht gewollt hatte, dass mein Leben so verlief. Dass er nichts dafür konnte, was Julius uns angetan hatte. Ich wollte nicht hören, dass er keine andere Wahl gehabt hatte. Denn das alles war mir bewusst. Ich konnte verstehen, dass er so gehandelt hatte. Ich wusste, dass er nur versucht hatte, seine Familie zu beschützen. Das alles wusste ich. Doch an meinem Zorn änderte es nichts.
„Wann willst du wieder mit uns sprechen? Mit Daniel?“, fragte Lucas. „Es geht ihm nicht gut. Er vermisst dich. Und deine Tante würde dich so gerne kennenlernen.“ Mein Onkel berührte mich am Arm. Ich unterdrückte den Impuls, ihm in die Augen zu schauen und konzentrierte mich weiterhin auf die Schwalben.
Er seufzte. „Bitte, Cecilia. Bitte versuch doch, Dan zu verzeihen.“
Mit diesen Worten verließ er mein Zimmer und ich starrte auf die Holztür, die sich hinter ihm schloss.
Kapitel 3
Marissa 29. Oktober
Wann sind die Koulonis abgereist?“ Der König sah nicht von seinem Teller auf, während er mit seiner Frau sprach.
„Gestern Abend. Akis meinte, dass es für Philippas Genesung besser sei, nachts zu reisen, um ihr Stress zu ersparen. Sie sollte möglichst viel schlafen“, erwiderte Königin Jocelyne mit ihrer melodischen Stimme.
Wir saßen am Frühstückstisch und ich bekam keinen Bissen hinunter. Die Worte meines Vaters klangen in meinem Kopf nach und das Klingeln in meinen Ohren quälte mich. Immer wieder starrte ich den König unauffällig an, ich konnte es nicht verhindern. Vielleicht war es so etwas wie ein Instinkt, den Feind im Auge behalten zu wollen.
Denn dieser Mann, mit dem wir Tag für Tag am Esstisch saßen, war das personifizierte Böse und meine Angst vor ihm schnürte mir die Kehle zu. Immer wenn ich in seine Augen sah.
Dads Stimme hatte gezittert, als er mir alles gebeichtet hatte. Er hat uns gefangen genommen! Er hat uns erpresst! Mit euren Leben! Er ist böse, Marissa. Wahnsinnig.
Ich kniff die Augen zusammen und hielt ein paar Sekunden lang die Luft an. Ich musste mich zusammenreißen, wir durften uns nichts anmerken lassen. Ruhe bewahren – das hatte Dad gesagt. Denn was würde Julius mit uns machen, wenn er erführe, dass auch Mom und ich Bescheid wussten?
„Marissa? Alles in Ordnung?“, fragte Elias. Erschrocken sah ich zu ihm auf. Der Blick aus seinen grünen Augen traf mich wie ein Blitz. So wie immer, wenn er mich ansah. Ich schnappte nach Luft, als ich auch den Blick des Königs auf mir spürte. Seine Augenbrauen zogen sich ein winziges Stück zusammen, bevor er schließlich zu meinem Vater sah. Dad schaute nicht auf. Er war gerade dabei, einige Kandisstückchen in seinen Tee zu löffeln. Sein Teller war leer geblieben. So wie meiner.
„Sicher!“, erwiderte ich und rang mir ein kleines Lächeln ab. „Ich vermisse Lia, das ist alles.“ Ich hörte Noran zitternd ausatmen, als ich den Namen meiner Schwester aussprach. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass er sich an die Brust griff. Elias sah kurz zu seinem Bruder und seine Miene verhärtete sich. Dann nickte er mir zu und schaute wieder auf seinen Teller.
Mom sagte nichts. Sie rührte in ihrem Joghurt herum. Ich sah, dass Dad ihr ein- oder zweimal die Hand aufs Knie legen wollte, doch Mom drückte sie unauffällig weg.
„Sonya?“, richtete Julius das Wort an meine Mutter, und sie sah erschrocken auf.
„J-Ja?“, stammelte sie.
„Wir werden Cecilia zurückholen! Das weißt du, oder? Du musst dir keine Sorgen machen.“ Julius‘ Stimme klang sanft, aber ein seltsamer Unterton schwang darin. Er sah Mom an. Eindringlich.
„Ich weiß“, gab Mom zurück und senkte den Blick wieder auf ihr Schälchen. Ein ungutes Gefühl überkam mich. So hatte Mom bisher noch nie reagiert, wenn es um Lia ging. Sie wollte Einzelheiten. Drängte Julius ständig, irgendetwas zu unternehmen. Und jetzt so eine Antwort! Ich konnte kaum atmen, als mein Blick von Mom zum König schwang, der sie noch immer musterte. Dann sah er zu mir. Ich konnte nicht anders, ich musste wegsehen. Gänsehaut überkam mich. Angst breitete sich in mir aus, unter dem Tisch verkrampften sich meine Finger. Julius bewegte sich nicht, sein Blick lag noch immer auf mir. Auch Mom schien jetzt zu bemerken, dass etwas nicht stimmte. Sie atmete unruhig und griff langsam nach meiner Hand. Ihre Finger waren eiskalt. Als ich endlich eine Bewegung aus Julius‘ Richtung registrierte, sah ich vorsichtig auf. Er legte sein Besteck neben den Teller, ganz ruhig. Besonnen. Langsam griff er nach einer Serviette und fuhr sich über den Mund. Er faltete das Stück Stoff und legte es neben seinen Teller. Während er das tat, schaute er meinen Vater an. Dad hielt dem Blick stand und rührte sich keinen Millimeter. Julius lehnte sich im Sessel zurück. Die Finger seiner rechten Hand tippten auf dem Tisch. Ein kleines Grinsen legte sich auf seine Lippen. Er schnaubte durch die Nase und lehnte sich dann wieder ein Stück vor. Er sah Dad noch ein paar Sekunden an, dann sagte er mitten in die Stille: „Sie wissen es, richtig?“
Kapitel 4
Cecilia 10. November
Ein ganzer Monat war inzwischen vergangen. Ein einsamer Monat. Ein stummer Monat.
Ich stand in ein Handtuch gewickelt vor meinem Badezimmerspiegel und betrachtete mein Spiegelbild. Hängende Schultern, eingefallene Gesichtszüge, rote Augen. Meine Schlüsselbeine ragten deutlich hervor. Ich hatte abgenommen. Kein Wunder. Ich aß kaum etwas und ich hatte seit Wochen keine frische Luft mehr geatmet.
Es war noch früh. Jedenfalls glaubte ich das, denn auch mein Zeitgefühl hatte sich längst wie von selbst auf eine lange Liste unwichtiger Dinge gesetzt. So wie alles andere. Tag für Tag hatte ich am Fenster gesessen oder im Bett gelegen. Hatte auf keinen von Onkel Dans Versuchen, mich zurück in die Wirklichkeit zu holen, auch nur reagiert. Ich wollte mit meinem Kummer allein sein. Erst einmal selbst verstehen, was geschehen war, bevor ich mit jemand anderem darüber sprach. In den letzten Tagen war Dan dann nicht mehr bei mir gewesen. Hatte er die Hoffnung aufgegeben, mich wieder zum Sprechen zu bringen?
Doch etwas war anders heute. Ich hatte geträumt!
Nicht von Rauch, Geschrei und Blut, sondern von meiner Schwester! Keine Ahnung, warum mein Unterbewusstsein mir ausgerechnet heute Nacht diese Erinnerung geschickt hatte. In meinem Traum waren Marissa und ich noch Kinder gewesen. Sie vielleicht neun und ich zehn Jahre alt. Es war Sommer in Vaduz und wir spielten im Garten unseres Hauses. Mom und Dad waren nicht zu Hause. Von drinnen waren die lauten Stimmen von Yvette und Tanja zu hören, die sich zankten. Marissa saß auf der hölzernen Schaukel, die Dad uns vor einigen Jahren gebaut hatte. Sie schwang vor und zurück und sang dabei eines ihrer Lieblingslieder. Ich selbst saß ein paar Meter entfernt auf dem Rasen und versuchte, einen Haufen Gänseblümchen in einen Blumenkranz zu verflechten. Doch irgendwie wollte es mir nicht so recht gelingen. Immer wieder rissen die Stiele ab oder die Knoten wollten einfach nicht richtig halten. Marissa schaukelte und schaukelte – immer wenn sie nach vorne schwang, wehte ein kleiner Windhauch in mein Gesicht.
„Lia! Guck mal, wie hoch ich bin!“, rief sie fröhlich zu mir herüber, doch ich konnte gerade nicht aufsehen. Diese verflixten Blumen!
„Lia! Guck doch mal!“, rief sie wieder.
„Gleich, Marissa!“, rief ich zurück, ohne den Blick von meinen Fingern zu lösen.
„Lia! Ich komme fast an den Ast vom Kirschbaum dran!“
„Mist!“, murmelte ich, während ich den hundertsten Versuch machte, das Gänseblümchen festzuknoten.
„Lia, guck, ich …“, begann Marissa erneut. Dann hörte ich ein lautes Kreischen, gefolgt von einem dumpfen Aufschlag. Ich ließ den Kranz fallen und sprang auf. Meine Schwester lag auf dem Rasen. Ich rannte zu ihr, ließ mich neben sie ins Gras fallen und drehte ihren Kopf in meine Richtung. Ein paar Sekunden lang lag sie nur da und hatte die Augen geschlossen. Panik überkam mich.
„MOM! MOM, KOMM SCHNELL!“, brüllte ich durch den Garten, obwohl ich wusste, dass sie nicht zu Hause war. Dann öffnete Marissa die Augen und hielt sich heulend den rechten Arm.
„Was ist passiert?“, hörte ich Tanjas raue Stimme. Sie und Yvette eilten zu uns in den Garten.
„Sie ist von der Schaukel gefallen, sie war zu hoch, sie …“, versuchte ich zu erklären, während mir die Tränen in die Augen schossen.
„Lia! Du weißt doch, dass ihr nicht so hoch schaukeln sollt. Das ist gefährlich! Du bist die Ältere! Du solltest auf deine Schwester achtgeben!“, rief Yvette und schob mich zur Seite, damit sie Marissas Verletzung begutachten konnte. Schluchzend starrte ich in das schmerzverzerrte Gesicht meiner kleinen Schwester. Das schlechte Gewissen traf mich wie ein eiskalter Wasserstrahl.
„Der Arm scheint gebrochen zu sein“, sagte Yvette. „Du rufst die Lady an. Ich trage sie ins Haus“, befahl sie Tanja, und das erste Mal schien die dicke Köchin keinen Einspruch erheben zu wollen. Ich stand noch immer mit wild pochendem Herzen im Garten und schaute zu, wie Yvette, Tanja und meine weinende Schwester im Haus verschwanden.
In diesem Moment war ich aufgewacht – aber ich erinnerte mich, dass ich mir selbst ein Versprechen abgenommen hatte. Ich würde immer auf meine Schwester aufpassen. Ich würde sie beschützen. Ich war die Ältere und es war meine Aufgabe, auf sie achtzugeben.
Ich hatte eine Aufgabe! Ich hatte eine jüngere Schwester, die ich beschützen musste. So wie ich es mir damals geschworen hatte. Es half Marissa nicht, wenn ich weiterhin in diesem Zimmer herumsaß. Ich musste etwas unternehmen!
Als die ältere Zofe mit dem Frühstück an meine Zimmertür klopfte und eintrat, konnte ich ihr die Überraschung im Gesicht ablesen. Zum ersten Mal saß ich nicht zusammengesunken am Fenster oder vegetierte in meinem Bett vor mich hin. Ich stand mitten im Zimmer und schaute sie das allererste Mal richtig an. Ich musste an Gini denken. Auch wenn sie ihr überhaupt nicht ähnlich sah. Vor ein paar Wochen noch war Gini es gewesen, die mich versorgt und sich um mich gekümmert hatte. Nun war sie Tausende Kilometer entfernt.
Die Frau fing sich schnell wieder und stellte das Tablett auf dem Tisch ab. So wie sie es jeden Tag getan hatte, seitdem ich hier war. Ich beobachtete sie, wie sie mit einem freundlichen Lächeln die Tür hinter sich schloss, und ging dann mit langsamen Schritten zur Couch.
Ich zwang mich, den Teller mit Rührei und Würstchen komplett leerzuessen und trank das Glas Orangensaft in einem Zug aus. Dann stand ich auf, atmete tief durch und ging zur Tür. Ich würde Dan suchen und mit ihm sprechen. Es war höchste Zeit.
Der lange Flur, auf den ich nun trat – unsicher, in welche Richtung ich gehen sollte – war mit blauem Teppichboden ausgelegt und an den Wänden hingen Gemälde von irgendwelchen Adligen. Es gab keine Fenster, aber unzählige silberne Kronleuchter. Die wenigen Zofen, Diener und Wachen, denen ich begegnete, beäugten mich interessiert und verneigten sich kurz, als ich vorbeiging. Ich war eine Prinzessin. Ihre Prinzessin. Dieser Gedanke fühlte sich in meinem Kopf immer noch fremd an. Genau wie sich auch nach den vielen Wochen die Kleider noch nicht vertraut anfühlten, die ich trug. Leider hatte ich bei meiner unfreiwilligen Abreise aus Vienna ja keinen Koffer packen können. Die Kommoden in meinem Zimmer waren größtenteils gefüllt mit Hosen, Blusen, Hemden und knielangen Röcken. Von aufwendig bestickten Ballkleidern keine Spur. Das war seltsam. War dies nicht ein Palast? Und ich eine Prinzessin? Glücklicherweise hatte ich beim Durchwühlen der Schubladen auch eine Jogginghose gefunden. Ähnlich meiner eigenen. Sie erinnerte mich an Zuhause und meine Familie. Ich trug kaum noch etwas anderes. Doch für meine heutige Mission hatte ich mir eine der fremden schwarzen Hosen und eine dunkelgrüne Bluse herausgesucht. Eigentlich war es ohnehin völlig egal, was ich trug.
Der Flur endete an einer breiten Treppe mit einer Galerie. Ich wurde von weißem Marmor geblendet. Die Galerie war mit Glas überdacht, das den Blick in den grauen Himmel freigab. Es roch nach Rosen und Freesien. Gigantische Blumenvasen säumten die Stufen der Treppe. Von ihnen ging dieser sanfte Duft aus.
Ich nahm einen Absatz nach dem nächsten. Eine Etage, zwei Etagen, drei Etagen, dann kam das Erdgeschoss. Das bedeutete, dass sich mein Zimmer im vierten Stock befand. Die große Halle, in der ich jetzt stand, war ebenfalls mit Marmor gefliest. Auf den Bodenplatten vor dem Treppenabsatz war das Wappen der Amerikaner eingemeißelt: Ein aufgerichteter Bär auf blauem Grund. Auch der Marmor war hier in den verschiedenen Blautönen eingefärbt worden. Ich starrte einen Moment auf das große Tier und den Schriftzug darunter.
Ich bin der Kompass – und der Pfad.
Ein merkwürdiger Leitsatz. Was sollte er bedeuten? Onkel Dan hatte von Lucas‘ Großherzigkeit und seinem Sinn für Gerechtigkeit erzählt. Von seiner Klugheit und seiner Fähigkeit, stets das Gute in einem Menschen zu sehen. Für Lucas gäbe es Licht, wo andere nur Schatten sähen. Er würde führen, wo es sonst niemand könnte. Das komplette Gegenteil von dem König Lucas, den Julius uns beschrieben hatte! Auch wenn ich nicht reagiert hatte, waren Onkel Dans Worte mir unter die Haut gegangen und unwillkürlich hatte ich mich gefragt, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn ich hier in Amerika, im Palast von Chicagon, aufgewachsen wäre. Mit nicht nur einem Onkel, sondern mit zweien. Mit einer Tante und einem Cousin. Als Prinzessin.
Ich atmete tief ein.
„Jaja, große Töne spucken können die Amis“, sagte plötzlich jemand neben mir.
Ich drehte mich ruckartig um und schaute in ein Paar helle, blaue Augen, die einem jungen Mann gehörten, der etwa in meinem Alter zu sein schien und recht langes braunes Haar hatte. Er war groß, aber weniger breit als … als Noran oder Elias! Der Gedanke an sie stach in meiner Brust.
Der junge Mann wirkte beinahe schmächtig, die schwarze Hose und das rostrote Oberteil saßen locker an seinem Körper. Zwei winzig kleine Schläuche gingen von seiner Nase über seine Wangen und verschwanden dann hinter seinen Ohren, unter den langen Haaren.
„Oh, entschuldige! Hab vergessen … du bist ja auch eine von denen. Oh, und ich selbst wohl auch!“, sagte er grinsend und zwinkerte mir zu. Stumm starrte ich ihn an. Ich wusste, wer er war – er sah seinem Vater unglaublich ähnlich.
„Stimmt ja! Du hast deine Stimme verloren!“, fuhr er fort. „Aber trotzdem … Hey, ich bin Sam.“ Er hielt mir seine dünne Hand hin und lächelte mich offen an. Ich hatte keine Ahnung, woran es lag, aber irgendetwas in seinem Blick fühlte sich warm an. Ich hatte seit Wochen nicht gesprochen. Nicht mit Onkel Dan oder Lucas und auch mit sonst niemandem. Doch dieser Junge, mein Cousin, schaffte es nur durch seinen Gesichtsausdruck, dass ich mir deswegen dumm vorkam.
„E-Entschuldige, ich wollte dich nicht anstarren“, erwiderte ich leise und ergriff seine Hand. Der Klang meiner Stimme war ungewohnt und rau. Ich räusperte mich kurz.
„Kein Problem. Passiert mir dauernd.“ Er verschränkte die Arme und musterte mich interessiert. Ich spürte, wie meine Wangen ein wenig wärmer wurden.
„Du siehst ziemlich scheiße aus, weißt du das?“, fragte er und zog die Augenbrauen hoch. Ruckartig hob ich den Kopf.
„Wie bitte?“
„Du siehst scheiße aus!“, wiederholte mein Cousin und grinste schief. „Du bist zu dünn und ziemlich blass. Wenn man dich so sieht, denkt man ja, du schuftest den ganzen Tag in einer Dosenfabrik.“
Ich hob ungläubig eine Augenbraue und ohne es zu wollen, zuckten meine Mundwinkel ein winziges Stück nach oben. Er selbst sah schließlich nicht viel besser aus!
„Du könntest ja deine wiedergewonnene Stimme dazu nutzen, den Leuten zu sagen, was du gerne essen möchtest. Die machen dir hier alles, was du willst, glaub mir! Und ein paar Kilo mehr würden dir echt nicht schaden.“
Jetzt musste ich wirklich grinsen. Dieser Kronprinz war frech. Aber genau das gefiel mir. Er verstellte sich nicht.
„Danke für den Tipp, Eure Hoheit“, erwiderte ich und verschränkte nun ebenfalls die Arme vor der Brust.
„Wie kommt‘s, dass du deinen Eichhornkobel verlässt und hier herumstreunerst?“, fragte Sam. Diese lockere Art – sie erinnerte mich an … Verflucht!
„Ich muss mit Onkel Dan sprechen“, gab ich zurück und hoffte, dass Sam mir mein schweres Herz nicht ansah. Aber vermutlich musste man schon blind sein, um nicht zu erkennen, dass ich ein einziges Häufchen Elend war.
„Kluge Entscheidung! Weißt du, hier wurden schon Wetten darüber abgeschlossen, wann du wohl endlich rauskommst. Welchen haben wir heute? Den 10., oder? Mist! So knapp!“
Ich starrte ihn an. „Wetten?“
„Jap, irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben, wenn man Krebs hat und fast nichts machen darf.“
Ich schluckte. Er stupste mich an und redete weiter: „Oh, entschuldige! Ich hätte dich vorwarnen sollen. Krebs ist ätzend, aber keine Sorge, noch habe ich den Krebs und nicht andersherum, verstehst du?“
Also, dieser Kerl war echt unglaublich! Jetzt seufzte er. „Weißt du, ich will ein ganz normales Leben führen. Ich krieg zu viel, wenn ich von allen Seiten bemitleidet oder bevorzugt behandelt werde. Na ja, letzteres habe ich wohl in die Wiege gelegt bekommen, aber das sollte nie mit meinem Gesundheitszustand zusammenhängen, okay? Also gewöhn dich dran, dass ich vorlaut bin und sarkastisch. Ach ja! Und ich mag es, zu wetten!“
Wie konnte ein todkranker Mensch so eine Lebensfreude haben? Und sie war noch dazu irgendwie ansteckend.
„Also, kannst du damit umgehen?“, fragte er und studierte mein Gesicht.
„D-Damit umgehen? Sicher!“, stammelte ich. Was sollte ich auch sonst sagen?
„Gut! Also dann … was machen wir?“
Er vergrub die Hände in die Hosentaschen und wippte auf den Fußballen leicht vor und zurück.
„Was wir machen?“ Nervös strich ich mir eine Strähne meines ungekämmten Haars hinters Ohr.
„Hast du einen Papagei gefrühstückt? Oder warum wiederholst du alles? Worauf hast du Lust? Wie kriege ich es hin, dass du wieder wie ein Mensch aussiehst?“
„Ich … ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich zu Onkel Dan …“, sagte ich. Plötzlich war ich wieder unsicher.
„Der ist nicht da“, erwiderte Sam.
„Was soll das heißen? Wo ist er denn?“, wollte ich wissen. Sam legte den Kopf etwas schräg und sah mich an, während er auf der Innenseite seiner Wange herumkaute.
„Dir hat echt noch niemand etwas gesagt, oder?“, fragte er und ich wurde nervös. Dass mir niemand etwas erzählt hatte, konnte man so nicht sagen. Schließlich war mein Leben vor einigen Wochen komplett auf den Kopf gestellt worden durch ihre Erzählungen. Was würde denn nun noch folgen? Wo war Dan?
Sam fuhr fort: „Onkel Dan ist in Australien.“ Als er sah, wie ich mich völlig geschockt auf die Treppenstufen sinken ließ, setzte er sich neben mich und legte sanft seine Hand auf mein Bein. „Cecilia, Onkel Dan ist nach Australien geflogen. Zu unserer Großmutter. Sie lebt dort. Dan wollte seine Mutter nach seiner Rückkehr natürlich unbedingt sehen. Immerhin konnte er das Jahrzehnte lang nicht tun. Und da du noch nicht bereit warst, ihm zu verzeihen, hat er sich entschieden, dir noch etwas Zeit zu geben und erst einmal sie zu besuchen. Sie will dich unbedingt kennenlernen. Dan wird sie kurz vor Weihnachten hierherbegleiten und –“
„STOPP!“, rief ich dazwischen und hob die Hände. Ich starrte Sam mit weit aufgerissenen Augen an. Hatte ich da gerade richtig gehört?
„Großmutter?“, wiederholte ich das Wort, das wie ein Paukenschlag in meinem Kopf vibrierte. Ich hatte eine Großmutter? In Australien? Dad hatte immer erzählt, dass seine Eltern noch vor meiner und Marissas Geburt gestorben waren. Ich hatte keinen Grund gehabt, ihm nicht zu glauben.
„Du hast sicher eine Million Fragen, hä?“, erwiderte Sam und lächelte schief. Ich wollte etwas sagen, doch es kam kein Ton aus meinem Mund. Sam erhob sich. Noch immer in einer Art Schockstarre gefangen, folgten meine Augen seiner dünnen Gestalt durch die Halle. Er lief hinüber zu einer Apparatur an der Wand. Sie sah aus wie ein Klingelknopf. Als Sam draufdrückte, hörte ich ein leises Summen und zehn Sekunden später stand eine junge Zofe vor uns. Sie machte einen tiefen Knicks.
„Bitte besorgen Sie der Prinzessin einen Mantel“, sagte Sam, noch immer grinsend. „Sehr wohl, Eure Hoheit“, erwiderte das Mädchen und verschwand.
Ich sah Sam stirnrunzelnd an. „Einen Mantel?“
Kapitel 5
Cecilia
Es dauerte nicht lange, bis das Mädchen zurück war und ich in einem weichen dunkelblauen Mantel steckte. Sam führte mich zur Rückseite des Palastes und hielt mir die Tür auf. Er zwinkerte verschmitzt und zusammen traten wir hinaus in die kalte Novemberluft.
„Nun erzähl schon!“, forderte ich meinen Cousin auf. „Ich habe eine Großmutter? Wie ist sie so? Wie sieht sie aus? Und warum lebt sie in Australien und ist nicht hier? Wieso hat mir niemand etwas gesagt, verdammt?“
„Immer mit der Ruhe“, antwortete Sam und grinste. „Ich werd dir alles sagen, aber zuerst …“ Sam blickte geradeaus. Wir standen vor einem riesigen See. Er war so groß, dass ich das andere Ende nicht sehen konnte. Zumindest nicht durch den weißen Nebel, der über der Oberfläche waberte. Ich warf einen Blick zurück und erst jetzt wurde mir bewusst, in was für einem beeindruckenden Gebäude ich mich die ganze Zeit über aufgehalten hatte.
Das amerikanische Königshaus sah völlig anders aus als der Palast von Vienna.
Es hatte keine Türme, aber dafür riesige Vorbauten, die kunstvoll an das Hauptgebäude anschlossen. In der Mitte erkannte ich das Glasdach über der Galerie und stellte fest, dass es sich dabei um eine riesige Kuppel handelte. Der prunkvolle Garten, durch den wir eben gegangen waren, musste im Sommer einen wunderschönen Anblick bieten. Ob es auch Tennisplätze gab? So wie in Vienna? Meine Gedanken schweiften zu einem ganz besonderen Kuss. Meinem ersten mit Noran. Schnell schüttelte ich die schmerzhaften Erinnerungen ab und sah mich weiter um.
Auf der rechten Seite des Palastes erkannte ich den Eingang zu einem Labyrinth aus grünen Hecken, auf der linken Seite ein Schwimmbecken, das bereits für den Winter abgedeckt worden war. Und daneben lag tatsächlich ein Tennisplatz!
„Schön, nicht wahr?“, sagte Sam. „Wenn du etwas früher aus deinem Kobel gekommen wärst, dann hättest du das Ganze auch im Sonnenschein bewundern können. Das ist nämlich noch viel besser“, fügte er hinzu und steckte zufrieden die Hände in die Hosentaschen.
Ich zuckte kurz mit den Schultern und lächelte ihn an. „Und … du hast jetzt vor Schwimmen zu gehen, oder was?“
„Meine Sauerstoffbox ist leider nicht wasserdicht!“, antwortete Sam grinsend und deutete auf einen kleinen Kasten, der an seinem unteren Rücken befestigt war. Dann ging er ein paar Schritte weiter zu einer kleinen weißen Holzhütte. Für einen Moment tat er mir leid. Es musste schrecklich sein, wenn man von seinem eigenen Körper derart im Stich gelassen wurde. Ich schüttelte das Gefühl ab. Schließlich hatte er deutlich gesagt, was er von Mitleid hielt.
„Hey! Ich hab dir ein paar Fragen gestellt!“, rief ich ihm hinterher.
„Jaja! Gleich! Ich hab hier noch was für dich!“, gab er zurück, als er in die Hütte verschwand und ein paar Sekunden später wieder heraustrat.
„Angeln?“ Ich verzog das Gesicht.
„Klar! Hast du das noch nie gemacht? Es ist toll!“, erklärte er und drückte mir eine der zwei langen Angelruten in die Hand.
Ich hatte schon einmal geangelt – und war froh, dass ich es seitdem nicht noch einmal hatte tun müssen. Es war mit Onkel Dan gewesen. Er hatte vorgeschlagen, das Abendessen selbst zu fangen. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso keinen Fisch mochte, hatte ich mich auch noch komplett dämlich angestellt. Ich hatte es nie geschafft, die Köder richtig zu befestigen, war genervt gewesen von der langen Warterei und als dann tatsächlich mal einer angebissen hatte, glitschte mir der Fisch durch die Finger, fiel wieder ins Wasser und ich hinterher.
Ich seufzte und kaute auf meiner Lippe. Sam schien meine Skepsis zu bemerken und stupste mich an. „Ach, komm schon! Probier‘s wenigstens! Es gibt nicht viel, was ich machen kann.“ Er legte einen herzerweichenden Blick auf.
„Hey! Ich dachte, du willst nicht bemitleidet werden“, erwiderte ich gespielt vorwurfsvoll. Er grinste.
„Na ja, ab und zu ein kleiner Bonus ist ja wohl drin, oder?“
Ich musste lachen. Ja, ich lachte tatsächlich. Zum ersten Mal seit Wochen. Und vielleicht konnte mein durchgeknallter Cousin mir beim Angeln ja ein paar Informationen geben, die mir helfen würden, so etwas wie einen Plan zu machen. Einen Plan, um meine Familie wiederzubekommen. Irgendetwas musste ja geschehen. Irgendetwas musste ich unternehmen.
„Na schön!“, sagte ich. „Aber ich leiste dir nur Gesellschaft!“ Ich legte die Angel ins feuchte Gras.
„Das ist ein Anfang!“, rief er fröhlich. „Hilfst du mir mit den Stühlen?“
Wenig später saßen wir nebeneinander und ich beobachtete, wie die Angelschnur kleine ringförmige Miniwellen auf der Wasseroberfläche hinterließ. Bis auf das gelegentliche Vogelgezwitscher war es vollkommen still. Schließlich sah ich zu Sam und zog die Augenbrauen hoch. Eine stumme Aufforderung, die er hoffentlich verstand. Sein Blick traf meinen und er lachte.
„Okay, okay!“ Er fummelte kurz an den kleinen Schläuchen in seiner Nase. Dann erzählte er endlich: „Also, unsere Großmutter – sie heißt übrigens Thea – lebt schon lange in Australien. Mittlerweile gute zehn Jahre. Sie hatte verschiedene Gründe, dorthin zu gehen. Zum einen brauchte sie, glaube ich, einfach Abstand zu Amerika. Sie wusste, dass mein Vater regierungsmäßig alles im Griff hatte. Sie musste ihn also nicht mehr unterstützen. Vor allem aber vermisste sie Onkel Dan und deinen Dad. Das konnte sogar ein Blinder sehen. Sie mied die Gemächer der beiden. Vermied es, über sie zu sprechen. Ja, sie konnte nicht einmal Bilder der beiden ansehen, ohne in Tränen auszubrechen. Ihre Söhne waren schon seit Jahren fort, aber sie kam einfach nicht damit klar. Und alles in diesem Palast erinnerte sie an die beiden.“ Sam stoppte kurz und warf seine Angel neu aus.
Die Entscheidung meiner Großmutter beeindruckte mich. Als verwitwete Frau mutterseelenallein auf einen anderen Kontinent zu gehen? Sie musste ziemlich taff sein. Aber sie tat mir auch leid. Ich hatte nichts von ihr gewusst, daher hatte ich sie auch nicht vermissen können. Sie hingegen hatte die letzten vierundzwanzig Jahre Angst und Sorge um zwei ihrer Söhne haben müssen.
„Sie mochte Australien schon immer und hatte es vor dem großen Krieg oft besucht. Onkel Dan wäre sogar beinahe dort geboren worden. Das hat sie mir irgendwann mal erzählt. Sie war schwanger mit ihm und er kam wohl eine ganze Weile zu früh. Sie waren gerade auf dem Rückflug, als die Wehen einsetzten“, erzählte Sam und ich zog überrascht die Augenbrauen hoch.
„Nun ja, und weil sie Australien so sehr liebt und sie wirklich Abstand zu Amerika und vermutlich auch zu uns brauchte, die wir sie immer an Dan und Gordon erinnert haben, hat sie nach der Befreiung beschlossen, sich dort auf eine Plantage zurückzuziehen. Eine Obstplantage. Mangos, glaube ich.“ Ich horchte auf. Mit Sams Erwähnung der Befreiung Australiens kam mir sofort meine Recherche in der Bibliothek von Vienna in den Kopf. Ich musste nachhaken.
„Was ist damals wirklich passiert? Also … vor zehn Jahren. In Australien?“, fragte ich. Mittlerweile war mir klar geworden, dass in Julius‘ manipulierten Aufzeichnungen nichts weiter als Lügen zu finden waren.
„Der afrikanische König Matayo Nayashga wurde nach dem Krieg nach Australien geschickt. Aber es war kein Exil – sie sind gefoltert und misshandelt, ausgehungert und gequält worden. Matayos Frau ist bereits nach wenigen Monaten gestorben. Seine sechzehnjährige Tochter zwei Jahre später, bei der Geburt ihres Sohnes.“
Ich stutzte. Ein Kind mit sechzehn? In Gefangenschaft?
„Ist sie … Ich meine, wurde sie etwa von jemandem …?“
Sam nickte. Es lief mir eiskalt den Rücken herunter.
„Nur der afrikanische König und sein Enkelsohn überlebten. Als Amerika sich dann vor zehn Jahren die Herrschaft über Australien erkämpft hatte, um den afrikanischen König zu befreien, war der Junge zwölf Jahre alt und völlig traumatisiert. Und ich meine wirklich traumatisiert. Das Kind war völlig irre. Verständlicherweise. Mein Vater erzählte Grandma von Matayos Zustand und dem des Jungen. Sie flog kurz nach der Befreiung nach Australien, um mit Matayo zu sprechen. Die beiden kannten sich schon ewig. Beide waren sie einmal Herrscher mächtiger Nationen gewesen. Kurz nach ihrem Treffen mit Matayo entschied sie sich dann endgültig für einen Umzug nach Australien. Sie half Matayo und seinem Enkel, sich von der jahrelangen Gefangenschaft zu erholen. Sie ließ ihnen ein Haus gleich neben ihrer Plantage bauen. Praktisch hat sie den Jungen großgezogen. Und ich denke, das hat nicht nur ihm geholfen, sondern auch Grandma.“ Sam schaute auf den See hinaus. „Aber natürlich hat sie ihren armen todkranken Enkel über die Jahre nicht völlig vergessen!“ Jetzt grinste er wieder. „Zweimal im Jahr kommt sie nach Amerika und wir sind für ein paar Wochen ihren Launen ausgesetzt.“
Ich lächelte ihm kurz zu, dann sah auch ich wieder auf das Wasser. So viel ging mir durch den Kopf. All die Lügen, die Julius erzählt hatte. Das Leid, dass die arme Königsfamilie von Afrika hatte durchmachen müssen. Meine Großmutter. Dan, der gerade bei ihr war. Auf der anderen Seite der Welt. Ich begriff es noch immer nicht vollständig. Ich atmete tief durch und für eine ganze Weile wagten weder Sam noch ich, die Stille über dem See zu stören.
„Weißt du, dass es echt hart war, die ganze Zeit auf dich zu warten?“, fragte Sam irgendwann. „Mir war schon klar, dass du Zeit brauchen würdest. Darum hab ich auch auf ein spätes Datum gewettet. Na ja, eigentlich gab es da noch einen anderen Grund, aber egal. Ich hatte trotzdem die kleine Hoffnung, dass es nicht so wahnsinnig lange dauern würde. Ich war verdammt neugierig auf meine Cousine aus Europa, weißt du? Jetzt erzähl mal von dir, ja?“
Ich hörte das Lächeln in seiner Stimme. „Was soll ich denn erzählen?“, fragte ich ihn. Sam atmete tief ein. „Am besten alles! Ich bin gespannt, was bei euch da drüben wirklich passiert ist. Ich weiß nämlich nur, was mein Vater mir erzählt hat, und das ist nicht wirklich viel. Er will mich schonen und hält mich deshalb aus allem raus.“
„Was hat er denn erzählt?“ Gespannt sah ich Sam an und bemerkte, wie sich seine Augenbrauen zusammenzogen.
„Na ja, dass König Julius vorhatte, dich gegen deinen Willen mit seinem Sohn zu verheiraten. Weil er scharf auf die amerikanische Krone ist. Er denkt, dass ich bald draufgehe und dann hätte er nur noch meinen Vater aus dem Weg räumen müssen, damit du zusammen mit seinem Sohn den Thron hättest besteigen können.“
„Dann weißt du doch schon alles“, erwiderte ich kurz und schob schnell das Bild von Noran und mir als Königspaar wieder aus meinem Kopf.
„Von wegen! Ich will genau wissen, was da gelaufen ist – ist Noran wirklich so schlimm wie sein Vater? Und er hat doch auch noch einen Bruder, oder?“, fragte er.
Oh ja, Noran hatte einen Bruder. Mein Herz krampfte sich zusammen.
„Ich will nicht über die beiden reden“, erwiderte ich und vergrub die Hände zwischen meinen Beinen, um sie zu wärmen. Noch immer zermarterte ich mir den Schädel, ob und wie viel Elias und Noran von der ganzen Sache gewusst hatten. Nichts? Ein wenig? Alles? Diese Ungewissheit machte mich wahnsinnig.
Sam sah mich fragend an. „So schlimm?“
Ich nickte. „Auf welchen Tag hast du gesetzt?“, wechselte ich das Thema.
„Was?“ Er verstand nicht sofort.
„Na, die Wette! Auf welchen Tag hast du gesetzt?“
Jetzt grinste er. „Auf den 13. November.“
„Und wieso gerade auf diesen Tag?“
„Darüber möchte ich nicht reden.“ Er grinste schelmisch und ich gab ihm einen kleinen Hieb auf den Oberarm.
„Autsch! Du schlägst deinen todkranken Cousin? Was stimmt nicht mit dir?“
Ich musste wieder lachen. Sam lächelte zurück und zwinkerte mir zu.
„Okay, wie wäre es mit einer neuen Wette?“, fragte ich. Sein Kopf fuhr herum und sein Gesicht erhellte sich.
„Klar!“, sagte er. „Worum geht’s?“
„Wenn du es nicht schaffst, innerhalb der nächsten Stunde einen Fisch zu fangen, dann erzählst du mir vom 13. November“, schlug ich vor.
„Und wenn ich es schaffe? Dann darf ich dich nach Noran und seinem Bruder fragen!“
Ich schaute eine Weile auf den glatten See, seufzte dann und nickte. Vielleicht würde es mir ja helfen, über alles zu reden.
Sam jubelte und begann sofort, den größten und besten Köder aus der Dose zu fischen. Der Geruch war widerwärtig.
Ich konnte es nicht fassen! Drei Minuten bevor die Stunde um war, biss doch tatsächlich ein Fisch an!
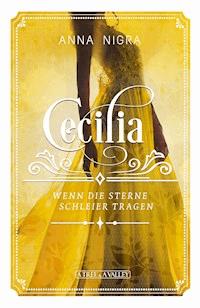
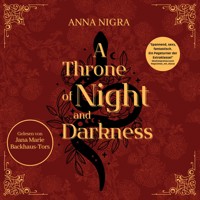















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











