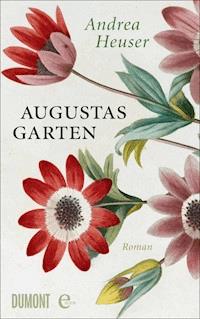10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Köln 1952: Der Krieg ist noch nicht lange vorüber, als Wilhelm im Zimmer einer Wohnung steht, in das er eine Wand einziehen soll. Ein Auftrag, auf den der Handwerker sich keinen Reim machen kann, wo die Wand doch Licht wegnehmen wird. Die Bewohner aber, Margot und ihr Sohn Fred, gehen ihm danach nicht mehr aus dem Kopf. Margot ist Luxemburgerin und stammt aus großbürgerlichem Milieu, doch als sie mit siebzehn ein uneheliches Kind erwartet, steht sie vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie muss ihre Heimat verlassen und ist mitten im Krieg auf sich allein gestellt. Als sie Jahre später nach Köln kommt, hat Margot Schuld auf sich geladen, und auch Wilhelm hat der Krieg traumatisiert. Wilhelm, Margot und Fred sind Verlorene – auf der Suche nach einem Zuhause, wie kein Ort es einem bieten kann. Also suchen sie das Zuhause beieinander, ohne zu wissen, ob dieses fragile Gebilde namens Familie halten wird. In ihrem autobiografisch grundierten, generationenübergreifenden Roman erzählt Andrea Heuser von Schuld und Verdrängung, dem Wunsch nach Verwurzelung und einem Leben im Modus der Suche und des Weitermachens. ›Wenn wir heimkehren‹ ist gleichermaßen Gesellschaftsepos, psychologisch nuancierte Familien- und bewegende Liebesgeschichte. Ein großer, poetischer, ebenso tiefgründiger wie anrührender Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Köln 1952: Der Krieg ist noch nicht lange vorüber, als Wilhelm im Zimmer einer Wohnung steht, in das er eine Wand einziehen soll. Ein Auftrag, auf den der Handwerker sich keinen Reim machen kann, wo die Wand doch Licht wegnehmen wird. Die Bewohner aber, Margot und ihr Sohn Fred, gehen ihm danach nicht mehr aus dem Kopf.
Margot ist Luxemburgerin und stammt aus großbürgerlichem Milieu, doch als sie mit siebzehn ein uneheliches Kind erwartet, steht sie vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie muss ihre Heimat verlassen und ist mitten im Krieg auf sich allein gestellt. Als sie Jahre später nach Köln kommt, hat Margot Schuld auf sich geladen, und auch Wilhelm hat der Krieg traumatisiert. Wilhelm, Margot und Fred sind Verlorene – auf der Suche nach einem Zuhause, wie kein Ort es einem bieten kann. Also suchen sie das Zuhause beieinander, ohne zu wissen, ob dieses fragile Gebilde namens Familie halten wird.
In ihrem autobiografisch grundierten, generationenübergreifenden Roman erzählt Andrea Heuser von Schuld und Verdrängung, dem Wunsch nach Verwurzelung und einem Leben im Modus der Suche und des Weitermachens. ›Wenn wir heimkehren‹ ist gleichermaßen Gesellschaftsepos, psychologisch nuancierte Familien- und bewegende Liebesgeschichte.
Ein großer, poetischer, ebenso tiefgründiger wie anrührender Roman.
Autorenfoto: © Jürgen Bauer
Andrea Heuser wurde 1972 in Köln geboren. Sie studierte Germanistik, Politik und Vergleichende Religionswissenschaften in Köln und Bonn und promovierte mit einer Studie zur deutsch-jüdischen Gegenwartsliteratur. Sie schreibt Lyrik, Libretti und Romane. Für ihre literarischen Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis für Lyrik sowie 2016, 2017 und 2019 mit den Literaturstipendien des Freistaats Bayern, der Kunststiftung NRW und der Stadt München für die Arbeit an ›Wenn wir heimkehren‹. Bei DuMont erschien bislang ihr Romandebüt ›Augustas Garten‹ (2014). Andrea Heuser lebt mit ihrer Familie in München.
Andrea Heuser
WENN WIR HEIMKEHREN
Roman
Von Andrea Heuser ist bei DuMont außerdem erschienen:
Augustas Garten
Die Autorin dankt der Kunststiftung NRW, der Stadt München sowie dem Freistaat Bayern für die Unterstützung bei der Arbeit an diesem Buch.
eBook 2021
© 2021 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © Sarah Butterfield / Bridgeman Images
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7100-1
www.dumont-buchverlag.de
Ewig besitzt man nur das Verlorene.
Erster Teil:
WIE DAS LICHT FÄLLT
1
1952, Köln
VIELLEICHT war es das Licht. Sanft, in sich gekehrt verlieh es dem kargen Raum eine gewisse Andacht, wie sie nur jenen frühesten Tagen im Jahr innewohnt, in denen die Welt, zögernd noch, ihre Augen aufschlägt.
Dieses Licht beschien nun auch die Frau und den Jungen, die sich dort im Türrahmen dicht beieinander hielten, als sei ihnen nicht recht klar, wer wen zu schützen hatte.
»Eine Wand, hier?« Wilhelm war bemüht, sich seine Verwirrung nicht allzu sehr anmerken zu lassen. Nicht ahnend, dass an diesem stillen Januarmorgen gerade etwas Folgenreiches seinen Anfang nahm, verspürte er doch eine gewisse Anspannung; eine Sprachlosigkeit, die er nicht verstand. Dies war weiß Gott nicht die erste schöne Frau, die er in seinem Leben vor sich sah. Wobei, in diesem Licht …
Wilhelm hatte eine Schwäche für gute Lichtverhältnisse. Allerdings kam es ihm dabei in erster Linie auf Helligkeit an. Scharfe Umrisse, die für Klarheit sorgten, die die wahre Beschaffenheit der Dinge zutage treten ließen. Zufriedenstellend oder unzureichend. Ja oder nein.
Die Werkzeugtasche fester umfassend, versuchte er, den Raum nun so in Augenschein zu nehmen, wie es sich gehörte. Immerhin war er hergekommen, um ein Geschäft abzuwickeln.
Wilhelm Koch, Willi genannt, war ein auffallend großer Mann. Beim Reden hielt er sich daher stets leicht nach vorne gebeugt. Eine Haltung, die seinem Umgang mit Kundschaft, dem Gespräch auf angestrebter Augenhöhe gut bekam. Seinem Rücken allerdings nicht.
Die öffentlichen Bauaufträge waren zur Jahreswende vorübergehend eingestellt worden, angeblich wegen der Witterung. Dabei war der Winter vergleichsweise mild, es lag noch nicht einmal Schnee. Stattdessen häuften sich in der Innenstadt die Trümmer. Wenigstens, sagte sich Willi, wurde der Schutt noch vom Kölner Dom überragt. Sanierungen und die Umbauwünsche einiger Privatiers bestimmten derzeit das Tagesgeschäft und erhoben den »Aufschwung« über den Status eines Gerüchts. »Materialknappheit« hingegen war ein Wort, das nur hinter vorgehaltener Hand weitergegeben wurde.
Seit die Großbaustellen brachlagen, hatten Willis Rückenschmerzen wieder zugenommen. Keine Frage, er hielt sich lieber im Freien auf. Geschlossene Räume, Enge, nein, das war nichts für ihn. Ebenso wenig Stille. Sie machte ihn nervös, war der Hohlraum, in den Dinge einsickern konnten.
Sieben Jahre waren seit dem Ende nun vergangen; dem Ende des Krieges. Und alle sieben Jahre, sagte sich Willi zuversichtlich, wächst einem eine neue Haut.
Er liebte Redeweisen und Sinnsprüche, kleine Volksweisheiten wie diese. Hier und jetzt aber, so viel stand fest, war es nicht die Haut, alte oder neue, war es nicht der Rücken, der ihm zu schaffen machte.
»Die wird Ihnen da aber viel Helligkeit wegnehmen, die Wand. Frau De Boer?« Diesen Namen hatte er sich im Auftrag notiert. Auf der Leiste mit den Klingelschildern allerdings hatte er vergeblich nach einer Familie De Boer gesucht. Womöglich war ihre Auskunft deswegen so präzise gewesen: »In die dritte Etage müssen Sie, in die Wohnung ganz rechts. Bei Heider.«
»Frau De Boer?«
Die Frau im Türrahmen rührte sich nicht.
»Das macht nichts. Mit der Helligkeit«, sagte sie schließlich und ließ seine Nachfrage hinsichtlich ihres Namens unbeantwortet. Der Junge an ihrer Seite sah Willi an. Nicht unangenehm; mehr auf eine Weise, die Willi das diffuse, aber dringliche Gefühl eingab, dieses so sorgsam gescheitelte Haar zerwühlen zu wollen. Ihn hochzuheben, das dünne, bleiche Kerlchen da vor ihm, hoch hinaus zu Wind und Licht, ihn auf seinen Schultern reiten zu lassen. Aber momentan fiel es ihm schwer, sich überhaupt zu regen.
Die Frau, ihr Gesicht: ebenmäßig, umrahmt von offenbar naturblondem Haar, war ebenso wie ihre ganze Gestalt (schlichter Rollkragenpulli, Caprihose) von jener ruhigen Schönheit, die Willi normalerweise registrierte, ohne sich davon angesprochen zu fühlen. Doch nun – da war etwas an ihr; ihre Haltung, ihr Blick, der nicht warb, nicht kokettierte und der dennoch eine unterschwellige Aufforderung – was zu tun? – barg. Willi, seltsam betroffen, verspürte den absurden Drang, sich der Welt im Nahkampf zu stellen, jetzt gleich.
»Geh bitte in die Küche, Fred.« Der Junge, an derlei Anweisungen offensichtlich gewöhnt, löste sich umgehend von der Mutter. Ohne Willi aus den Augen zu lassen, griff er im Vorbeigehen nach einem Buch, das auf der Ablage im Flur bereitlag.
Donnerlittchen, das Kerlchen kann doch nicht etwa schon lesen, fuhr es Willi durch den Kopf, während sich Fred mit seinem Buch in die Küche zurückzog, deren Tür er weit geöffnet ließ.
Und endlich, als wäre durch den Rückzug des Jungen etwas aufgehoben worden, ein bislang unbekanntes Element der Schwerkraft vielleicht, konnte auch Willi sich wieder regen. Sein gewohntes Tempo, seine Sicherheiten aufnehmen, die in der Tätigkeit, der sich vergewissernden Rede lagen: »Nicht mehr hausen, wieder wohnen – was sich die Stadt da mal wieder für Fisimatenten einfallen lässt. Wissen Sie, ich bin kein Theoretiker, ich bin Praktiker. Für Wärme- und Schallisolierungen, für Deckengeschosse hat man zurzeit offenbar nichts übrig, aber den Rundfunk unbedingt bis zum Sommer fertig bauen. Eines der modernsten Funkhäuser Europas solls angeblich werden. Und auf dem Weg dorthin, durch all den Schutt, macht man am besten die Augen zu, oder wie stellen die sich das vor? Also, wenn Sie mich fragen, lächerlich!«
Ihm wurde zusehends wohler, die Wirklichkeit kehrte zurück. Frau De Boer – oder war es Frau Heider? – strich sich eine verirrte Strähne aus dem Gesicht. Sie selbst, sagte sie, höre gern Radio, das sei so tröstend. Willi, der darauf nichts zu erwidern fand, empfahl ihr das Radiogeschäft »Simons«, »gleich hier in direkter Nachbarschaft«. Ein Geschäft, das weit und breit die besten Röhrengeräte anbot. Mit Garantie sogar: »Da wissen Sie genau, was Sie für Ihr Geld bekommen. Der Simons nimmt auch gebrauchte Geräte in Zahlung. Falls Sie, na, Sie wissen schon – und nun zu Ihrer Wand …«
Willi stieg über einige verstreut liegende Teile von Freds Eisenbahn und legte seine Unterlagen auf das hübsch lackierte Nierentischchen. Er streifte die zwei umstehenden zierlichen Sessel mit einem kurzen, geradezu seufzenden Blick und ließ sich dann auf der alten, aber recht stabil wirkenden Couch gegenüber nieder, die bis auf einen Stoffbären unbesetzt war.
Seine recht ausführliche Darlegung des Arbeits- und Kostenaufwands ließ Frau De Boer/Heider unkommentiert. Auf seine Frage nach dem Sinn und Zweck einer zusätzlichen Wand in diesem »doch so schön übersichtlichen Raum« erwiderte sie unter kaum merklichem Erröten: »Privatsphäre«.
Privatsphäre war ein Wort, das Willi eher selten zu Gehör bekam. Wenngleich dessen Bedeutung: Intimität, Ungestörtheit, bei all seinen Innenraummaßnahmen auf die eine oder andere Art Thema war.
Nun fiel ihm erstmals auch der leichte Akzent der Frau auf. De Boer – dieser Name ließ eine niederländische Herkunft vermuten. Die Holländer, die Willi von Berufs wegen kannte, sprachen Deutsch allerdings ganz anders als diese Frau. Auf eine, wie er fand, unverkennbare Hollandweise. Nämlich bemerkenswert korrekt und holpernd zugleich. Als hielte sie irgendetwas davon ab, sich ungezwungen in dieser Sprache zu bewegen. Frau De Boer/Heider hingegen, die soeben erwähnte, dass sie erst seit Kurzem hier wohne, sprach weder holpernd noch mit einem erkennbaren Dialekt. Allerdings hob sie ihre Stimme am Satzende beiläufig um eine Nuance an; französisch klang das, charmant. Er hatte das noch gut im Ohr. Saint Denis, 1944 – irgendetwas an dieser Erinnerung ließ Willi von der Couch hochfahren. Er ging zur Kopfseite des Raums und klopfte sie so sorgsam ab, wie es der Arzt neulich mit seiner Brust getan hatte.
»Also, in die tragende Wand hier lässt sich kein Durchbruch machen. Außerdem laufen da ziemlich viele Stromleitungen durch …«
Willi liebte Wände. Ihr stoisches und daher umso nachhaltigeres Versprechen von Standfestigkeit. Ein Versprechen, auf das (wenn nicht gerade Bomben auf sie niederfielen) Verlass war, an das man sich lehnen konnte. Auch ihren so offensichtlichen, fraglosen Daseinszweck liebte er. Ihre Duldsamkeit, mit der sie mancherlei Pfusch von unsachgemäßer Hand in sich ausglichen.
Nach der Bautechniker- und Maurerlehre war es für ihn mit siebzehn gleich in den Krieg gegangen. Und direkt nach dem Krieg kam, verstörend nahtlos, die Ausbildung zum Maurermeister.
In den ersten Nachkriegswochen hatten seine Hände, Soldatenhände, unter dem Schutt Schädel und Knochen hervorziehend, so unkontrollierbar gezittert, dass er seinen Gliedern schließlich nur noch hilflose Kommandos zumurmelte.
»Do kann man nit hinlore.« Jochen Schäffer, der Poliermeister und vormalige MG-Schütze, schickte ihn heim. Zu Willis Mutter aber sagte er: »Et hätt halt nit immer jot jejange. Aber der Willi, der wird schon werden.«
Und tatsächlich, nach einer Weile, in der die besorgte Mutter ihren Jüngsten nicht von den Fenstern wegbekam, die er weit aufriss, um dann reglos davorzustehen, als warte er auf irgendetwas, das sich nie einstellte, sah es ganz so aus, als würde »der Willi schon werden«. Eines Tages hörte der Schäffer ihn wieder scherzen und mit den anderen vom Trupp »verzälle«. Auch Willis Hände schienen zu genesen, sich mehr und mehr an ihr Tun vor dem Krieg zu erinnern. Die Ziegel, Streben und Steine jedenfalls fügten sich seinem Willen. Als würden sie, Mauern und Mensch, sich gegenseitig formen, aneinander aufrichten. Er ertastete ihre undichten Stellen, ihre Widerstände; spürte, wo sich Risse zu bilden drohten, welche Belastungen sie ertrugen und welche nicht. Die Resultate schienen sich wie von selbst einzustellen: Meisterbrief, Baufirma, Angestellte. Verantwortung also, die hungrig nach ihm schnappte, um mit ihm im Maul davonzugaloppieren.
»… ein Glas Wasser vielleicht?«
»Wie? Nein danke.« Doch keine Französin, sagte sich Willi. Das Französische strömte weich dahin. Ihre Worte hingegen klangen härter, geschliffener. Wo in Gottes Namen, dachte Willi, spricht man bloß so?
»Ich würde Resopal hernehmen«, sagte er laut, »für die Zwischenwand. Vor allem beim Bau von Küchen haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Leicht zu reinigen, feuerhemmend und vor allem lichtbeständig. Außerdem kann es mit verschiedenen Glanzgraden versehen werden. Sie wissen schon, für die Optik. Und …«, er holte tief Luft, »sollten Sie die Wand dann eines Tages nicht mehr brauchen, ist sie recht leicht wieder abzumontieren. Andere Firmen würden Ihnen wahrscheinlich Gipskartonplatten empfehlen. Das mit dem Gips kommt jetzt überall auf, aber der lässt sich zurzeit nicht ordentlich verarbeiten, und außerdem heißt das: Brandschutz, ade! Nun, jeder Jeck is anders. Der Zugang muss allerdings auch noch gewährleistet sein. Also, wenn Sie mich fragen, ich würde die Zwischenwand eher als eine Art Schiebetürvorrichtung …«
»Es ist wieder kalt.« Fred stand vor dem Zimmer. An seiner Stimme erkannte Willi, dass der Junge tatsächlich älter sein musste, als er ursprünglich gedacht hatte. Dieser Tage waren Kinder so dünn, ihre Kleidung ausschließlich durch das noch Vorhandene bestimmt, dass jegliche Altersmerkmale an ihnen abglitten, es sei denn, man blickte ihnen in die Augen. Sieben, nein, wohl eher acht, schätzte Willi. Würde jedenfalls zum Lesen passen.
»Der Ofen, Mama.« Freds Tonfall war nicht weinerlich, wie dies bei kleineren Kindern häufig der Fall war, wenn sie über Hunger oder eben Kälte klagten. Er sprach ruhig und sachlich. Eine Mitteilung, mehr nicht.
Frau De Boer/Heider ging zu einer schönen Kommode aus massivem poliertem Eichenholz, die wie eine trotzige Behauptung von etwas Abwesendem an der kahlen Fensterseite des Zimmers stand. Mit einer offenbar unbewussten Geste, die Willi in ihrer Beiläufigkeit überaus zärtlich erschien, strich sie über die verschnörkelten Messingbeschläge. Dann zog sie das obere Schubfach auf und entnahm ein großes Baumwolltuch, das sie dem Jungen hinhielt.
Wer hat diesen Ömmes nur all die Treppen hochgewuchtet, fragte sich Willi. Zugleich begriff er Sinn und Zweck des Tuches. »Komm, ich helf dir, Junge. Die Kohlen sind doch schwer.«
Kurz darauf fand er sich samt Kellerschlüssel und Weidenkorb neben Fred auf der Treppe wieder. Jener schief getretenen Treppe, die er nun für so umgehend reparaturbedürftig hielt, dass er seine freie Hand schützend nach dem Jungen ausstreckte. Als ließe sich so die fehlende Stabilität des Zustands zumindest vorübergehend ausgleichen.
Fred jedoch hielt sich mit der einen Hand am Geländer fest, in der anderen hielt er das Tuch der Mutter, das bereits Spuren früherer Kohlegänge aufwies.
»Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp …« Willi, dessen helfende Hand soeben ignoriert worden war, fiel nichts anderes ein, als zu singen. All die vielen Treppenstufen von der dritten Etage bis ins Parterre hinunter sang Willi allein.
»Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach …« Willi stieß die schwere Kellertür auf und betätigte den Lichtschalter. Flackerndes Glühbirnenlicht erhellte die oberen Stufen, die steil abwärts führten. Er blinzelte – DUCKEN.
»Runter …«
»Rein hier.«
»Schneller, schneller.«
»Willi, Hans, los, los!«
»Weg hier, weg!«
»Willi …«
»Hans! Haaans …« –
Und nun war er, Willi, es, der unwillkürlich die Hand des Jungen packte, die das Treppengeländer freigegeben hatte. Einige Sekunden, eine Ewigkeit standen sie so, bis – »… mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot, und haben wir dieses, so hats keine Not …« – Freds Stimme, die jetzt klar und deutlich neben ihm vernehmbar war, Willi Ort und Zeit zurückgab: »Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp …«
Willi ließ die Hand des Jungen los und stieg nun ohne weiteres Zögern die Kellertreppe hinunter. Er nahm sich fest vor, auf dem Rückweg die unselige Glühbirne festzuschrauben, die sich in der Fassung gelockert haben musste.
»Welcher Verschlag ist es denn?«, fragte er, sich auf halbem Weg zu dem Jungen umdrehend. Da sah er, dass Fred ihm gar nicht gefolgt war. Er stand weiterhin oben auf der höchsten Stufe der Kellertreppe und sah zu ihm hinunter.
»Magst du nicht mitkommen?«
Fred schüttelte den Kopf.
»Na schön.« Willi ging den schmalen Gang entlang und probierte vorsichtig, als wäre er ein Einbrecher, die Schlösser der Holzverschläge rechts und links, bis eines von ihnen dem Schlüssel in seiner Hand nachgab und sich öffnete. Ohne sich weiter umzusehen, ging er auf den Kohlehaufen in der hinteren Ecke des Kellerabteils zu und füllte den Weidenkorb bis zum Rand. Schönes Gefühl. Vor nicht allzu langer Zeit waren ganz andere Gänge dafür nötig gewesen …
Zurück an der Kellertreppe, tauchte Stufe um Stufe aufwärts Freds Gestalt (Schnürschuhe, Knickerbocker, Pullunder, Gesicht) vor ihm auf. Als der Junge Willi sah, trat er einen Schritt zur Seite, um ihm Platz zu machen. An seinem Arm hing, seltsam erschlafft, das Tuch der Mutter bis zum Boden hinab.
Einer Eingebung folgend, packte Willi einen Teil der Kohle in das große Baumwolltuch, dessen Ende er zu einem Knoten band, sodass der Junge das Bündel zu tragen vermochte. Freds Gesicht hellte sich augenblicklich auf, und Willi begann, die Stufen in die Stockwerke hochzusteigen.
Der Rückweg ging deutlich langsamer vonstatten. Willi, dem soeben einfiel, dass er doch eigentlich die Glühbirne im Keller hatte festschrauben wollen und dass er sich außerdem viel zu lange schon bei diesem Auftrag hier aufhielt, ging gedankenverloren und daher grußlos an der älteren Dame vorbei, die ihnen von oben entgegenkam.
Die Dame, in kornblumenblauem Hängemantel und Hut, musterte Willi und Fred mit einer Mischung aus Mitleid, Herablassung und Häme. Hätte Willi ihren Blick bemerkt, er hätte sie verblüfft zur Rede gestellt. Fred aber senkte den Kopf über sein Kohlenbündel, als hätte ihn der Blick der Frau mit einem zusätzlichen Gewicht beschwert.
»Es blüht eine weiße Lilie in blauer Tropennacht. Sie hat einem fremden Seemann das große Glück gebracht …«
Aus der Nachbarswohnung drang Musik. Freds Mutter hatte die Wohnungstür einen Spaltbreit offen gelassen; für ihren Sohn, für Willi, für die Musik.
Als sie eintraten, stellte Willi als Erstes den schweren Korb neben dem Ofen ab und schob Kohlen nach. Fred legte sein Bündel daneben. Frau De Boer/Heider saß vor dem geöffneten Küchenfenster und rauchte. Ihre Beine waren in lässiger Eleganz übereinandergeschlagen, was ihre schlanken Fesseln, die die Caprihose freiließ, betonte; ihr Blick ging Richtung Fenster. Ihre Haltung strahlte ein aufreizendes Gefühl der Selbstgenügsamkeit aus, was Willi so unmittelbar erregte, wie ihn der Anblick ihrer Zigarette abstieß. Auf Rauch reagierte er empfindlich. Er verspürte den starken Drang, das Fenster aufzureißen, sofort. Nur, es war bereits geöffnet.
»Wo ist das Bad?«, fragte er, um sich mit dem erstbesten Satz Luft zu verschaffen.
Frau De Boer/Heider wandte sich ihm nun zu und drückte die halb gerauchte Zigarette aus, die in dem bauchigen Aschenbecher vor ihr zum Liegen kam wie ein gekrümmtes Insekt. Fred lief auf sie zu, legte seinen Kopf an ihre Schulter.
»Gleich hier«, sagte sie. »Sie stehen gewissermaßen schon drin.« Und nun lächelte sie zum ersten Mal, was ihrem Gesicht einen vollkommen anderen, unerwarteten Ausdruck verlieh. Willi sah etwas Mädchenhaftes, Verschmitztes in ihren Zügen aufblitzen.
Grübchenfunkeln, dachte er. Und war einigermaßen verblüfft darüber, was ihm heute so alles in den Sinn kam. Er zog den Vorhang zur Seite, der offensichtlich als Raumteilung diente. Dahinter befand sich »das Bad«: Zinkwanne, ein Waschbecken mit Spiegelschränkchen und ein Regal mit Handtüchern. Der Boden war mit demselben hellgrauen Linoleum ausgelegt wie der Rest der Küche.
»Tielsa«, die Küche, die nichts übel nimmt. Willi hatte erst vor einigen Tagen ein ebensolches Linoleum verlegt. Er ging zum Waschbecken, griff nach der Kernseife und säuberte sich die Hände bis über die Handgelenke hinaus mit jener mechanischen, präzisen Bewegung, wie sie Ärzten und Soldaten zu eigen ist, denen die Reinlichkeit in Fleisch und Blut übergegangen ist. Auch das Wurzelbürstchen benutzte er, um den hartnäckigen Kohlenstaub unter den Nägeln möglichst spurlos zu beseitigen.
»Der Teufel wohnt unter den Fingernägeln, Sohn.« – Willi sah auf. Fast erwartete er, das Gesicht des Vaters (belehrend, freundlich, menschenmüde) neben dem seinen im Spiegel vorzufinden. Es blickte ihm aber nur das eigene Spiegelbild entgegen. Markante Gesichtszüge, die niemals erröteten. So auch nicht bei dem, was er nun tat. Doch spürte Willi, dass ihm die Handflächen feucht wurden, als er mit einer Behutsamkeit, die man seinen großen, schweren Händen auf den ersten Blick gar nicht zutraute, das Spiegelschränkchen öffnete.
Seit er sie, Mutter und Sohn, dort vor sich im Türrahmen hatte stehen sehen, war er mehr oder weniger bewusst auf der Suche nach Hinweisen gewesen. Hinweisen, die für die Existenz eines Herrn De Boer oder eines Herrn Heider sprachen. Die Wohnung selbst gab derlei Auskünfte nicht preis. Weder in Form von Kleidungsstücken noch durch Möbel oder ebenjene Gegenstände, die einem Hausherrn üblicherweise zugeordnet werden. Keine Hausschuhe, Hüte, keine Zeitung auf dem Küchentisch, keine Fotografien. Alles sprach dafür, dass hier eine Frau allein mit ihrem kleinen Sohn lebte.
Doch ein Instinkt sagte Willi, dass dem nicht so war. Dass die »Privatsphäre«, die die Frau durch eine zusätzliche Wand in ihrer Wohnung herzustellen wünschte, nicht nur eine zwischen Mutter und Kind war. Er hätte nicht sagen können, woran dies festzumachen sei. Es war, als würde etwas an dem Bild, so wie es sich ihm darbot, nicht ganz stimmen, auch wenn man den Finger nicht auf die entsprechende Stelle legen konnte.
Das Wandschränkchen öffnete sich, und Willi unterdrückte einen Seufzer. Rasierpinsel und -seife, Klingen, Alaunstift, Duftwasser, Zahnbürste; sorgsam aufgereiht wie kleine wachsame Zinnsoldaten. Sogar ein Maniküreset war vorhanden.
Nicht da und doch da, dachte er etwas zusammenhanglos und schloss das Schränkchen eine Spur weniger behutsam, als er es zuvor geöffnet hatte. Plötzlich hatte er es eilig. Er zog den Vorhang auf und ging in den Küchenbereich zurück, wo Frau De Boer/Heider gerade frischen Kaffee aufgebrüht hatte. Sie wandte sich ihm zu. Ihr Gesicht war, möglicherweise vom Wasserdampf, leicht erhitzt.
»Ich habe Kaffee gemacht. Möchten Sie …?«
»Herr Rohde, mein Mitarbeiter, wird morgen noch einmal bei Ihnen vorbeischauen, Frau … De Boer? Wir müssen noch eine Feuchtigkeitsmessung in der Wand vornehmen. Wann würde es passen? Drei Uhr? Prima.« Willi packte mit wenigen Handgriffen seine Unterlagen zusammen und war schon halb in der Tür, als eine Hand ihn vorsichtig am Hosenbein zupfte.
»Auf Wiedersehen, Jungchen.« Er beugte sich zu Fred hinunter, und nun erlaubte er sich die Geste und strich ihm über das Haar.
Willi verließ die Wohnung, und es war ihm, als hallten seine Schritte auf der Treppe ungewöhnlich laut nach.
Trittschallschutz mangelhaft. Statik kritisch. Mängel notierten sich in seinem Kopf wie von selbst. Bestandsaufnahmen, darauf war Verlass, o ja!
Frau De Boer/Heider war in der Tür, die sie Willi aufgehalten hatte, stehen geblieben. Nun ging sie zum Treppengeländer, beugte sich ein Stück vor und rief Willi etwas zu. Sie rief es in seinen fliehenden Rücken wie ein Geständnis: »Ich heiße Margot.«
2
1952, Köln
MARGOT nebelte sich ein. Rauchen, das war wie atmen. So natürlich wars ihr mit der Zeit geworden, so organisch. Sie saß am Küchentisch und versuchte den Blick auf die zwei leeren Tassen zu vermeiden.
»Koch, mein Name, Willi. Ich komme wegen Ihrer Wand.« – Warum hatte er den Kaffee abgelehnt, war so überstürzt verschwunden? Gehörte sich so was? Nein.
»Fred? Fred!«
Keine Antwort. Wahrscheinlich hockte der Junge im Wohnzimmer, in einen seiner Comics versunken, oder war nach draußen gelaufen zum Spielen. Na, ihr sollte es recht sein. Sie stieß den Rauch möglichst geräuschvoll aus …
»Margot. Margot!«
Wie nachdrücklich die Stimme ihrer eigenen Mutter stets gewesen war; herrisch, befehlsgewohnt. Sie lag ihr plötzlich im Ohr wie ein seltsam verschobenes Echo ihres eigenen, erfolglosen Rufens.
Ja, dachte sie leicht verstimmt. Sie hatte damals stets reagiert, wenn die Mutter nach ihr verlangte. Sie sah es geradezu vor sich: Aufgesprungen war sie. Vom Schneidersitz direkt hoch in den Stand. Eine so flüssige, natürliche Bewegung, wie sie nur Kindern möglich ist, deren Körper noch frei sind von den Korrekturen, den Einschreibungen des Lebens.
Damals …
1933, Eechternoach
»MARGOT, tout de suite.«
»Oui, Maman.«
Eigentlich galt dieses »Oui« dem Hausmädchen. Ich kann sehr wohl gehorchen, wenn ich will, hieß das. Du hingegen kannst mich rufen, bis du schwarz wirst. Und tatsächlich, Clarissas Aufforderung, zu Tisch zu kommen, hatte sie mal wieder komplett ignoriert.
Bereits am Morgen hatte »das Clärchen« ihr nämlich übel mitgespielt. Mutters Lieblingshausmädchen hatte sich mit der Lebertranflasche und dem Dosierlöffel so im Türrahmen platziert, dass keiner in den Frühstücksraum konnte, ohne an ihr vorbeizumüssen.
Wenn du wüsstest, wie dumm du aussiehst, dachte Margot missmutig. Mit dieser albernen Dienstschürze und diesen steifen Schleifenbändern im Rücken. Als ob du heimlich hinten die Finger kreuzt, du falsche Schlange!
Sie selbst tat das manchmal, das mit dem Fingerkreuzen, wenn sie schwindelte. Aber das war etwas ganz anderes.
Die vier Geschwister hatten sich mal wieder brav in die Reihe gestellt, Charles und Emilie allen voran, und diese grässliche Medizin geschluckt. Selbst Jean, aber der bekam ja auch gleich danach heißen Kakao. Sie nicht. Ihr wurde dummerweise schlecht von dem Kakao. Aber bestimmt lag das nur an dem Lebertran! An der Übelkeit, die ihr da erst einmal eingeträufelt wurde.
Sie selbst stand ganz hinten in der Reihe. Aber als Mathilde, die vor ihr stand, dran war und gehorsam den Mund aufmachte, war der Moment gekommen. Flink duckte sie sich unter Clarissas erhobenem Arm hinweg und wollte gerade Richtung Esstisch stürzen. Doch Clarissa – schnell wie ein Fechtmeister war sie mit der freien Hand vorgeschnellt – hatte sie zurückgezerrt und den widerlichen langen Löffel statt in Mathildes tief in ihren, Margots, Rachen versenkt. Er war so voller Tran, dass ihr die ekelhaften Tropfen über die Mundwinkel rannen.
»MAMAN!«
Was hatte sie gespuckt und gewürgt. Die ganze klebrige Bitterkeit der Welt war da auf einmal in ihrem Mund gewesen. Und schlimmer: Nun steckte sie auch noch tief in ihrem Hals fest, wollte einfach nicht verschwinden.
Als aber die Mama herbeigeeilt kam, brachte sie vor lauter Ekel im Mund kein Wort mehr heraus. Anders als Clarissa: »Oh, Madame, es ist wohl leider alles danebengegangen!«
Woraufhin ihr unter Aufsicht eine volle, zweite Dosis verabreicht wurde.
Margot verließ ihren Lieblingsplatz, die breite Fensterbank des Studierzimmers, von wo aus sich ein wundervoller Blick auf den Garten bot.
Eigentlich war es ein Park.
Jeden Morgen, wenn Clarissa den schweren Brokatstoff unter dem verheißungsvollen Klirren der metallenen Vorhangringe zur Seite zog, lief sie rasch herbei. Doch sie kam immer zu spät. Der Morgen war stets schon vor ihr da.
Ja, und heute war von allen möglichen Tagen ausgerechnet Sonntag. Und der war mal wieder übelst langweilig.
Die letzte Stunde hatte sie damit verbracht, die Kratzspuren der Eichhörnchen auf den Vorhängen mit den Fingern nachzufahren. Sobald sich die Fenster zum Garten hin öffneten, kamen die halb zahmen Tiere, um Nüsse aus der Schale zu stibitzen, die sie ihnen heimlich hinstellte. Ihre Stickarbeit harrte derweil irgendwo hinter ihr auf dem Teppich aus. Ein schier endloses Gewirr loser Fäden …
Die Eichhörnchen jedenfalls waren heute mal wieder unter ihren anfeuernden Rufen die langen schweren Stoffbahnen hinauf und hinunter gehuscht, hatten mit der Kordel und den Säumen der Vorhänge gespielt, bis sie schließlich – »Schu! Schu!« – von Clarissa mit dem Besenstiel vertrieben worden waren. Die gönnte einem einfach gar nichts. Nicht den kleinsten Spaß.
»Margot!«
Margot verließ das Studierzimmer, ließ es weiter vor sich hin dämmern.
»… ist zu alt, Mama. Die ganze Gruppe trägt neue. Nur ich …«
»Deine Tracht sitzt tadellos, Kind.«
»Aus, Sepp. Aus!«
Am Esstisch war wie immer etwas los. Sepp, der Rauhaardackel – Himmel, was war der stur –, hatte sich den ständigen Platz an der Seite des Vaters gesichert, sogar bei Tisch. Zu dessen Füßen thronend, bedachte er Möhrchen, den jungen Kater, jetzt mit einem lauten, vernichtenden Bellen. Der hatte nämlich die Gelegenheit gewittert und sich ihr an die Fersen geheftet, in der Hoffnung, einen der sorgsam gehüteten Leckerbissen hinter der Tür zu erhaschen.
»Schusch.« Eine Geste der Mutter, und der Kater huschte, zusammen mit Clarissa, hinaus. Sepp gab seine alarmierte Haltung auf und ließ den Kopf zurück auf die Pfoten sinken. Die Ordnung war wiederhergestellt.
Emilie aber rang jetzt geräuschvoll nach Luft. Gleich darauf ließ ein Hustenkrampf sie und den gesamten Esstisch erbeben. Seit Margot zurückdenken konnte, war die Schwester krank. Vielleicht war Emilie deshalb kaum größer als sie, obwohl sie doch fast drei Jahre älter war. Fasziniert sah sie zu, wie sich ihre Schlüsselbeine auf der schmalen Brust hoben und senkten. Das Tuch auf die Lippen gepresst, griff die Schwester nun mit der freien Hand zielsicher nach dem Wasserglas.
»… also wirklich!« Währenddessen hatte Mathilde einfach weitergeplaudert. Anscheinend ging es um die Springprozession. Und wieder einmal staunte Margot darüber, wie sehr sich die älteste Schwester von ihnen allen unterschied. So, als wollte sie sagen: Schaut her, es geht auch anders. Als Einzige von ihnen hatte sie das kräftige dunkle Haar des Vaters geerbt. Anders als sie, Emilie und die Brüder. Sie alle waren nobelblond. »Meine Nobelblondchen.« Mathilde nannte sie so. Sie alle, bis auf die Mutter natürlich. Obwohl sie sie doch von ihr hatten, diese Haarfarbe.
Mathilde jedenfalls war schon dreizehn – ach, wäre sie doch auch schon so groß – und war dem Vater überhaupt sehr ähnlich; sogar sein eckiges Kinn hatte sie geerbt und die einnehmende, volltönende Stimme.
»Ich habe dieses Jahr so viel geübt, und alle werden mich anstarren in dem alten Zeugs, und …«
»Sei doch froh, wenn überhaupt jemand schaut. Bei dem unrhythmischen Herumgehopse.«
»Charles!«
»Na, ist doch wahr.«
Charles war zwar schon fünfzehn, sagenhaft alt also, aber »immer noch jung und dumm genug, um seine Schwestern zu ärgern«, wie der Vater es nannte. Der Bruder wollte gerade noch weiter ausholen, aber er wurde – »Och, bitte, Papa!« – von Jean abgelenkt. Margot lächelte, weil Jeans Haar mal wieder in einem struppigen Wirbel am Hinterkopf abstand. Dass die Mama ihm das durchgehen ließ, dass er so zum Essen erschien. Bei ihr hätte es natürlich wieder einen Riesenaufstand gegeben.
»Bitteeee.«
Diese Bettelei. Kaum zu fassen, dass er älter war als sie. Wenn auch nur ein bisschen.
»Darf ich heute mal vorne sitzen? Bitte. Nur ausnahmsweise …«
Charles, das sah man ihm an, war jetzt auf der Hut. Der Vater würde sicherlich jeden Augenblick nachgeben und ihn auf der Spazierfahrt nach hinten verbannen. Zu den Mädchen!
»C’est mon domaine, Jean.«
»Mais, Papa …«
Wie still es war – selbst das Ticken der Küchenuhr war nun deutlich zu hören. Von Fred weiterhin kein Laut. Normalerweise hatte Margot liebend gern ihre Ruhe. Heute aber machte sie ihr aus irgendeinem Grund zu schaffen.
»C’est mon domaine, Jean.«
»Mais, Papa …«
Margot griff nach der Zigarettenschachtel. Fast leer. Sie rüttelte daran, bis ihr aufging, wie sinnlos das war. Schließlich zündete sie sich eine der noch verbliebenen Zigaretten an, inhalierte. Wie wild sie damals alle stets durcheinandergeredet hatten. Französisch, Luxemburgisch, ja, sogar Deutsch. Die Mutter hatte es gehasst.
Kaweechelchen.
Sie kicherte, als ihr dieses schöne, weiche Wort so plötzlich wieder einfiel. Als wäre sie wieder das Kind, das heimlich Eichhörnchen zähmte. Kaweechelchen …
»Kaweechelchen, Papa, vèier Stéck! Und ein Grauhörnchen war auch da. Die sind noch viel flinker, weißt du, als …« So. Jetzt war sie mal dran.
»Kein Dialekt bei Tisch, Margot.« Die Mutter sah nicht nur sie, sondern vor allem den Vater stirnrunzelnd an. Wahrscheinlich weil der so nachsichtig lächelte.
»Pardon, Maman.«
Die Mutter griff nach der Karaffe mit dem Tischwein und füllte das Glas des Vaters auf. Margot sah das gerne, wenn die Mutter das tat. Anders als Tante Sophie, die jetzt adelig war und andauernd bedient wurde, verzichtete die Mutter zum Glück auf »derlei Gedöns«.
»Ich möchte, dass wir bei Tisch unter uns sind«, hatte sie ihnen einmal erklärt. »Wie es sich für anständige Bürger gehört.«
»… hat sogar angedroht, das Essen zu verweigern, weil sie bei der Prozession nicht dabei sein darf. Die Ärmste. Nur weil sie sich letztes Mal den Knöchel gebrochen hat.« Mathilde wirkte empört.
»Warum wird die Choreografie der Schritte nicht endlich einmal einheitlich geregelt? Jedes Jahr dasselbe Chaos. Man könnte meinen, ihr jungen Leute lasst euch da mit voller Absicht ineinanderfallen.«
»Aber, Papa …« Mathilde errötete. Sie setzte zu einer Antwort an, doch die Mutter kam ihr zuvor.
»Immerhin handelt es sich hierbei um eine religiöse Tradition und nicht um primitive, martialische Aufmärsche, wie sie in gewissen Nachbarländern derzeit Mode sind, Georg.«
»Ach, komm schon, Johanna.« Der Vater klang jetzt verstimmt.
Ein stattlicher Mann war er, der Vater, mit seinem kantigen Kinn und dem stets sorgsam gebürsteten Oberlippenbart. Stirn und Augenpartie strahlten Eigensinn und Ehrgeiz aus. Ein Mann, der, wie der Fotograf es neulich beim Familienporträt genannt hatte, »jedem Bild seine Konturen gab«.
Margot wusste, dass er mit Blick auf die Sankt-Willibrord-Basilika geboren und aufgewachsen war. Dennoch, er verabscheute religiöse Frömmelei und Volkstümelei. Die alljährliche Springprozession war ihm zuwider. Auf die Nachbarn hingegen ließ er nichts kommen.
»Na, na, Johanna. Du sagst es doch selbst: Eine Mode ist das. Dieser Hitler und seine Bande, die werden sich nicht lange halten. Wahrscheinlich muss sich das Volk nur mal austoben nach all den Miseren. All diese Aufmärsche und Fackelzüge! Austoben, das ist einem ja hierzulande auch nicht ganz fremd, nicht wahr, Mathilde?«
Der Vater war ins Deutsche übergewechselt. Er liebte diese Sprache. Die Oma kam aus Thüringen, und sie hatte ihm als Kind, wie er gern erzählte, viele Lieder beigebracht. Lieder, die er auf seinen langen Spaziergängen mit Sepp vor sich hin sang: »Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumte in seinem Schatten so manchen süßen Traum …«
Sie hörte das gern. Die Mutter hingegen sprach nur Deutsch, wenn es um Geschäftliches ging. Ansonsten ausschließlich Französisch. Vor allem bei Tisch. Kein Wunder, dass sie leicht gereizt war. Und jetzt sprach der Vater auch noch über das, was die Erwachsenen »Politik« nannten. Über etwas also, das sie angeblich nichts anging. Margot spitzte die Ohren.
»… kommen alle wieder zu Sinnen. Wenn sie merken, dass ein Land vernünftige Lösungen braucht. Und dann ist der Hitler, überhaupt der ganze braune Spuk passé.«
»Wie der sich aufführt, unfassbar.«
»Wer ist denn dieser Hitler?«, fragte Jean, während er sich den Teller voll Pastinaken und Pasteten schaufelte.
»Niemand«, sagten der Vater und die Mutter fast zeitgleich.
Und Jean tat mit vollen Backen kauend und unter dem gestrengen Blick der Mutter einige der kleineren Pasteten in die Schüssel zurück. »Weißt du, Margot, wenn ich mal groß bin, dann kauf ich mir noch ein viel größeres Auto als das vom Papa und …«
Margot zog den Aschenbecher näher zu sich heran. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus und mit dem rauchigen Atem zugleich, so schien es ihr, die Erinnerung: Jean. Der nimmersatte kleine Bruder mit den roten Wangen, dessen Hemdzipfel stets hinten aus der Hose heraushing, der bei Tisch gern begeistert und mit vollem Mund sprach. Der davon träumte, seine eigene Bande zu gründen und mit ihr durch die Straßen zu ziehen, besser noch: zu fahren. Im Auto des Papas, mit ihm, Jean, höchstpersönlich am Steuer. Zehn Jahre später war er tot. Gefallen, bei Königsberg.
»Weißt du, Margot, wenn ich mal groß bin, dann kauf ich mir noch ein viel größeres Auto als das vom Papa und …«
»Ich sitze nachher vorn.« Charles hielt den Moment für gekommen, sich seinen Platz zu sichern. Der Vater war nach Dessert und Kaffee immer besonders empfänglich. Dummerweise fiel Margot gerade nichts ein, was sie sich erbetteln wollte.
Das mit der Spazierfahrt am Nachmittag war schon ein Spaß. Der Tag wurde damit entschieden besser.
Das Automobil – »Nicht irgendein Auto, eine Limousine! Marmon, 69er-Modell mit V16-Motor und Rückspiegel, Margot!« – war stets auf Hochglanz poliert. Bis vor Kurzem waren noch von überallher die Kinder herbeigeströmt, wenn der Vater den Wagen aus der Garage fuhr und den Motor, der dann immer so schön laut schnurrte, anließ. All das Winken und Rufen, als wären sie die Fürstenfamilie höchstpersönlich. An der Orangerie und der Abtei vorbei bis hoch zur alten Sauerbrücke waren sie ihnen oft gefolgt. Inzwischen aber gab es mehr und mehr davon, von diesen Limousinen. Neulich waren ihnen bereits sechs andere auf der Rue de Luxembourg entgegengekommen. Und das noch innerhalb der Stadtmauern. Die Kinder waren dann natürlich auch denen hinterhergelaufen. Schade …
Die Mutter erhob sich und läutete die Tischglocke. »L’heure de repos.«
Na endlich! Margot wurde ganz kribbelig. Mittagsruhe. Und zwar genau eine Stunde und dreißig Minuten. Mathilde und Emilie mussten in der Zeit »Schönheitsschlaf halten«. Sie selbst war zum Glück noch nicht zehn. Das mit dem Schlaf und der Schönheit galt nämlich erst ab dann. Charles und Jean mussten, quatsch, durften sich »der weiterbildenden Lektüre widmen«. Anscheinend waren sie schon schön genug.
Sie liebte diese Zeit. Keine Clarissa weit und breit. Kein »Oh, Madame«-Gesäusel, kein »Das junge Fräulein war leider wieder einmal gar nicht brav«-Getue. Und sie, nur sie durfte mit der Mama zu den Angorakaninchen. Ganz sicher war die Sache mit ihr und der Mama und den Kaninchen allerdings nie. Das Ritual konnte jederzeit enden. Zum Beispiel als Strafe für ein »ungebührliches Verhalten«. Und tatsächlich: »Erscheine bitte das nächste Mal pünktlich bei Tisch, Margot. Und kein Dialekt. Sonst …«
»Oui. Bien sûre.«
Also ging sie nun ganz besonders leise, auf Tuchfühlung, neben der Mama her über den langen Korridor, als könne sie jederzeit verschwinden …
Schusch – Margot wedelte den Rauch beiseite. Wie schnell das ging, dass etwas verschwand. Hatte sie das als Mädchen schon gespürt? Wie schemenhaft ihr Dasein dort in dem großen, alten Haus mit den vielen blinden Winkeln im Grunde gewesen war? (Wer hatte es erbaut? Wer hatte vor ihnen dort gelebt?) Wohl kaum. Sie hatte als Kind einfach nur all diese vielen Kleinigkeiten besonders geliebt; Dinge, die sich nun einmal nicht festhalten ließen: das Morgenlicht hinter den schweren Brokatvorhängen, Kaweechelchen, Sepps zufriedenes Schnaufen zu des Vaters Füßen, das ofenwarme Brot im Korb, L’heure de repos, ja, und, schusch, die mit dem Kater hinaushuschende Clarissa. Von der Mutter entlassen, sozusagen. Ha! Überhaupt die Mutter, die – wie hatte sie ausgesehen?
Margot runzelte die Stirn. Aber sosehr sie es auch versuchte, das Gesicht der Mutter wollte sich einfach nicht einstellen. Ihre Stimme, gewohnt, Anweisungen zu geben, die befolgt wurden. Ja, ihre Stimme, die war da, in ihrem Kopf, in der Erinnerung. Ebenso ihr forscher Gang durch all die Korridore und Zimmer, der Druck dieser rauen, erstaunlich warmen Hand, an der sie all die Sonntage ihrer Kindheit spazieren gegangen war. Aber ihr Gesicht? Nein, da war nichts. Nur ihr eigener Blick, Mädchenblick, der immer wieder zur Mutter hoch- und wieder weggehuscht war …
Die Mama ansehen. Sie hatte genauso nobelblondes Haar wie sie, aber sie trug es nicht so lang und in ganz gleichmäßige Wellen gelegt. Wie gerne würde sie mal darüber streichen, um zu schauen, wie sich ihr Haar anfühlte und was dann wohl passieren würde mit diesen Wellen, aber das tat sie natürlich nicht. Das würde bestimmt das Ende ihrer gemeinsamen Sonntagspause bedeuten, wenn sie so etwas »Privates« wie das Haar der Mama in Unordnung brachte.
Alles an der Mama war hell und schön. Und streng. Ihre Haut, die schmale Nase, die Augen. Nur ihre Brauen und Wimpern waren erstaunlich dunkel, wie gemalt sahen die aus. Und ihre Kleider, die kamen aus Paris …
Ihr Blick wurde von der Mama weg- und von dem Bild angezogen; einem großen Ölgemälde, das an der Wand im Mädchentrakt hing, neben einer Reihe anderer Porträts, auf denen hauptsächlich alte Männer mit Bärten und breiten goldenen Ketten zu sehen waren. Öde.
Das Bild der Frau aber zog ihren Blick jedes Mal magisch an, wenn sie mit der Mama über diesen Korridor ging. Vielleicht weil es nicht so rissig und dunkel aussah wie all die anderen. Und die Frau dort auf dem Bild, die war irgendwie so wie die Mama. Hell, streng und schön. Wer aber war das? Die Mama? Nein. Eine Schwester der Mama? Wer?
Margot klopfte die Glut in den Aschenbecher ab. Jetzt, wo sie darüber nachdachte: Sie sah die Mutter (wenngleich ohne klare Gesichtszüge) immer als schlanke, elegante Frau vor sich. Aber stimmte das wirklich, war sie nicht eher füllig gewesen? Ihre Arbeitsschürze, die sie über den Kleidern getragen hatte, hatte um die Brust herum doch immer ein wenig gespannt. Und ihre Haare, waren die so hell gewesen wie die ihren, oder hatte sie sich das nur so zurechtgelegt, weil Mathilde sie immer damit aufgezogen hatte, mit diesem nobelblond? Hatte sich die Erinnerung an die Frau auf dem Bild mit der an die Mutter vermengt? Was wusste sie eigentlich über sie?
Einmal, so viel stand immerhin fest, hatte es wohl mit dem Kinderkriegen nicht geklappt.
Sie konnte gar nicht mehr genau sagen, woher sie das wusste. Aber eines Tages hatte die Mutter etwas darüber gesagt, was sie nicht so ganz verstand. Nicht zu ihr natürlich, aber zur Tante, die mal wieder zu Besuch da gewesen war. Sie hatte gelauscht, und vielleicht hatte sie es sich deswegen gemerkt, diesen einen merkwürdigen Satz: »Der Körper vergisst nichts.«
Mit einer ganz ungewohnten Stimme hatte die Mutter das gesagt und etwas von geheimen Verlusten.
Das war seltsam, das mit den geheimen Verlusten, weil nichts an der Mutter geheim wirkte. Sie sprach stets ruhig und klar, wenn auch niemals besonders viel, sie lachte selten. Ihre Hände, ja, da war sie sich ganz sicher, waren schmal gewesen. Zupackend, warm und rau. Von all der Geschäftigkeit, vielleicht. Aber nie war sie krank oder bettlägerig. Und immer war sie in Bewegung gewesen. Vor allem ihre Schlüssel!
Sie hatte viele. Für jedes Zimmer und etliche Schränke und Fächer im Haus einen, und sie trug sie alle an einem großen schweren Ring dicht an der Hüfte. Dieser Ring gehörte ganz und gar zur Mutter oder sie zu ihm. Er regte sich – klirr, klirr – bei jedem ihrer Schritte. Was gut gewesen war, denn so hatte man immer ganz genau gewusst, wo im Haus die Mutter sich gerade befand, auch ohne sie zu sehen.
Klirr, klirr …
Die Mama hakte den Schlüsselbund los und öffnete die Tür zu Emilies Zimmer.
Margot blinzelte. Nein, es war nichts zu erkennen. Alles sorgsam abgedunkelt. Sie stellte sich vor, wie Emilie dort drinnen in ihrem Bett lag. Ein schmaler Körper in einem riesigen, unnachgiebigen Meer aus Decken und Kissen, über das sich ihr nobelblondes Haar ausbreitete wie die langfingrigen goldenen Fäden irgendeiner verwunschenen Märchengestalt. Hatte sie die Augen geschlossen? Träumte, atmete sie?
Margot stellte sich auf die Zehenspitzen, aber sie konnte nichts erkennen. Nichts als ein intensiver Geruch war da, der ihr entgegenströmte. Eine Mischung aus Kampfer, Desinfektionsmittel und Müdigkeit. Die Mutter schloss leise die Tür. Anscheinend war alles so, wie es sein sollte.
Sie gingen weiter.
In Mathildes Raum waren die Gardinen nur halb zugezogen, eine leichte Brise umspielte den Saum der Vorhänge, doch von Mathilde war ebenfalls nichts zu sehen. Nichts als eine riesige Schlafbinde, die Decke brav bis unters Kinn hochgezogen. Dazu das fast unhörbare Aufatmen der Mutter. Sie selbst war ein bisschen enttäuscht. Eigentlich hasste Mathilde solche Dinge wie Schönheitsschlaf. Meist las sie heimlich unter der Bettdecke in einem Buch, fast immer wurde sie von der Mutter dabei erwischt. Dann gab es ein herrliches Theater. Die Mutter sah es nämlich überhaupt nicht gern, wenn sie zu lange lasen.
»In Maßen, Mädchen, in Maßen. Ihr verderbt euch bloß die Augen.«
Pah! Leider waren von all den vielen Büchern im Studierzimmer die wenigsten interessant für sie. Die wirklich spannenden Sachen, Romane, wurden in einem gesonderten Schrank aufbewahrt. Natürlich war er verschlossen.
»Dafür seid ihr noch zu jung.«
Aber es gab zwei Schlüssel. Der eine hing, unerreichbar, am Schlüsselbundring der Mutter. Der andere jedoch, der Obhut des Vaters anvertraut, lag, von einigen losen Briefbögen nur halbherzig bedeckt, im vorderen Schubfach des Sekretärs.
Natürlich hatten sie rasch herausgefunden, wann der Moment günstig und die Abwesenheit der Eltern, am besten noch die der Brüder dazu, für mindestens eine Stunde gesichert war. Dann wurde entschlüsselt.
Während Emilie und Mathilde nahe der Tür Wache hielten, öffnete sie selbst unter dem angehaltenen Atem der Schwestern den Schrank. Ihre Hände hatten die ersten Male noch ein wenig gezittert vor Aufregung, und sie hatte sich die feuchten Handflächen rasch an ihrem Rock abgewischt, in der Hoffnung, dass die Schwestern es nicht sahen. Dann zog sie stets ein Buch mit einem besonders schönen Einband hervor, aus dem Mathilde, die von ihnen dreien die schönste Vorlesestimme hatte, vorlas: »Sie hatten schon Abschied voneinander genommen, und so sprachen sie nicht mehr. Wenn es sehr windig war, kam ihr flaumiges Haar im Nacken in wehenden Wirrwarr, oder die Schürzenbänder begannen, ihr um die Hüften zu flattern. Einmal war Tauwetter. An den Rinden der Bäume rann Wasser in den Hof hinab, und auf den Dächern der Gebäude schmolz aller Schnee. Emma war bereits auf der Schwelle, da ging sie wieder ins Haus, holte ihren Sonnenschirm und spannte ihn auf. Die Sonnenlichter stahlen sich durch die taubengraue Seide und tupften tanzende Reflexe auf die weiße Haut ihres Gesichts. Das gab ein so warmes, wohliges Gefühl auf der Haut, dass Emma lächelte …«
Es war verwirrend. Lag es an Mathildes Stimme? Oder saß der Erzähler etwa direkt im Kopf dieser Emma und kroch jetzt in den ihren?
»… hatte sie geglaubt, daß sie Liebe für ihn empfinde; aber da das Glück, das aus dieser Liebe hätte entspringen sollen, ausgeblieben war, musste sie denken, dass sie sich geirrt habe …«
Woher konnte jemand anders so genau wissen, was diese Emma dachte und fühlte? Dass sich jemand die Mühe machte, all das aufzuschreiben, und das so wichtig nahm. Niemand interessierte sich sonderlich dafür, was sie fühlte.
Margot seufzte. Nun, wo es um die Springprozession ging, wollte Mathilde offenbar doch lieber schön sein als heimlich lesen. Sie schlief oder tat zumindest so.
Klirr, klirr …
Margot sah zu, wie die Mutter auch diese Tür wieder verschloss. Sie verließen den Mädchentrakt über den Korridor. Ab und an knarzte eine Holzdiele unter ihren Sohlen, ansonsten war nur die leise, beharrliche Regung des Schlüsselbunds zu hören. Bis sie zum Musikzimmer kamen.
Ave Maria, gratia plena …
Charles spielte Schubert. Irgendwie hatte er es durchgesetzt, dass die Mutter das Musizieren als »weiterbildende Lektüre« durchgehen ließ. Allerdings bestand sie darauf, dass er beim Üben einen Spitzdämpfer verwendete.
Margot schloss für einen kurzen Moment die Augen. Wenn man Charles auf seiner Trompete spielen hörte, brauchte man ihn nicht erst noch zu sehen. All die starren Flure füllten sich mit seinem Atem, seinem Klang. Ach, nur ein kleines Weilchen noch stehen bleiben, lauschen.
Ave, ave dominus, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus …
Aber die Mutter war schon weitergegangen. Sie inspizierte den Aufenthaltsraum. Margot schaute gar nicht erst richtig hin. Hier wohnten die Möbel. Lindgrüne Samttapeten, über die ließ sich wenigstens ganz gut mit den Fingern fahren, dicke Teppiche, die alles ausbremsten. Stehlampen, denen man besser nicht zu nahe kam, Staffelei, Sekretär, Chaiselongue und Sesselgrüppchen. Irgendwelche öden Bildbände auf Tischchen, eine Schale mit Obst. Immerhin. Trotzdem, die Botschaft des Zimmers war klar: Du bist hier überflüssig. Die Mutter schien das anders zu sehen.
»Jean?«, rief sie unnötigerweise.
Jean war nicht da. Der ausladende Polsterstuhl mit der breiten, geschwungenen Lehne war leer. »Biedermeier« sagte die Mama dazu, aber in Wirklichkeit war er Jeans Pferd. Er ritt es in jede Schlacht, sein »treues Ross«, und obwohl Charles ihm schon tausendmal erklärt hatte, dass »das gute Stück« von dem »wilden Herumgehampel« Schaden nehmen konnte, schrie Jean unbeeindruckt weiter seine »Attackeeee!« und rückte unsichtbaren Feinden auf »Biedermeier« zu Leibe. Nun aber war er ebenfalls unsichtbar. Offenbar genau das, was er gerade sein sollte.
Und nun endlich, endlich zog die Mutter den Riegel zurück und stieß die schwere Hintertür auf, die über eine kurze Treppe hinunter in den Garten zu den Kaninchenstallungen führte.
Licht!
Margot sog das klare Mittagslicht tief in sich auf. Es war überall, brach durch die Blätter der Eschenzweige, glitt über Büsche und Gras, überzog die Hauswand mit Glanz, streichelte ihre Stirn, Nase, die Wangen. Auch im Haar der Mutter blitzte es auf, warm und hellgolden.
»Willst du da festwachsen, Kind?«
Die Mutter streifte sich bereits die Baumwollschürze zum Schutz ihrer Kleidung über. Dann nahm sie die fünf Angorakaninchen aus ihren Ställen und setzte sie nacheinander vor sich ins satte Gras, an dem die ruhigen Tierchen sogleich genüsslich zu knabbern begannen. Den Angoras war das Tätigkeit genug. Dass sie wertvoll waren – »kein Spielzeug« –, war ihr früh eingebläut worden. Margot ließ ihre Finger durch das unfassbar weiche Fell gleiten, und wie immer durchströmte sie dabei ein sanftes Glücksgefühl.
Die Mutter ließ sich neben ihr im Gras nieder und löste die Schnallen ihrer Schuhe. Die Hände locker im Schoß zusammengelegt, saß sie so da. Von Zeit zu Zeit fuhren auch ihre Finger durch die Kaninchenfelle, langsam, bedächtig, als wollte sie ihr Wohlbehagen speichern.
Und tatsächlich, nach einer Weile hörte Margot sie summen: »Meereenchen ass eng giedlech Saach. Net wann es sabbelt Dag fir Dag …«
Die Mama sah auf und lächelte sie an. »Meine Mutter hat das immer gesungen. Sie ist nicht sehr alt geworden, weißt du. Im Grunde habe ich sie kaum gekannt.«
Langsam wurde es kalt in der Küche. Margot drückte die Zigarette aus. Sie musste dringend Kohlen nachschieben.
»Im Grunde habe ich sie kaum gekannt …« – ja, dort im Sonnenlicht hatten sie gesessen, im Gras, während jener stets so genau arrangierten L’heure de repos. Die Mutter hatte gesummt, ihr Ausdruck war weich gewesen, fast mädchenhaft.
Aber woher kam das Licht? War es nicht meist ein wenig verhangen gewesen und außerdem recht kühl im Halbschatten der Eschen? Hatte sie sich nicht stets ein Wolltuch um ihre Schultern geschlungen, weil sie so gefröstelt hatte? Überhaupt, was hatte sie zu der Mutter gesagt, dort im Gras? Hatte sie mitgesummt? Hatte sie ihr je etwas anvertraut, Hoffnungen oder Wünsche? Nach ihrer Hand gegriffen? Und die Mutter, was hatte sie wohl sonst noch so gesagt? Warum hatte sie nicht besser zugehört?
»Sie wird Ihnen da aber viel Licht wegnehmen, die Wand.« – Schon wieder war sie da, schob sich vor ihre Erinnerungen wie ein ungebetener Kommentar: die Stimme dieses jungen Bauunternehmers. »Helligkeit«, murmelte sie. »Nicht Licht. Er hatte Helligkeit gesagt.«
Na und? Das war doch überhaupt nicht von Belang. Und diese trübseligen Kaffeetassen, sie sollte sie endlich wegräumen.
Margot schob den Stuhl zurück. Die Tassen ließ sie stehen. Bevor sie die Küche verließ, hielt sie kurz inne. Im Grunde war sie meist ganz schön langweilig gewesen, diese Mittagsstunde mit der Mutter, dort im Gras. Und ihr Gesicht – sie hatte es verloren. Für immer.
Ein Bild hingegen war nie verblasst, wurde niemals trüb: der klirrende Schlüsselbundring an der Hüfte der Mutter.
3
1952, Köln
FREDS Geschmack im Mund war bitter. Er saß auf dem breiten Sims des Wohnzimmerfensters und schaute auf die Straße hinunter. Gerade war der große Mann mit der lauten, fröhlichen Stimme gegangen – seinen Namen hatte er sich nicht gemerkt –, und die Mutter war in der Küche vor den leeren Tassen sitzen geblieben.
Fred lehnte den Kopf gegen die Fensterscheibe, und ein kleiner nagender Teil von ihm wünschte sich, die Scheibe wäre fort. Schweben …und dann – Fred spuckte auf die Scheibe. Er zerrieb die Spucke so lange, bis sie sich in immer bleicheren Schlieren auf dem Glas verlor.
Der bittere Geschmack im Mund aber blieb. Soeben hatte er die Tasse Bohnenkaffee, die der Handwerker abgelehnt hatte, in hastigen Schlucken geleert, und die Mutter hatte ihm dafür über die Wange gestrichen.
»Der ist so teuer, weißt du …«
Also hatte er es verschwinden lassen, das Teure, und damit wohl auch den Handwerker, irgendwie. Ja, im Verschwindenlassen war er gut.
Aber auch die Mutter war jetzt verschwunden. Zumindest sah es so aus, wenn sie dort saß: am stillen Küchentisch, in Rauch gehüllt.
Die Mutter liebte Rauch, das war ganz klar. Klar war auch, dass sie wieder einmal so merkwürdig in sich hineingekrochen war.
»Was schaust du denn so?«, hatte er sie mal gefragt.
»Ach weißt du, ich denke einfach nur nach.« Dann hatte sie den Rauch ein wenig zur Seite gewedelt, aber weiter so komisch leer geschaut.
In solchen Momenten wars hier im Nebenraum auf alle Fälle besser, besonders auf der Fensterbank. Da unten auf der Straße gab es nämlich allerhand zu sehen.
Zwei Gäule zogen gerade einen hoch beladenen Karren mit Schutt die Straße hinauf, vor ihren Mäulern stand Schaum. Ein paar Jungs waren hinten auf den Karren aufgesprungen und ließen ihre Beine baumeln.
Für einen kurzen Moment stellte er sich vor, er wäre einer der Jungen, die dort saßen. Am liebsten der stämmige. Der hatte zwar keinen Schal und keine Mütze, aber ihm schien trotzdem warm zu sein. Der kleinere daneben, der hatte eine Mütze auf, sah aber so aus, als ob er arg friere. Vielleicht hatte der stämmige seine Jacke mit Zeitungspapier ausgestopft, das half. Vielleicht war der in Wirklichkeit also auch so dünn wie die zwei anderen. Aber klüger. Da, einer der kleineren warf jetzt etwas, einen kaputten Ziegel?, quer über die Straße in Richtung Café.
Vor dem Eigelstein-Café saßen Männer auf Stühlen über irgendetwas gebeugt. Sie blickten nicht einmal auf. Einer von ihnen hatte sich einen Wollschal um Hals und Mund gewickelt, doch die anderen saßen lediglich in ihren ausgebeulten Jacken da. Das würde ihm keinen Spaß machen, dachte Fred. Da draußen auf den kippeligen Stühlen. Bei dem Wetter. Aber vielleicht wussten die Männer nicht, wo sie sonst hinsollten. Vielleicht hatten die keine Fensterbank so wie er.
Bei der Gasexplosion neulich war das halbe Nachbarhaus eingestürzt. Ganz schön aufregend war das gewesen. Aber auch furchtbar. Alles hatte gebebt, und die Wände hatten so gewackelt wie der Zahn, der ihm neulich ausgefallen war. In der Küche war einiges von dem Geschirr zerbrochen, und er hatte noch Stunden später einen fiesen Pfeifton in den Ohren gehabt. Ja, und all der Staub, der durch das Fenster reingekommen war. Einen schlimmen Husten hatte das gegeben. Und er wollte einfach nicht verschwinden, der Staub. Ganz egal, wie viel die Mutter auch wischte. Er lag einfach auf allem drauf wie eine zweite Haut.
Wenn er es vorher gewusst hätte, dass das passiert, dann hätte er sich rechtzeitig versteckt, wo mans nicht so mitbekam. Unter dem Sofa zum Beispiel. Aber die Explosion war ganz plötzlich gekommen. Den Krieg stellte er sich ungefähr so vor. Ein großer Lastwagen mit rotem Kreuz war gekommen und hatte die Kaputten, nein, die Verletzten mitgenommen.
»Keine Toten«, hatte die Mutter gesagt. Aber sie hatte so geschaut, als hätte es doch welche gegeben. Und sie hatte gezittert, dabei war ihr doch gar nichts passiert.
»Als gäbe es nicht schon genug Trümmer. Ja, hört das denn nie auf? Wer weiß, wo sonst noch überall Bomben vor sich hin dämmern. Wo sollen diese armen Menschen denn jetzt hin?«
Sie hatte das so vor sich hergesagt, also nicht zu ihm. Dabei hätte er die Lösung gewusst. Es gab doch so viele leere Häuser überall, gleich hier in der Eintrachtstraße und auch die Machabäerstraße hinunter, wo er und Peter immer spielten. Warum nahmen diese Leute nicht einfach eines von denen, die anscheinend sowieso keiner mehr wollte?
Bei der Explosion waren auch die Fensterscheiben vom Café zersprungen, die Frontseite war jetzt mit Holzlatten vernagelt. Und sofort war da eine Unmenge von Fotos, Steckbriefen und Zetteln drauf erschienen. Als hätten alle nur darauf gewartet, dass sie was sagen, was loswerden konnten. Einige von den Mitteilungen waren jetzt schon wieder halb abgerissen oder zu Boden gefallen. Er selbst hatte auch einen Zettel hingehängt.
Wer will mit mir Zukunft spielen?, hatte er drauf geschrieben. Nur so zum Spaß natürlich. Er hatte ja schon den Peter zum Freund. Aber der hatte heute so einen komischen Ausschlag und durfte nicht raus.
Ein Hund pinkelte an die Latten unterhalb der Zettel. War das etwa einer von denen, die diese Krankheit, Tollwut, übertrugen?
»Halt dich von denen fern«, hatte die Mutter gesagt. Dieser da, der braune Zottelige, schien das Café zu mögen. Er rieb sein Hinterteil an den Latten und blieb dann liegen. Komisch, der war ganz allein. Normalerweise schnüffelten die doch zu mehreren in den Hofeingängen und weiter hinten um die Mülltonnen herum nach Essensresten; aber sie waren fast immer zu spät dran. Katzen, Ratten und Menschen waren meistens schneller.
Aber was war das? Von der Weidengasse her bildete sich plötzlich eine kleine Schlange vor dem Gemüseladen.
Eine Frau im Kittelkleid und mit Eimer in der Hand stellte sich gleich dazu. War das nicht Marie Mertensen, die da gerade ihr Putzwasser in den Rinnstein gegossen hatte? Sie nahm sich noch nicht mal die Zeit, ins Haus zurückzulaufen und ihren Mantel zu holen. Und die zwei, die da auf ihren Lambrettas vorbeifuhren, hielten nun auch an, um sich das Ganze anzuschauen. Der Geisinger hatte anscheinend neue Ware bekommen. Vielleicht war es eine von diesen »Sonderaktionen«, von denen die Erwachsenen immer so redeten, als sei das ein Geheimnis, das nicht jeder wissen durfte. Aber warum wusste die Mutter nichts davon? Sie erfuhr so was doch sonst immer rechtzeitig.
Fred richtete sich kerzengerade auf. Rasch zu ihr, in die Küche –
»Du sollst nicht stören. Hast du mich verstanden? Du sollst nicht stören!«
Fred blinzelte.
Der war doch weg.
Der Vater …
»Was bist du?«
»Sch …«
»Lauter.«
»Ein Scheißkerl.«
»Ich hör nichts!«
»SCHEISSkerl. EinSCHEISSKERLbin ich.«
Zählen. Zählen half. Und zwar laut: »Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben …«
»Hermann, bitte …«
»… neun, zehn …«
»Hermann, bitte! Bitte nicht …«
»Mama!«
»Halts Maul. HaltsMAUL.«
Null. An die Null denken. Rund ist die. Fett. Eine runde, fette Blase. Sie vor sich sehen: Kaugummiblase, Sprechblase. Comic-Blase. Micky Maus. Und Donald Duck …
»Komm schon, Onkel Donald! Aufstehen!«
»Tröööt!«
»Aargh! Na, wartet!«
Tick, Trick und Track haben Tröten in der Hand. Und da ist Donald. Schimpfend springt der vom Sofa auf. Der Donald ist wütend auf diesen Bildern. Seinen Schnabel hat er ganz weit aufgerissen, sodass man hinten das Zäpfchen im Hals sieht. Die Fäuste sind geballt. Seine blaue Matrosenmütze fliegt hoch in die Luft. Gleich holt er den Teppichklopfer. Die drei Kleinen rennen raus, ihre Füße sind jetzt Räder statt Entenflossen, so schnell laufen sie, raus und dann über die Strickleiter in ihr Baumhaus hoch. Die Strickleiter wird hochgezogen, ach, wie gern hätte er auch so ein Baumhaus. Brüder. Dreisein. Ja, drei war eine gute Zahl …
»Du hast wieder unser Sparschwein geplündert, Onkel Donald.«
»Wir wollen auch mal wegfahren!«
»Tja, Kinder, euer Onkel ist eben ein Pechvogel.«
Noch beim Geisinger drinnen im Laden hatte er anfangen, in dem neuen Heft zu lesen. Beim Geisinger, wo es nach allerlei aufregenden Dingen roch. Nach Schiff roch es zum Beispiel, vor allem wenn man ganz nah an die übereinandergestapelten Holzkisten heranging. Zumindest roch es so, wie er es sich auf einem Schiff vorstellte: salzig und fischig, muffig und frisch zugleich, nach Pflanzen, nach Früchten, Dreck und rauer See. Ja, und nach Metall. Schweiß und Händen. Vielen Händen.
»Na, da biste ja, Jung!« – Die Hände vom Geisinger, seine dicklich-rötlichen, erstaunlich geschickten Finger, hatten hinter der Ladentheke eine Schublade aufgezogen, und »Donald auf Wochenendfahrt« war daraus zum Vorschein gekommen. Das allerneueste Heft!
»Richtig lesen, Fred. Nicht nur dieses gestamel aus deinen Comics …« – Johan hatte das neulich zu ihm gesagt. Johan war der neue Freund. Das erkannte man daran, dass er ihm stets etwas mitbrachte, wenn er zu ihnen kam. Natürlich kam er eigentlich zur Mutter. Das war immer so mit Männern. Alle von denen mochten sie. Aber weil er, Fred, nun mal auch da war, bekam er was. Ein Buch zum Beispiel. Auch die Wohnung, in der sie jetzt lebten, hatte Johan ihnen gegeben und ihnen für die Zukunft sogar ein Radio versprochen. Außerdem brachte er ihnen Geld. Also war Johan ein Freund.
Und neulich, da hatte er ihm »Robinson Crusoe« mitgebracht. Erst hatte er das gar nicht gewollt: richtig lesen. In dem Buch stand alles so eng beieinander geschrieben. Ganz schön anstrengend.
Fred griff nach dem Buch, das neben ihm auf dem Fensterbrett lag, als habe es da auf ihn gewartet. Was ja auch stimmte. Er blätterte wieder einmal darin herum. Da waren viele lange und seltsame Sätze auf jeder Seite, wie zum Beispiel diese: »Nach der geachteten Familie, welcher sie [die Mutter] angehörte, wurde ich Robinson Kreuznaer genannt. In England aber ist es Mode, die Worte zu verunstalten, und so heißen wir jetzt Crusoe, nennen und schreiben uns sogar selbst so, und diesen Namen habe auch ich von jeher unter meinen Bekannten geführt.«
Das gefiel ihm, dass Robinson und seine Familie, dass die ihren Namen einfach so ändern durften und alle das Spiel mitmachten. Leider verstand er nicht, was die Worte »verunstalten« und »von jeher« meinten, und so hatte er Johan danach gefragt.
»Du bist doch ein kluger Junge. Lies schön weiter, dann wirst du immer mehr verstehen mit der Zeit.« – Das hatte Johan gesagt und ihm die Worte, die er nicht verstand, in seinem etwas merkwürdigen Tonfall erklärt, in einem Deutsch, das stimmte und gleichzeitig auch nicht.
»Auswendiglernen, das hilft auch«, sagte Johan noch.