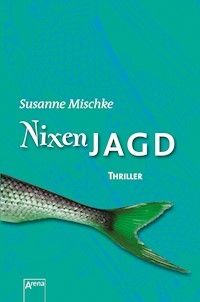8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein mysteriöser Knochenfund im Garten einer betagten Kundin bringt das Leben der Gärtnerin Rosa ganz schön durcheinander. Was weiß Luise Pauly, die harmlose alte Dame, von den verwitterten Knochen in ihrem Garten? Und weshalb verschwand Rosas Mutter vor über 25 Jahren? Neugierig begibt sich Rosa auf Spurensuche und fördert dabei ein viel zu lange gehütetes Geheimnis ihrer Familie zutage, das bis in die grausamen Wirren des Zweiten Weltkriegs zurückführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe1. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95570-6
© Piper Verlag GmbH, München, 2000
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: Wolf Huber, München
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Schlachtabfälle, Eingeweide von Tieren und Geflügel, wie sie im Haushalt oder in größeren Mengen in Schlachthäusern abfallen, sind doppelt so gehaltreich wie reiner Stallmist, müssen aber verfaulen, sie sind frisch zu scharf. Deshalb auf den Komposthaufen damit!
Boettners Gartenbuch, 1969
I
»Die sind von einem Schwein«, sagt Frau Pauly.
»Einem Schwein?« fragt Rosa.
»Ja, einem Schwein.«
»Das sind keine Schweineknochen.«
»Ein Hund wird sie verbuddelt haben.«
Beide senken den Blick in das Erdloch.
»So tief gräbt kein Hund.«
Frau Paulys schmächtiger Brustkorb hebt sich, als sie verärgert schnauft.
»Nun gut. Wir haben sie vergraben. Damals, nach dem Krieg. Hier wurde ab und zu schwarz geschlachtet, unten, in der Waschküche.«
»Das sind keine Schweineknochen«, wiederholt Rosa.
»Hunde hatten wir auch. Zwei Riesenschnauzer, Terry und Harry, und davor mal einen Spitz. Das war ein ganz scharfer. War auch gut so, sonst hätten die uns alles geklaut.« Frau Paulys Arm beschreibt einen Bogen von der gestutzten Thujenhecke im Norden über die noch kahlen Rosen hinweg bis zu den baumhohen Hibiskussträuchern an der südlichen Grundstücksgrenze. »Das war mal ein Acker. Kartoffeln, Rüben, Kohl. Können Sie sich das vorstellen?«
»Nein.«
»Wir waren darauf angewiesen, zum Überleben. Und zum Tauschen. Wie hieß er nur? Fällt mir schon noch ein. Spitze sieht man jetzt kaum noch. Sind nicht mehr in Mode, was?«
Rosa deutet auf die erdverschmierten Knochen, die auf dem Aushub neben der Grube liegen.
»Das hier war jedenfalls ein Mensch.«
Frau Pauly läßt den Blick schweifen, als betrachte sie zum erstenmal die Rhododendren, den Kirschbaum und die Kletterrosen, die sich verspielt am Pavillon hochranken. Es ist eine frühblühende Sorte, cremefarben.
»Der Pavillon müßte mal wieder gestrichen werden.«
»Hier ist ein Stück vom Becken. Das da sind Rippen. Und das ist ein Wirbel …« Rosa tippt jedes angesprochene Teil mit der Schaufel des Spatens an. Dann bückt sie sich und streckt Frau Pauly etwas Langes, Schmutziges hin. »Der Oberschenkel. Die halten sich immer am besten.«
»So. Tun sie das?«
»Ja.« Rosa neigt den Kopf und schaut ihrem Gegenüber in die Augen. Sie mochten einmal braun gewesen sein, vielleicht auch grün, nun ist die Farbe verwässert.
»Frau Pauly, der Bursche da …«
»Wieso Bursche?« fährt Frau Pauly dazwischen.
Rosa hebt ihr rechtes Knie und hält den Knochen neben ihren Schenkel. »Viel länger als meiner. Und das ohne Kniegelenk. Das muß ein Mann gewesen sein. Ein größerer, für damalige Verhältnisse. So, wie der beeinander ist, liegt er bestimmt schon dreißig, vierzig Jahre da drin.«
Sie ist sich mit der Datierung der Gebeine längst nicht so sicher, wie sie vorgibt. Ihre einzige Erfahrung mit einem Fund dieser Art liegt fünfundzwanzig Jahre zurück, und sie erinnert sich nicht gerne daran.
»Mein Mann war groß«, bemerkt Frau Pauly. »Aber der liegt nicht hier im Garten. Er ist auf dem Waldfriedhof. Er war immer für Ordnung.«
»Und wer ist dann der da? Ein lästiger Liebhaber?«
»Jackie!«
»War er ein Ami?«
»Ein Ami?« wiederholt Frau Pauly begriffsstutzig.
»Also Jackie«, hält Rosa fest. »Und wie weiter?«
»Nur Jackie. Seit wann haben Hunde Nachnamen?«
»Wieso Hunde?«
»Ich habe Ihnen doch eben von unserem Spitz erzählt. Sie sind heute ein wenig zerstreut, liebe Rosa. Man könnte meinen, Sie haben Alzheimer!« Frau Pauly strafft die Schultern und reckt ihr schroffes Kinn. »Und überhaupt: Wie kommen Sie dazu, riesige Löcher in meinen Rasen zu buddeln?« Sie deutet auf die Grube und hebt streng die Augenbrauen, die nur noch in Form zweier zittriger Linien aus braunem Kajal existieren.
»Ich bin die Gärtnerin«, setzt Rosa dagegen. »Schon vergessen?«
»Werden Sie nicht süffisant.«
»Tut mir leid.« Das ist aufrichtig gemeint. Sie hat Respekt vor dieser Frau, einer Dame zweifellos, auch wenn sie etwas bizarr aussieht: Stets trägt sie taubengrauen Lidschatten und einen Lippenstift, den Rosa für Frau Paulys Alter zu grell findet. Das nußbraun gefärbte Haar trägt sie offen, es ist über schulterlang und an den Spitzen fedrig dünn. Ein wie mit einem Säbel abgeschnittener Pony verdeckt bis zur Hälfte die hohe Stirn mit den tiefen Furchen.
»Ich bin noch nicht so vertrottelt, wie es einige Leute gerne hätten.« Frau Pauly verschränkt trotzig die Arme, wobei ihre Hände in den Ärmeln einer eierlikörgelben Kaschmirjacke verschwinden. Der Farbton harmoniert mit dem Schottenkaro ihres wollenen Faltenrocks, den sie über schwarzen Wollstrumpfhosen trägt. Bis dahin findet Rosa Frau Paulys Garderobe ganz in Ordnung, aber unterhalb der Knie schlottern weiße Kniestrümpfe mit Lochmuster um ihre spatzendünnen Fesseln, und die Füße stecken in flachen, beigefarbenen Lackschuhen mit silbernen Spangen.
»Also, raus damit! Wonach haben Sie gesucht?«
»Ich habe nichts gesucht, Frau Pauly.«
»Wozu dann diese Verwüstung?«
»Ihre Schwiegertochter sagte mir, daß Sie an diese Stelle einen Pfirsichbaum gepflanzt haben wollen«, erklärt Rosa ruhig und zeigt auf die dürre, zwei Meter hohe Staude im Plastikeimer.
»Das soll ich gesagt haben?«
»Und wie ich das Pflanzloch aushebe, finde ich diese Knochen.«
»Einen Pfirsichbaum? Mein Sohn ißt doch gar keine Pfirsiche. Die sind ihm zu pelzig. Höchstens Nektarinen. Als Kind mußte ich ihm immer die Schale abmachen, damals gab es noch keine Nektarinen, Ende der Vierziger. Noch nicht mal in den Fünfzigern. Die erfand man erst viel später.«
»Vielleicht ißt sie selbst gerne Pfirsiche. Oder Sie vielleicht?«
»Mir kommt da kein Pfirsichbaum hin! Ich will, daß alles so bleibt, wie es früher war. Genau so.«
»Kartoffeln, Rüben, Kohl?«
»Unsinn!« Frau Pauly fuchtelt unwirsch mit der Hand. Ihre Nägel sind perlmuttfarben lackiert. »Nicht, wie es nach dem Krieg war. Sondern früher. Am Anfang.«
»Es ist schwierig, einen Garten zu konservieren, Frau Pauly. Pflanzen verändern sich nun mal.«
Frau Pauly antwortet nicht, und auch Rosa schweigt. Ihr Blick verfängt sich im Frühlingsgrün, Frau Paulys in der Vergangenheit.
Der Garten. Kamelien, die nicht mehr da sind, englische Rosen am Erker, eine Sorte, die es nicht mehr gibt. Eine warme Nacht im September: In den Bäumen weiße Girlanden über weiß gedeckten Tischen. Die vielen schönen Frauen. Die einen tragen Feengewänder, andere Kleider, die verboten schwarz und eng sind. Eine rezitiert im Schein zweier Fackeln traurige Gedichte unter dem Mandelbaum, den es auch nicht mehr gibt. Ihr Gesicht ist kalkweiß mit Augen wie Kohlen, ihr Kleid eine einzige schwüle Männerphantasie. Im großen Zimmer, das Salon genannt wird, sitzt ein Mann im Frack an einem lackschwarzen Klavier. Dissonante Klänge verschmelzen mit dem Gesprächslärm, dem Gurren und Lachen, den Schmeicheleien und Streitereien. Ein Paar tanzt in ekstatischen Verrenkungen, ein anderes huscht die Treppe hinauf, im Nebenzimmer wird über Politik debattiert und Billard gespielt. Es wird reichlich geraucht, Zigarren, und getrunken, Kognak und Champagner, Veuve Clicquot. Wie hieß nur der Kognak? Jakob muß dem Mädchen helfen, Tabletts mit Häppchen und Gläsern in den Garten zu tragen, Luise wandert in dem großen Haus herum und öffnet eine falsche Tür. Da ist ein Geräusch, ein schweres Atmen, ein glucksendes Lachen. Luise muß jetzt einfach stehen bleiben, Augen und Ohren weit aufgesperrt. Irgendwo im Raum brennen drei Kerzen, drei schwebende Sterne in einem großen Spiegel. Etwas Helles bewegt sich hinter einer Bettlade aus Eisenschnörkeln, deren verschlungene Schatten die Wände mit Ornamenten verzieren. Gehauchte Worte, das Flüstern von Seide. Jetzt erkennt Luise zwei entblößte Knie, die wie weiße Berge aufragen, eine zuckende Hand.
Sie hält den Atem an. Das Gesicht mit den Höhlenaugen wird für einen Moment deutlich sichtbar, es schwebt wie ein Vollmond zwischen den beiden Marmorschenkeln, ein Stöhnen veranlaßt Luise, auf die Knöchel ihrer Faust zu beißen. Dann fällt ein dunkler Haarvorhang.
Lene, die kennt sich mit solchen Sachen aus. Theoretisch. Beim Ballett seien die Männer alle schwul, damit müsse sie, Lene, sich als künftige Primaballerina beizeiten abfinden.
Aber wie ist das bei Frauen? Ist denen so etwas erlaubt? Gehören diese schlanken Finger, die sich gerade in einen fleischigen Hintern krallen, einer Kriminellen? Ist die Kohlenäugige, die jetzt eine Billardkugel in der Hand hält, sie kurz mit den Lippen berührt und sie dann … »Die rosa Blüten werden sich vor dem weißen Pavillon gut machen«, bricht Rosa das Schweigen, denn sie verspürt wenig Lust, den Baum wieder abzutransportieren.
Frau Pauly schaut sie an wie eine Schlafwandlerin, die man gerade vom Dach geholt hat.
»Es war die Acht.«
»Die Acht?«
»Ach, nichts. Der Pavillon müßte dringend gestrichen werden.«
»Das sagten Sie schon. Ich werde mich darum kümmern.«
»Ein Mandelbaum wäre auch gegangen.«
»Wie?«
»Wegen der rosa Blüten.«
»Kann schon sein. Was machen wir jetzt mit den Knochen?«
»Warum wollte Gertrud den Pfirsichbaum?« insistiert Frau Pauly.
»Keine Ahnung. Sie sagte auch was von noch mehr Rosen und einem Gartenfest zu Ihrem Achtzigsten.«
Frau Pauly schüttelt energisch den Kopf. »Nichts da. Wenn ich gestorben bin, kann sie alles auf den Kopf stellen. So lange muß sie noch warten. Sagen Sie ihr das, wenn sie Sie das nächste Mal dazu anstiftet, den Garten zu verwüsten.«
Rosa verdreht die Augen himmelwärts. An manchen Tagen kann Frau Pauly ziemlich anstrengend sein.
Frau Pauly hebt die Hand an den Mund und wispert: »Wissen Sie, manchmal hat sie nicht alle beisammen.«
Das gleiche hat Gertrud Pauly über ihre Schwiegermutter auch gesagt, und im Prinzip ist Rosa geneigt, beiden zu glauben. Aber möglicherweise ist das Theater wegen des Baumes nur ein Ablenkungsmanöver, da die Hausherrin offensichtlich gar nicht gern über den Fund in ihrem Garten sprechen will. Rosa wirft den Schenkelknochen ins Gras, stößt den Spaten in die Erde und holt tief Atem. Sie bemüht sich, ihre ganze Entschlossenheit in Haltung und Stimme zum Ausdruck zu bringen: »Frau Pauly. Wer ist der Tote da?«
Die alte Dame senkt den Kopf, ihre Nackenwirbel stechen unter dem dünnen Haar hervor wie Zahnräder. Sie scheint nachzudenken.
Schließlich verkündet sie feierlich: »Ich hab’s vergessen.«
Sie wendet sich um und tippelt in ihren Kleinmädchenschuhen über den Rasen in Richtung Haus.
»Was soll ich denn jetzt damit machen?« ruft ihr Rosa nach.
»Zurück ins Loch«, befiehlt Frau Pauly, ehe sie durch die Terrassentür schlüpft. »Und kein Wort davon zu meiner Schwiegertochter!«
Nachdenklich auf den Spatenstiel gestützt, steht Rosa vor einem Problem. Ehe Gertrud Pauly zur Kartoffelkur in die Eifel entschwand, hat sie Rosa genau gezeigt, wo der neue Baum hin soll. Er soll ein gleichschenkliges Dreieck mit dem Kirschbaum und dem Pavillon bilden. Das Wort »gleichschenklig« ist Rosa im Gedächtnis geblieben, weil früher an dieser Stelle im Mathematikunterricht immer gekichert wurde. Wenn man nur Gertruds Mann um Rat fragen könnte. Rosa sieht Herrn Pauly gischtbesprüht in den Wanten hängen, die Situation ist kritisch, doch der Pensionär hat die Elemente im Griff, er spürt den Wind (Stärke sieben bis acht) im graubärtigen Gesicht, er bläst ihm gerade den letzten Aktenstaub aus dem Hirn, endlich Freiheit und Abenteuer, da dudelt das Handy unter seinem Friesennerz. Eine Sturmwarnung vom Wetterdienst? Nein, es ist die Gärtnerin seiner Mutter, die ihm etwas von Pfirsichbäumen, gleichschenkligen Dreiecken und Knochen erzählt.
Lieber nicht.
Sie raucht eine Selbstgedrehte und entscheidet sich dann für Frau Pauly seniors Vorschlag. Immerhin arbeitet sie noch für die alte Dame. Sie wird das Loch ein wenig tiefer und breiter machen, die Gebeine zurück an ihren Fundort legen und den Baum obendrauf setzen. Die beste Lösung, findet sie, auch für den Toten. Es gibt häßlichere Orte, um begraben zu sein.
Sie gräbt noch nicht lange, als der nächste Knochen sichtbar wird. Eine Rippe. Beim nächsten Stich findet sie den Schädel.
Rosa macht sich die Mühe und spritzt ihn mit dem Gartenschlauch ab. Er ist bräunlich verfärbt, aber sonst gut erhalten, nur der Unterkiefer fehlt. Rosa wendet sich um in Richtung Haus und hält den nassen Schädel wie eine Monstranz vor sich hin. Sie ist sicher, daß Frau Pauly hinter irgendeiner Gardine auf der Lauer liegt. Aber nichts rührt sich, nur Vogelgezwitscher durchbricht die Stille.
Rosa legt den Schädel auf die zierliche Eisenbank vor dem Pavillon und setzt sich neben ihn. Sie raucht noch eine. Das mit dem Schädel ist doch etwas anderes. Sie kann den Pfirsichbaum jetzt nicht mehr einfach in die Grube setzen, als ob nichts wäre. Denn da ist etwas. Ein Mensch, der gelebt hat, geatmet. Wurde er das Opfer eines Verbrechens? Gut möglich. Sonst würde er ja auf einem Friedhof liegen, wie es sich für Tote gehört, und nicht hier im Garten. Wie auch immer, beschließt Rosa, er soll ein richtiges Grab bekommen.
Ein richtiges Grab. Seit ihrem siebten Geburtstag wünscht sie sich ein richtiges Grab für ihre Mutter. Mit einem Stein, vielleicht sogar einer Figur, und einer Inschrift in Goldbuchstaben: Hier ruht Hemma Ganni, geborene Semper … Ein Grab, das man bepflanzen und gießen kann, ein Ort, an dem unsichtbare Drähte oder Strahlen direkt vom Himmel münden, wie eine unsichtbare Telefonleitung, durch die der Tote ansprechbar, quasi erreichbar, bleibt.
Eine tote Mutter wäre gar nicht so schlimm gewesen. Eine tote Mutter wirft keine Fragen auf, höchstens nach dem Wie und dem Wann. Zwei klare, knappe Antworten, und dann wird man zum Gegenstand reinen Mitleids ohne den Beigeschmack von Neugier und Sensationslust.
Sie drückt die Zigarette aus und hält ihre Hand über den Schädel, als wolle sie ihn tätscheln, aber sie sagt nur: »Keine Sorge, wir finden schon was für dich.«
Tatsächlich steht Luise Pauly hinter der blauen Gardine ihres Schlafzimmers und sieht mit zusammengepreßten Lippen zu, wie ihre Gärtnerin neben dem Schädel auf der Bank sitzt und raucht. Ab und zu scheint sie etwas zu ihm zu sagen, aber da ist sich Frau Pauly nicht ganz sicher. Jetzt drückt Rosa die Zigarette auf der Bank aus, schnippt sie in Richtung Komposthaufen und steht auf. Sie ist groß und breitschultrig, ihr tabakbraunes Haar ist von künstlichen blonden Strähnen durchzogen. Ein hübsches Ding, aber kein Stil, denkt Frau Pauly. Woher auch, wenn die Mutter fehlt.
Rosa fängt erneut an zu graben. Einmal bückt sie sich und legt etwas beiseite, es sieht aus wie ein Unterkiefer. Dann verschwindet sie aus Frau Paulys Blickfeld und kommt mit einer leeren Plastiktüte mit dem Aufdruck Humuserde – Beste Gärtnerqualität zurück. Sie sammelt die Knochen ein und stochert anschließend mit dem Rechen im Aushub. Warum tut sie nicht, was ich ihr gesagt habe? Was sollen die Knochen in dem Plastiksack? Eigensinnige Person! Und jetzt? Jetzt geht sie einfach. Macht pünktlich um fünf Uhr Feierabend. Nimmt den Sack mit, läßt den Baum im Eimer und das Loch im Rasen. Es hat inzwischen die Größe einer Badewanne. Oder eines Sargs.
Rosa hüpft von Grab zu Grab. Wasser schwappt aus der Gießkanne auf die nagelneuen roten Sandalen – Größe 33 –, die Hemma für sie im Sommerschlußverkauf erstanden hat. Die rechte ist schon ganz naß. Drei Spritzer je Grab. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Das hat sie neulich bei einer Beerdigung gesehen. Der Priester verwendete sogar eine spezielle Grabspritzbürste. Rosa hat nur eine Spülbürste mit platten Borsten, aber das geht genauso gut. Sie gibt sich der Vorstellung hin, ihre Fürsorge muntere die Verstorbenen für eine Weile auf – einen Tag vielleicht, oder eine Nacht, sofern der Unterschied für die da unten überhaupt feststellbar ist. Sie verrichtet ihr Werk systematisch und im Akkord. Drei Spritzer je Grab, denn die Drei ist die Zahl. Drei Wünsche gewährt die Fee, im Himmel thront die heilige Dreifaltigkeit, drei goldene Haare hat der Teufel. Tick, Trick und Track. Vater, Mutter, Kind …
Drei Spritzer je Grab, eine Reihe nach der anderen. Stets hofft sie, alle Toten zu beglücken, ehe Hemma mit dem Gräberrichten fertig ist, aber es gelingt nie. Es sind zu viele. Sie merkt sich den letzten Grabstein, um beim nächstenmal dort weiterzumachen, aber oft findet sie den Stein nicht mehr, weshalb sie sich beeilt, lesen zu lernen. Mit fünfeinhalb kann Rosa die meisten Grabinschriften entziffern und beherrscht das Dreier-Einmaleins bis fünfzehn.
Doch das neu erworbene Wissen schafft neue Erschwernisse. Rosa entdeckt, daß in manchen Gräbern mehrere Tote liegen, und aus Gründen der Parität verlangen diese Gräber nach drei Wasserspritzern pro Person. Rosa sieht sich gezwungen, sich vor jeder Grabbespritzung über die Belegung zu informieren, wobei das Lesen der Namen ungleich mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Beweihwässerung.
Der Totengräber ist taubstumm, Rosa versteht sich gut mit ihm. Zwei Wochen vor ihrem siebten Geburtstag schenkt er ihr ein paar Knochenstücke, die bei einer Umbettung vergessen wurden. Rosa wundert sich, daß die Knochen nicht weiß sind, sondern erdbraun. Sie steckt sie in die geräumige Tasche ihrer orangefarbenen Latzjeans und zu Hause, als ihre Mutter im Laden ist, in die Spülmaschine. Die Maschine ist nagelneu, erst kürzlich angeschafft, »wegen dem Baby«, wie Hemma Enzo gegenüber argumentierte. Es soll und wird ein Junge werden. Ihre Eltern sprechen jedenfalls von »ihm«, und das andauernd. Vor allem ihr Vater. Sie weiß nicht, was an einem Jungen so Besonderes sein soll, daß man seinetwegen eine Spülmaschine von AEG im Haus haben muß, aber immerhin weiß Rosa bereits, wie man das Gerät einschaltet.
Laden zu vermieten steht auf dem verblichenen Schild hinter der Scheibe, und man braucht nur einen Blick auf die staubigen Fenster und den leeren Verkaufsraum zu werfen, um zu erkennen, daß die Geschäfte hier schon seit längerer Zeit ruhen. Die Blechbuchstaben Gärtnerei Semper an der Front des Gebäudes sind verrostet, rotbraune Spuren ziehen sich über den grauen Putz, der am Sockel Blasen wirft. Ihre Mutter wollte einen grasgrünen Neonschriftzug haben, aber dazu ist es nicht mehr gekommen.
Rosa parkt den Wagen vor der Ladentür und folgt dem holprigen, bemoosten Betonplattenweg, der um das Gebäude herum führt, zu einem unproportionierten Anbau. Das flache Rechteck ist zu groß für das kleine spitzgiebelige Haupthaus und zu klein für die großflächigen Fenster. Panoramafenster, wie sie in den Sechzigern Mode waren. An der Haustür, unter dem Schild Komme noch heute wieder, Rosa, klebt ein kleiner gelber Zettel: Habe vielleicht eine Spur. Komm doch mal rauf. J. Sie dreht sich um. In der Dachwohnung, die über dem Laden liegt, sind die Rolläden heruntergelassen. Wie immer. Vielleicht eine Spur. Sehr vielversprechend klingt das nicht, aber wenn ihr überhaupt einer helfen kann, dann Jochen. Sie macht sich nicht viele Hoffnungen, versucht, sich überhaupt keine zu machen, zwingt sich zur Gelassenheit, indem sie beschließt, sich erst morgen darum zu kümmern. Nach so vielen Jahren kommt es auf einen Tag nicht an. Außerdem hat sie heute schon etwas vor.
Sie schlüpft aus den Arbeitsklamotten, schaltet in der Küche das Radio und im Bad den Elektroboiler ein und brüht sich einen Instant-Cappuccino auf. Die Kaffeedose ist schon seit Tagen leer, es macht ihr nichts aus, heute nicht. Ronald will mit ihr Essen gehen, so ganz außer der Reihe, mitten in der Woche, einfach so. Sie setzt sich auf einen der drei Küchenstühle und lackiert sich die Zehennägel dunkelblau. Im Radio werden deutsche Schlager abgenudelt. Die getigerte Katze nimmt Reißaus. Das Tier hat Geschmack, erkennt Rosa.
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben …
Rosa dreht sich eine Zigarette und steckt sie sich an, während sie mit gespreizten Zehen auf dem Stuhl hockt. Sie schaut erst ihre Füße an – ihre Zehen sind zu lang, findet sie – und dann ihre Küche. Sie erprobt einen neuen, einen distanzierten Blick, als wäre sie eine Besucherin. Blümchentapete (verblaßt), orangefarbene Wandfliesen (verkalkt), Nirostaspüle (zerkratzt und verbeult), darüber ein kleiner Boiler (ein Stromfresser), eine höhlenartige Lücke unter der abgestoßenen Kunststoffarbeitsplatte, wo die Spülmaschine war und nun der Putzeimer steht, ein Hängeschrank in Babyhellblau mit geriffeltem Glas (dahinter ein Geschirrmix aus Ikea und Woolworth). Ein nagelneuer Kühlschrank, viel zu groß für eine Person, ein Schnäppchen mit kleinen Lackschäden, die man nur sieht, wenn man’s weiß. Er steht auf einem ockerfarbenen Fliesenboden mit verschmutzten Fugen. (Sein Inhalt besteht im wesentlichen aus Tomaten- und Zucchinisoße.)
Schalala lalala …
Rosa summt mit. Warum will er wohl so ganz außer der Reihe, mitten in der Woche, mit ihr Essen gehen? Auch noch ins Weststadt. Ich werde das rote Kleid anziehen, das mit dem Wahnsinnsausschnitt, und die neuen Schuhe, oder vielleicht …
Sie steht abrupt auf. Rosa, du Gans! Du bildest dir doch hoffentlich keine Schwachheiten ein? Es wird enden, wie es immer endet. Sie geht zum Radio und würgt das Geräusch ab. Trotzdem kann sie nicht verhindern, daß gewisse Bilder in ihrem Kopf herumgeistern. Die von der allerkitschigsten Sorte.
Rosa fährt mit dem Zeigefinger an der Tischkante auf und ab und hört Ronald zu. Schon zum drittenmal benutzt er das Wort »Karrieresprungbrett« – und zum drittenmal sieht ihn Rosa auf einem Dreimeterbrett über einem türkisglitzernden Schwimmbad stehen. Er schwärmt von Reisen, einem Dienstwagen. Es klingt wie ein Refrain. Zukunftsmusik.
Die Kellnerin serviert den Hauptgang. Fisch für Rosa, Lamm für Ronald, eine neue Flasche Rotwein für beide.
Sie stoßen an. Ronald beschwört die Schönheit des Sees, das internationale Flair der Stadt, beklagt die Immobilienpreise, füllt zum dritten- oder viertenmal Rotwein in Rosas leeres Glas. Er trinkt fast nichts, er ist der Fahrer.
Ronald nimmt ihre Hand, die zur Faust verkrampft neben dem Teller mit der Seezunge auf Limettenschaum liegt, und küßt sie. Er redet und redet, und als er endlich einmal schweigt, sieht er sie erwartungsvoll an.
»Jetzt sag doch auch mal was!«
Aber Rosa kann nichts sagen, sie kämpft gegen das Kribbeln in der Nase, das Beben der Lippen, die Klammer in der Kehle. Das Aufstehen ist ein Kraftakt, die Erdanziehung hat sich verdoppelt. Sie hat beinahe vergessen, daß es auch körperlich weh tut.
Hemma Ganni schaut verstohlen auf ihre Armbanduhr. Nur die Dame mit dem schwarzen Hut ist noch im Laden. Sie erscheint in letzter Zeit regelmäßig freitags kurz vor Ladenschluß und kauft einen Strauß in mittlerer Preislage. Heute schwankt sie zwischen Gerbera und Schwertlilien und verwickelt Hemma dabei in ein persönliches Gespräch, was selten jemandem gelingt. Unterhaltungen mit der Kundschaft, die über das Floristische hinausgehen, manövriert Hemma geschickt ins allgemeine.
»Wie soll es denn heißen?« will die Dame mit dem schwarzen Hut wissen.
»Vielleicht Carlo.«
»Carlo gefällt mir, ›Vielleicht‹ ist etwas ausgefallen. Und wenn es ein Mädchen wird?«
»Es wird kein Mädchen.«
»Davon bitte sieben Stück mit ein bißchen Grünzeug dabei.« Die Dame deutet auf die Schwertlilien. »Wann ist es denn soweit?«
»In fünf Wochen.«
»Hoffentlich bekommt es ihr schönes dunkles Haar.«
Vielleicht sollte man die Beleuchtung im Laden ändern, überlegt Hemma. Ihr Haar ist braun, ein schlichtes, bescheidenes Braun, weder hell noch dunkel.
»Bestimmt bekommt er schönes Haar. Wenn nicht von mir, dann von seinem Vater. Papier oder Folie?«
»Papier. Wie geht es der Frau Semper?«
Hemma wickelt den Strauß ein und nimmt den Geldschein entgegen. Die Frage stellt die Dame jede Woche. Anscheinend ist sie eine Stammkundin ihrer Mutter, die bis vor wenigen Wochen den Laden regierte.
»Unverändert«, antwortet Hemma mit unbewegtem Gesichtsausdruck, und die Dame lächelt, als hätte sie eine gute Nachricht vernommen, nimmt das Wechselgeld und ihren Strauß und geht, einen Gruß murmelnd, durch die bimmelnde Ladentür.
Kaum ist die Kundin draußen, schließt Hemma den Laden ab und eilt über die frisch gelegten Betonplatten. Sie muß für Rosa und Enzo das Abendessen vorbereiten, sie selbst will noch ins Krankenhaus, ehe sie dort keinen Besuch mehr hineinlassen.
Mit raschen Schritten betritt sie die Küche. Rosa kauert mit angezogenen Beinen auf dem Eßtisch und sieht fasziniert zu, wie aus den Türritzen der Maschine Schaum auf die ockerfarbenen Fliesen quillt und sich dort zu Bergen türmt. Sie bemerkt ihre Mutter erst, als die einen kleinen Schrei ausstößt und im knistrigen Weiß versinkt. Rosa muß lachen.
Rutschend rappelt sich Hemma auf und holt zu einer Ohrfeige aus, was sie beinahe erneut aus dem Gleichgewicht bringt, aber kurz vor dem Ziel läßt sie die Hand sinken. Sie schimpft nicht, sondern krümmt sich über die Spüle und verzieht das Gesicht zu einer Grimasse, als hätte sie am Grund des blankgescheuerten Stahlbeckens etwas Scheußliches entdeckt. Rosa hat aufgehört zu lachen.
In der Nacht wird Hemma von Enzo in das Krankenhaus gefahren, in dem schon die Großmutter liegt.
Morgenlicht sickert durch das Blau der Gardinen. Luise ist schlecht. Vom Veuve Clicquot und all dem anderen Zeug. Sie liegt auf seinem Bett in ihrer Unterwäsche, und für einen Augenblick muß sie an das andere Zimmer denken und wie sie die Treppe hinunter taumelt, nach dem erstbesten Glas greift, das man ihr entgegenstreckt, und es auf einen Zug leert. Und gleich noch eins. Eine Hand auf ihrer Schulter, man nimmt ihr das Glas aus der Hand. Jakob. Berühr mich und küß mich, küß mir die Bilder von den Augen, die schaurigschönen, verbotenen Bilder, tanz mit mir, drück mich ganz fest an dich!
Jetzt liegt Jakob zusammengerollt wie eine Katze in einem tiefen Ohrensessel unter einer Wolldecke. Sie streicht eine dunkle Locke aus seiner blassen Stirn und küßt die freigewordene Stelle.
Er seufzt. Sie schlüpft in ihre Kleider, die ordentlich über einem Stuhl hängen, neben Jakobs Anzug, seinem Hemd, seiner … Erschrocken sieht sie an sich hinunter, greift sich zwischen die Beine. Ihr wird erneut übel. Was, wenn er … Aber das müßte sie doch merken. Oder? So was merkt man doch, oder, Lene? Wo ist die Expertin, wenn man sie braucht? Das Bettlaken ist sauber. Nein, was für eine Idee, Jakob würde niemals … Aber wenn er ebenfalls betrunken war? Wenn er ist wie … wie die anderen hier? Sie schämt sich sofort für diesen Gedanken, und ihr wird jetzt in raschem Wechsel heiß und kalt. Sie öffnet die Tür, ihre Hand hinterläßt einen flüchtigen feuchten Fleck auf der polierten Messingklinke. Gott, ist mir übel. Sterben will ich, sterben. Aber nicht hier. Nicht im Tod würden mir die Eltern das verzeihen. Ich muß es bis zu Lene schaffen. Die Holztreppe knarrt, daß es durch das ganze Haus tönt, aber außer ihr scheint niemand wach zu sein. Im Erdgeschoß stinkt es nach erkaltetem Zigarrenrauch und abgestandenem Alkohol. Sie erreicht gerade noch die Küche, ehe der Champagner seinen Weg zurück in den silbernen Kübel nimmt, in dem er Stunden zuvor serviert worden war. Sie säubert das Gefäß und sich selbst, dann hastet sie durch den stillen, kühlen Morgen hinunter ins Dorf.
Als Rosa wach wird, ist ihr Kopf einen Augenblick lang wie leergefegt. Dazu kommt ein ausgedörrtes Gefühl im Mund, vom Geschmack gar nicht zu reden. Sie ist froh um die Stiche im Kopf, die einsetzen, sobald sie sich bewegt, als hätte sie ein Messer im Schädel. Vielleicht können sie verhindern, daß die Bilder zu schnell ins Bewußtsein sickern, vielleicht bleiben noch ein paar Minuten, in denen sie denken kann: ich habe einen Kater, bloß einen Kater. Sie kennt das: Das Aufwachen ist das Schlimmste, wenn einen die Realität mit voller Wucht erwischt.
Sie richtet sich auf, sehr langsam, die Augen läßt sie noch zu, es gilt, schnelle, unkontrollierte Bewegungen zu vermeiden, doch dann fährt sie mit einem heftigen Ruck in die Höhe und reißt die Augen auf. Ein Geräusch. Ein Brutzeln, Zischen und Röcheln. Es kommt aus der Küche. Ronald? Kann nicht sein, nicht seit gestern. Und zweitens weiß – oder soll sie sich schon mal angewöhnen, von ihm in der Vergangenheitsform zu denken? –, wußte Ronald, daß die Espressokanne tabu ist, und das Geräusch ist die Espressokanne. Sie kann es jetzt riechen, die verbrannten Kaffeetropfen auf der Herdplatte, ohne die es nie geht. Sie steigt aus dem Bett. Das rote Kleid liegt als obszöner Kringel auf dem Flokati, das lange T-Shirt, in dem sie üblicherweise schläft, befindet sich in dem Berg Kleidung, der sich um einen Sitzsack aus Kunstleder herum sedimentiert hat. Sie schlüpft hinein, sie bewegt sich lautlos und vorsichtig, als wäre das Zimmer vermint. Die Tür ist offen, auch nicht üblich, sie schleicht über den schmalen Flur. Die Küche befindet sich gegenüber, durch den Spalt sieht Rosa einen ihrer Rohrstühle und neben dem stählernen Stuhlbein etwas Menschliches. Haarig. Ein Bein, ein Fuß, Schuhgröße 44, mindestens. Rosa stößt die Tür an, ein paar Zentimeter noch, dann wird sie anfangen zu knarren. Ein Hinterkopf mit dunkelbraunem Stoppelhaar, ein filigran gemeißeltes Ohr, eine Wange mit Dreitagebart, ein nackter Rücken, unbehaart. Sie macht die Tür auf. Der Mann dreht sich zu Rosa um, langsam, als wäre sein Hiersein etwas Selbstverständliches. Er hebt die Tasse an. »Schmeckt scheußlich.«
Er hat feine, gerade Augenbrauen, dunkler als das braune Haar, die Nase ist schmal und ein bißchen krumm, aber nur, wenn man genau hinsieht.
»Das Aroma läßt mit den Jahren ein bißchen nach.«
Er steht auf und kippt den Espresso in den Ausguß. Er muß Kanne und Kaffee aus dem hintersten Winkel des Schranks gezerrt haben. Ihr Vater war der letzte, der das Gerät benutzt hat.
Rosa geht ins Bad. Der Boiler ist bereits an. Auf der Toilette sitzend, den Kopf in die Hände gestützt, versucht sie, den gestrigen Abend von jenem Moment an zu rekonstruieren, als sie Ronald und seine Lammnüßchen im Kräutermantel im Weststadt zurückgelassen hat. Da wäre vor allen Dingen einmal die Frage. Sie hat keine einschlägigen Spuren an sich entdecken können, aber was heißt das schon, im Zeitalter von safer sex? Lieber Himmel, Rosa! Wie tief bist du schon gesunken, um dich so was fragen zu müssen? Wenn Papa dich jetzt sehen könnte, heilige Madonna!
Auf dem Sofa im Wohnzimmer liegt ein Haufen Bettzeug, und der Besucher steht vor dem geöffneten Kühlschrank und bestaunt den Inhalt: vierundvierzig Gläser mit rotem, achtundzwanzig mit grünem Inhalt. Tomaten oben, Zucchini unten. Ordnung muß sein. Dazu eine Tüte H-Milch und eine Tube scharfer Senf.
Seine Unterhose sitzt ziemlich knapp. Netter Hintern. Unter dem Küchentisch liegen ihre neuen Stilettos. Jetzt erinnert sie sich an den abgebrochenen Absatz und sieht sich durchs Industriegebiet humpeln, mißtrauisch beäugt von den Exotinnen der Straße, die in lockeren Abständen dastehen und auf Fremdenverkehr aus sind. Hätte Ronald nicht wenigstens ein Lokal wählen können, das in einer respektablen Gegend liegt? Ein Wagen hält, es ist nicht Ronald. Sie steigt in den Jeep, und sie und der Fahrer stranden an einer Wachstischdecke in den italienischen Nationalfarben, darauf kleine Tonvasen mit orangeroten Tagetes. Eine dürre Pizza mit Sardellen und Chianti aus der Korbflasche, ein Lautsprecher krächzt Volare.
Rosa wirft zwei Aspirin in ein Glas und füllt es mit Leitungswasser, während sie weiterhin versucht, die Erinnerungsfetzen zu einem Ganzen zusammenzufügen. Sie öffnet die Kaffeedose. Himmelherrgott! Ein total verwahrloster Haushalt ist das! Also wieder dieses Fertigzeug.
Er macht den Kühlschrank zu, dreht sich um und lächelt bedauernd, als wären die Zustände da drin seine Schuld. Zwischen seinen oberen Schneidezähnen klafft eine kleine Lücke. Olivgrüne Augen. Auch das noch.
»Wieso läufst du hier halbnackt herum?«
»Weil meine Sachen noch nicht trocken sind.«
»Sachen?«
»Der Rotwein«, hilft er ihr auf die Sprünge. »Das Glas, das du … das umgefallen ist und mir Hemd und Hose eingesaut hat.«
»Ah, ja.« Er scheint die Wahrheit zu sagen, seine Jeans und sein Hemd hängen über der Stuhllehne vor dem Heizkörper. Und es stimmt, da war noch was mit einer Weinflasche, hier, am Küchentisch …
»Die Heizung ist kalt«, gibt Rosa zu bedenken. »Das kann dauern.«
»Hast du einen Fön?«
»Im Bad.«
Er sammelt seine Klamotten ein. Rosa hört ihn im Bad hantieren, dann ertönt das gleichmäßige Dröhnen und Rasseln des uralten Föns, der noch von ihrer Mutter stammt.
»Nicht zu lange, sonst brennt er durch, und es gibt einen Kurzen!« schreit sie in Richtung Bad.
»Gibt’s Kaffee?« fragt er, als er angekleidet zurück in die Küche kommt.
Statt einer Antwort hält ihm Rosa die leere Dose unter die Nase, worauf er sich wortlos umdreht und geht. Die Haustür klappt. Sie hört ihn fluchen. Wahrscheinlich ist er in eine tote Maus getreten, da wäre er nicht der erste. Schritte auf den Platten vor dem Fenster, ein Motor springt an.
Rosa macht sich einen Instant-Cappuccino und dreht sich eine Zigarette. Ein Zug, ein Schluck, bis die Tasse leer ist.
»Zum Kotzen«, sagt sie zu der schwarzen Katze, die zögernd herangeschlichen ist und sich am Tischbein reibt.
»Warum machst du es dann?«
Sie fährt herum. Ein bleiches Gesicht im Türrahmen. Als wäre ein Sarg aufgegangen.
»’tschuldige, hier war offen. Ich wollte dich nicht erschrekken.«
Rosa winkt mit einer müden Geste ab. »Setz dich.« Aber Jochen bleibt stehen, leicht gebückte Einsneunzig, schütteres Haar, eine Spur dunkler als seine Augenringe.
»Hast du meinen Zettel gefunden?«
»Nein«, schwindelt Rosa. »Ich komme heute abend zu dir rüber, ich habe saumäßige Kopfschmerzen.«
»Jajaklar«, nuschelt Jochen und ist schon an der Tür.
»Oder warte!«
Jochen wartet.
»Sag mal … hast du gestern, ich meine heute nacht, irgendwas gehört?«
Jochen schaut sie ein wenig tumb an. Er hat bernsteinfarbene Augen, das fällt Rosa zum erstenmal auf, sie kennt sein Gesicht nur als weißen Fleck vor einem Monitor.
»Du weißt schon …«
»Oh«, sagt Jochen und setzt sich jetzt doch hin. »Nein, ich hab nichts gehört. Nur diesen Jeep, der vorfuhr, so gegen drei, sonst nichts. Ist was passiert?«
»Ich denke nicht.«
»Was ist mit dem Typen im karierten Sakko? Ich hab da doch schon im Geiste die Hochzeitsglocken läuten hören.«
»Auch Geister irren sich bisweilen.« Rosa läßt den Kopf sinken, sie muß blinzeln.
»Ach, Scheiße.« Jochen drückt ihr die Hand. Seine ist weiß, kühl und feucht. Sie kann nicht verhindern, daß ein paar Tränen auf die Tischplatte tropfen. Ronald. Ein Jahr, zwei Monate und vier Tage war sie mit ihm zusammen, und den gestrigen Abend hat sie sich anders vorgestellt, ganz anders. Jochen stellt die Rolle mit den Papiertüchern vor sie hin. Rosa schneuzt sich ausgiebig.
»Warst ihm nicht genug Schickimicki, was?«
Die Küchentür geht auf, eine Tüte landet auf dem Tisch, sofort duftet es aufdringlich nach Kaffee und Croissants. Der Geruch verursacht bei Rosa Übelkeit, und mit der Übelkeit überkommt sie die Erkenntnis, daß sie heute keinen lebenden Menschen ertragen kann, weder Jochen noch diesen anderen Gockel, der hier herumstolziert, als wäre das sein Misthaufen.
Jetzt stellt er noch eine Packung Filtertüten dazu! Der überläßt wohl nichts dem Zufall. Fehlt nur noch die Lätta! Was, glaubt er, gibt ihm das Recht, sich in meinen Haushalt einzumischen?
Rosa steht auf und fixiert ihre Besucher aus schmalen Augen.
»Was soll das Rambozambo hier? Ihr könnt hier nicht rumgammeln und einfach Kaffee trinken. Ich bin UNTERNEHMERIN, ich habe TERMINE, da sind Kunden, die warten, die rechnen fest mit mir, also dann, wenn ich die Herren bitten darf …«
Mit drei Schritten ist sie im Schlafzimmer. Sie schließt die Tür mit einem Fußtritt, greift sich ihren abgewetzten Teddybären und wirft sich mit ihm aufs Bett, daß die Sprungfedern krachen. Sie zieht die Bettdecke über sich und den Bären, denn plötzlich friert und zittert sie am ganzen Körper.
Als sie nach einer halben Stunde den tränenfeuchten Bären wieder an seinen Platz auf dem Bücherbord setzt, ist im Haus alles still. Die rote Katze wagt sich herein, Rosa spendiert ihr einen Klecks Milch in einer Untertasse. Die Croissants und der Kaffee liegen noch immer auf dem Tisch. Auf der Rückseite eines ihrer Rechnungsformulare steht in großen Ziffern eine Telefonnummer. Sonst nichts. Rosa knüllt den Zettel in den Aschenbecher, hält ihr Feuerzeug an eine Ecke und sieht zu, wie der Papierball sich in eine schwarze Aschekugel verwandelt. Muß dieser Kerl auch noch meine Rechnungsformulare vergeuden! Bei Jochen wird sie sich heute abend entschuldigen. Oder morgen. Jetzt gibt’s erst einmal einen anständigen Kaffee …
Als Rosa zum Gewächshaus geht, knirscht es unter ihrem Stiefel. Sie flucht hinüber zu den gestreiften Markisen, die sich hinter dem Bahngleis aneinanderreihen. Die Kinder aus der Wohnsiedlung pflegen die Steine vom Bahndamm auf das Gewächshaus zu werfen, wenn ihnen danach ist, und das ist es in letzter Zeit immer öfter. Je mehr Scheiben fehlen, desto mehr scheinen die verbliebenen zur Zerstörung einzuladen. Sie flickt die schadhaften Stellen mit Plastikfolie.
Rosa schließt das Eisentor auf. Gleich rechts lagert ein Vorrat diverser Pflanzböden in Plastiksäcken, links stehen leere Töpfe und Kübel. In der Mitte des Treibhauses wachsen mediterranes Gemüse und Kräuter, die Basis von Rosas Ernährung. Letzten Sommer ergaben die vier Zucchinipflanzen eine kleine Überproduktion. Auch die Tomatenstauden wird sie dieses Jahr reduzieren. Lieber etwas mehr Basilikum und zwei, drei Kürbisse. Die Zierpflanzen für ihre Kunden kauft Rosa größtenteils im Gartencenter, selbst zu züchten rentiert sich nicht.
Im hinteren Drittel des Gewächshauses beginnt der Urwald. Es sind die Pflanzen, die vor acht Jahren keiner wollte, ausgesondert, übriggeblieben, weil sie schon zu groß waren oder nicht ganz in Ordnung; krummgewachsene Palmen mit zuwenig Blättern. Rosa bringt es seit Jahren nicht übers Herz, sie wegzuwerfen, im Gegenteil, sie gießt sie, und obwohl sie auf Dünger verzichtet, äußern die Pflanzen ihre Dankbarkeit durch intensives Wachstum, besonders die Bananenstauden und die Schlingpflanze, die bald das ganze Gewächshaus mit ihren Tentakel durchzieht. Dort hat Rosa ihren Lieblingsplatz, eine Holzbank ohne Lehne auf Ziegelsteinen, zwischen Palmen und einem riesigen Farn. Dort sitzt sie manchmal, raucht eine Zigarette und schaut durch das Glasdach den Wolken zu.
Aus irgendeinem Grund sind damals, als ihr Vater seine Wahlheimat endgültig verließ, zwölf mickrige Pfirsichbäume stehengeblieben. Sie sind inzwischen über zwei Meter hoch und tragen jedes Jahr Früchte. Seit gestern sind es nur noch elf, registriert Rosa zufrieden, belädt die Schubkarre mit vier Sack dunkler Erde und karrt sie zu ihrem Transporter. Der Ford ist nicht mehr der Jüngste, doch bis auf das defekte Schloß an der Hecktür ist er gut in Schuß. Der Wagen ist ihr Betriebskapital. Erst letzten Herbst hat sie ihn neu lackieren lassen, knallrot, damit die weißen Buchstaben auf beiden Seiten und am Heck gut zu lesen sind:
Gärtnerei Semper, Inh. RosaGanni Gartengestaltung, Grabpflege
Darunter die Telefonnummern. Seit die Handynummer auf dem Auto steht, wird sie hin und wieder von anderen Handybesitzern angerufen, die neben ihr an der Ampel oder im Stau stehen. Sie grinsen dann verstohlen oder auch ganz frech aus ihren BMWs und Golfs. Auf diese Weise hat sie Ronald kennengelernt.
Sie hat vorhin nicht ganz die Wahrheit gesagt, was ihre Kundschaft betrifft. Heute wartet niemand auf sie, zumindest nicht mit Ungeduld. Donnerstag ist Friedhofstag. Rosas Lieblingstag. Da ist niemand, der sie beobachtet, ihr dazwischenredet, Ratschläge erteilt, eine Lebensgeschichte erzählt – die eigene oder die der Nachbarin – oder ihre Zigarettenpausen zählt. Auch die Angehörigen kümmern sich kaum um Rosas Arbeit, Hauptsache, an Feiertagen und zum Geburts- und Todestag des Verstorbenen macht das Grab etwas her.
Rosa parkt vor dem Alten Friedhof, wuchtet ihre Schubkarre aus dem Wagen und belädt sie mit den vier Säcken Erde, ihrem Spaten und einem zugeknoteten Plastiksack. Langsam, wie es sich für einen Leichenzug gehört, rollt die schwere Fracht über die Kieswege.
Karl Isidor Schepp5.7.1928 – 1.4.1999
steht auf dem provisorischen Holzkreuz. Er ist am Gründonnerstag gestorben. Magenkrebs. Die Tochter lebt in Lüneburg, sie wird sich nicht viel um ihren toten Vater kümmern können. Das macht ab jetzt Rosa. Man kann sich auf sie verlassen, sogar mehr als das. Ihre Gräber werden liebevoll betreut. Die Gärtnerei Semper ist seit langem im Friedhofsgeschäft. Rosas Großmutter Agathe Semper knüpfte und pflegte die geschäftlichen Beziehungen zu den örtlichen Bestattungsinstituten, die sich trotz einer längeren Unterbrechung bis heute gehalten haben. Dort empfiehlt man Rosa an die ratsuchenden Hinterbliebenen weiter, wie zuvor ihre Mutter und davor ihre Großmutter empfohlen wurden.
Rosa fühlt sich wohl auf Friedhöfen, seit jeher, und an Tagen wie heute haben die Gräber etwas Tröstliches. Alte, verläßliche Freunde. Wie könnte sie die je im Stich lassen? Bestimmt hätte ich mich dort gar nicht wohl gefühlt, überlegt sie, während sie die Säcke ablädt, die welken Kränze und Gestecke vom Grab ihres neuen Schützlings sammelt und auf die Schubkarre legt. In die Schweiz, was für ein Gedanke! Regelrecht absurd!Warum erwarten Männer von Frauen, daß sie ihren Karrieren hinterherziehen wie die Dorfhunde der Karawane?
»Du bist über Dreißig, du solltest jetzt wirklich an eine eigene Familie denken«, meinte ihr Vater, als sie vor ein paar Wochen mit ihm telefoniert hat. »Willst du eine alte Jungfer werden wie deine Großtante Lene?«
Sie hat geantwortet, er könne ganz unbesorgt sein, der Zug wäre längst abgefahren.
Sollte ihr Vater in seinem festen Glauben, sie führe ein wüstes Lotterleben, bestätigt werden. Vor Jahren, als sich Rosa naturgemäß fürs andere Geschlecht zu interessieren begann, brach in ihrem Vater urplötzlich der Sizilianer durch. Sämtliche Jungen, die Rosa seiner Meinung nach zu nahe kamen, wurden von ihm erfolgreich vergrault. Rosa war neunzehn, als sie ihren ersten festen Freund hatte, einen schüchternen Betriebswirtschaftstudenten. Die Beziehung ging vor Langeweile nach einem Jahr in die Brüche. Danach wechselte Enzo komplett die Zielrichtung. Er war fortan der Ansicht, seine Tochter sollte endlich wissen, »wo sie hingehört«, vorher könne er nicht guten Gewissens in seine Heimat zurückkehren. Kaum ein Versuch, Rosa zu verkuppeln, war ihrem Vater zu peinlich. Als Rosa vierundzwanzig wurde, gab er endlich auf. Schweren Herzens entschloß er sich, nach Sizilien zurückzukehren, ohne seine Tochter unter die Haube gebracht zu haben.
Doch ehe Enzo Ganni das Land verließ, bestand er auf dem Verkauf der Gärtnerei. »Ich kann nicht nach über fünfundzwanzig Jahren mit leeren ’änden nach ’ause kommen«, jammerte er und bestätigte damit Rosas leisen Verdacht, den sie seit Jahren hegte, daß Enzos eifriges Bestreben, Rosa zu verheiraten, nicht allein seiner väterlichen Fürsorge, sondern auch einer Spur schnödem Materialismus entsprang.
»Der Betrieb rentiert sich nicht mehr. Das Gartencenter, du weißt doch.«
Natürlich wußte Rosa.
»Und wenn sie heimkommt?«
»Sie wird nicht kommen«, antwortete Enzo. »’ör doch endlich auf damit.«
Rosa verkaufte den Pflanzenbestand, die Ladeneinrichtung und die meisten Geräte und nahm eine Hypothek auf, um ihren Vater auszuzahlen, der wiederum seine beiden Geschwister auszahlte und den elterlichen Hof zu renovieren begann. Ein Projekt, das ihn bis heute beschäftigt. Rosa verspricht ihm jedes Jahr, ihn im Winter, in der toten Saison, zu besuchen. Ihn und seine sizilianische Großfamilie und damit eigentlich auch ihre, aber dieser Gedanke will ihr nicht vertraut werden.
Rosa fährt die Kränze und Gestecke zum Kompost. Die Bänder mit den letzten Grüßen löst sie ab, sie müssen in die Mülltonne. Unterwegs bleibt sie stehen und zupft am Grab ihrer Großmutter ein paar Unkräuter aus. Es ist das gemeinsame Grab ihrer Großeltern, aber ihren Großvater Hagen Semper hat Rosa nicht mehr gekannt, er starb zwei Jahre vor ihrer Geburt, als ihre Eltern sich gerade kennengelernt hatten.
An ihre Großmutter erinnert sich Rosa noch. Eine große Frau mit einem blondierten Haarturm, einer »Hochfrisur«, und einem schmalen, fast lippenlosen Mund, der häufig von ihrem verstorbenen Mann sprach. »Die Russen haben ihn auf dem Gewissen«, hörte man sie oft sagen, und dabei wurden ihre Augen immer ganz klein vor Haß.
Rosas letzte Erinnerung an sie ist verbunden mit einem Kruzifix an einer Wand, die in einem kränklichen Gelbton gestrichen ist. Darunter ihre Großmutter in einem Bett auf Rädern, sie hat ein Vogelgesicht, gelb wie die Wand, der Mund ist eingefallen, ihr Haar ist strähnig und am Haaransatz aschgrau. Schläuche kriechen unter der Bettdecke hervor, aus dem Handgelenk und aus der Nase. Einige sind blutig, in anderen fließt eine gelbe Flüssigkeit in sie hinein oder aus ihr heraus, Rosa ist fasziniert von diesem Kreislauf der unterschiedlichen Körperflüssigkeiten, der nun nach außen verlegt und quasi für jedermann sichtbar gemacht wurde. Ihre Mutter sitzt auf einem Stuhl neben dem Bett, sie hält Agathes Hand, die schlauchlose, in ihren Händen, sie hat wunderschöne Hände, ihre Mutter, trotz der Gärtnerarbeit. Es ist das erste und das letzte Mal, daß Rosa die beiden Frauen eine zärtliche Geste tauschen sieht.
Vor dem Grabstein aus grauem Odenwälder Granit bilden drei kugelförmig gestutzte Buchsbäumchen ein exaktes Dreieck. Rosa schneidet die Bäumchen regelmäßig zurecht, damit sie nicht zu einem Busch zusammenwachsen. Vor den drei Buchskugeln liegt ein umgekippter Plastiktopf, der einen dürren Rosenstock mit kleinen weißen Blüten enthält. Schneewittchen steht auf dem Plastikschild vom Gartencenter. Wahrscheinlich wollte jemand das mickrige Ding loswerden. Rosa befreit die Pflanze vom Kunststoff und setzt sie an eine freie Stelle. Sie hat erst neulich den Efeu gestutzt, damit Tulpen und Zwergnarzissen Luft und Sonne bekommen. Sie nimmt die Schubkarre wieder auf, entsorgt den Inhalt gemäß der Friedhofsordnung und fährt zurück zu Isidor Schepp. Einen Buchsbaum wird sie pflanzen, links vor den Stein. Oder drei? In der Mitte auf jeden Fall niedrigwachsende Rosen, eine duftende, mehrmals blühende Sorte. Dazwischen Lavendel. Zitronenthymian als Randbepflanzung. Rosa liebt es, wenn Gräber duften.
Sie lockert den Untergrund und gräbt ein Loch von einem knappen Meter Durchmesser und gut eineinhalb Meter Tiefe, bis die Schaufel zum erstenmal auf Holz stößt. Sie sieht sich um. Ihr war eben, als hätte sie Schritte auf dem Kies knirschen hören, doch es ist niemand in der Nähe. Vielleicht statt dem Buchs lieber eine Feige? Mal was anderes, ein bißchen ausgefallener. Oder einen ihrer elf Prunus persicus? Wieder schaut sich Rosa um, sie ist nervös, als habe sie vor, eine Straftat zu begehen. Wahrscheinlich begeht sie gerade eine. Sie kauert vor dem Erdloch nieder und öffnet den Sack.
»Bist nicht so allein«, sagt sie zu Isidor Schepp und wirft den ersten Knochen hinab. Er landet seufzend auf der lokkeren Erde. Es folgen Oberschenkel, Becken, Schulterblatt, Rippen, wobei es jetzt ab und zu leise klackert, wie Bocciakugeln. Am Ende sind bloß noch ein paar Wirbel und winzige Knöchelchen übrig. Rosa leert sie auf einmal aus, faltet den Sack zusammen, mechanisch, gedankenverloren, den Blick starr nach unten gerichtet. Sie war sich schon gestern darüber im klaren, daß das Skelett nicht bis zur letzten Rippe komplett ist, aber die wichtigsten Teile, die, die einen Menschen ausmachen, waren da. Jetzt fehlt eines. Sie steht auf, läßt den Sack fallen und sieht sich um. Alles ist still, wie es sich für einen Friedhof gehört. Vögel zwitschern.
Der Sack war fest verknotet, als sie ihn aus dem Wagen genommen und hierher gebracht hat. Da ist sie hundertprozentig sicher. Sie steckt sich eine Zigarette an und überlegt. Als sie aufgeraucht ist, zuckt Rosa mit den Schultern, nimmt den Spaten und schaufelt das Grab zu. Obendrauf schüttet sie die vier Sack Friedhofserde. Business as usual. Sie geht zum Auto, um ihren Rechen zu holen, den sie vorhin vergessen hat. Die große Schubkarre und den Spaten nimmt sie mit. Sie will sie nicht am Grab stehen lassen, keine zwei Minuten. So wie hier geklaut wird.
»Was machen Sie denn hier?«
Rosa fährt erschrocken aus der Grube. Frau Pauly steht vor ihr, die Arme streitlustig in die Seiten gestützt. Sie trägt schwarze Reeboks und eine an den Seiten aufknöpfbare Trainingshose, ihr Outfit für den täglichen Spaziergang um den Tannenberg.
»Der Baum muß in die Erde, sonst wächst er nicht an.«
»Ein Riesenloch für so ein Bäumchen!«
»Ich lockere nur die Erde«, erklärt Rosa unwirsch.
»Heute ist gar nicht Ihr Tag. Oder haben wir etwa Mittwoch? Nein, heute ist Donnerstag. Heute kommt die Fußpflegerin, nicht Sie. Sie bringen ja alles durcheinander!«
»Ich weiß, daß heute Donnerstag ist. Aber ich mußte gestern weg, ich war verabredet. Ich wollte den Baum pflanzen, ehe Ihre Schwiegertochter wiederkommt. Sie kommt doch am Wochenende zurück, oder?«
»Ja, ich erinnere mich.« Frau Pauly mustert das Bäumchen, das bereits von seinem Plastikgefäß befreit wurde, wie einen ungebetenen Gast. »War’s schön?«
»Das müssen Sie schon Ihre Schwiegertochter fragen.«
»Ihre Verabredung.«
»Ach so, das. Ja, ganz nett.«
»Würden Sie vielleicht eine Tasse Tee mit mir trinken?« fragt Frau Pauly und lächelt Rosa huldvoll an.
Rosa fühlt sich plötzlich erschöpft, und Durst hat sie auch. Nachdurst wahrscheinlich.
»Ja, danke. Ich komme gleich.«
»Ich warte im Salon«, verkündet Frau Pauly, »ziehen Sie bitte Ihre Stiefel in der Küche aus.«
Rosa stellt den Baum in die Grube. Die Wühlerei ist sowieso zwecklos. Der Schädel war in der Tüte, da wette ich meinen Kopf. Sie schaufelt die ausgehobene Erde zurück, mischt dabei frischen Kompost unter, tritt den Boden um den Baum fest, so daß sich um ihn herum ein kleiner Graben bildet, und begießt ihn mit Wasser aus der Regentonne. Drei Kannen braucht es, bis die Erde eingeschlämmt ist. Sie zieht sich die schmutzigen Stiefel vor der Terrassentür aus und wäscht sich die Hände in der Spüle, dem Anblick von Kunststoff in Eichenmaserung ausgeliefert. Es ist keine Seife da, nur Pril. Rosa muß sich überwinden, aber sie möchte nicht mit schwarzen Händen zur Audienz erscheinen.
Sie hat den Verdacht, daß Gertrud Pauly die Kücheneinrichtung zu verantworten hat, die goldenen, verschnörkelten Griffe erinnern an die Art von Schmuck, mit dem sie sich behängt und der die Mittvierzigerin zehn Jahre älter macht. Die »jungen« Paulys scheinen sich hier nach und nach einzunisten; auch was den Garten betrifft, mischt Gertrud Pauly bereits ordentlich mit. Sie und ihr Mann wohnen in einem Reihenhaus, nur ein paar Straßen weiter. Wahrscheinlich zwischen halbgepackten Umzugskartons, spekuliert Rosa.
Frau Pauly hat die Sportkleidung gegen einen Rock und schwarze Samthausschuhe ausgetauscht und wartet an einem ovalen Tisch aus Nußbaum. Er steht in der Mitte des Raumes und bietet genug Platz für eine kleine Hochzeitsgesellschaft.
Frau Pauly gießt dünnen Tee in hauchdünne Tassen. Rosa setzt sich hin und sieht sich um. Hohe Decken, schwere dunkelrote Vorhänge, ein riesiger Perserteppich auf polierter Eiche. Es gibt wenig Möbel; eine Vitrine voller Geschirr und Tinnef, ein dunkelrotes Zweiersofa mit zierlichen, nach außen geschwungenen Beinchen, eine massive Anrichte, auf der ein Buddha aus Ebenholz thront und als Stütze für die Post der letzten Tage dient. Das Ganze wirkt edel und ein bißchen düster und eigentlich so, wie Rosa es erwartet hat. Weit und breit kein Aschenbecher.
Frau Pauly hat Rosa bei der Betrachtung des Raumes beobachtet. »Finden Sie auch, daß das Haus zu groß für mich ist?«
»Nein. Wenn es Ihnen nicht zu groß ist.«
»Ich bin’s gewohnt.«
»Geht mir auch so«, stimmt Rosa zu. »Ich wohne zwar in einem kleinen Haus, aber auf einem Riesenareal, der früheren Gärtnerei eben. Es hat was Einsames, aber auch was von Freiheit.«
Ende der Leseprobe