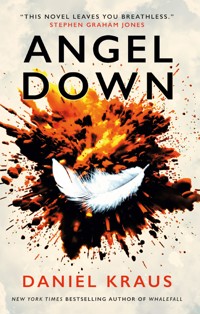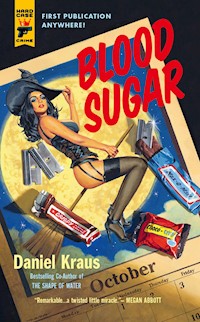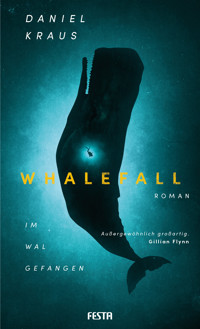
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Obwohl es ein aussichtsloses Unterfangen ist, hat sich Jay Gardiner an der Pazifikküste vor Monastery Beach auf die Suche nach den sterblichen Überresten seines Vaters gemacht. Er glaubt, dass es die einzige Möglichkeit ist, seine Schuldgefühle loszuwerden, die er seit dem Selbstmord seines Vaters mit sich herumträgt. Bei einem Tauchgang wird er von den Tentakeln eines Riesenkalmars erfasst, der kurz darauf von einem Pottwal auf der Suche nach Futter angegriffen wird. Gemeinsam landen sie in einem der vier Mägen des riesigen Wals … Jay hat nur eine Stunde Zeit, bevor ihm der Sauerstoff ausgeht – eine Stunde, um seine Dämonen zu besiegen und aus dem Bauch des Wals zu entkommen. Ein wissenschaftlich exakter Thriller, der in einer absurd unwahrscheinlichen Umgebung spielt. Ein emotionales und wahnsinnig unterhaltsames Abenteuer. Doch der Star des Buches ist eindeutig der Wal – gewaltig, unergründlich und intelligent. Und er ist sich, wie Jay, seiner Sterblichkeit sehr bewusst. Daniel Kraus, der mit Guillermo del Toro die Romanversion des Films The Shape of Water schrieb, schildert die Rätsel der Unterwasserwelt mit der Strenge eines Wissenschaftlers und der Sensibilität eines Dichters. Booklist: »Eine bewegende Charakterstudie, getarnt als fesselnder, kinoreifer Überlebensthriller ... Das Tempo ist unerbittlich, die Ehrfurcht verblüffend und die Spannung erdrückend ...« Gillian Flynn: »Außergewöhnlich großartig. Whalefall ist wirklich ein wunderschöner Roman – ein Must Read über das Meer, die Demut und die bitteren Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Claudia Rapp
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Whalefall
erschien 2023 im Verlag MTV Books.
Copyright © 2023 by Daniel Kraus
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: César Pardo
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-107-3
www.Festa-Verlag.de
Für die zehn Autoren,
die verändert haben,
wie ich schreibe:
Megan Abbott
Richard Adams
P. Djèlí Clark
Carol J. Clover
Joseph P. DeSario
Ralph Ellison
Junji Ito
Kathe Koja
Grace Metalious
Herman Wouk
Wenn dieser Wal ein König ist,
schaut er aber ganz schön mürrisch drein.
Herman Melville, Moby Dick
WAHRHEIT
3000 psi – 207 bar
Der Highway 1 brummt. Die Zypressen rauschen. Schwadronen von Möwen kreischen. Aber alles, was Jay Gardiner hört, ist die Stimme seines Vaters, der die Familie um sechs Uhr morgens weckt. Ob Wochentag, Wochenende, Feiertag, der Mann hat die Gezeiten im Blut, so sehr, dass er ohne Wecker aufsteht und die Invasion der Schlafzimmer startet, seinen Kaffeebecher mit dem Löffel dengelnd.
Schläfer, wacht auf!
Mitt Gardiner ist nun schon seit einem Jahr tot, aber sein Nebelhorn wird Jay für den Rest seines Lebens aus dem Schlaf hochschrecken lassen, dessen ist er sich sicher.
Jay liebt seine Mom durchaus, und seine Schwestern auch, die sind in Ordnung. Also sind da Schuldgefühle. Weil er sich während der ganzen grässlichen endlosen Geschichte ihren vernünftigen Bitten verweigert hat. Mom, Nan und Eva haben jetzt Therapeuten und reden darüber, »abzuschließen«. Jay weiß nicht genau, ob er an Therapie glaubt. An ein Abschließen glaubt er definitiv nicht. Menschen sind ja keine Türen. Sie sind ganze Grundrisse, Labyrinthe, und je heftiger man versucht zu entkommen, desto mehr verirrt man sich in ihnen.
Jay steckt 17 Jahre tief im Irrgarten; zu spät, um seinen Weg zurückzuverfolgen.
Sein Wagen verliert schorfige Rostflocken, als er darin den zimtfarbenen Randstreifen des Highway 1 entlangkriecht. Eine weiße Wolke schwebt wie ein Fallschirm über die Straße, Dunst von den Ozeanwellen, die er hört, aber nicht sehen kann. Keine freie Parklücke. Komisch. Das hier ist nicht Huntington Beach. Es gibt keine Geschäfte, die Fudge verkaufen, keine Bikini-Boutiquen, nur die Santa-Lucia-Hügelkette. Anfang August, um Viertel vor acht in der Frühe sollte Monastery Beach eher einer Geisterstadt gleichen, abgesehen von den Autos der Katholiken, die den Hügel hinaufzuckeln, zur Messe im Karmelitinnenkloster.
Jay brummt die ersten vier Schimpfwörter vor sich hin, die ihm in den Sinn kommen. Er sollte nach Hause fahren, sich einen anderen Tag aussuchen. In seinem Brustkorb plustern sich Krähen, schlagen missbilligend und streng mit den Flügeln. Das bringt sein Herz zum Wummern, seine Kopfhaut zum Schwitzen. Er hat sich so heftig hochgeputscht, um dies zu tun, mit Doom Metal und Kaffee, dass ihm übel wird bei dem Gedanken, es zu lassen. Wenn er jetzt wegfährt, war es das, dann wird er nie wieder zurückkehren, sich nie davon erholen. Für die Leute, die ihn kennen, wird er für immer der Mist sein, den man von Mitt Gardiners Schuh gekratzt hat.
Jenseits der Straßenböschung ist das Meer, in dem Mitt starb.
Ein Abschluss? Nein. Aber Wegweiser durch das Labyrinth? Vielleicht.
»Du machst den Tauchgang, Jay«, sagt er.
Weiter vorwärts ist der einzige Ausweg. Er schämt sich dafür, dass seine Mutter ihn so sehr vermisst. Seine Schwestern sind stocksauer auf ihn. Es scheint, dass niemand in Monterey denkt, dass er den Namen Gardiner überhaupt verdient, nachdem er zugelassen hat, dass sein Vater so gelitten hat ohne ihn.
Dieser Tauchgang könnte das alles verändern.
Als er aufhört, die Zähne zusammenzubeißen, dringen die gewohnten Aromen ein. Salz, Sand und Angst.
Er weiß eine andere Stelle, an der er parken kann, eine Nebenroute zum Strand.
Er wendet. Ein Graureiher beschwert sich im Flug, während ihn das Licht des Sonnenaufgangs blendet. Es ist anders als das Licht bei Sonnenuntergang, auch wenn beide sich anfühlen wie unterschiedliche Arten von Fallen. Mitt war anderer Meinung. Jay denkt daran zurück, an seinen Vater. Er hat den ganzen Morgen an nichts anderes gedacht.
2015
»Steinbeck nannte das ›die Stunde der Perlen‹.«
Der Tag geht zur Neige, der Abend dämmert rosig grau herauf, ein ungetrübter Glanz liegt auf allem. Dad spricht von John Steinbecks Cannery Row, der Straße der Ölsardinen. Im Herzen von Monterey kann man keinen Meter gehen, ohne dass auf Straßenschildern und in Schaufenstern mit dem Buch geprahlt wird. Steinbecks Roman beschwört eine einfachere, erbarmungslose Zeit herauf, genau wie die Ruinen der Sardinenfabriken an der Row selbst. Eigenschaften, die Mitt Gardiner schätzt. Für ihn ist das moderne Monterey ein Geschwür, aus dem Touristen wie Eiter über den Küstenabschnitt quellen, der weiterhin den Leuten gehören sollte, die nach Fisch stanken und dort ihrer Arbeit nachgingen.
Jay ist zehn Jahre alt und anderer Meinung. Die Row ist elektrisierend. Aus den Lautsprechern der Restaurants dröhnt knackige Musik, der Wind riecht nach frittiertem Essen, da sind Zauberkünstler auf dem Gehsteig. Flecken von heruntergetropftem Eis, von denen Dad sagt, sie sähen aus wie Blut, aber Jay machen sie hungrig.
»›Wenn die Zeit innehält und sich selbst betrachtet‹, schrieb er.«
Sie warten auf einem Hotelparkplatz. Dads momentaner Job besteht darin, den Dreck und die Algen vom Pier des Hotels zu schaben. In fünf Minuten wird sein Boss auftauchen und ihn feuern. Es liegt an Dads Verhalten. Du kannst die Gäste nicht anraunzen, Mitt, auch dann nicht, wenn sie einen Plastikbecher in die Bucht werfen. Dad rollt Cannery Row mit seinen riesigen Händen ein und aus. Dad liest nicht. Dieses Buch ist die einzige Ausnahme, sein Quell von Alltagspsalmen.
Er reicht Jay das Buch, als wäre es ein Sakrament. Jay hasst Cannery Row jetzt noch nicht, aber sobald die Lehrer ihn zwingen, es in der sechsten, der achten und der zehnten Klasse zu lesen, wird er es hassen. Eine Bindung Seiten fällt heraus und wird vom Wind geraubt; vergilbte Schwalben, die sich zu den schwarzen Kormoranen gesellen, die über die Ruinen der Konservenfabriken herrschen. Dad sieht zu, wie sie davonsegeln.
»Das ist nicht schlimm. Zu jeder Perlenstunde wird dir klar, dass auch du ein paar Seiten verloren hast. Immer mehr Seiten, bis …«, er pfeift und macht die passende Geste, »… bis du ganz weg bist.«
Mit der rechten Hand zupft Dad eine weitere Seite heraus, ihm fehlt der halbe Ringfinger. Er lässt die Seite davonfliegen wie seinen Job. Er klopft auf das Buch, das vom Wasser ganz aufgequollen ist.
»Das passiert, wenn du im Ozean stirbst: Du wirst aufgebläht.«
3000 psi – 207 bar
150 Meter weiter nördlich befindet sich der Bay School Parent Co-Op Kindergarten, ein flaches, magentafarbenes Gebäude, das wie eine Kerbe zwischen den hohen, grünen Bäumen liegt. Er ist geschlossen, das Plastik auf dem Spielplatz von einstmals Rot zu einem trüben Rosa verblasst, keine umherkletternden Zwerge zu sehen. Jay ist froh darüber. Er hat keine Zeit für Neid. Die Spielplätze seiner Kindheit waren Landungsstege voller Seetang, mit Moos überzogene Docks, nach Schwefel stinkende Boote.
Er lenkt den Wagen vom Highway 1 auf den Parkplatz des Kindergartens, und seine Reifen verleiben sich herabgefallene Blätter ein. Was zur Hölle? Auch hier stehen Autos. Zwar nur vier, aber das sind vier mehr als erwartet. Jay parkt im Schatten und ist froh, dass dieser auch ihn verbirgt. Auf dem Pick-up rechts von ihm prangen zwei Logos, NOAA und NMFS. National Oceanic and Atmospheric Administration und National Marine Fisheries Service. Die Klimabehörde und ihre Abteilung zur Überwachung der Küsten- und Hochseefischerei.
»Ihr wollt mich doch wohl verarschen.«
Jay schlägt mit den flachen Händen aufs Lenkrad. Dieses Pech ist typisch für ihn. An 99 von 100 Tagen konnte ein Taucher ohne einen einzigen Zeugen am Monastery Beach absteigen. Und heute ist genau was hier los? Eine Umweltkatastrophe? Er wendet den Blick nach links, und seine Haut scheint augenblicklich heißer: Da steht ein orange gestreifter SUV mit der Aufschrift UNITED STATES COAST GUARD. Die Küstenwache.
»Was zum Geier.«
Mitt Gardiner hasste eine Menge Dinge, Menschen, Ideen und Philosophien, aber nichts regte ihn mehr auf als das, was er nur ›die dreckige KW‹ nannte. Jay hasst es, mit seinem Vater über irgendwas einer Meinung zu sein; jedes Mal ist es wie eine Infektion. Aber sich von dem über Generationen weitergegebenen Misstrauen gegenüber der Küstenwache zu verabschieden wäre in etwa so, als würde er sich seine eigene Milz herausreißen.
Jay braucht keinen Therapeuten, der ihm sagt, dass er sich dumm verhält. Vielleicht ist letzte Nacht jemand am Monastery Beach ertrunken, und die Küstenwache sammelt die Überreste ein. Jays Vorbehalte rühren daher, dass die KW seinen Vater zuverlässig immer wieder verärgert hat; daher, wie oft er Zeuge von Mitts heftigem Zorn wurde. Er erinnert sich, wie er schniefend die Tränen zurückdrängte, während Mitt einen dreckigen KW runtermachte, weil dieser einen belanglosen Regelverstoß mit einem Strafzettel quittierte.
Du willst mir sagen, was das Richtige für das Meer ist, du Bürohengst? Ich bin auf dem Wasser geboren worden! (Das war nicht einmal wahr, sagte Oma Gardiner. Sie bekam zwar auf einem Boot die Wehen, aber Mitt wurde in einem Krankenhaus zur Welt gebracht wie ein gewöhnlicher Mensch – wie beschämend.)
Jedes Mal wenn Mitt ausrastete, war nur Jay da, um es abzufedern, einzustecken, zu zittern und zu weinen und danach Mitts Abscheu gegen Jays Kleinkind-Reaktionen zu ertragen. Nein, nicht nur Jay. Nicht ganz. Möwen, Otter, Seelöwen, Haie bildeten das Publikum, gelegentlich war sogar ein Wal dabei.
Diese Tiere zuckten niemals unter Mitts Tiraden zusammen.
Und das wird Jay auch nicht tun. Nicht mehr.
Wenn die Umweltbehörde und die KW hier sind, könnten sie versuchen, ihn von seinem geplanten Tauchgang abzuhalten.
Aber wenn ein Taucher gewitzt ist, sieht ihn vielleicht auch gar keiner.
3000 psi – 207 bar
Jay hatte den Tauchanzug auf der Fahrt bereits zur Hälfte an. Die gummiartige Enge des Neoprens um seine Beine und seinen Schritt hat er nicht vermisst. Die obere Hälfte des tiefschwarzen Anzugs sammelt sich um seine Taille wie abgeschälte Haut. Der Anzug ist von Henderson, von der Sonne gebleicht, von Korallen zerkratzt, der Reißverschluss zickt. In miesem Zustand, aber das trifft auf seine gesamte Ausrüstung zu. Er musste alles aus den Tonnen fischen, die er seit zwei Jahren mit sich herumschleppt. Die Sachen fühlen sich leichter und dünner an, als er sie in Erinnerung hat, wie Tauchspielzeug, nicht wie richtige Ausrüstung.
Jay steigt aus dem Wagen. Zuerst die Haube. Er zieht sie auf, die Ohren kleben jetzt flach an seinem Schädel, der Latz aus Neopren liegt über seinem mageren Brustbein. Er schlängelt die Arme in die Ärmel des Anzugs. Das Material zieht an seinen Härchen. Er hatte vergessen, wie sehr das brennt. Als er komplett drinsteckt, ist der Henderson schwer wie Lehm, sieben Millimeter dick für das kalte Wasser in der Monterey Bay. Wenn die Wassertemperatur um diese Jahreszeit bis auf 15 Grad steigt, ist das Glück. Jay streckt den Arm nach hinten über den Rücken aus, greift nach dem 60 Zentimeter langen Gurt des Reißverschlusses und fasst ihn mit beiden Händen. Jay glaubt nicht an Gott, aber er betet innerlich, als täte er es.
Drei Jahre zuvor im Januar war er bei einem Tauchgang beim East Pescadero Pinnacle mit dem Schieber an einer Bootsreling hängen geblieben und das Teil brach. Er gab seinem Vater mit Handzeichen zu verstehen, dass er auftauchen musste, und nahm seinen Atemregler aus dem Mund, als sie an der Oberfläche waren, um Bescheid zu sagen, dass sein Rücken freilag. Mitts Blick war so ausdruckslos wie die Schneide einer Machete. Ein kaputter Reißverschluss war etwas selbst Verschuldetes. Mitt tauchte erneut, Jay folgte ihm. Es war der kälteste Tauchgang seines Lebens; das unnachgiebige Meer zerrieb seinen Körper, seine Zähne klapperten gegen das Plastik seines Mundstücks und das Geräusch dabei hallte in seinem eingefrorenen Schädel verstärkt wider.
Der Reißverschluss ist das einzige Stück seiner Ausrüstung, das Jay für heute repariert hat. Er tat das aber nicht gestern im Tauchshop, als er seinen Tank neu befüllen ließ. Er hatte dort so wenig Zeit wie möglich verbracht. In den Shops in der Umgebung verehrten alle Mitt Gardiner, die lokale Legende, den wandelnden Folianten überlieferten Wissens über das Meer und alles drum herum. Ihre Augen leuchteten stets, wenn er da war, und lechzten nach seiner Anerkennung, während Jay, das nutzlose kleine Kind, verkümmerte. Die Tauchbrüder wussten, dass Mitt trank – Scheiße, na klar, mit einem Drink bekam man schließlich die besten Storys aus dem Kerl raus –, aber sie wussten nicht, dass er ein Säufer war, ein mehrfacher Knacki, ein stets unzufriedener Mann, der keinen Job länger als ein, zwei Jahre behielt und dann so tat, als wäre das bloß ein weiterer Beweis seiner Prinzipientreue.
Prinzipien: eine praktische Ausrede, sich wie ein Arschloch zu verhalten.
Jay wird nicht länger ignoriert von den Tauchbrüdern. Jetzt wird er verachtet. Irgendwie kam die Geschichte ans Licht: Mitts lange Krankheit, die egoistische Weigerung seines Sohnes, seinen Schmerz zu lindern. Sie wissen nicht, wie der echte Mitt war. Sie haben keinen Schimmer.
Also brachte Jay seinen Tauchanzug zu Mel’s Shoes in Del Rey Oaks und wandte sich an Mel, einen tausend Jahre alten Kerl, der einen Trockenanzug nicht von einem Nassanzug unterscheiden konnte, aber mit seinen runzligen Fingerspitzen über den Reißverschluss des Neoprenanzugs fuhr wie eine Zunge über eine Reihe Zähne. Jetzt zerrt Jay an dem langen Gurt, und der Reißverschluss surrt die Kurven seines Rückgrats hinauf wie eine gut geschmierte Achterbahn und schließt ihn wasserdicht ein. Er atmet aus.
»Wenn es einen Gott gibt, Mel, dann segne er dich.«
2017
»Wenn du in der Klemme steckst, sind Männer, die Schuhe flicken können, deine besten Freunde. Lerne deinen örtlichen Schuster kennen, Jay. Diese alten Hasen haben Fähigkeiten wie sonst niemand auf der Welt.«
Das sagt Dad, während er in den knallroten vulkanisierten Gummi eines Ganzkörper-Trockenanzugs mit PVC-Gesichtsschutz schlüpft. Sieht cool aus, als würde er losziehen und gegen Außerirdische kämpfen. Tut er aber nicht. Sie sind auf dem Pepper-Hills-Golfplatz, eine 20-minütige Autofahrt von zu Hause entfernt, die sich wie 20 Millionen anfühlt. Meere aus gestutztem Gras ohne Unterbrechung. Ein Clubhaus aus taubenblauem Holz. Dads aktueller Job? Er gehört zu einem dreiköpfigen Team, das auf dem Grund der Pepper-Hills-Teiche nach Golfbällen taucht. Weißes Gold, sagt Dad. Bei 25 Cent pro Ball? Jay ist skeptisch, aber Dad sagt, es rechnet sich.
Die beiden anderen Taucher, die sich umziehen, sind 18. Zu nahe an Jays zwölf, als dass er nicht erröten würde.
Dad erzählt immer wieder von den tollen Jobs, die er hatte. Abalone-Sammeln, Arbeit auf Bohrinseln, Tauchen nach Heringsrogen in Alaska; er hat eine topografische Tätowierung des 49. Staates auf seinem Oberschenkel. Nan und Eva verdrehen bei diesen Geschichten immer die Augen, während Mom ganz still das Essen auf den Tisch stellt. Jay glaubt, das liegt daran, dass diese Geschichten aus der Zeit vor Mom stammen, als Dad noch umherstreifte und tauchte, wo immer es ihm gefiel, als er noch – anders kann man es nicht ausdrücken – glücklich war.
Jay fühlt sich verstört bei dem Gedanken. Dad hat alles, was ein Mann sich wünschen kann. Eine Frau, die ihn trotz seiner Fehler anhimmelt. Zwei Töchter, mit denen er spielerisch Beleidigungen austauscht. Einen Sohn zum Quälen.
Offenbar ist das nicht genug.
Seit Jay Erinnerungen hat, die er sein Eigen nennen kann, passen Dads Jobs nicht mehr zu der Verehrung, die ihm die örtlichen Taucher entgegenbringen. Inspektion von Abwasserauslässen: überprüfen, wo die Scheiße aus den Rohren ins Meer fließt. Sanierung der Pfeiler von Stegen mit Plastik oder Zement. Rankenfußkrebse, Moos und Bryozoen von Bootsrümpfen schrubben, für drei Dollar pro Meter, und dann in den Graben am Straßenrand kotzen wegen des Kupfers und Zyanids in der Farbe.
Dad ist 52 Jahre alt. Pepper Hills ist sein bisher bescheidenster Job.
3000 psi – 207 bar
Jay klappt den Kofferraum auf. Sein BCD, die Tarierweste, mit der sich der Auftrieb regulieren lässt, hat schon bessere Tage gesehen, aber auch nicht so viel bessere: Mitt Gardiner war abergläubisch und misstraute neuer Ausrüstung. Seine kam aus zweiter Hand, und Jays aus dritter. Das hier ist eine alte Oceanic, eine dicke schwarze Weste, bei der ein Wirrwarr von Clips und Taschen die Ansammlung von Schläuchen bündelt, die aussehen wie drapierte Tentakel.
Er hat die Druckluftflasche in das BCD geschnallt, bevor er losgefahren ist, aber er überprüft den Sitz noch einmal. Es geht ja nur um sein Leben, oder? Zwei schwarze Riemen werden mit Nocken um den Zylinder gespannt. Ein Sicherheitsriemen ist mit dem K-Ventil des Tanks verbunden. Es ist die einzige Luftquelle, die Jay hat, ein zerbeulter 16,5-Liter-Zylinder aus Stahl statt Aluminium. Die dickeren Neoprenanzüge, die für die Kälte der Monterey Bay erforderlich sind, verleihen einem Taucher einen so hohen Auftrieb, dass die zusätzliche Dichte von Stahl hilfreich ist.
Weitere 15 Pfund Ballast in den BCD-Taschen wären ideal. Aber in Jays Aufbewahrungstonnen fanden sich nur ein paar Fünf-Pfund-Tauchgewichte. Das Letzte, was er vor seiner Abfahrt tat, war, das Haus der Tarshishs nach diesen letzten fünf Pfund zu durchsuchen. In der Küchenschublade fand er eine immense Ansammlung von Duracell-Batterien. Schnelle Google-Suche. Eine D-Batterie entspricht 180 Gramm; 403 Gramm entsprechen einem Pfund.
Er zerrte zwölf D-Batterien aus der Verpackung und für den Rest eine Handvoll loser Mignon-Batterien und eine einzelne 9-Volt-Batterie. Jetzt haben seine BCD-Taschen dicke Backen wie Streifenhörnchen. Fühlt sich komisch an. Jay hofft, dass sie halten.
Nicht mehr als 15 Grad, aber, Mann, er schwitzt, die Haut fühlt sich schmierig an im Neoprenanzug. Jay hebt den Oktopus-Halter aus dem Kofferraum und schraubt ihn an das Tankventil. Vier Schläuche hängen herab. Er schließt den Inflator an das BCD an und wischt die anderen Schläuche zur Seite. Er schiebt das Ganze an den Rand des Kofferraums. Zeit, sich das Ding aufzuladen. Wenn er erst einmal 32 Kilo von diesem Zeug am Körper trägt, wird es zu viel Mühe sein umzukehren.
Oder?
32 Kilogramm. Selbst jetzt beschämt ihn das schiere Gewicht.
2017
»Als ich anfing, hatten wir keine großen, schweren Stabilisierwesten. Wir hatten arschschwere Panzer, die dich ratzfatz untergehen ließen. Auch keine Neoprenanzüge. Wir hatten langärmelige Hemden und Overalls. Wir haben die Tauchgänge nie protokolliert. Wir tauchten erst mal. Was hast du für ein Zertifikat?«
Jay ist zwölf, auf einem Pier und hat Salamisandwiches in Wachspapier dabei. Hewey ist auch da und bezahlt einen Jungen dafür, den Bootsmotor zu betanken. Hewey ist Dads bester Freund. Vielleicht sein einziger Freund. Als ehemaliger Zahnarzt verbringt er jetzt seine ganze Freizeit mit Bootfahren und Angeln, kommt pummelig daher mit seinen Schwimmwesten. Hewey kann nicht schwimmen. Das ist verrückt. Wie alt ist der Typ? 60? 70? Jay konnte ihn noch nie auf ein Alter festnageln. Könnte auch 100 sein. Er liebt den Alten. Warum Hewey sich mit Mitt abgibt, wird ihm nie einleuchten.
»Open Water I«, antwortet Jay.
Mitt lacht, was selten vorkommt. Seltsamerweise sind in seinen großen, viereckig wirkenden Kopf wie Klammern wirkende Lachfalten eingegraben, die rechte Falte von einer alten Speerfischer-Narbe schraffiert. Es muss eine Zeit gegeben haben, in der Mitt Gardiners Welt voll von Dingen war, über die er lachen konnte. Er ist fast 1,90 groß, seine Hände groß wie Tennisschläger, sein Körper ist mit nautischen Tattoos übersät, er hat kein Fett angesetzt, obwohl sich die Zeichen des Alterns bemerkbar machen. Die Schultern sind gekrümmt, die Brustmuskulatur erschlafft, die Finger sind etwas zittrig. Aber er ist immer noch größer, breiter und stärker, als Jay jemals sein wird.
»Das Boot ist vollgetankt.« Heweys Schatten ist lang und kühl. »Sei nicht so gemein, Mitt.«
Mitt ignoriert ihn. »Open Water I. Open Water II. Tieftauchen. Nachttauchen. Wracktauchen. Höhlentauchen. Weißt du, was für Kurse wir hatten? Wir hatten einen Kommisskopp, der uns mit schwarzer Farbe übermalte Schwimmbrillen gab und uns Runden schwimmen ließ, bis wir so müde waren, dass er uns mit einem Netz herausfischen musste. Bist du lange genug geschwommen? Bäm! Glückwunsch, du bist ein Taucher.«
3000 psi – 207 bar
Jay sitzt auf der Stoßstange. Schlängelt den linken Arm durch die Öffnung der BCD-Weste, dann den rechten Arm. Die Bewegung ist sofort eingeschränkt, es zwickt wie eine Zwangsjacke. Taillengurt, dicker Klettverschluss. Kummerbund und Brustgurt, zwei Hundehalsband-Druckknöpfe. Alles klar, los geht’s, Zeit aufzustehen. Jay fragt sich, ob in den zwei Jahren ohne Tauchen seine Wirbelsäule zu einem morschen Zweig verkümmert ist.
Er lehnt sich nach vorn, um das Gewicht vom Kofferraum zu verlagern. Es fühlt sich an wie ein Toyota Corolla auf seinem Rücken. Er stellt sich vor, wie er nach vorn fällt, mit dem Gesicht im Dreck versinkt, eingeklemmt von seiner eigenen Ausrüstung, bis ein dreckiger KW ihn findet. Jetzt die Oberschenkel anspannen, die Beine arbeiten lassen – und Jay steht aufrecht, nur eine Sekunde unsicher, bevor er sich daran erinnert, wie man als Packesel steht. Es ist nicht der 50 Pfund schwere Panzer, den er trägt, nicht die 15 Pfund an Gewichten und Batterien. Es sind 17 Jahre, in denen er Mitt Gardiners Sohn gewesen ist, die Erwartungen und Enttäuschungen, all das noch einmal auf seinem Rücken.
Motorisches Gedächtnis: Seine verschwitzten Hände rücken die Gurte zurecht, um eine aufrechte Haltung einzunehmen. Seine Knie wackeln, und das hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Das ist es, was man Trauma nennt, denkt er. Vielleicht sollte er Mom, Nan und Eva nachgeben und das mit dem Therapeuten noch mal überdenken.
Beweg dich, los. Jay beugt ein Knie, um seine Tauchermaske aus dem Kofferraum zu fischen. Darin befindet sich ein Fläschchen mit Babyshampoo, und er schmiert den rosafarbenen Schleim auf die Innenseite der Gesichtsplatte. Maskenbeschlagmittel sind billig, aber Mitt ist noch nie auf ein offizielles Produkt gestoßen, das er nicht mit einer selbst gemachten Lösung besser hinkriegen konnte. Mehr als die Ausrüstung erinnert ihn der Jasminduft des Shampoos an die Vergangenheit.
2016
Er ist elf, sitzt in Dads vier Meter langem, Bibo-gelbem Malibu-Kajak, reibt Shampoo in das Silikon seiner kleinen Maske und fragt Dad, ob das dasselbe Shampoo ist, mit dem Mama ihm als Baby die Haare gewaschen hat. Es ist das letzte Mal, dass er eine Frage stellt, die den alten Herrn garantiert wütend machen wird. Dad sieht entsetzt aus, als hätte Jay gefragt, welches My Little Pony er am liebsten mag.
»Wenn deine Mutter auf mich gehört hätte, hättest du damals gleich das reguläre Zeug in die Augen bekommen, damit du dich ein für alle Mal fertig ausgeheult hast.«
Das reißt das Lächeln aus Jays Gesicht. Er weint zu viel, und er weiß es. Es scheint, als würde er einmal am Tag in einem Käfig aus heißen, schleppenden Tränen ersticken. Er weiß nicht, warum. Er weiß nur, dass Dad bei jedem Anfall die Zähne zusammenbeißt, als wäre es eine persönliche Beleidigung. Jay spürt in sich selbst keinerlei Männlichkeit. Er klammert sich buchstäblich an die Schürze seiner Mutter. Er hat eine Kuscheldecke. Er ist zu klein. Dürr wie ein Mädchen, wirft Mitt ihm und seiner Mutter gern beim Abendessen vor und schiebt die Teller mit dem Essen über den Tisch, bis sie gegen Jays kleinen Teller stoßen.
3000 psi – 207 bar
Jay hat seit sechs Jahren keine Träne vergossen. Nicht einmal auf Mitts Beerdigung.
Er holt die letzten Sachen aus dem Kofferraum: zwei Flossen und einen feinmaschigen Netzbeutel. Er befestigt den Beutel an seinem BCD. Eigentlich sollte er einen richtigen Karabiner verwenden, aber als er seine gesamte Tauchausrüstung ausgrub, konnte er keinen einzigen finden. Stattdessen befestigt er die Tasche mit einem Bootsschnapper, den er sich von der Schultasche seiner Freundin Chloe Tarshish geliehen hat.
Kluge Taucher verwenden keine Schnapphaken. Sie nennen sie »Selbstmordklammern«, weil sie die tödliche Neigung haben, sich in allem zu verfangen, was sie berühren.
Jay knallt den Kofferraum zu. Dann soll es so sein.
Eine Selbstmordklammer für den Ort, an dem Mitt Gardiner durch Selbstmord starb.
Jay hätte es schon an dem Tag kommen sehen müssen, als er von der Krankheit erfuhr.
2021
»Jay. Liebling. Dein Vater hat Krebs.«
Das Erste, was Jay verspürt, ist, dass er sich durch Moms zittrigen Tonfall angegriffen fühlt, denn sie erwartet ganz offensichtlich, dass Jay zusammenbricht und nach Hause eilt, um alles, was zwischen ihm und seinem Vater vorgefallen ist, zu vergessen. Als ob eine Krebserkrankung eine so selbstlose Tat wäre, dass sie alles Vergangene auslöscht. Das Zweite, was er spürt, ist Benommenheit. Mitt Gardiner, der menschliche Mammutbaum, soll krank sein?
»Welche Art?«
»Es ist ein Mesotheliom. Es ist in seiner Lungenschleimhaut. Ich versuche schon seit Monaten, ihn zum Arzt zu bringen. Er hustet Blut und hat Atemprobleme. Sein ganzer Hals und seine Brust sind geschwollen. Jay, du hast ja keine Ahnung.«
»Methoso… Wird das nicht durch Asbest verursacht?«
»Sie haben mir gesagt, dass es auch bei Sporttauchern vorkommt. Besonders in der Nähe von Monterey. Trifft vor allem die Älteren, die ohne Neoprenanzug tauchten. Ich schätze, hier gibt es viel natürliches Asbest. Vielleicht auch in diesen alten Konservenfabriken.«
Mom wirft nicht absichtlich mit Messern, aber dieses hier rutscht ihr aus der Hand und trifft Jay in die Lunge, vielleicht ein Hinweis auf sein eigenes Mesotheliom-Schicksal. Er fühlt sich schwach, ohnmächtig. Er lässt sich auf den Boden fallen, außer Sichtweite der sorglosen Tarshishs. Er macht schon genug Ärger und Arbeit, weil er bei der Familie seiner Freundin wohnt, die brauchen nicht auch noch sein Drama.
»Wie ist die … Ich meine, wie lange geben sie ihm …«
Tränen durchbrechen Moms Dämme. »Könnte ein Jahr sein. Vielleicht zwei. Vielleicht mehr, wenn wir Glück haben.«
Pause. Erwartungsvoll. Was soll Jay jetzt sagen? Er hat die Gedanken an Dad fünf Monate lang ferngehalten, seit er von zu Hause weg ist. Bilder schießen ihm durch den Kopf, aber sie sind alle vom 1. August 2020, dem letzten Mal, als Jay Mitt sah, auf dem Deck der Sleep. Die Bilder kollidieren mit der Krebsnachricht und tun weh. Mom schnieft, als würde sie es auch spüren.
»Jay, komm nach Hause. Du musst nach Hause kommen.«
3000 psi – 207 bar
Nach Hause? Nein. Jay ist in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.
Am hinteren Ende des Parkplatzes ist der Startpunkt des Carmel-Meadows-Wanderwegs. Überall Warnschilder. Lagerfeuer verboten. Hunde sind an die Leine zu nehmen. Angeln verboten. Alle Wildtiere und Pflanzen sind geschützt. Auf dem größten Schild steht: ACHTUNG – WARNUNG VOR PERIODISCH EXTREMEM WELLENGANG – WATEN UND SCHWIMMEN UNTERSAGT – LEBENSGEFAHR.
Jay braucht keine Warnung, die lässt er hinter sich. Er stapft durch das Gatter, kopflastig, die Füße schwer wie Ambosse, die Augen auf den Grund vor sich gerichtet, damit er nicht stürzt und abschmiert. Wären am Highway 1 nicht so viele Autos gewesen, hätte er den kürzeren Weg über die Strandböschung genommen. Die Beschilderung dort ist noch schriller, noch lauter: SEI NICHT DAS NÄCHSTE OPFER! KEINE EIGENMÄCHTIGEN RETTUNGSVERSUCHE! MINDESTENS 30 MENSCHEN SIND AN DIESEM STRAND UMS LEBEN GEKOMMEN! Ein Dummkopf pro Jahr, pflegte Mitt zu sagen. Er liebte es, Monastery vor allen als Amerikas gefährlichsten Strand zu bezeichnen.
Welcher andere Ort wäre infrage gekommen, als er sich umbringen wollte?
Der Schmutz knirscht unter jedem Schritt von Jays nackten Füßen. Es klingt wie Kichern. Zu seiner Linken lugt ein Mietobjekt aus dem Eichenwald hervor. Zu seiner Rechten niedrige, ockerfarbene Hügel mit goldenem Gras, übersät mit Unkrautbüscheln und harten Sträuchern. Dazwischen nichts als Luft und offenes Gelände. Fünf Minuten weiter oben auf dem Weg befindet sich ein Schmuckreif aus schicken Häusern, die zu Carmel Meadows gehören. Jeden Moment wird eine reiche alte Dame mit einem Hund über den Hügel humpeln, jede Sekunde.
Jay versteift sich, aber er kann es nicht spüren, weil der Neoprenanzug so eng sitzt. In einer Tauchausrüstung kann man sich nicht wirklich verstecken. Man könnte genauso gut eine Rüstung tragen.
90 Sekunden später hält sein Glück immer noch. Er trampelt über zwei Laufstege und schlägt einen Haken nach links. Ein Abhang, dann ist er vor Blicken verborgen; lasst die alten Damen mit den Hunden frei! Geschützt, verwandelt sich Jay. Der Henderson entspannt sich über seinen Ellbogen und Knien. Die Oceanic schmiegt sich an seine Wirbelsäule. Die Oktopusschläuche streicheln seine Schultern so zärtlich, wie sonst nur Mom das tut. Beruhigendes Geflüster von allen Seiten – der Sprühnebel der Gischt und Strandroggen, der sich im Wind wiegt.
So hätte das Tauchen sein können. So hätte das Wasser sein können. Wenn er nicht mit der martialischen Fanfare »Schläfer, wacht auf!« zu beidem gedrängt und getrieben worden wäre!
Noch fünf Schritte, und die Nebelschwaden ziehen wie Fähnchen davon. Da ist er, der Strand, Mitts Friedhof, das felsige Maul weit aufgerissen, als wäre er hungrig auf den Ozean selbst.
3000 psi – 207 bar
Morgens liegt über den Buchten Nebel, der von den grünen Bergen ausgeatmet wird. Meistens lichtet er sich mittags, aber Jay hat schon als Kind gelernt, sich nicht von einem silbernen Himmel täuschen zu lassen. Der wird dich rösten. Er erträgt das grelle Licht ebenso wie die Hitze, die ihn fast vergehen lässt, als er stehen bleibt; ihm stockt der Atem wie jedes Mal, wenn er den leckenden grauen Schaum sieht, das Aufbäumen und Brodeln des Wassers, den gutturalen Sog und die überkochende Brühe am Monastery Beach.
Taucher nennen ihn nicht umsonst »Mortuary Beach«, die Totenhalle unter den Stränden.
Er musste in diesen Gewässern bestimmt ein Dutzend Mal mit Mitt getaucht sein. Nie allein. Mitt nahm ihm das Versprechen ab, nie allein zu tauchen, bis er ausgewachsen und erwachsen wäre.
Ist er jetzt erwachsen? Nur wenige würden ihm das zugestehen. Mitts Gefolgsleute aus der Szene sicher nicht. Vor sechs Tagen, als er die Fremont entlangging, begegnete ihm ein Tauchbruder, leicht zu erkennen an seinem Neoprengestank und der riesigen Armbanduhr, und spuckte auf Jays Schuh. Arschloch, murmelte der Kerl und dachte, er wüsste alles über Mitt, den großen Taucher, und Jay, den bockigen Sohn.
Vielleicht wusste der Tauchbruder genug. Jay kann so nicht weitermachen. Er hat noch zwölf Monate bis zum College, wie auch immer das dann aussehen mag. Zwölf weitere Monate, um angespuckt zu werden.
Monastery Beach ist nichts weiter als ein bescheidenes Stück Sand in Halbmondform, das sich zwischen Carmel-by-the-Sea und dem Naturschutzgebiet Point Lobos erstreckt. Ein 20-minütiger Spaziergang für Touristen, die auf dem Weg nach San Francisco hier vorbeikommen. Ein Teil von ihnen stellt sich immer wieder mit dem Rücken zum Wasser, um Fotos zu machen, wird von einer hinterrücks heranbrandenden Welle erwischt und vom Rückstrom mitgerissen. Nur für erfahrene Taucher geeignet, und selbst die mussten die versteckte Mulde direkt innerhalb der Brandungslinie respektieren, die dafür sorgen konnte, dass sie, wenn sie den Einstieg nicht richtig wählten, immer wieder überrollt wurden wie ein zum Verschlucken eingeweichter Bissen.
Das wahre Wunder, vielleicht auch der wahre Schrecken, kommt später, zwölf Seemeilen ins Blau hinaus: der Monterey Canyon, ein über 140 Kilometer langer, gut anderthalb Kilometer tiefer Abgrund von der Größe des Grand Canyon, ein eiskalter schwarzer Zufluchtsort für die seltsamsten Wesen der Welt. Ein dürrer Abzweig, ein Stängel namens Carmel Canyon, zeigt auf den Monastery Beach wie der Finger des Sensenmannes. Was will er damit sagen?
Jay denkt an den Leistungskurs Englisch, an Dantes Inferno, die Inschrift über den Toren der Hölle: Lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr hier eintretet. Jays Gemurmel ist so leise wie die Brandung.
»Sie sollten es einfach zu den Schildern hinzufügen.«
3000 psi – 207 bar
Es gibt eine Holztreppe, aber die Meeresluft hat sie zerfressen. Die Stufen, etwa 15, schrauben sich bloß noch nach unten, ausgewrungen wie ein Handtuch. Jay beginnt mit dem Abstieg, und die erste Stufe jagt ihm einen schmerzhaften Stoß von der Ferse bis zum Becken. Mit so viel Ausrüstung fühlt sich eine 20 Zentimeter hohe Stufe wie zweieinhalb Meter an.
Er spannt seinen unteren Rücken an und geht weiter. Diese Stufen neigen sich nach Westen. Jene Stufen neigen sich nach Osten. Die letzte Stufe ist verzogen wie eine Wippe. Jay rutscht von der Unterkante hinunter. Seine Füße stecken sofort knöcheltief in den charakteristischen runden Sandkörnern des Strandes.
Jay macht fünf Schritte, den fünften über einen zwei Meter langen Kadaver aus Seetang hinweg, der wie ein verwesender Delfin aussieht. Jetzt kann er hinter die Spitze des Mietgrundstücks sehen, wo ein makabrer Zaun die freiliegenden Wurzeln eines riesigen Baumes zurückhält. Weit drüben am Südende des Strandes herrscht Aufruhr.
Zwei breite Lichterketten, eine Unmenge tuckernder Generatoren. Ein Bulldozer kriecht über die westliche Böschung, schaufelmaulig wie ein Monster aus dem Monterey Canyon. Dazu 30 oder 40 Leute, die Fahrer all dieser Autos.
»Scheiße.«
Jay duckt sich hinter den halb umgestürzten Baum. Seine Sicht ist blockiert. Das Gewicht seines Tanks wirft ihn gegen den Zaun. Er kann sich kaum aufrecht halten. Er keucht. Der Neoprenanzug ist dick, aber sein Herz hämmert durch ihn hindurch. Wenn die dreckigen KWs ihn entdecken, werden sie ihn am Tauchen hindern. Das kann er nicht zulassen. Seine Familie, der Respekt der Gemeinde, alles hängt davon ab, ob er zeigen kann, wozu er imstande ist – wozu er ohne Mitt Gardiner imstande ist.
Jay konzentriert sich auf die Flut. Sie gleitet in die Bucht in langen, sich kräuselnden Kegeln, die sich unter ihrem eigenen Gewicht zerstäuben, aufschlagen, wie Albino-Schlangen umherhuschen und vor Vergnügen keuchen, wenn sie zwischen zerklüfteten schwarzen Felsen zurück ins Meer gesaugt werden.
Diese Felstrümmer sind einer der Gründe, warum Taucher niemals aus diesem Kessel des Strandes abtauchen. Ein falscher Tritt, und man ist weg. Aber die Felsbrocken reichen nur etwa sechs Meter weit. Jay ruft sich selbst Anweisungen zu, die niemand außer ihm über das Dröhnen des Meeres hinweg hören kann.
»Schnell durchkommen. Wenn du fällst, fall nach vorn. Dann tritt kräftig mit den Beinen aus. Überwinde die Gefahrenzone, bevor die nächste Welle kommt.«
Die Anweisungen klingen wie Mitt, also tut Jay, was Mitt nie getan hat, und fügt etwas Optimismus hinzu.
»Du schaffst das, Jay! 60 Sekunden, und du bist durch! Das ist wie Fahrradfahren!«
Ein paar Sekunden lang wird er zu sehen sein, bevor ihn ein felsiger Haufen Steinbrocken verdeckt. Er geht ein wenig in die Knie. Packt die Flossen fester. Atmet fünfmal schnell aus, um sich aufzupumpen. Hält seine Maske in der linken Hand. Mit der rechten Hand zupft er ein letztes Mal an dem Netzbeutel. Der Selbstmordclip klingelt leise. Egal wie heftig der Abstieg ist, Jay darf den Beutel nicht verlieren.
Wie soll er sonst die sterblichen Überreste seines Vaters transportieren?
2021
In gewisser Weise hat er in den zwölf Monaten, in denen er bei Freunden lebt, die sterblichen Überreste seiner ganzen Familie bei sich getragen. Während einer Pandemie ist das eine große Aufgabe. Die Isolation war für alle seine Freunde hart, aber Jay vermutet, dass es für ihn am härtesten war, weil er seine Familie nicht um sich hatte, sich nicht auf sie stützen konnte. Er ist ein professionelles Pflegekind, das ständig versucht, sich seinen Gastgebern anzupassen, sich jeweils an die Covid-Regeln zu halten, die sie befolgen oder missachten. Seine Nebenhöhlen schmerzen von den vielen Nasenabstrichen. Es ist anstrengend und einsam, und er hat zu viel Zeit zum Nachdenken. Das Einzige, was ihm geholfen hat, ist, sich in die Schularbeiten zu stürzen.
Draußen ist der einzige Ort, an dem er wirklich atmen kann. Es ist ein Mittwochmorgen, als er zwischen den Onlinekursen nach draußen geht, um Sonne zu tanken, und Hewey am Briefkasten der Tarshishs stehen sieht, mit Safarihut und Covid-Maske, Gürtel zu hoch, Hände in den Taschen. Die Anwesenheit von Heweys Auto trägt nicht dazu bei, dass dessen Erscheinen weniger übernatürlich wirkt.
In der Sekunde, in der Jay ihn sieht, weiß er es. Die Augustluft quillt auf wie Seetang. Jay wünscht sich, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, er wäre im Meer, dann könnte er problemlos zu Hewey hinüberschwimmen, anstatt auf Quallenbeinen auf den Rasen zu fallen.
Hewey hilft ihm auf. Zieht Jay in seine Arme. Das schlaffe Krepppapier seiner Hände. Der traubige Geruch seines Parfüms. Die harte Goldkette unter seinem halb aufgeknöpften Hemd. Jay wurde nicht beigebracht, wie man Männer umarmt, aber er tut es, und es fühlt sich an, als könnte er sein ganzes Gewicht auf Hewey legen und der alte Mann würde ihn aufrecht halten.
»Es tut mir leid, mein Junge.«
Jay nickt gegen Heweys Schulter und hat Angst, etwas zu sagen, denn was, wenn seiner Kehle dabei ein Schluchzen entweicht? Was, wenn dieser eine Schluchzer noch mehr auslöst? Heweys Arme fühlen sich an wie die Schultergurte von Jays Tarierweste.
»Es war Selbstmord. Das muss ich dir ganz offen sagen.«
Jay nickt wieder. Das dachte er sich. Das Letzte, was er gehört hatte, war, dass Dad aus dem Krankenhaus entlassen wurde und alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren.
»Wir waren auf meinem Ruderboot, Junge. Er ist mit Absicht über Bord gegangen. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Aber so ist es passiert. Ich habe deiner Mutter gesagt, dass ich derjenige sein will, der es dir sagt.«
Jay steht gerade. Die Emotionen sind unter Verschluss. Er ist stolz darauf. Hewey lächelt, aber alte Augenlider, das hat Jay bereits gemerkt, können die Tränen nicht zurückhalten. Jay macht Hewey keinen Vorwurf wegen des Selbstmords, und er bewundert Hewey dafür, dass er wusste, dass er es nicht tun würde.
»Dad hat dich benutzt, um raus aufs Meer zu kommen. Er wusste, dass du nicht schwimmen kannst.«
Hewey lächelt. Engelsgleich. »Er hat mich deswegen immer wieder aufgezogen.«
Jay lacht. Was für ein Geschenk in einem Moment wie diesem. Hewey nimmt seinen Safarihut ab. Wischt sich den Schweiß fort. Er tut Jay schrecklich leid. Der alte Mann hat heute seinen besten Freund verloren, direkt aus seinem Boot. Er muss Trauer empfinden, und auch Schuldgefühle. Er trägt diese Last für Jay. Hewey gestikuliert zu seinem Auto.
»Kommst du mit zu deiner Mom?«
Jay nickt. Er holt nicht erst seine Brieftasche, sagt kein Wort zu Chloe. Sie steigen ein.
Erst als der Motor ein ablenkendes, lautes Brummen von sich gibt, fragt Jay: »Wo ist es passiert?«
»Am Monastery Beach.«
Hewey ist Jude, aber er hat eine Plastikfigur des heiligen Christophorus auf sein Armaturenbrett geklebt. Der Schutzheilige des Reisens. Jay berührt sie. Da ist ein Fehler in der Ausformung. Der heilige Christophorus sieht aus, als würde er zwinkern.
3000 psi – 207 bar
Man verbringt nicht sein ganzes Leben mit Tauchen, ohne zu lernen, was der Ozean mit Leichen macht. Mitt Gardiner musste große Aasfresser angezogen haben. Wahrscheinlich Haie. Sechs Monate nach seinem Tod wäre sein Leichnam komplett aufgefressen, nur noch ein Skelett. Die Tatsache, dass seine Knochen bisher nicht von Tauchern entdeckt wurden, lässt vermuten, dass sie zwischen Felsen oder in die Vegetation gerutscht sind. Jay hofft, den Schädel seines Vaters zu finden, aber er wird nehmen, was er kriegen kann. Einen Oberschenkelknochen. Ein paar Rippen. Eine Handvoll Fingerknochen wie Würfel. Die ordentliche, richtige Beerdigung von Mitts Überresten, nicht dieser Scheinplatz in Moss Landing, könnte den mystischen »Abschluss« bringen, nach dem sich seine Mutter und seine Schwestern sehnen, die Jay dann vielleicht wieder in der Herde willkommen heißen werden.