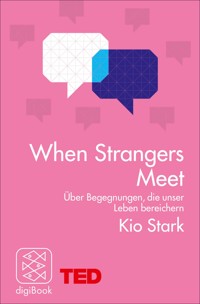
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Kio Stark schreibt in ihrem TED Book ›When strangers meet. Über Begegnungen, die unser Leben bereichern‹ über die unsichtbaren Mechanismen und Bedeutungen von ›street interaction‹. Immer sind wir in Eile. Die Augen fest auf das Smartphone gerichtet. Nur selten sind wir aufnahmebereit für etwas Neues oder jemand Unbekanntes. Doch ein Kontakt mit Fremden unterbricht die Routine des Alltags, er kann kreative Energien freisetzen, die Welt öffnen und die Beziehung zu den Orten festigen, an denen wir uns gerade aufhalten. Kio Stark zeigt ganz konkret, wie wir mit Fremden ins Gespräch kommen können, und hat einige abenteuerliche Aufgaben für die Mutigen unter uns parat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kio Stark
When Strangers Meet – Über Begegnungen, die unser Leben bereichern
TED Books
Über dieses Buch
Ein Gespräch mit Fremden kann dein Leben verändern!
Immer sind wir in Eile. Die Augen fest auf das Smartphone gerichtet. Nur selten sind wir aufnahmebereit für etwas Neues oder jemand Unbekanntes.
Doch ein Kontakt mit Fremden unterbricht die Routine des Alltags, er kann kreative Energien freisetzen, die Welt öffnen und die Beziehung zu den Orten festigen, an denen wir uns gerade aufhalten. Kio Stark zeigt ganz konkret, wie wir mit Fremden ins Gespräch kommen können, und hat einige abenteuerliche Aufgaben für die Mutigen unter uns parat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kio Stark ist eine junge Autorin, Journalistin, Kommunikationsexpertin und Gamedesignerin. Sie ist in der ganzen Welt unterwegs und hält Vorträge über Kommunikation und selbständiges Lernen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de.
Impressum
Erschienen bei FISCHER digiBook
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel:
»When Strangers Meet«
im Verlag Simon & Schuster, Inc., New York
© 2016 by Kio Stark
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt nach Vorlage und Idee von Simon & Schuster, GB
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490400-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Einleitung
1 Wer ist ein Fremder?
2 Flüchtige Intimität
Die äußere Schicht des Selbst
Zuhören
Nachbarn
Körperlose Fremde
3 Eine Welt voller Fremder
Kosmopolitisch sein
Kontakt und Vorurteil
4 Die Mechanik der Interaktion
Höfliche Gleichgültigkeit
Der Blick
Grüßen
Mitten im Geschehen
Rückzugsstrategien
Epilog
Exkursionen
Exkursion: »Leute beobachten«
Exkursion: »Grüßen Sie jeden«
Exkursion: »Verirren wir uns«
Exkursion: »Die Frage«
Exkursion: »Hier haben Sie nichts zu suchen«
Danksagung
Literaturangaben
Flüchtige Intimität
Eine Welt voller Fremder
Die Mechanik der Interaktion
Der TED Talk von [...]
Kleine Bücher – große Ideen!
Für meine Mutter
Einleitung
Die Theke beim Metzger ist so hoch, dass ich mich auf die Zehenspitzen stellen muss, um dem Mann, der die Sandwiches macht, in die Augen sehen zu können. Ich bestelle, er nickt. Als ich einen Schritt zurücktrete, höre ich über mir eine Stimme. »Wie geht es Ihnen?«, fragt mich der Metzger, der gerade auf einer Leiter steht, von oben. »Nicht schlecht«, sage ich. »Und es wird mir noch viel besser gehen, wenn ich erst dieses Sandwich esse.« Er lacht und wendet sich wieder den Konserven auf seinem Regal zu.
»Und wie geht es Ihnen?«
Er dreht sich wieder um. »Mir? Sie sind hier hereingekommen, damit ist mein Tag gerettet.« Er verbeugt sich und lächelt. Er meint es als Kompliment, und ich beschließe, es auch so zu verstehen. »Haben Sie heute frei?« Ich sehe nicht so aus, als würde ich ins Büro gehen. Ich verstehe, warum er mir diese Frage gestellt hat.
»Na ja, ich bin Autorin, deshalb werde ich an meinem Computer sitzen.« Ich mache eine Handbewegung des Tippens. Er fragt mich, woran ich gerade arbeite.
»An einem Buch über Unterhaltungen mit Fremden.«
»Was Sie nicht sagen! Das ist ja klasse.« Er kommt von der Leiter runter. »Wissen Sie was? Das mache ich die ganze Zeit. Also hier, meine ich, das ist mein Job. Aber auch sonst überall.« Er breitet seine Arme in der Luft aus. »Wissen Sie, in einem Aufzug oder so, nicht immer, das kann man nicht immer machen. Einfach nur Hallo oder guten Morgen. Neulich war ich in einem Aufzug und sagte zu einer Frau neben mir einfach ›Guten Morgen‹ – und schaute dann wieder zur Tür. Ich möchte nicht, dass sie denkt, ich will irgendetwas von ihr, darum geht es mir nicht. Sie drehte sich also zu mir um und sagte: ›Ihnen auch einen guten Morgen.‹ Dann sagte sie: ›Wirklich, ich danke Ihnen. Jetzt fühle ich mich wie ein Mensch.‹ Ich versuche einfach, es so zu machen. Ach, ich wünschte, das wäre jedem klar. Wir sollten nicht alle so tun, als würden uns die anderen nichts angehen.«
Mit Leuten zu sprechen, die ich vorher noch nie gesehen habe, ist ein Abenteuer für mich. Es ist für mich ein Vergnügen, ein Aufbegehren, eine Befreiung. So lebe ich.
Und zwar aus dem folgenden Grund: Wenn man mit Fremden spricht, unterbricht man den vorhersehbaren Ablauf des Alltags auf schöne, überraschende Art und Weise. Man wechselt die Perspektive. Man knüpft flüchtige, aber bedeutsame Verbindungen. Man findet Fragen, deren Antworten man zu kennen glaubte. Man erteilt den Vorstellungen, die uns so viel Misstrauen gegen andere einimpfen, eine Absage.
Darüber denke ich schon lange nach. Nicht nur erlebe ich meine Interaktionen mit Fremden als sinnstiftend. Ich bin auch einfach vom Leben der anderen fasziniert, davon, wie Menschen auf der ganzen Welt mit Fremden sprechen, warum sie es tun oder nicht tun. In den vergangenen zehn Jahren hat sich meine Faszination auch auf die Welt des Internets übertragen, denn das Netz steckt voller Technologien, die ganz neue Formen der Verbundenheit generieren können. Viele von den Ideen, die ich Ihnen hier vorstelle, haben sich erstmals in einem Seminar herauskristallisiert, das ich im Rahmen des Programms »Interaktive Telekommunikation« an der New York University (NYU) hielt. In diesem Seminar wollte ich den Technikern, Programmierern und App-Designern zeigen, wie sich die Fremden, die sie miteinander in Kontakt zu bringen versuchen, tatsächlich verhalten und warum sich Menschen anderen, unbekannten Menschen gegenüber so verhalten, wie sie es tun.
In diesem Buch möchte ich herausarbeiten, warum es gut für uns ist, mit Fremden zu sprechen. Ich möchte herausfinden, wie es Menschen gelingen kann, sich für ein, und sei es noch so kurzes, Gespräch mit Fremden zu öffnen und welche faszinierende Dynamik diesem Prozess zugrunde liegt. Was kostet es, einem Fremden, an dem man auf der Straße vorbeigeht, einfach Hallo zu sagen? Wie könnte eine solche Interaktion weitergehen? Welche Orte bieten sich dafür an, mit Unbekannten in Kontakt zu kommen? Wie befreit man sich wieder aus einem Gespräch? Man könnte meinen, diese Fragen wären leicht zu beantworten. Doch wie sich noch herausstellen wird, sind sie es nicht.
Jetzt zu den Regeln.
Eines sollte sich von selbst verstehen, doch da es in diesem Buch ja gerade um das Wahrnehmen selbstverständlicher Dinge geht, hier nur für alle Fälle:
Wenn ich von Unterhaltungen mit Fremden spreche, dann meine ich damit offene, respektvolle, aufrichtige Interaktionen. Nichts von dem, was Sie hier lesen, soll begründen oder nahelegen, dass eine unerwünschte, unfreundliche Kontaktaufnahme – mit anderen Worten Belästigung oder Anmache – unser Gefühl der Zugehörigkeit oder Menschlichkeit in irgendeiner Weise stärkt. Fremden Leuten Dinge hinterherzurufen ist eine Form von Gewalt: Nachpfeifen, Beschimpfen, anzügliche Kommentare über ihr Äußeres, Verspotten, verhüllte oder unverhüllte Drohungen. Und nicht nur die Augenblicke, in denen Menschen immer wieder gezwungen sind, sich gegen ein solches Verhalten zur Wehr zu setzen, konditionieren sie darauf, nicht mit Fremden zu sprechen. Als Passant hat man zwei Pflichten. Die erste Pflicht ist, nett und höflich zu sein. Die zweite Pflicht ist einzugreifen, wenn man auf der Straße Zeuge eines verbal oder körperlich aggressiven Verhaltens wird, jedenfalls solange nicht zu befürchten ist, dass die eigene Einmischung die Lage verschlimmert. Man sollte sich dafür einsetzen, dass möglichst alle Menschen die Chance haben, in der Öffentlichkeit positive Erfahrungen mit Unbekannten machen zu können, indem man Querulanten, Menschenfeinden und Belästigern die Stirn bietet.
In diesem Buch geht es um das Sprechen, und es geht auch um das Sehen, Zuhören und Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte Ihnen zeigen, wie poetisch und tiefgründig die flüchtigsten Verbindungen sein können. Ich möchte, dass Sie lernen, die Menschen, die Ihnen fremd sind, intensiver wahrzunehmen und besser zu verstehen. Ich möchte Ihnen die unsichtbare Mechanik der Straßenkommunikation zum Bewusstsein bringen. Ich möchte Sie lehren, die Welt mit neuen Augen zu sehen und zu lieben.
1Wer ist ein Fremder?
Wie unterteilt man die Welt in bekannt und unbekannt?
Fremder ist ein heikler Begriff – man glaubt zu wissen, was er bedeutet, bis man versucht, ihn für sich selbst auszubuchstabieren. Er bezeichnet eine Idee, die unseren Alltag auf unsichtbare Weise strukturiert: die Dinge, die wir sehen, die Entscheidungen, die wir treffen, die Art, wie wir uns bewegen. Sind Sie bereit, sich klarzumachen, wie heikel er wirklich ist? Erklären Sie mir bitte, was Sie meinen, wenn Sie Fremder sagen!
Diese Frage stelle ich oft; die Antworten lassen sich unter folgende, wunderbar widersprüchliche Liste subsumieren:
jemanden, den man nur einmal gesehen hat
die Menschen der ganzen Welt, die man nie getroffen oder kennengelernt hat
alle Menschen, die man nicht kennt, aber im Prinzip kennen könnte; die Menschen, die man irgendwie als Individuen identifiziert, ohne dass man sie je persönlich getroffen oder kennengelernt hätte
Menschen, über die man persönliche Dinge weiß, ohne sie je kennengelernt zu haben, so wie etwa den Freund eines Freundes oder eine Person des öffentlichen Lebens
einen Menschen, der sich, ideologisch oder geographisch gesehen, nicht im eigenen Umfeld bewegt
einen Menschen, mit dem man nichts gemein hat
jemanden, der zu keiner der Gruppen gehört, über deren Zugehörigkeit man sich selbst definiert
jemanden, den man nicht versteht
jemanden, der eine Gefahr darstellt
jemanden, dem man häufig begegnet, über den man aber nicht mehr weiß als das, was sich beobachten lässt
jemanden, dessen Namen man nicht kennt.
Wenn wir unsere Ideen über Fremde Revue passieren lassen, dann sortieren wir die Vorstellung, dass ein Fremder jemand ist, vor dem man Angst haben muss, oftmals aus. Da sie im Widerspruch zu unserer gelebten Erfahrung steht, halten wir sie für ein Produkt unserer Erziehung, die uns als Kind vor vermeintlich »gefährlichen Fremden« schützen sollte, oder medial vermittelter Vorurteile. Wen wir als Fremden betrachten, ist eine persönliche Sache. Sie ist aber auch kulturell und historisch geprägt. Unser Umgang mit Fremden – und damit auch unsere Vorstellung, wer sie eigentlich sind – kann sich im Zuge einschneidender Ereignisse verändern. Bei größeren Katastrophen oder Beeinträchtigungen unseres täglichen Lebens wie etwa Stürmen, Fluten, Gewalttaten oder einem Streik der Verkehrsbetriebe werden unsere gewöhnlichen Erwartungen plötzlich außer Kraft gesetzt. Das Gemeinschaftsgefühl triumphiert dann über die Angst. Angesichts der zunehmenden terroristischen Anschläge, die islamische Fundamentalisten auf der ganzen Welt verüben, hat das Misstrauen gegen Fremde deutlich zugenommen – und mit ihm auch die unlogischen und unhaltbaren Annahmen darüber, welche Art von Fremder eine Bedrohung für uns darstellt.
Unser Begriff von einem Fremden und unser Verhalten ihm gegenüber sind außerdem stark von der jeweiligen Situation abhängig. Ist es dunkel, bin ich alleine, befinde ich mich auf vertrautem Boden, habe ich mich verlaufen, bin ich an einem bestimmten Ort in der Minderheit?
Wer gilt als Fremder? Wen grüßen wir? Wem weichen wir lieber aus? Meine vierjährige Tochter bringt mich dazu, unablässig über diese Fragen nachzudenken. Ich lebe mit meiner Familie in einem Stadtviertel, in dem es Wohn- und Geschäftsstraßen gibt. Wenn ich mit meiner Tochter durch das Viertel laufe, kann ich beobachten, wie sie die Fremden sortiert.
Ich grüße die meisten Leute, und sie möchte gerne wissen, warum. Sind das deine Freunde?, fragt sie mich. »Nein, das war nur ein Nachbar«, könnte meine Antwort lauten, wenn es jemand ist, den wir öfter sehen, oder wenn es Leute sind, die in der Nähe unseres Hauses herumlaufen. Kennen wir sie? »Nein, wir haben sie bisher nicht kennengelernt.« Warum hast du dann ›Hallo‹ gesagt? »Es ist einfach schön, freundlich zu sein.« Ich überlege es mir zweimal, bevor ich so etwas sage, obwohl ich es wirklich so meine. Und als Frau weiß ich sehr wohl, dass Fremde auf der Straße keinesfalls immer gute Absichten haben. Es ist schön, freundlich zu sein, und es ist auch gut zu wissen, wann man es lieber nicht sein sollte. Das bedeutet aber in keiner Hinsicht, dass wir Angst haben müssen.
In der Nähe unserer Wohnung gibt es ein Rehazentrum, in dem offenbar auch ein paar schwere Fälle leben, die auf die eine oder andere Weise ein bisschen »neben der Spur« sind. Diese Leute laufen beispielsweise in ziemlich abgerissenen oder schmutzigen Sachen herum oder benehmen sich, als ob sie betrunken oder »high« wären. Ihre Art zu reden und sich zu bewegen, versetzt mich gelegentlich in Alarmbereitschaft, doch ich weiß überhaupt nicht, ob ihr Verhalten im Prinzip gefährlich sein könnte oder vollkommen harmlos ist. Bei diesen Gelegenheiten fühle ich mich mehr oder weniger unbehaglich, und ich möchte meiner Tochter zeigen, dass ich sehr wohl auswähle – und ihr beibringen, das selbst auch zu tun –, wen ich grüße und welche Vorkehrungen ich treffe, um jemandem aus dem Weg zu gehen, der mir potentiell unberechenbar oder unangenehm zu sein scheint. Ich möchte, dass sie einen wesentlichen Unterschied in einer Welt von Fremden begreift: unberechenbar und unangenehm heißt nicht notwendigerweise gefährlich.
Eines Morgens auf dem Weg zum Kindergarten sehen wir mitten auf der Straße, die wir normalerweise entlanggehen, einen Mann wütend herumschreien und dabei wild mit den Armen gestikulieren und mit den Füßen stampfen. Ich sage zu meiner Tochter: »Lass uns einen anderen Weg nehmen.« Da fragt sie mich: Warum können wir nicht hier langgehen, ist er denn nicht unser Nachbar? Sobald eine solche Frage erst einmal im Raum steht, zieht sie viele andere Fragen nach sich. Ich muss mir überlegen, warum ich mich unwohl gefühlt habe und ob dieses Gefühl aus einer richtigen Intuition stammt oder einfach nur aus einem unbegründeten Vorurteil. An diesem Tag sage ich: »Nun, dieser Mann macht mir einen ziemlich aufgebrachten Eindruck, und ich möchte ihm nicht allzu nahe kommen.« Warum ist er denn aufgebracht?, fragte sie. »Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, doch an der Art, wie er schreit und seinen Körper bewegt, kann ich erkennen, dass ich ihm jetzt nicht zu nahe kommen möchte.« Ich beobachte, wie sie diese Information aufnimmt. Ich habe es vermieden, kurz und bündig zu sagen: »Er verhält sich, als ob er verrückt wäre«, obwohl ich das möglicherweise zu einem Erwachsenen gesagt hätte. Das lag nun weniger daran, dass ich nichts Unfreundliches über ihn sagen wollte. Ich wollte nur einer Lawine von Fragen aus dem Weg gehen, die ich hier an der Straßenecke nicht unmittelbar hätte beantworten können. Was heißt verrückt? Wie ist er verrückt geworden? Ist er immer verrückt? Woher weiß ich, ob jemand verrückt ist?
Worum es mir in diesem Augenblick ging, war, meiner Tochter beizubringen, dass sie Leute wahrnimmt, statt sie gleich zu kategorisieren und sie in eine Schublade zu stecken.





























