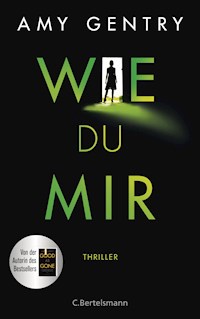
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen im Rachefieber ...
Die junge Comedian Dana Diaz begegnet nach einem missglückten Auftritt der IT-Spezialistin Amanda. Als Frauen in typischen Männerberufen klagen sie sich ihr Leid, denn beide sahen sich in der Vergangenheit häufig mit sexuellen Belästigungen oder Übergriffen konfrontiert. Lange haben sie dies einfach erduldet, jetzt wollen sie selbst für Gerechtigkeit sorgen. Sie schließen einen Pakt: Jede soll sich an den Gewalttätern der anderen rächen. Nach kurzer Zeit übertrumpfen sich die beiden Frauen in ihren Rachespielen, geraten in eine Spirale aus Gewalt, Betrug und Täuschung. Bis sich Dana irgendwann fragt, ob sie ihrer neuen Freundin eigentlich wirklich blind vertrauen kann. Und was, wenn nicht? Wäre es dann für einen Absprung aus dem teuflischen Spiel nicht schon viel zu spät…?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt:
Die junge Comedian Dana Diaz begegnet nach einem missglückten Auftritt der IT-Spezialistin Amanda. Als Frauen in typischen Männerberufen klagen sie sich ihr Leid, denn beide sahen sich in der Vergangenheit häufig mit sexuellen Belästigungen oder Übergriffen konfrontiert. Lange haben sie dies einfach erduldet, jetzt wollen sie selbst für Gerechtigkeit sorgen. Sie schließen einen Pakt: Jede soll sich an den Gewalttätern der anderen rächen. Nach kurzer Zeit übertrumpfen sich die beiden Frauen in ihren Rachespielen, geraten in eine Spirale aus Gewalt, Betrug und Täuschung. Bis sich Dana irgendwann fragt, ob sie ihrer neuen Freundin eigentlich wirklich blind vertrauen kann. Und was, wenn nicht? Wäre es dann für einen Absprung aus dem teuflischen Spiel nicht schon viel zu spät …?
Autorin:
Amy Gentry ist freie Literaturkritikerin und unterrichtet in Austin, Texas, englische Literatur an einer High School. Außerdem engagierte sie sich mehrere Jahre lang als Ehrenamtliche in einer Organisation für Opfer sexueller Gewalt. Ihr Debüt »Good as Gone« wurde zu einem internationalen Bestseller und erschien in über 20 Ländern. Amy Gentry lebt mit ihrer Familie in Austin.
AMY GENTRY
WIE DU MIR
So ich dir
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Astrid Arz
C. Bertelsmann
Für AJZ, eine ausgesprochen kluge Frau
NANCY: Ich sollte zu dir gehen, wenn ich Ideen brauche.SYLVIA: Zu irgendwem jedenfalls.
Die Frauen, 1939
1
»Und jetzt: Bühne frei für Daaaaana Diaz!«
Ein paar Leute klatschten, während ich die hölzerne Bühne bestieg und dabei den Lautsprechern auswich. Im Scheinwerferlicht zupfte ich ein letztes Mal den T-Shirt-Saum vom Bund meiner Jeans, strich mir eine dunkelbraune Strähne vom Lipgloss-Lächeln, umfasste das Mikrofon mit einer Hand und löste sorgsam das Kabel vom Ständer. Es war Quatsch, zwei Minuten mit dem Runterschrauben auf meine Körpergröße zu verlieren: 1,65 m auf Zehn-Zentimeter-Absätzen, ohne die ich mich so gut wie nie auf die Bretter stelle.
»Hallo zusammen«, sagte ich. »Ich bin Dana und heute Abend eure Quoten-Latina.«
Ich wartete auf das betretene Gekicher, doch alles, was kam, war die dumpfe, beleidigte Schweigepause eines Kneipenpublikums, dem die Musik abgedreht worden war, gefolgt von einem bellenden Husten. Weiter im Text.
»Und sag mir ja keiner, ich soll dahin zurückgehen, wo ich herkomme. Amarillo liegt am Arsch der Welt.« Wieder Schweigen. Ich nestelte am Mikroständer herum. »Irgendwer aus Amarillo im Publikum? Nein?« Kein Gejohle. »Schon okay, ich würd’s auch nicht zugeben, wenn es nicht mein Job wäre. Na ja, Hobby.«
Ich war seit etwas über einem Jahr wieder in Austin, absolvierte so viele Open Mics, Gastauftritte und Newcomer-Sets wie möglich und hatte mir meinen Slot auf der Third-Thursday-Bühne im Nomad redlich verdient. Aber in letzter Zeit wollte der Funke einfach nicht überspringen, und ich wusste nicht, woran es lag.
Ich fuhr fort. »In Amarillo ist wenig los. Na ja, der zweitgrößte Arbeitgeber ist ein Heliumwerk. Als ich zur Highschool ging, hingen wir immer hinter dem Seven-Eleven rum …«, ich tat so, als saugte ich an einem Heliumballon, und sagte mit hoher Piepsstimme: »Hey, Alter, reich Mickymausmal weiter.«
Ausdruckslose Mienen. Mein Schnüffler-Gag klang wenig überzeugend, weil meine Wochenenden in der Highschool-Zeit tatsächlich eher clean gewesen waren. Jason und ich hatten gesehen, was Drogen mit seinem großen Bruder angerichtet hatten, und wollten nichts damit zu tun haben. Ich nahm mir fest vor, an meiner komischen Stimme zu arbeiten, und preschte voran. »Als ich klein war, hat meine Mom in der Heliumfabrik gearbeitet. Ich dachte immer, sie wär Kindergeburtstagsclown.« Kurze Pause. »Der Tag, an dem sie mich mal mit zur Arbeit nahm, war eine herbe Enttäuschung für mich.«
Ich suchte auf den bühnennächsten Plätzen nach einem freundlichen Gesicht, sah aber nur dumpfäugige Trinker und verkorkste Tinder-Dates. In Gedanken driftete ich in die grellen Untiefen der Scheinwerfer ab. Jason, mein Co-Autor und bester Freund, seit wir vierzehn waren, hatte mir vor vielen Jahren den Tipp gegeben, mir das freundlichste Gesicht in der Menge auszugucken, wenn ich floppte, und mir vorzustellen, dass ich nur diesem Menschen alle meine Witze erzählte. Zwar hatte ich mit Jasons Trick nur selten das Publikum zurückgewonnen, war mittlerweile aber oft genug gefloppt, um zu wissen, dass es gar nicht so sehr darauf ankam. Sondern darauf, dem Publikum zu zeigen, dass es einem da oben bestens ging, danke der Nachfrage. Es gibt kein schlimmeres Fremdschämen als zuzusehen, wie jemand auf der Bühne hilflos herumzappelt. Ich hatte dieser Regel einen geheimen Namen gegeben: Kein Blut im Wasser.
Ich merkte, dass ich fahrig herumfuchtelte, mit angespannter Stimme, um mich größer zu machen. Nach vier Jahren in Los Angeles fiel es mir schwer, mich in dieser etwas zu lockeren Stadt zu entspannen. Mir fehlte die Plackerei. Das Publikum in L. A. war hart gewesen, hatte mich aber abgehärtet; hier in Austin hingegen setzte einem die Gleichgültigkeit zu. Als ich aus L.A. abgehauen war, hatte Jason kaum noch mit mir geredet, und da hatte ich es mir geschenkt, ihm die gleiche Leier zu erzählen wie allen anderen: Ich würde eine Auszeit brauchen, nur kurz, und dann wiederkommen. Doch das war leichter gesagt als getan. Beim letzten Umzug war ich fünf Jahre jünger gewesen, und nicht allein. Mit Jason war mir alles leichter gefallen. Er wusste, wo wir herkamen und wie wichtig es war, sich nicht den Wind aus den Segeln nehmen zu lassen, nie zurückzufallen.
So viel dazu. Nach vier Jahren Abwesenheit kam es mir vor, als würde ich in Austin wieder von vorne anfangen, nur dass die Konkurrenz mittlerweile größer und das Bier teurer geworden waren. In ein paar Monaten, wenn mein alter Mietvertrag auslief, würde ich für meine schäbige Wohnung astronomische Summen zahlen müssen, mein Anteil an der Trinkgeldkasse reichte kaum für ein Bier nach dem Auftritt, und ich rackerte mich immer noch mit angstschweißgebadeten Auftritten in Kellerbars und Coffeeshops ab. Achtundzwanzig war vielleicht nicht alt, aber doch zu alt dafür.
»Ich danke meiner Mom für meine passenden Initialen: Doppel-D«, mit einem vielsagenden Blick auf meinen Busen, was mir immerhin etwas Gekicher einbrachte. Ah, Tittenwitze. Comedy-Krönung. »Damit war ich der Hit in der Mittelstufe.«
»Geile Möpse!«, rief einer aus den hinteren Reihen.
»Bobby Micklethwaite, bist du das?«, schoss ich zurück, während ich mit einer Hand die Augen abschirmte, als wollte ich an den Scheinwerfern vorbeispähen. »Du hast dich ja seit der Siebten überhaupt nicht verändert. Bis auf – was bloß? Ach ja, du bist noch viel hässlicher geworden.«
Unbeeindruckt rief dieselbe Stimme: »Ausziehen!«
»Dafür immer noch die gleiche geschliffene Ausdrucksweise«, murmelte ich und wollte weitermachen.
»Zeig uns deine Titten!«
Ein paar Buhrufe ertönten. Jemand rief: »Halt’s Maul!« Ich spürte das Prickeln des hochkochenden Ärgers im Publikum, wusste aber, wenn mir die Situation jetzt entglitt, hätte es der Zwischenrufer endgültig geschafft. Ich kämpfte gegen die aufsteigende leichte Panik an. Kein Blut im Wasser, sagte ich mir. Zeig ihnen, dass du damit klarkommst.
Mit zuckersüßer Stimme fragte ich: »Hat dich etwa jemand verletzt?«, dann, in normalem Tonfall: »Vor- und Nachnamen, bitte. Ich will wissen, wen ich dafür bezahlen kann, dass es wieder passiert.« Unsicheres Gelächter im Publikum bei der Erwähnung von Gewalt. »Und immer und immer wieder.«
Der Zwischenrufer lenkte bloß noch mit betrunkenem Gemurmel ein, doch kaum jemand im Publikum lachte. »War bloß ’n Witz, Leute!«, rief ich mit weit ausgebreiteten Armen. »Dafür verdien ich nicht genug. Vielleicht sollten wir ein Crowdfunding für mich starten?«
Eine Mischung aus Lachen und Buhrufen, unklar, ob sie mir oder dem Zwischenrufer galten. Der Türsteher näherte sich endlich dem Störenfried, also nahm ich den Faden meiner Nummer wieder auf und ging zu Witzen über meinen Brotberuf über. Mein Adrenalinspiegel war zeitgleich mit dem der Menge angestiegen, aber es war kein gutes Gefühl. Die Zuschauer waren schon vorher nicht mitgegangen, und der Zwischenrufer hatte nur das Gift im Raum so aufgesogen und verdichtet, dass es fast greifbar wurde. Nicht die Augen schließen, sagte ich mir, nicht blinzeln, bis du sie zurück hast. Doch in meinem Blickfeld tanzten immer mehr schwarze Punkte.
Zuerst hörte ich ihr wild bellendes Lachen, dann sah ich sie: das freundliche Gesicht. Die Frau saß an einem Tisch in Wandnähe, den strubbeligen blonden Haarschopf von grüner Neon-Bierwerbung beleuchtet. Ich erhaschte einen Blick auf große, weit auseinanderstehende Augen in tief liegenden Höhlen, hohe Wangenknochen, weiße Zähne in einem zum Grinsen verzogenen Mund. Ich fragte mich, warum sie mir zuvor nicht aufgefallen war; entweder hatte sie noch nicht unter dem Licht gesessen oder nicht gelacht. Jetzt nickte sie wie eine Löwenzahnblüte im Wind, ein sicherer Hafen hingerissener Zustimmung, und ich spürte, wie ich mich entspannte. Ich merkte mir ihr Gesicht und blickte den restlichen Auftritt über zwar wie immer ins Publikum, erzählte meine Witze aber ausschließlich der Löwenzahnfrau, die immer mal wieder schallend loslachte. Die zehn Minuten vergingen zum Glück wie im Flug, und schon trat ich vom teppichbespannten Podest, aus dem Scheinwerferkegel und ins übliche Dämmerlicht einer schmuddeligen Kneipe.
»Noch mal einen Riesenapplaus für Dana Diaz!«, rief der Moderator Fash ins verhaltene Klatschen, während ich über die Lautsprecherkabel stakste und mich an der Wand entlang zur Theke vorschob. »Als Nächstes …«
Als Nächstes kam Toby, ein Hipster aus Minneapolis, kurz vor dem Ortswechsel nach L. A. – »geben wir ihm also einen fetten Applaus mit auf den Weg!« (Vereinzeltes Klatschen.)Nach ihmwarKim dran, alias das Andere Girl, mit buschigem blondem Pony und Slip Dress à la Courtney Love; dann James, mit Hosenträgern und Ukulele. Als Letzter Fash Banner, der Moderator und Organisator, der voriges Jahr im »Funniest Person in Austin«-Wettbewerb Platz drei belegt hatte. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, mir anzusehen, wie sie einer nach dem anderen toppten oder floppten, sondern wollte meinen Drink im Nebenraum genießen, und heute Abend musste es etwas Stärkeres sein. »Whiskey Soda«, sagte ich zu Nick, dem Donnerstags-Barkeeper, während Toby mit seinem Programm loslegte.
»Der geht auf mich«, hörte ich eine Stimme in Ellenbogennähe, dann knallte jemand eine Kreditkarte auf den Tresen und schob sie rüber. Ich drehte mich um und sah die Frau mit dem freundlichen Gesicht.
»Danke«, sagte ich. Ich würde mir ja wohl kaum einen Gratisdrink entgehen lassen, und dieser Fremden fühlte ich mich noch verbunden, weil sie mir geholfen hatte, den verkorksten Auftritt durchzustehen. Ich musterte die Blonde, die neben mir stand, oder besser über mir aufragte – dazu gehört ja nicht viel –, und erkannte aus nächster Nähe, dass ihr gewellter Haarschopf in breiten Strähnen blondiert war, die an den dunkelblonden Ansätzen herauswuchsen. Der Stehkragen ihrer abgetragenen Bikerjacke verlieh ihr den Hauch einer priesterlichen Aura.
»Für mich auch einen«, rief sie Nicky zu. Anscheinend wollte sie wohl gemeinsam etwas trinken. Weil es zu spät war, dem zu entgehen, nahm ich meinen Whiskey Soda, mahnte sie mit einer Geste in Richtung Toby auf der Bühne zum Schweigen und machte mich ins Nebenzimmer auf. Noch keine Minute war herum, da tauchte sie mit ihrem Glas in der Tür auf und steuerte meinen Tisch an. Hier im Nebenraum waren die Lautsprecher leiser, das Stimmengewirr gedämpft.
»Ich bin Amanda«, sagte sie und hielt mir die Hand hin. »Ich fand’s toll, wie du mit diesem betrunkenen Typen umgesprungen bist, und da wollte ich dir einen ausgeben.«
Hatte ich’s mir doch gedacht: Sie hatte meinen ganzen Auftritt gesehen, aber erst beim Vorfall mit dem Zwischenrufer aufgehorcht. Das verpasste meinem Gratisdrink irgendwie einen schalen Beigeschmack.
»Dana«, sagte ich und schüttelte ihr die Hand. »Und danke. Beim restlichen Publikum hab ich mir damit allerdings nicht gerade Pluspunkte eingehandelt.«
»Die Leute können die Wahrheit schlecht vertragen«, sagte sie. »Aber Typen wie der gehören wirklich außer Gefecht gesetzt.«
Typen wie der! Das war schon fast niedlich. »Du gehst nicht oft zu Comedy, oder?«
Amanda lächelte. »Nein«, gab sie zu. »Ich bin erst vor ein paar Wochen hergezogen.« Ob sie damit erklären wollte, warum sie sich noch kaum Comedy angesehen hatte oder warum sie an diesem Abend gekommen war, blieb offen.
»Also, Amanda«, sagte ich, »›Ausziehen‹ ist quasi Zwischenruf-Vorschule für weibliche Stand-up-Comedians. Wenn man damit nicht fertig wird …« Ich zuckte mit den Schultern.
»Dann wirst du also andauernd so belästigt?«, fragte sie mit ungläubig aufgerissenen Augen. »Und musst dir das einfach bieten lassen?«
»Zwischenrufer belästigen jeden«, sagte ich peinlich berührt. »Das gehört zum Geschäft. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Ehrlich …«, ich lachte. »Ich mein, besser ein Zwischenrufer als eine anzügliche Bemerkung vom Moderator.«
»Das kommt auch vor?«
»… oder ein Schwung Vergewaltigungswitze vom Typen vor mir. Oder, das hab ich am allerliebsten, wenn einer aus dem Publikum hinterher ankommt und sagt: ›Für ’ne Frau ganz witzig.‹« Ich hatte schon lange die Nase voll von diesen alten »Frauen und Comedy«-Kamellen und hielt mich sonst raus, wenn meine Kolleginnen rummeckerten. Nicht, dass es nicht stimmte, aber es war einfach sinnlos, sich darin zu verbeißen. Doch jetzt, wider Erwarten amüsiert von Amandas empörtem Gesichtsausdruck, ertappte ich mich dabei, wie ich das ganze Arsenal genüsslich aus dem Hut zog.
»Da musst du dir aber ein dickes Fell zulegen«, sagte sie kopfschüttelnd.
»O ja, früher hab ich in Größe 34 gepasst«, scherzte ich. Der Humor entging ihr, was ich seltsam liebenswert fand. Meine Mutter verstand meine Witze auch nicht, aber mir war nie klar, wie viel davon auf die Sprachbarriere ging und was ihr Selbstschutz gegen die Erinnerung an meinen Spaßvogel von einem Vater war, der uns längst verlassen hatte. Manchmal suchte sie sich aus, was sie verstand und was nicht.
Amanda sah mich erwartungsvoll an, gespannt auf das Ende der Geschichte. Nach einem großen Schluck Whiskey Soda gab ich es auf und erklärte: »Ich mein ja nur, man hat ziemlich schnell den Dreh raus, wie man mit Zwischenrufern umgeht. Sonst lässt man sich bloß aus dem Konzept bringen.«
»Ich könnte niemals so schnell zurückschießen.«
»Es geht nicht wirklich drum, was besonders Geistreiches zu sagen. Sondern darum, schnell weiterzumachen, damit man seinen Auftritt durchkriegt. Ihm zu zeigen …« Ich verbesserte mich: »… nein, dem Publikum zu zeigen, dass er einem nichts anhaben kann.«
»Wirklich? Hat es dir nicht auch ein bisschen Spaß gemacht? Dem Typen gerade eins vor den Latz zu knallen, bis er sich so klein mit Hut vorkam?« Sie verengte die Augen zu schmalen Schlitzen und lächelte verschwörerisch. »Gib’s ruhig zu.«
Der Whiskey wärmte mir den Bauch. Ich lachte. »Ein bisschen vielleicht schon«, räumte ich ein. In dem Augenblick, als ich mich über den »Geile Titten«-Rufer lustig machte, hatte ich die Vorstellung, dass es ihm wehtat, tatsächlich ein wenig genossen. Der Gedanke war mir unangenehm. Es hatte etwas Unanständiges, obwohl jede Menge Komiker diesem Impuls nachgaben. Ein Themenwechsel war angesagt. »Du meintest, du bist gerade hergezogen? Von woher?«
»Los Angeles«, sagte sie. »Ich wollte Schauspielerin werden.«
Das überraschte mich nicht, sondern kam mir durchaus bekannt vor. Ihre Mischung aus Naivität und Selbstsicherheit erinnerte mich an bestimmte Frauen, die mir in Schauspielkursen begegnet waren, zierliche, umwerfend attraktive Persönchen, die in Waschsalons entdeckt worden oder in ihrem Heimatort jemandem beim Zigarettenholen in der Kioskschlange aufgefallen waren. Auf Girl Groups und Nebenrollen in Seifenopern getrimmt, gelang ihnen nur selten der Durchbruch. Fürs Schauspielern hatten sie zu wenig Fantasie und zu viel Realitätssinn, und irgendwann ließen sie sich hinter die schöne Kulissenwelt von L. A. zurückfallen oder zogen weiter.
»Da hab ich auch eine Zeit lang gewohnt«, sagte ich. »Vielleicht haben wir gemeinsame Freunde.«
»Ich war bloß ein Jahr lang da«, sagte sie und rührte in ihrem Drink. »Hab’s gehasst.«
»Ja, ich auch«, flunkerte ich, während mir plötzlich eine Idee zu einem Pilotfilm kam: Gescheiterte Schauspielerin gründet Kleintheater in ihrer Heimatstadt; irgendwas zwischen Wie im Himmel und Crazy Ex-Girlfriend. Ich knetete an meiner Serviette herum und ärgerte mich, dass ich keinen Stift dabeihatte. »Wahrscheinlich bist du hingezogen, kurz bevor ich weg bin. Mal sehen …« Ich ratterte eine lange Liste von Gelegenheiten runter, bei denen wir uns hätten über den Weg laufen können: Improtheater, Schauspielworkshops, Networking-Events und sogar das Culver City Diner, wo ich als Kellnerin gejobbt hatte. Jedes Mal schüttelte sie den Kopf. Wir hatten uns knapp verfehlt, doch während ich mögliche Berührungspunkte aufzählte, nahm mein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit ihr eher zu als ab. »Mit wem warst du denn unterwegs?«, fragte ich.
»Eigentlich mit niemand. Ich hab alle meine Freunde mit meinem IT-Job verloren.« Als sie meinen fragenden Blick sah, ergänzte sie: »Ich war Programmiererin bei Runnr.«
Selbst ich mit meiner Borderline-Technophobie hatte von der Dienstleistungs-App gehört, die alle anderen vom Markt verdrängt hatte, auch wenn ich mehr Freunde in der Unterhaltungsbranche hatte, die sich mit Aushilfsjobs als Set-Runner über Wasser hielten, als solche, die die gleichnamige App nutzten. Etwas von meiner Überraschung musste mir anzusehen gewesen sein, dazu Reue über mein Schubladendenken – Girl Groups und Seifenopern! –, weil sie mich mit schiefem Grinsen beäugte. »Ja, ja, schon klar. Ich seh nicht aus wie ’ne Softwarespezialistin. Aber dir sieht man die Komikerin ja auch nicht gerade an.«
Ich wurde rot. Es stimmte schon, von meinem Äußeren – klein, braunhäutig und mit der Figur meiner Mutter, nur ohne die Bauch-weg-Strumpfhose – konnten die wenigsten auf meine freiberufliche Tätigkeit schließen. »Sorry.«
»Schon okay«, erwiderte sie. »Sagen wir einfach, von meinen Kollegen fand auch keiner, dass ich wie eine Programmiererin aussah. Das haben sie mir überdeutlich zu verstehen gegeben.« Sie nahm noch einen Schluck. »Und zwar noch bevor mein Abteilungsleiter anfing, mir Penisfotos zu schicken.«
»Ekelhaft«, sagte ich. Typen wie der also. »Hast du deshalb deine Stelle verloren?«
»Genau.« Sie trank aus, hielt den Strohhalm zur Seite und leerte das Glas. »Blöd, wie ich bin, hab ich doch glatt eine Beschwerde bei der Personalabteilung eingereicht. Zwei Jahre unter Beschuss in einem Prozess wegen sexueller Belästigung haben mir zwar ein hübsches Abfindungssümmchen eingebracht, das schon. Aber von da an war ich wirklich bei jedem einzelnen Start-up im Silicon Valley unten durch. Und dann die Trolle – auf Reddit hat jemand aus einem Nachrichten-Spot meinen Namen erraten. Kann nicht schwer gewesen sein, da draufzukommen. Bei Runnr gab es keine Unmengen von Programmiererinnen.«
»Und wie bist du schließlich in L. A. gelandet?«
»Es kam mir wie der beste Ort vor, um unterzutauchen.« Sie schaute in ihr leeres Glas. »Einer von ihnen hat mich geswattet – du weißt, was das heißt, oder? Sie haben ein SWAT-Team zu mir nach Hause geschickt. Ich wurde mitten in der Nacht von einem Haufen bis an die Zähne bewaffneter Typen geweckt, die gegen meine Tür hämmerten. Danach war ich ein Nervenbündel. Ich hab mein Online-Profil gelöscht, damit sie mich nicht wiederfinden konnten, bin ins Darknet abgetaucht. Und hab gemacht, dass ich aus der Stadt raus bin.«
»Warum Schauspielerei?«, fragte ich.
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich hab was gesucht, was möglichst weit weg von der IT-Welt war. Hab mir gedacht, Na gut. Dann schaun wir doch mal, wie das so ist, wenn man mit seinem Aussehen punktet.« Zugegeben, mir imponierte, wie sie das bekannte: offen und ehrlich, ohne die üblichen selbstironischen Gesten. »Ehrlich gesagt, ich war grottenschlecht, aber mit meinem hübschen Gesicht hab ich immer wieder Vorsprechtermine gekriegt.«
Da konnte ich mir einen Anflug von Bitterkeit nicht verkneifen und hob das Glas. »Schön für dich.«
»Es war okay«, räumte sie ein. »Bis ich meinen Ex kennengelernt hab. Der hat jede Chance kaputtgemacht, die sich mir bot, als Schauspielerin weiterzukommen. Er war krankhaft eifersüchtig. Ist ausgerastet, wenn ich bis spät auf einer Party blieb oder gar, Gott bewahre, mit einem Mann sprach. Dabei ist schließlich jeder, auf den es ankommt, männlich, oder? Aber das ist wieder eine andere Geschichte.« Seufzend klapperte sie mit den Eiswürfeln in ihrem Glas. »Kaum waren wir zusammengezogen, fing er damit an, mein Handy zu verstecken, damit ich zu keinem Vorsprechen mehr ging. Hat mich ausspioniert. Und bedroht.« Sie musterte mich forschend, fast so, als wollte sie eine Reaktion aus mir herauskitzeln. Dabei fiel mir auf, dass ihre weit auseinanderstehenden Augen graugrün waren, und was ich anfänglich für Scheu in ihrem Blick gehalten hatte, etwas anderes war, irgendein unbestimmter Hunger.
Dann sagte sie: »Er hat mich nicht geschlagen, wenn du das denkst.«
In meiner Unsicherheit, wie ich darauf reagieren sollte, nahm ich Zuflucht zu Ironie. »Klingt nach ’nem Märchenprinzen.«
»Er hat andere Sachen gemacht. Hat mich in einem schalldichten Raum eingesperrt.« Sie schauderte. »Früher oder später hätte er mir Schlimmeres getan, wenn ich geblieben wäre.«
»Gut, dass du von ihm weg bist«, sagte ich.
Ein Beifallssturm im Nebenraum verriet, dass Toby seinen Auftritt beendet hatte, der Lautstärke nach erfolgreicher als ich. Das Andere Girl wurde vorgestellt, und ich fragte mich unwillkürlich, ob sich der »Geile Titten«-Rufer wieder zu Wort melden würde. Ich stellte mir vor, er hätte draußen nur darauf gelauert, dass eine Frauenstimme aus den Lautsprechern kam.
Ich hielt mein leeres Glas hoch und sagte: »Die nächste Runde geht auf mich?«
Aus der nächsten Runde wurde nahtlos die übernächste, bis ich zu spät und verschwommen merkte, dass ich mich betrank. Nämlich daran, dass ich angefangen hatte, vom Comedy-Wettstreit »Funniest Person in Austin« zu erzählen.
»Es ist albern«, sagte ich. »Noch dazu minimale Erfolgschancen.«
»Garantiert nicht«, sagte sie, so betrunken, dass ihr die Ellenbogen auf der Tischplatte wegrutschten.
Aber es stimmte. Mit meinen Freunden aus der Branche hätte ich es nie so angesprochen – beiläufig, hoffnungsvoll –, weil wir alle gewinnen wollten, was uns allen peinlich war. Doch für Amanda war Stand-up-Comedy Fremdland und ich ihre einzige Führerin. Es war eine Erleichterung, meine lächerlichen Träume einer anzuvertrauen, die nicht ahnen konnte, wie unrealistisch sie waren.
»Jedes Jahr gibt’s diesen großen Wettbewerb im Bat City Comedy Club. Wirklich alle Stand-ups der Stadt machen mit. Es gibt ein Preisgeld.« Der erste Preis betrug fünftausend Dollar, genug für mich, um nach L. A. zurückzuziehen; vielleicht bliebe sogar noch ein kleiner Rest für ein Low-Budget-Comedy-Filmchen übrig. Oder für einen Serien-Pilotfilm, wenn mir bloß die richtige Idee dazu einfiel. Wenn ich gewann, sagte eine leise, aber hartnäckige Stimme in meinem Kopf, würde Jason mich vielleicht wieder als Co-Autorin akzeptieren, und wir könnten das Pilot-Drehbuch zusammen schreiben. »Letztes Jahr hab ich die Anmeldung verpasst«, fuhr ich fort. »Aber dieses Jahr …« Amandas Augen leuchteten auf, und ich fuhr rasch fort: »Nein, es hat eh keinen Sinn. Alle Komiker der Stadt, wirklich jeder, den ich kenne, macht mit.« Und mit einer Geste in Richtung Nebenraum, wo James einen Klagegesang zu seiner Ukulele anstimmte: »In der Jury sind allerdings lauter Branchengrößen aus L. A., New York und Toronto, das heißt, selbst wenn man es nur bis in die Endrunde schafft …« Ich brach ab. Leute, die ich kannte, waren bei Managern und Agenten gelandet, hatten Einladungen zu Festivals und sogar kleine Auftritte in Vorabendserien abgestaubt, nachdem sie einen vorderen Platz belegt hatten. Es erschien mir vermessen, all diese Möglichkeiten aufzuzählen.
Sie musste meinen resignierten Gesichtsausdruck bemerkt haben. »Warum bist du überhaupt hierher zurückgekommen?«
Es hatte reichlich Gründe gegeben, aus L. A. wegzuziehen – unsere Miete stieg und stieg, und mein Kellnerinnen-Job im Diner schlauchte mich –, doch den Ausschlag hatte zuletzt mein katastrophales Meeting mit Aaron Neely gegeben. Neely war das wandelnde Klischee eines ehemaligen Starkomikers mit selbstzerstörerischen Zügen, der nach dem üblichen Aufenthalt in einer Entzugsklinik die unübliche Entscheidung gefällt hatte, auf dem Höhepunkt seiner Karriere die Weichen neu zu stellen und junge Talente zu lancieren. In vier Jahren hatten Jason und ich ein paarmal kurz vor dem Durchbruch gestanden, aber als Jason durch ein mittleres Networking-Wunder das Meeting bei Neely ergatterte, dachten wir, das wär’s, wir hätten den großen Coup gelandet. Wir hatten einander hoch und heilig versprochen, nie ohne den anderen zu einem Meeting zu gehen – solche L. A.-Typen waren wir nicht –, aber als Jason sich vor der Smoothie-Bar, wo Neely wartete, nicht blicken ließ, brachte ich es nicht über mich, mir die Gelegenheit entgehen zu lassen. Nach einem letzten prüfenden Blick auf mein Handy – immer noch keine Nachricht von Jason – ging ich rein, gewappnet mit meinen Prada-Imitat-High-Heels, meinem Diane-von-Furstenberg-Imitat-Wickelkleid und meiner Marc-Jacobs-Imitat-Tasche, um unseren Pilotauftritt allein zu pitchen.
Was dann kam, war schon fast komisch unwirklich: der Smoothie, den Aaron mir an seinem Tisch in einer Nische bestellt hatte, eine rotbraune gequirlte Brühe aus Grünkohl und Roter Bete mit kalkigem Nachgeschmack, zu der ich mir begeisterte Ausrufe abrang, während ich sie runterwürgte. Wie der Barhocker nach der Hälfte der Zeit unter mir wegzukippen schien, die Wände um mich her ins Rutschen gerieten. Das laute Flüstern, offenbar von den Topffarnen, die uns vom Rest der Smoothie-Bar abschirmten, übertönte irgendwann jedes andere Geräusch außer seiner Stimme, die sagte: »Mädchen, du siehst ja schlimm aus, komm, ich bring dich nach Hause.«
Und dann war da natürlich Neely selbst, den ich als Komiker verehrte, mit seiner roten, großporigen Nase und den Riesenpranken. Überlebensgroß. Später, auf dem schwarz gepolsterten Rücksitz seines SUV, hinter schwarz getönten Scheiben, nur noch größer als ich.
Als er mich schließlich zu Hause absetzte, wackelig auf den Beinen, aber erleichtert, dass ich überhaupt gehen konnte, fand ich Jason, dem auch schlecht war, in seinem Elend über die Toilettenschüssel gebeugt vor. Der Blick, den er mir zuwarf, ging mir durch Mark und Bein: so vernichtend und verächtlich wegen meines Vertrauensbruchs, dass ich wusste, er würde niemals über das Vorgefallene sprechen. Und irgendetwas in mir wollte es auch nicht, aus Angst, mich vom Treibsand der Erinnerung auf Neelys Autorücksitz zurückzerren zu lassen. Es reichte zu wissen, dass wir nie eine Zusage zur Show bekommen würden. Ich hatte unseren Pitch eindeutig vermasselt.
Amanda wartete immer noch auf Antwort.
Nach kurzer Pause sagte ich: »Träume sind Schäume – manchmal soll es halt einfach nicht sein. Aber man darf sich davon nicht unterkriegen lassen. Sondern muss zurück auf Anfang, es noch mal versuchen.«
Amanda fixierte mich wieder lange mit ihrem intensiven Blick, der nahtlos von Naivität zu Scharfsinn und wieder zurück zu springen schien, als wären es zwei Seiten einer Medaille. »Bewundernswert«, sagte sie schließlich.
Mit Frauenfreundschaften hatte ich es nicht so. Dem gängigen Geben und Nehmen konnte ich nichts abgewinnen: Wenn du mir dieses Geheimnis anvertraust, verrate ich dir dafür meine heimlichste Unsicherheit. Und immer so weiter. Selbst als Kind war ich einfach nicht interessiert. In der fünften Klasse bildeten sich Grüppchen heraus: Die einen würden groß und hübsch werden, die anderen Streberinnen, wieder andere Jungs hinterherlaufen, noch andere all diese Dinge auf Spanisch tun, das ich nicht spreche, obwohl ich aussehe, als sollte ich das, und nur verstehe, wenn meine Mutter es spricht. Mit Witzigsein kam man in keine dieser Cliquen. Als Jason ein paar Jahre später mit seinen Furz-Witzen und Saturday-Night-Live-Zusammenfassungen aufkreuzte, war ich dankbar, ein für alle Mal vor den komplizierten Pas-de-deux-Tänzchen dieser Mädchengespräche gerettet zu sein.
Doch als ich jetzt spürte, dass Amanda etwas auf Distanz ging, hatte ich noch genügend Erfahrung, um ihr im Gegenzug ein eigenes Geständnis anzubieten. Ich ließ es auf einen Versuch ankommen. »Also eigentlich hab ich zurzeit eine Art Schreibblockade«, hangelte ich aufs Geratewohl nach etwas Erfundenem und merkte erst in dem Moment, als ich es aussprach, dass es stimmte. »Alles in meinem Programm kommt mir irgendwie so tot vor. Manchmal fühle ich mich wie tot.« Diese verdammten Whiskey-Sodas!
Amanda beugte sich vor, mit einem Mal kämpferisch, und umklammerte mein Handgelenk mit ihren spillerigen Fingern. »Hör zu, Dana«, sagte sie. »Ich weiß, wie es ist, wenn man aus der Stadt verjagt wird, sein Einkommen verliert, seine Selbstachtung, einfach alles. Ich hab mich von meinem Ex einsperren und mir einreden lassen, ich wäre nichts wert. Dabei sah er nicht mal gut aus.« Sie gluckste leise vor sich hin, aber es klang verbittert und unschön. »Ich hätte ihn keines Blickes gewürdigt, wenn ich mich nicht innerlich tot gefühlt hätte. Aber ich bin nicht tot. Ich bin noch da. Genau wie du.« Ihr betrunkener Blick funkelte, und ihre Knöchel drückten in meinen Handwurzelknochen. »Was auch immer dir in L. A. passiert ist, du bist nicht tot. Der dir das angetan hat, sollte sich so fühlen, nicht du.«
»Nichts ist mir in L. A. passiert«, sagte ich und löste sanft ihre Finger.
Sie ließ mich los und zog sich etwas zurück, als käme sie zur Besinnung. Dann sah sie mein Handgelenk an, das ich mit der anderen Hand rieb, und lachte, dieses kurze Bellen, das ich während meines Auftritts gehört hatte, wie ein Fuchs. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück.
»Na klar«, sagte sie grinsend. »Ich wüsste bloß gern, wer dieser Nichts ist, damit ich ihn finden und ihm für dich die Kniescheiben zertrümmern kann.«
Erster Punkt an die Wörtlichnehmerin. »Ich könnte es dir sagen, aber dann müsste ich dich töten.«
»Darauf lasse ich’s ankommen.«
Plötzlich ließ meine innere Anspannung nach, und ich hatte es satt, mich zu verstellen. »Ich hab ’ne bessere Idee. Wie wär’s damit: Während du diesem Nichts die Kniescheiben brichst, stöber ich deinen Ex-Freund auf und schlag ihn zusammen?«
»Das wär doch mal was für den Anfang«, sagte sie. »Aber ich warne dich, wenn du nach Typen zum Zusammenschlagen suchst, ich hab eine lange Liste.«
»Ich zeig dir meine, wenn du mir deine zeigst.«
»Abgemacht.«
Ich hob das Glas. Wir stießen an und nahmen synchron einen Schluck. Ich hörte, dass Fash im Nebenraum mit seinem Auftritt ans Ende kam, und die Komiker-Kollegen, die als Zuschauer geblieben waren, sammelten sich, um weiterzuziehen – wahrscheinlich ins Bat City zum Late-Night Open Mic. Jeden Moment konnte einer von ihnen den Kopf zur Tür hereinstecken und fragen, ob ich mitkäme. Wenn ich mich davor drücken wollte, ihnen Amanda vorzustellen, war jetzt Zeit zum Aufbruch.
»Hey, es war echt nett, dich kennenzulernen«, sagte ich. »Das war kein leichter Auftritt. Und jetzt fühle ich mich schon…«, mit einer Hand auf dem Herzen, »viel betrunkener.« Sie lachte. »Aber im Ernst, danke.« Und als mir einfiel, was ich aus Karrieregründen nicht versäumen durfte, ergänzte ich noch rasch: »Wenn du wissen möchtest, wann ich hier in der Stadt auftrete, kannst du mir auf Facebook folgen.«
»Ich halt mich fern von Social Media«, sagte Amanda. »Nenn mich paranoid, aber seit meiner Zeit bei Runnr weiß ich, was die mit den Daten anstellen. Gibst du mir stattdessen deine Nummer?« Sie schob eine Serviette zu mir rüber und reichte mir einen Stift.
Nach kurzem Zögern sagte ich: »Klar.« Ich notierte rasch meine Telefonnummer und stand auf. Als ich ihr den Kuli zurückgab, fiel mir eine weitere Idee für einen Pilotfilm ein: Gescheiterte Komikerin erstellt den Instagram-Auftritt eines erfundenen Lifestyle-Gurus. Der Account geht viral. Die Komikerin muss den Rest ihres Lebens Ernsthaftigkeit vortäuschen. Ich wandte mich zum Gehen.
»Viel Glück für den Wettbewerb nächste Woche«, rief sie mir hinterher.
»Du meinst Hals- und Beinbruch«, sagte ich reflexartig.
»Nur bei jemand anderem.«
Ich registrierte ihren zweiten lahmen Versuch, einen Witz zu reißen, und gluckste zur Antwort leise vor mich hin. In dem Moment schien es mir möglich, dass sie, wenn schon kein Fan, so doch etwas werden könnte, was ich noch mehr brauchte: eine Freundin.
2
Als ich am nächsten Morgen spät und verkatert aufwachte, eilte ich zu meiner Frühschicht in Laurel’s Schreibwaren und Geschenke und hätte mir fast mit der flachen Hand gegen die Stirn geschlagen, als ich die vielen Autos auf dem Parkplatz sah. Ich hatte die Belegschaftsversammlung vergessen. Ich schloss auf und hastete an den Warenregalen voller Briefpapier und Notizbüchern mit Goldschnitt vorbei.
Gleich nach meiner Rückkehr aus L. A. hatte ich als Kundin bei Laurel’s vorbeigeschaut, in der Hoffnung, ein besonders schickes Notizbuch könnte mich wieder zum Schreiben inspirieren, und dann am Ende doch wieder das gleiche Moleskine im Taschenformat gekauft, das ich benutze, seit es das erste Mal in Amarillos einzigem Barnes & Noble neben der Kasse aufgetaucht war. Doch an dem Tag stand Laurel, eine gedrungene, hippiehafte Frau Ende fünfzig, zufällig selbst im Laden. Ich brachte sie zum Lachen, als sie meinen Einkauf kassierte, und dann kamen wir in ein langes Gespräch, das mit ihrer Frage endete, ob ich nicht Lust hätte, bei ihr zu arbeiten. So leicht war es mir noch nie gemacht worden, irgendwo angeheuert zu werden. Damals bestärkte es mich in meiner Überzeugung, dass Austin nicht nur ein lebenswertes Pflaster, sondern auch genau das Richtige für mich zur Erholung von L.A war.
Es heißt, Verkauf sei langweilig, aber mir machte es nichts aus. Nach all den Jahren als Kellnerin wollte ich mir nie wieder eine Schürze umbinden müssen, und in diesem Laden voll mit überflüssigen Luxusartikeln schienen die Tage in einem schier unglaublich gemächlichen Tempo zu vergehen. Gerade das Zweckfreie des Warenangebots sagte mir zu, und auch, wie gemütlich die Kunden sich durch den Laden treiben ließen, sich ohne feste Vorstellung nach etwas wie einem Geschenk zu einer Einweihungsparty umsahen oder einem Packen Dankeskärtchen. Nie platzte jemand zur Tür herein, der etwas Dringenderes brauchte als eine Geburtstagskarte.
Leider wurden wir dank Laurels Gutmütigkeit beim Einsammeln verirrter Seelen seit Neuestem von Becca heimgesucht, einem unterjochten, verhuschten Strich in der Landschaft, die Augenbrauen zu einem Ausdruck permanenter Überraschung gezupft, samt Freund Henry, einem selbst ernannten »Einzelhandels-Identitätstherapeuten« mit tätowierten Armen und sorgfältig gehegtem Dreitagebart. Henry, der es verstand, eine Spätfünfzigerin mit Charmeoffensiven zu ködern, hatte sich im Handumdrehen in eine Beraterposition eingeschleimt, um den Laden groß rauszubringen. Die neuen Waren, die er bestellt und zwischen den älteren Zeitschriften und Karten aufgebaut hatte, waren Objekte, die – in seinen Worten – »eine Geschichte über ihre Herkunft erzählten«. Die richtige Geschichte sollte zwar an Behaglichkeit, nicht aber an Luxus denken lassen; Charakter, aber keine negativen Schwingungen transportieren, Kargheit, aber beileibe kein Elend. In die Auswahl schafften es handgewebte farbenprächtige Tischsets von indonesischen Frauen (eigentlich Nonnen, aber Henry meinte, die würden die Leute zu sehr an Religion erinnern) sowie schwere Steinkuben, die laut Schildchen das Ding-an-sich repräsentierten. Minimalistische Schalen aus mattem gehämmertem Silber wurden mit Halstüchern aus geflochtenem und zerzaustem Zwirn befüllt. Selbstredend war all der Kram höchst unerschwinglich. Die Witze drängten sich einem geradezu auf. (Pilotfilm-Idee: Verzauberter Geschenkeladen, in dem alle Geschenke reden können, aber sie sind noch widerlichere Arschlöcher als die Menschen. Mittelding aus Wonderfalls und Andersens Märchen.) In der ganzen Stadt lag so etwas gerade im Trend, und ich konnte mir nur denken, dass die steigenden Mieten, die die alteingesessenen Nachbarn des Ladens zum Auszug gezwungen hatten, Laurel, der ihr Lädchen seit ewigen Zeiten gehörte, nervös gemacht hatten. Oder vielleicht appellierte dieses ganze Authentizitäts-Gewäsch an ihre Hippie-Seele. Wie auch immer, Henry war ein lästiges Anhängsel eines Jobs, der mir ansonsten ideale Gelegenheiten bot, unter der Ladentheke mein Notizbüchlein vollzuschreiben.
Als ich die Tür zum Pausenraum öffnete, dozierte er bereits ungebremst und machte sich am Tisch so breit, dass sich der Rest der Belegschaft, ausschließlich Frauen, nur mit Mühe drum herum quetschen konnte. Ein starker Geruch nach gebratenen Eiern mit Speck erinnerte mich, nicht nur angenehm, an meinen Kater, auch wenn ich aus der zerknüllten Papiertüte und den hie und da verstreuten leeren Salsa-Näpfchen schloss, dass mir die Frühstücks-Tacos ohnehin entgangen waren.
»Ach, hallo, Dana«, sagte Laurel, während ich mich um die Tür herumwand, um sie zu schließen. »Henry hat uns gerade erklärt, dass wir mehr als bloß irgendein Laden sein werden. Nämlich ein – äh –« Sie warf ihm einen unsicheren Blick zu.
»Ein Markenzeichen für begehrten Lifestyle«, warf Henry lässig ein. »Was damit anfängt, dass sich alle im Team zu Pünktlichkeit verpflichten.«
Ich musste mich beherrschen, nicht die Augen zu verdrehen, während er weiterschwafelte. Henrys Objekte mit ihrer zwanghaften Authentizität waren mir ein Gräuel. Die Vorstellung, dass indonesische Nonnen, japanische Töpfer und salvadorianische Bauern in ihren entlegenen Bergdörfern hockten und sie fabrizierten, erschien mir unsäglich deprimierend. Als sich das Team zerstreute, ertappte ich mich bei dem Wunsch, die Geschichten all dieser Dinge seien frei erfunden, in Wirklichkeit handele es sich um Waren aus chinesischer Massenproduktion. Na, wenn das mal kein guter Gag wäre.
»Hochstapler«, murmelte Ruby mir zu, als ich mir später Notizen machte. Sie stand dicht neben mir hinter der Theke, Henry und Becca fest im Blick, die sich auf dem Parkplatz zankten, und riss verbissen die weißen Preisaufkleber von den Füllern, um Platz zu schaffen für die neuen, von Henry verordneten Leinen-Preisetiketten. »So was riech ich auf Meilen gegen den Wind.«
Ruby faszinierte mich. Etwa zehn Jahre älter als ich, kam sie Tag für Tag in der perfekten Version eines Fünfziger-Jahre-Sekretärinnen-Outfits zur Arbeit: Etuikleider mit Schleifchen an der Taille, Bleistiftröcke und Blusen mit Bubi-Kragen, eine smaragdgrüne Schmetterlingsbrille an einer Halskette. Ihre festgesprayten Locken waren kurz und rot, und es dauerte lange, bis ich dahinterkam, dass sie eine Perücke trug. Eines Tages zog sie einen Bleistift hinter dem Ohr hervor, und ich sah, dass alle Locken gleichzeitig verrutschten, bloß um ein paar Millimeter, aber flächendeckend. »Ich hatte einfach die Nase voll von miesen Haarschnitten«, erklärte sie mir, als sie bemerkte, dass ich es bemerkt hatte, und ich wartete, bis sie nach hinten gegangen war, um es mir wortwörtlich aufzuschreiben.
»Ich weiß ehrlich nicht, was Becca an dem Scheusal findet«, sagte Ruby gerade. Sie beugte sich zu mir rüber und flüsterte: »Glaubst du, er schlägt sie?«
Das riss mich aus meinen Tagträumen. »Wie kommst du darauf?«
»Ich weiß nicht, hab da nur so ein Gefühl«, sagte sie. »Ist dir nicht aufgefallen, dass sie immer blaue Flecken an den Armen hat?«
»Nein«, sagte ich.
»Tja, das kommt, weil sie langärmlige Sachen trägt. Sogar im Sommer.« Vielsagend zog sie die aufgemalten Augenbrauen hoch.
»Wir haben noch Frühling«, erklärte ich, was sie mit einem Schulterzucken quittierte. Sie war eine unverbesserliche Klatschtante und noch dazu paranoid, doch bei dem Gespräch fiel mir Amanda wieder ein. Nachdem ich eben noch Henrys Objekte in Gedanken geächtet hatte, stellte ich mir jetzt die hochgewachsene, schlanke Frau vom Vorabend in ihrer Lederjacke vor, wie sie an den Verkaufsregalen stand, Dinge in die Hand nahm und wieder zurückstellte, die kleinen japanischen Keramikanhänger vor ihrem Gesicht hin- und herpendeln ließ und die Duftkerzen auf der Handfläche wog. Etwas an ihr ließ mich vermuten, dass sie sich deren Geschichten sehr wohl anhören konnte. Ich errötete.
»Gestern Abend im Nomad hab ich so eine seltsame Frau kennengelernt«, sagte ich. »Sie ist nach meinem Auftritt angekommen.«
»Hört sich nach einem neuen großen Fan von dir an«, sagte Ruby. »Sieh dich bloß vor.«
»Na klar, ich halt meinen Vorschlaghammer unter Verschluss«, sagte ich. »Nein, sie war eigentlich echt nett. Wir haben festgestellt, dass wir einiges gemeinsam haben.«
»Die Leute kommen nach deinen Auftritten doch sicher ständig an und wollen mit dir reden?«
»Ach, bloß so etwa ein Dutzend pro Abend«, sagte ich mit unbewegter Miene. »Normalerweise kann ich damit umgehen.« Ich kritzelte weiter in mein Notizbuch.
Ruby riss noch ein Preisschild ab und sah mich an. »Was war seltsam an ihr?«
»Hä?«
»Du hast gesagt, sie war seltsam.«
»Hab ich?« Ruby sah mich herausfordernd an, und ich gab nach. »Was du über Becca gesagt hast, hat mich an sie erinnert.« Was genau? »Diese Frau hat mir von ihrem Ex-Freund erzählt, und sie hat gesagt: ›Er hat mich nicht geschlagen.‹ Einfach so.«
»Dann hat er sie definitiv geschlagen«, sagte Ruby lebensklug.
»Es kam mir einfach seltsam vor, einer völlig Fremden so was auf die Nase zu binden.«
»Die wird Probleme mit Abgrenzung haben. Ich hatte selbst heftige Abgrenzungsprobleme, weil ich als Kind missbraucht wurde.« Ich hatte mich an derlei verstörende Enthüllungen von Ruby gewöhnt, wusste aber trotzdem nie, wo ich hinsehen sollte. Diesmal hielt ich den Blick aufs Notizbuch gesenkt. »Mein Therapeut sagt, dass ich damit umgehe, indem ich kontrolliere, was in meiner Macht steht. Also etwa das hier.« Sie zeigte auf ihre falsche Frisur, und ich nickte, als leuchtete es mir vollkommen ein. »Aber da muss man aufpassen. Die Dinger können einem regelrecht die Persönlichkeit verändern. Eine Perücke, die ich mal getragen hab, so ein Bob à la Louise Brooks, hat mich ziemlich gemein gemacht … so was von fies …«
Mich juckte es in den Fingern, mir Notizen zu machen, aber Ruby plapperte weiter, bis mein Handy unter der Theke summte. Plötzlich hatte ich eine Vorahnung, dass es Amanda war, als hätte ich sie mit der Kraft meiner Gedanken angelockt. Abergläubisch ließ ich es vibrieren und horchte nach dem Eingang einer Mailbox-Nachricht, ehe ich einen Blick auf das Display warf.
Meine leichte Enttäuschung schluckte ich runter. Es war Kim, die andere Komikerin im Donnerstagabendprogramm. Insofern als jede Komikerin eine Masche hat, war ihre die übliche: blond, dünn und irgendwie vulgär-sexy, mit hoher Babystimme und losem Mundwerk. An solchen Abenden war ich immer die einzige Latina neben der einen oder anderen Kim. Ich nahm das nicht persönlich. Es war nicht mehr so schlimm wie damals, als ich weggezogen war, aber absurderweise trug genau das zum Problem bei. In Austin hatte es immer eine bemerkenswerte lateinamerikanische Comedy-Szene gegeben, doch die wurde von Männern dominiert. Außerdem hatte ich als Halbmexikanerin, Halbjüdin, die kein Wort Spanisch konnte, nie so richtig dazugehört. Meine Mutter hatte mir zwar ihren Nachnamen vermacht, aber versäumt, mir ihre Sprache beizubringen; sie hatte dem Ärger über meinen Vater Luft gemacht, ohne ihre Ambitionen aufzugeben, dass ich mich perfekt anpassen und Amarillo irgendwann hinter mir lassen würde. Es hatte funktioniert: Ich war abgehauen. Und die von teigigen Weißen angeführte Comedy-Szene hatte für mich auch funktioniert – wahrscheinlich weil mein bester Freund einer von ihnen war. Während meines L. A.-Aufenthalts war die Szene zwar bunter geworden, aber bei meinem Geschick in diesen Dingen hatte ich es irgendwie geschafft, Austin genau zum falschen Zeitpunkt zu verlassen, sodass ich nichts mehr davon hatte. Ich hatte die Gelegenheit verpasst, auf dem Weg nach oben Beziehungen zu knüpfen, und nichts von den Vorteilen der neuen Szene abgegriffen; traf jetzt nur auf härtere Konkurrenz durch eine Newcomer-Schwemme.
Als ich mir Kims SMS ansah – sie wünschte mir Hals- und Beinbruch im Wettbewerb und bot sich als Sparringpartnerin an, falls ich neues Material ausprobieren wollte –, ging mir nicht zum ersten Mal, aber mit neuer Vehemenz auf, wie einsam ich hier in Austin war. Zu Komikerinnen wie Kim wahrte ich Distanz, mied die Biere vor einem Auftritt und die Stammtischtreffen danach. Erst recht galt das für Männer. Sie waren in Ordnung, alle mehr oder weniger wie Fash. Doch da ich nicht mit ihnen schlafen wollte, wusste ich, dass ich höchstens auf eine Rolle als Maskottchen hoffen durfte, ihr kleiner, süßer, brauner weiblicher Kumpel, den man im Suff so toll hochheben und durch die Luft schwenken konnte. Nein, danke. Mir fehlte Jason zu sehr, als dass ich diese Figur für irgendjemand anderen als ihn spielen wollte.
Meine Mutter sagte immer, ich müsse meinen Sinn für Humor von meinem Dad haben, an den ich mich verschwommen als an einen haarigen, neckischen Spaßvogel erinnerte, der mir ständig zuzwinkerte und so tat, als risse er sich den Daumen ab, um mich zum Kichern zu bringen. Dabei hatte meine Mom mir mein erstes Witzbuch gekauft, irgendwann nachdem er uns verlassen hatte. Sie hatte damit angefangen, samstagsvormittags zu Garagenverkäufen zu gehen, stand in aller Herrgottsfrühe auf, um die Nachbarschaft abzugrasen, und kam häufig mit Stapeln gebrauchter Erstlesebücher mit Eselsohren für mich wieder. In einem dieser Stapel steckte ein schmales orangefarbenes Taschenbuch mit dem schönen Titel 101 ausgeflippte, saukomische, total verrückte Witze für Kinder von acht bis zehn.
Die meisten Witze waren erbärmliche Kalauer, aber einen gab es, der mich seither begleitet. Er ging ungefähr so:
Kommt eine Motte zum Psychiater und legt sich auf die Couch.
PSYCHIATER: Also, wollen wir vielleicht damit anfangen, dass Sie mir ein bisschen was von sich erzählen?
MOTTE: Tja, Herr Doktor, ich habe eine Frau, zwei Kinder und ein nettes Haus mit Doppelgarage am Stadtrand.
PSYCHIATER: Und wie geht es Ihnen damit?
MOTTE: Ganz gut so weit.
PSYCHIATER: Irgendwelche Probleme?
MOTTE: Nö.
PSYCHIATER: Sie sind also vollkommen zufrieden mit Ihrem Leben?
MOTTE (überlegt): Ja, kann man so sagen.
PSYCHIATER: Und was führt Sie dann zu mir?
MOTTE: Das Licht war an.
Die dazugehörige Zeichnung habe ich noch heute vor Augen, bis zum letzten Federstrich: Die Motte, aufrecht stehend mit einem Karikatur-Filzhut auf dem Kopf, hält eine Aktentasche in einem ihrer behaarten Insektenbeine und schüttelt dem Psychiater mit einem anderen die Hand, während im Hintergrund die mysteriöse Couch aufragt. Alles, was ich über den Aufbau von Witzen lernte, lernte ich von dieser albernen Motte. Ausgangslage: zwei Dinge, die nicht zusammenpassen (Motte und Psychiater). Steigerung: die Dialogzeilen in der Mitte, die einen vergessen lassen, dass es sich um eine Motte handelt. Pointe: die plötzliche Erinnerung.
Wie ich später feststellen sollte, kursiert der Mottenwitz in tausenderlei Varianten: Die Motte geht in eine Kneipe, bestellt sich aber nichts zu trinken; in ein Fitnessstudio, benutzt aber keine Geräte; zu einem Autohändler, kauft aber kein Auto. Irgendwann wird sie gefragt, warum sie da ist, und die Antwort lautet immer gleich: Das Licht war an. Der Witz wiegt einen in der trügerischen Hoffnung, diese eine Motte könnte nur dieses eine Mal anders sein. Was aber nie zutrifft. Im Grunde genommen ist es ein Witz übers Witzeerzählen: Comedians sind keine fröhlichen Menschen. Wir streben zum Licht, ohne zu wissen, warum.
Als ich mein eigenes Programm zusammenstellte, versuchte ich mir den Autor von 101 ausgeflippte, saukomische, total verrückte Witze für Kinder von acht bis zehn vorzustellen. Ich sah einen armen Kerl vor mir, der in einem düsteren New Yorker Apartment an der Schreibmaschine saß, neben sich einen Haufen Papierservietten, die er von seinen Freunden im Suff mit ihren Lieblingswitzen hatte beschreiben lassen, allesamt zu unanständig für ein Kinderbuch. Vielleicht ging er am Ende, als der Abgabetermin schon überzogen war und er noch einen ganzen Haufen solcher Witzbücher abzuliefern hatte, in die Bücherei und griff sich einen Stapel noch etwas älterer Witzbücher, in dem er schließlich den in Ehren ergrauten Mottenwitz fand. Und dann, weil es schon spät war und er gerade mit seiner Freundin einen Woody-Allen-Film gesehen und sich womöglich hinterher mit ihr gestritten hatte, verlegte er seine Version des Witzes in das Sprechzimmer eines Psychiaters, obwohl es zu den dringendsten Anliegen unserer Gesellschaft gehört, dass Acht-bis Zehnjährige so wenig wie möglich über die Tätigkeit eines Psychiaters erfahren.
Ich wusste damals nicht mal, wie das Wort ausgesprochen wurde, geschweige denn, was es bedeutete. Doch das eine wusste ich: Was auch immer die Motte behauptete, Dinge wie Frau, Kind und Doppelgarage machen keinen Menschen glücklich. Das wusste ich, weil mein Dad all das gehabt hatte und doch ausgeflogen war, einem Licht nach, und mich allein mit meiner Mom in Amarillo zurückgelassen hatte.
Allein – und dann kam Jason.
Wir lernten uns in der achten Klasse in Amerikanischer Geschichte kennen. Wir hatten beide an dem Tag gefehlt, als die Arbeitsgruppen für ein großes Projekt gebildet wurden, und weil alle anderen schon zugeteilt waren, mussten wir zu zweit zurechtkommen. Erst ärgerte ich mich, weil ich auf Anhieb erkannte, dass die ganze Arbeit an mir hängen bleiben würde – Wissenswertes über Geronimo recherchieren und aufschreiben, einen großen Karton mit ordentlichen Druckbuchstaben beschriften –, während dieser dunkelhaarige schlaksige Kerl über sein Notizheft gebeugt dasaß und still vor sich hin kritzelte. Aber als ich ihm über die Schulter spähte, um mir die Zeichnung anzusehen, durchfuhr es mich: David Letterman, seine abgeflachte Neandertaler-Stirn und das hämische Grinsen selbst in karikierter Form erkennbar.
Jason sah auf, bemerkte meinen Gesichtsausdruck und wackelte wie Letterman mit den Augenbrauen. »Na, was sagst du dazu, Paul? Hi-hie!«
Es war so eine perfekte Imitation des Letterman-Kicherns und so unvereinbar mit Jasons pickeligem Brillengesicht, dass ich mich fast vor Lachen weggeschmissen hätte. Stattdessen zog ich meine beste Paul-Shaffer-Miene und sagte: »Nicht schlecht, Dave, nicht schlecht.«
So ging es eine Zeit lang zwischen uns hin und her, bis wir genug hatten.
»Welches ist dein Lieblings-Stupid Pet Trick?«, fragte ich.
»Weiß nicht, bin noch nicht durch.«
»Durch?«
»Ich seh mir jede Folge auf YouTube an. Bin erst bis 1987 gekommen.« Den Blick, den ich ihm zuwarf, deutete er falsch. »Ich wär schon weiter, wenn ich mich nicht dauernd unterbrechen und Sachen aus dem Monolog googeln würde.«
»Wow«, war alles, was ich herausbrachte. »Wen magst du sonst noch?«
»Conan.«
»Logisch. Und was ist mit den Neuen? Sarah Silverman?« Er verzog das Gesicht. »Maria Bamford?«
»Die ist gut. Aber ich lerne erst mal von den Klassikern«, sagte er wichtigtuerisch. »Den großen Late-Night-Moderatoren. Um eines Tages Gagschreiber beim Fernsehen zu werden.«
»Warum nicht selbst Moderator? Das hab ich vor.«
»Late-Night-Shows werden nie von Frauen moderiert.« Das sagte er im Ton tiefsten Bedauerns, mir die schlechte Nachricht überbringen zu müssen.
»Eine muss schließlich die Erste sein.«
»Oh, wie bescheiden«, sagte er. »Das gefällt mir an dir, Dana Diaz.«
So fing alles an. Natürlich konnten wir in der Schule nichts zusammen machen, ohne »Der geht mit der«-Hänseleien auf uns zu ziehen, aber wir wussten, wer wir waren und was wir einander zu bieten hatten. Im Sommer nach der Achten fing er an, mich zu sich einzuladen, um Aufnahmen von Comedy-Sondersendungen aus Late-Night-Kabelfernsehshows zu gucken, und ich ging unter den abstrusesten Vorwänden hin. Luxusgüter wie Kabelfernsehen und Videoaufnahmen waren bei uns eine Seltenheit, seit mein Vater fort war, und verschwanden völlig, nachdem meine Mutter von der mittlerweile privatisierten Heliumfabrik entlassen worden war. Jason hatte den Fernseher in Matties altem Zimmer, das ihr Vater zu einem Hobbyraum mit Billardtisch und Spielkonsole umgebaut hatte, meist für sich allein.
Mattie war der einzige Haken an der Sache. Jasons älterer Bruder hatte die Highschool abgebrochen und wohnte noch zu Hause. Er sah wie eine Ausgabe von Jason aus, die jemand ohne großes künstlerisches Talent aus dem Gedächtnis hingeworfen hatte: Das schwarze Haar hing ihm platt über die niedrige Stirn, die blauen Augen blinzelten schief über einer einmal gebrochenen Nase. Er war zwar kaum größer als Jason – vielleicht sogar einen Zentimeter kleiner –, aber breitschultriger, jedenfalls erweckte seine Haltung diesen Eindruck. Er schikanierte Jason, doch vor allem hing seine Unberechenbarkeit wie eine düstere Wolke über dem Haus. Seine Freizeit verbrachte Mattie hauptsächlich damit, seinen beängstigend großen Schäferhund Kenny auszuführen und Gewichte zu stemmen in dem verrauchten, vollgestopften Apartment, das ihr Vater ihm zähneknirschend in der Garage hergerichtet hatte, nachdem Mattie von Drogen weggekommen war und angefangen hatte, als Gabelstaplerfahrer in einem Fleischverarbeitungsbetrieb zu arbeiten. Doch ab und zu ließ er sich in der Tür zum Fernsehzimmer blicken – »Na, du Schwuli, hab nicht gewusst, dass du da bist« –, dann hatte ich den Eindruck, dass Jason sich vor ihm duckte. Sobald Mattie mich sah, glotzte er mir unverschämt auf den Busen, und ich musste mich zusammenreißen, nicht die Arme davor zu verschränken.
Auch Jason schielte manchmal heimlich nach meinem Busen, und eine Zeit lang erwartete ich, dass er mich um ein Date bitten würde. Doch dazu kam es nie, und irgendwann rechnete ich nicht mehr damit und hatte weniger Schuldgefühle, wenn ich meiner Mom etwas über Jasons meist sturmfreie Bude vorschwindelte. Ich radelte zu ihm rüber, während sein Vater noch bei der Arbeit war – seine Mutter hatte sich genau wie mein Vater schon längst abgesetzt –, dann gingen wir direkt ins Fernsehzimmer und ließen uns nebeneinander im flackernden Zwielicht des Bildschirms auf zerknautschten Sitzsäcken nieder. Wie jede gute Motte sagte ich mir, dass ich nur zum Licht wollte.
3
Die unspektakuläre Lage des Bat City Comedy Clubs im Winkel einer Ladenzeile im Norden der Stadt entsprach ganz und gar nicht seiner zentralen Bedeutung für Austins Comedy-Szene. Überschattet von einer Hochstraße, flankiert von Outlet-Läden und Tanzstudios, hielt er mit gewissem Trotz die Fahne des an sich bereits aberwitzigen Stand-up-Geschäfts hoch, inklusive Neonschilder, einer komplett in den Grundfarben gehaltenen Bar und eines Festsaals mit flächendeckender Auslegware, neckisch gemustert mit Komödien-Tragödien-Masken. Man könnte zwar meinen, dass die Deko nicht unbedingt zu einem Comedy-Club passte, doch ich hatte beim Warten auf meine Open-Mic-Auftritte lange genug das scheußliche Geschnörkel aus Schleifen und Grimassen betrachten müssen, um seine ernüchternde Botschaft in mich aufzunehmen, eine Art Memento mori des Stand-ups: Denk dran, schlag ein wie eine Bombe.
Am Abend der ersten Runde im »Funniest Person in Austin«-Wettbewerb fuhr ich, ganz nach E-Mail-Anweisung, mit meinem stoßstangenlosen Honda Civic bis an die geschlossenen Geschäfte am anderen Parkplatzende heran und wünschte, ich hätte vor Jahren den Mut zur Teilnahme aufgebracht, als der Andrang noch nicht so groß gewesen war. Ich kannte nur etwa die Hälfte der Namen dieses Abends – darunter allerdings auch, was mir einen Stich versetzt hatte, Fash Banner, den Vorjahresdritten. Natürlich gab es für uns beide Luft nach oben, doch wenn die Newcomer etwas taugten oder wenn ich es so in den Sand setzte wie letztens … Ich schob den Gedanken beiseite. Als ich vor zehn Jahren das erste Mal von Amarillo nach Austin gezogen war, weil Jasons Berichte von einem quirligen Nachtleben und jeder Menge Open Mics mich von Leerlauf und Selbstmitleid im Haus meiner Mutter weggelockt hatten, war der Wettbewerb noch klein und etwas für Eingeweihte gewesen, bloß ein, zwei Wochen mit Auftritten befreundeter Kontrahenten, die sich gegenseitig anfeuerten und auf die Schulter klopften. Jetzt gab es Vorausscheidungen ohne Ende, jeden Abend, wochenlang, und das Halbfinale zog sich eine ganze Woche lang hin.
Natürlich hatte ich mich damals leichter einschüchtern lassen. Jasons Collegefreunde hatten seinen komischen kleinen Sidekick aus der Heimat zwar freundlich aufgenommen, aber ich war vor ihnen schüchtern und gehemmt gewesen, mir peinlich bewusst, dass ich auf ein Community College ging, weil ich es nicht so wie die anderen auf die University of Texas geschafft hatte. Und obwohl Jason mich zu Open Mics mitschleifte und nicht müde wurde, mir zu versichern, dass ich als Stand-up besser sei als er, sollte es lange dauern, bis ich ihm das abnahm.
Stand-up-Comedy war immer mein Ding gewesen, aber wie alle anderen in der Szene von Austin hatte ich damals querbeet dies und das ausprobiert. Mit unseren wenigen Auftrittsmöglichkeiten gingen wir in Impro-Kurse, schrieben Sketche, nahmen Nebenjobs in städtischen Theateraufführungen an, bis wir endlich unsere Nische fanden, wie die bunten Einsteckformen in einem dieser Baby-Puzzles in Arztwartezimmern. Die Optimisten blieben bei Impro, sie machten sich nichts aus Ruhm und schlugen sich mit unerträglich positiven Gute-Laune-Sprüchen durchs Leben. Die Größenwahnsinnigen schrieben Gags und Sketche und hielten an der Hoffnung fest, eines Tages käme jemand daher und würde sie für eine der großen Late-Night-Shows im Fernsehen engagieren. Manche Leute meinten, dass es die Masochisten zum Stand-up hinzog, aber dagegen führte ich ins Feld, dass wir bloß Realisten waren: Wenn man floppte, wusste man wenigstens, an wem es lag.
In durch und durch realistischer Stimmung taxierte ich die Teilnehmer, die nervös unter dem Vordach auf und ab gingen. Ich hatte auf scharenweise Neulinge gehofft – jeder konnte sich zur Vorausscheidung anmelden –, doch in meinen Augen sahen alle einfach wie Komiker aus, die einander rauchend zu ignorieren versuchten, während sie ihre Fünf-Minuten-Sets durchgingen. Der Bühnenplan, der an der Tür hing, war mein erster Glücksbote des Abends: Ich kam in der zweiten Hälfte der Show dran, aber Gott sei Dank nicht als Letzte. Und Fash – der Ärmste! – war Erster. Meine Anspannung legte sich.
Ich ließ die nervösen Auf-und-ab-Geher hinter mir und ging drinnen an die Theke, um Ruhe bemüht mithilfe meiner Kopfhörer, eines Gin Tonics und eines bewusst von den Bildschirmen, auf denen das Bühnengeschehen live übertragen wurde, abgewandten Platzes. Angefangen mit Fash, absolvierten die Teilnehmer vor mir der Reihe nach ihre Auftritte. Die Erfolgreichen hingen danach an der Theke ab und hackten genauso intensiv aufeinander herum wie auf den Eiswürfeln in ihren Drinks; wer gefloppt war, schlich sich niedergeschlagen auf den Parkplatz hinaus. Ein schlaksiger Typ, den ich vom Open Mic in einem Coffeeshop wiedererkannte, hämmerte bei seinem Abgang mit beiden Händen gegen den Chrom-Sperrriegel an den Türflügeln und stieß einen Fluch aus, für mich dank meiner Beyoncé-Power-Playlist lautlos.
Fash, der sich früh von seinem Auftritt erholt hatte und an einem Kneipentisch in der Nähe saß, zog eine Augenbraue hoch und machte mir Zeichen, ich solle die Kopfhörer abnehmen. Er deutete zur Tür, die noch vom Schlag zitterte. »Hey, die Hauptsache ist doch, dass wir da oben Spaß haben, oder?«
»Red dir das nur weiter ein, Fash.«
»Wollte dich bloß aufmuntern!«, antwortete er. »Schließlich kann nicht jeder hier von sich behaupten, die drittkomischste Person Austins zu sein.«
»Was ist noch mal mit Nummer eins und zwei passiert?«, sagte ich mit gerunzelter Stirn. »Ach ja, die sind nach L. A. gezogen. Bei Bronze ist das wohl nicht drin.«
Er mimte den Getroffenen und zeigte auf mich. »Peng. Echt. Voll ins Schwarze.«
Ich kehrte lächelnd zu Beyoncé zurück. Warum sollte ich mich von Fash irremachen lassen? Mein Material war vielleicht nicht brandneu, aber ich kannte es in- und auswendig. Ich hatte Komiker gesehen, die wegen zusammengebissener Zähne, eines zuckenden Augenlids oder einer hartnäckigen Stirnfalte mit darunter manisch grinsendem Mund gefloppt waren, aber Nervosität war in letzter Zeit nicht mein Problem. Sondern dass ich meine Auftritte wie im Schlaf abspulte. Doch hier wurde ich vom Hauch möglicher Berühmtheit in der Luft aufgeweckt, und der Wettbewerb ließ meinen Adrenalinspiegel ansteigen wie ein scharfes Messer an der Kehle. Als es Zeit für meinen Auftritt war, war ich bereit.
Im Scheinwerferlicht atmete ich den Geruch verschwitzten Metalls vom eingedellten Mikrofon ein und wurde endgültig wach. In der Vorausscheidung hatte ich kein so großes Publikum erwartet, aber die langen Tischreihen waren komplett belegt. Vor so vielen Leuten war ich fast noch nie aufgetreten. Statt zum Tisch der Jury auf der linken Seite hinüberzusehen, konzentrierte ich mich lieber auf die unerwartete Energie der Menge. Sie waren gut drauf, angeheitert von der Zwei-Drinks-Mindestmenge im Club.
»Also, ich bin aus Amarillo –«, setzte ich an, und jemand im Publikum johlte aus Solidarität. »Hat da eben jemand gejohlt?«, unterbrach ich mich. »Hat da echt wer für Amarillo, Texas, gejohlt? Derjenige sollte mal sein Leben überdenken.« Ich kassierte meinen ersten Lacher, und das Scheinwerferlicht formte sich zu einer sauberen, soliden Stützwand, die sanft im Rhythmus des Publikumsgelächters aufstrahlte. Ich glitt mühelos weiter zu meinen Auftaktwitzen, die Menge kam mir bei jeder Pointe entgegen, und ich nahm sie genau im richtigen Tempo mit, zügig genug, um sie bei der Stange zu halten. Als ich an die Stelle über meinen Busen kam, die beim letzten Mal den Zwischenrufer provoziert hatte (»die beiden hier hab ich gekriegt, als ich neun wurde. Schlimmstes Geburtstagsgeschenk ever«), fühlte ich mich so sicher, dass ich ein paar Sätze aus dem Stegreif dazu erfand und das Ganze fast eine Minute länger als sonst ausdehnte, ständig von Gelächter getragen. Es lief glatter als erwartet.
Das blaue Licht an der Rückwand ging an, durchstieß den Schleier der Bühnenbeleuchtung, um mir die Botschaft zu überbringen: noch eine Minute. Eine Minute bergab auf den Beifall zuschweben, der mich ins Halbfinale befördern würde, von da könnte es ins Finale gehen, und dann, überlegte ich schon fast, eventuell zurück nach L. A. Insgeheim bedankte ich mich schon bei Austin, auch »Samtsarg« genannt, dafür, dass es für mich da gewesen war, als ich eine Zuflucht gebraucht hatte. Selbst bei meinen Schlussworten – fünfundvierzig Sekunden; ich spürte jedes Ticken des Uhrzeigers – überlegte ich mir, jemanden zur Untermiete zu suchen, der meine Restmiete übernehmen würde, genau wie bei mir, als ich eingezogen war. Leb wohl, Austin. Ich spürte schon fast, wie die Wände des Comedy Clubs hinter dem Vorhang aus Scheinwerferlicht dahinschmolzen und die Aussicht auf Palmen und Smog freigaben. Noch dreißig Sekunden.
Es muss der Gedanke an L. A. gewesen sein, der mich ungewollt einen Blick in Richtung Jury werfen ließ. Links vom Publikum sah ich an einem langen Tisch im Dunkeln zunächst nur vage Umrisse sitzen. Bis mir etwas an einem davon auffiel – ein direkt unter einem Ohr vorstehendes Bartbüschel, das mich diesmal eine Spur länger hinsehen ließ. Lange genug, um die Form des Scheitels und den glänzenden Schweiß auf einer hohen runden Stirn zu bemerken.
Er war es. Aaron Neely saß am Jurorentisch.





























