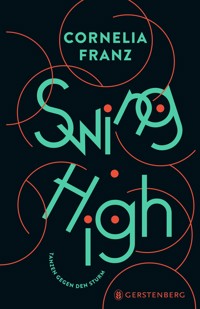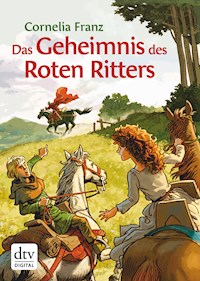Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
28. Februar 2020, an Bord der Queen Mary 2 nach New York, kurz vor Mitternacht. Emily hat die Schiffsreise zu ihrem 12. Geburtstag geschenkt bekommen. Doch plötzlich findet sie sich an Bord eines Auswandererschiffs wieder - im Jahr 1913! Das Gleiche ist auch Lorenzo und Malik passiert, die die Atlantiküberquerung nicht zum ersten Mal mitmachen. Nach der Ankunft in New York, erzählen die beiden, wird ein Feuer ausbrechen, bei dem es Tote und Verletzte geben wird. Das müssen sie unbedingt verhindern! Und es irgendwie schaffen, in die Gegenwart zurückzugelangen. Falls es einen Menschen gibt, der ihnen dabei helfen kann, ist das Albert Einstein … Eine spannende und abenteuerliche Zeitreise ins Jahr 1913, als viele Deutsche alles hinter sich ließen, um in der Fremde ein neues Leben zu beginnen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cornelia Franz
Wie ich Einstein das Leben rettete
Mit Vignetten von Petra Baan
Inhalt
Teil 1: Atlantischer Ozean
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Teil 2: New York
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Teil 3: Atlantischer Ozean
Kapitel 33
Anhang
Lorenzo rannte um sein Leben. Diesmal wollte er zu den Ersten gehören, die die rettende Gangway erreichten. Doch er hatte zu lange gewartet, weil er Malik gesucht hatte. Noch einmal ganz hinunter in den Bauch des Schiffes war er gelaufen, um ihn zu holen. Aber er hatte ihn nicht gefunden, weder im Autofrachtraum noch in einer der Kabinen. Kostbare Zeit hatte er verloren, weil er all die Treppen wieder hochlaufen musste. Und jetzt war das Deck bereits voller Menschen, sodass er kaum vorwärtskam.
»Malik? Malik, wo bist du?« Lorenzo schaute in alle Richtungen. Wenn sie sich nicht beeilten, kamen sie niemals rechtzeitig von Bord. Die Luft war schon voller Brandgeruch. Schreie, Flüche, verzweifelte Hilferufe vermischten sich mit dem Jaulen der Schiffssirene. Er hatte es gewusst: Das Feuer kam näher, die Menschen gerieten in Panik!
An die Reling gepresst stand er da und sah hilflos zu, wie die Passagiere versuchten, an Land zu kommen. Wie sie Taschen und Koffer fallen ließen, um schneller zu sein. Wie sie drängelten und schubsten, bis die Ersten stürzten. Er wollte das nicht sehen! Sein Blick wanderte zur Skyline von Manhattan hinüber, wo hinter den altmodischen Wolkenkratzern gerade die Sonne aufging. New York war unerreichbar.
Da zog ihn jemand am Arm. »Lorenzo …«
Malik war da, endlich! Erleichtert packte er ihn bei den Schultern und schüttelte ihn. »Wo hast du denn gesteckt, verdammt noch mal?« Er drückte ihn an sich. »Nun komm!«
»Meinst du, wir schaffen es dieses Mal?«
»Natürlich schaffen wir es. Pass nur auf, dass du dicht bei mir bleibst!« Er nahm ihn an die Hand und gemeinsam bahnten sie sich ihren Weg zur Gangway.
»Women and children first! Frauen und Kinder zuerst!«, schrie ein Schiffsoffizier und tatsächlich gab es ein paar Männer, die Lorenzo und Malik durchließen.
Nur noch wenige Meter, dann waren sie auf dem hölzernen Steg, der auf den Kai führte. Nur noch drei, vier Schritte, dann waren sie an Land. Nur noch wenige Sekunden, dann würde der ganze verdammte Spuk vielleicht vorbei sein. Geschoben und gestoßen von den verängstigten Menschen hinter ihnen, stolperten sie über die Gangway. Keinen einzigen Moment lockerte Lorenzo den Griff, mit dem er Maliks Hand umklammert hielt. Dieses Mal mussten sie es schaffen!
Auch als ihm schwarz vor Augen wurde und ihm die Sinne schwanden, ließ er den Jungen nicht los. Das Letzte, was er spürte, waren Maliks verschwitzte Finger. Dann fiel er in ein tiefes dunkles Loch.
Als Lorenzo die Augen öffnete, lag Malik zusammengerollt wie eine Katze neben ihm an Deck, in seinem alten Spiderman-T-Shirt. Gespenstisch still war es nach dem Geschrei, das gerade eben noch die Luft erfüllt hatte. Nur das Stampfen der Motoren war zu hören und das Schlagen der Wellen gegen den Bug. Nicht einmal das Krächzen der Möwen begleitete das Schiff, hier, mitten auf dem offenen Meer, drei Tagesreisen entfernt von der amerikanischen Küste.
Es dauerte keinen Wimpernschlag, dann wusste Lorenzo genau, wo er sich befand. Wieder einmal.
Ein paar Minuten lag er an Deck und starrte verzweifelt und mutlos in den Morgenhimmel, der wie zum Hohn in den schönsten Goldtönen schimmerte. Dann richtete er sich auf, sodass ihm der Seewind die Locken aus der Stirn blies. Sein Blick ging hinaus über den Ozean, wo kein Land in Sicht war, und dann zurück zu dem schlafenden Malik.
Lorenzo ballte die Fäuste. Tief durchatmend biss er sich auf die Lippen und schluckte die Tränen hinunter, die in ihm aufstiegen. Nein, auch wenn sie dieses Mal wieder gescheitert waren: Er würde nicht aufgeben. Es musste einen Weg geben, von diesem verdammten Schiff runterzukommen. Und er würde ihn finden.
Teil 1
Atlantischer Ozean
Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Albert Einstein
1
Achterbahn, hinauf und hinunter, und keine Chance auszusteigen. In Emilys Magen rumorte es. Der Saal drehte sich um sie herum, die Leuchter an der hohen Decke schwankten verdächtig. Ihren Vater, der ihr gegenüber an dem runden Tischchen saß, nahm sie nur verschwommen wahr. Von dem, was er ihr da gerade erzählte, bekam sie kaum etwas mit.
Fünf Tage waren sie jetzt schon auf der Queen Mary. Die Fahrt von Hamburg den breiten Fluss hinunter war so schön gewesen, vorbei an der glitzernden Elbphilharmonie und all den vielen Schiffen im Hafen. Vom Strand aus hatten die Menschen ihnen zugewinkt und hinter Hamburg waren sie vom Willkomm-Höft mit Musik verabschiedet worden. Keinen einzigen Moment lang war ihr unwohl gewesen. Auch als es dann von Southampton aus hinaus auf den offenen Atlantik gegangen war, hatte ihr das Wiegen des Schiffes nichts ausgemacht. Im Gegenteil, sie hatte alles an Bord genossen: den Swimmingpool, das viele gute Essen und das Planetarium, wo man in die Geheimnisse des Weltalls eingeweiht wurde. Aber ausgerechnet heute, kurz vor ihrem Geburtstag, wurde sie seekrank.
»Zwölf Jahre, Emily! Zwölf, das ist etwas ganz Besonderes. Eine magische Zahl, weißt du? Ein Jahr hat zwölf Monate, es gibt zwölf Tierkreiszeichen, Jesus hatte der Überlieferung nach zwölf Jünger. Und in der Mythologie bedeutet …«
»Papa! Tut mir leid, ich muss kurz raus.« Emily stand auf und hielt sich an der Tischkante fest. Beinahe hätte sie die Sektflasche umgestoßen, die vor ihr stand. Eisgekühlter Erdbeersekt, natürlich ohne Alkohol – auf diesem Schiff gab es nichts, was es nicht gab. »Ich bin gleich wieder da.« Und schon rannte sie aus dem Restaurant, vorbei an dem Kellner, der gerade eine Geburtstagstorte durch die Tischreihen balancierte.
»Aber Emmi, es ist fünf vor zwölf!«, hörte sie ihren Vater rufen.
Sie lief die breite geschwungene Treppe hinauf, wobei sie das Kleid, das sie zur Feier des Tages trug, mit den Händen raffte. Über den roten Teppich ging es hinweg, Stockwerk für Stockwerk höher, Deck für Deck, bis sie durch die oberste Bar hindurch nach draußen gelangte. Frische Seeluft, wie gut das tat!
Tief atmend lehnte sie sich an die Reling und schaute hinaus auf das schwarze Meer. Nieselregen hüllte sie ein, aber das störte sie nicht. Im Gegenteil, es gefiel ihr, so ganz allein hier oben zu stehen. Der große, weite Ozean lag vor ihr: undurchschaubar, unergründlich und voller Geheimnisse, wie die Zukunft. Papa hatte recht: Zwölf Jahre, das war wunderbar! Es war soo nett von Papa, ihr zum Geburtstag eine Schiffsreise nach New York zu schenken – auf der Queen Mary 2, dem schönsten Passagierschiff der Welt, wie es im Prospekt hieß. Auch wenn er damit sein schlechtes Gewissen beruhigen wollte, weil er sonst so wenig Zeit mit ihr verbrachte und immer nur mit seinem Job beschäftigt war. Aber seitdem sie an Bord waren, hatte er sein Handy tatsächlich nur noch benutzt, um Mama ein paar Fotos von ihrer Reise zu schicken.
Emily schloss die Augen, legte den Kopf in den Nacken und hielt ihr Gesicht in die kühle Brise. Als sie die Augen wieder öffnete, hatte der Seewind die Regenwolken weggepustet. Über ihr spannte sich ein funkelnder, flimmernder Winterhimmel, der kein Ende nahm. Sterne über Sterne über Sterne! Auch die Milchstraße war als weißes Band zu sehen. So einen Himmel gab es in Hamburg nicht.
»Oh ja, der ist überall so. Wir sehen ihn nur nicht immer in seiner ganzen Schönheit.«
Überrascht drehte sich Emily um. Neben ihr stand ein Mann in Mantel und Wollmütze an der Reling und nickte ihr freundlich zu. Hatte sie aus Versehen laut gesprochen, statt zu denken? Vielleicht wurde sie allmählich tüdelig. Wie spät war es eigentlich? Sie wollte auf ihre Armbanduhr schauen, doch der Blick des Mannes ließ sie stocken. Seine dunklen Augen lächelten so freundlich und humorvoll, dass sie sich in seiner Nähe wohlfühlte und gar keine Lust hatte, schnell wieder ins Restaurant hinunterzulaufen.
»Als Kind hab ich angefangen, die Sterne zu zählen«, sagte der Mann. »Aber ich bin immer durcheinandergeraten.«
»Das kenne ich. Ich hab’s auch mal versucht!«, rief Emily. »Und dabei ist das Universum doch unendlich.«
Der Fremde zupfte an seinem dichten Schnurrbart herum. »Tja … Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.« Er kicherte.
Stirnrunzelnd schaute Emily ihn an. Das war schon ein ulkiger Mann. »Nun aber keine Zeit verlieren«, murmelte er, wobei er eine altmodische Taschenuhr hervorzog. »Es ist gleich Mitternacht.« Entschlossen griff er in seine Manteltasche und holte etwas heraus, das wie eine Feuerwerksrakete aussah. »Du lieber Himmel, bin ich gespannt!«, sagte er und ließ wieder ein kindliches Kichern hören.
»Ich auch«, entfuhr es Emily. Als der Fremde mit der einen Hand die Rakete in die Luft hielt und mit der anderen ein Feuerzeug unter der Zündschnur anklickte, lief ihr ein Kribbeln von der Kopfhaut bis hinunter in die Zehenspitzen. Eine Geburtstagsrakete, wie schön!
Der Mann begann zu zählen. »Zehn, neun, acht …« Er sah sie auffordernd an.
»… sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei«, zählte Emily jetzt mit. »Eins und null!« Die Rakete schoss in den Himmel. Ein leuchtend roter Stern, der immer kleiner und kleiner wurde. Mitten hinein in das silberne Gefunkel dort oben sauste er und Emilys Blick folgte ihm, bis er zwischen all den Sternen nicht mehr zu erkennen war. Es flimmerte ihr so vor den Augen, dass ihr schwindlig wurde und sie sich an der Reling festhalten musste. Alles begann sich zu drehen, die Sterne, das Meer, die klugen braunen Augen des Fremden. »Nanu«, murmelte Emily, »nanu.« Ganz leicht und neblig wurde ihr im Kopf, als würde sie Teil einer schwebenden schwarzen Wolke. Und dann schwanden ihr die Sinne.
2
Es roch merkwürdig brenzlig, nach qualmender Kohle und Lagerfeuer. Emilys Augen tränten und ihre Finger, die die Reling umklammerten, waren steif vor Kälte. Aber ihr war nicht mehr schwindlig. Und so ließ sie das Geländer los und rieb sich übers Gesicht, um richtig wach zu werden. War sie etwa hier oben an Deck eingeschlafen? Noch dazu im Stehen? Das konnte ja wohl nicht sein.
Die Sterne standen immer noch hoch am Himmel, unter ihr wogte das schwarze Meer, genau wie zuvor. Aber trotzdem fühlte sich alles so ganz anders an. Der Qualm in der Luft, das deutlich lautere Stampfen der Motoren, selbst das Deck unter ihren Füßen schien ungewöhnlich stark zu vibrieren. Auch das Licht an Bord hatte sich verändert. Schützend schlang sie die Arme um die Schultern. Sie zitterte, obwohl es viel wärmer war als gerade eben noch. Jetzt aber schnell ins Restaurant zurück zu Papa, der sich bestimmt schon Sorgen machte. Vorsichtig ging sie über das spärlich beleuchtete Achterdeck zur Tür, um durch die Bar zu den Treppen nach unten zu laufen.
Doch schon nach wenigen Schritten traute sie sich keinen Meter weiter. Hier stimmte ja gar nichts mehr! Sie fand den Eingang zur Bar nicht. Dort, wo eine Glastür sein sollte, war eine Wand. Und diese hölzernen Rettungsboote hatten vorhin auch nicht da gehangen. Am merkwürdigsten waren jedoch die gewaltigen gelben Schornsteine, aus denen dicker Qualm Richtung Heck zog. Die waren ihr noch nie aufgefallen … »Ich versteh das nicht«, murmelte sie. Ratlos stand sie im Seewind und schaute sich mit großen Augen um.
Als sie suchend weiterging, fand sie eine Tür, die in ein schlichtes Treppenhaus führte, das so gar nicht zur sonstigen Einrichtung der Queen Mary passte. Vielleicht war sie ja doch an der Reling eingeschlafen und dann geschlafwandelt, sodass sie sich jetzt in einem anderen Teil des Schiffes befand? Früher war sie manchmal im Schlaf in der Wohnung herumgegeistert, bis Mama sie geweckt und ins Bett zurückgebracht hatte.
Ein junger Mann kam ihr entgegen. Er trug einen schlecht sitzenden Anzug mit viel zu kurzen Ärmeln und ausgebeulten Knien, dazu Hosenträger und eine Schiebermütze auf dem Kopf. Mitleidig sah er an ihrem nassen Kleid hinunter. »Na, Lütte, hast dich verlaufen? Du bist doch bestimmt nicht dritte Klasse, oder?«
Sie rollte mit den Augen. Dritte Klasse? Nach den Sommerferien kam sie in die siebte! Und was ging das diesen Typen in seinen altmodischen Klamotten überhaupt an? »Pfff«, machte sie. Doch dann guckte sie freundlicher. Denn verlaufen hatte sie sich wirklich und der Mann konnte ihr vielleicht helfen. »Ich suche den Queen’s Room«, sagte sie. »Mein Papa wartet da auf mich.«
Der Mann zuckte die Schultern. »Queen’s Room? Kenn ich nicht. Der Adel kann mir den Buckel runterrutschen.« Immer noch musterte er sie von Kopf bis Fuß. »Also, wenn du in die zweite Klasse willst, solltest du ein Stück bugwärts gehen. Oder fährst du Luxus? Dann musst du noch weiter zur Schiffsmitte.«
Jetzt verstand Emily ihn endlich. Er glaubte also, dass sie in einer der tollen großen Außenkabinen schliefen. Nein, so spendabel war Papa nun auch wieder nicht. »Wir haben Kabine 11017, auf Deck elf«, antwortete sie.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich kenn nur die dritte Klasse. Viel Glück bei der Suche.« Er ging an ihr vorbei die Treppe hoch.
Ja, Glück konnte Emily wirklich gebrauchen. Noch nie in ihrem Leben war sie so verwirrt gewesen. Treppauf und treppab lief sie, doch es war wie verhext. Sie fand nicht zurück in den schönen warmen Queen’s Room, wo ihr Vater auf sie wartete. Wenn sie doch nur ihr Handy nicht in der Kabine gelassen hätte, dann könnte sie ihn anrufen.
Schließlich traf sie am Eingang zu einem weiteren Gang auf einen Steward in Uniform, der sie genauso musterte wie der junge Mann zuvor. Doch leider längst nicht so freundlich. »Was läufst du hier mitten in der Nacht herum?«, herrschte er sie an, während er ihr den Weg versperrte. »Geh zurück in deinen Schlafraum! Wenn ich dich noch einmal hier erwische, gibt’s Ärger!«
Mit Tränen in den Augen biss sich Emily auf die Unterlippe. Sie war erschöpft, das nasse Kleid klebte ihr am Körper und sie wollte endlich ins Bett.
Aber der Steward zeigte wenig Mitleid. »Ab hier kommt nur noch die zweite Klasse. Ihr wisst doch, dass ihr dort nichts zu suchen habt«, sagte er barsch. Er packte sie fest am Arm und schleppte sie den Korridor hinunter. »Schläfst du hier?«, fragte er vor der ersten Kabine.
Sie nickte, damit er sie endlich losließ. Und so öffnete er die Tür und schob sie in den Raum hinein. Im Dunkeln nahm sie erst nur die abgestandene, nach Schlaf riechende Luft wahr. Dann sah sie die beiden Stockbetten – und das Mädchen, das von einer der oberen Pritschen auf sie hinunterschaute. »Was machst du hier?«, flüsterte es.
»Ich hab mich verlaufen«, flüsterte Emily zurück und fing an zu weinen.
Drei Sekunden später war das Mädchen vom Bett geklettert. In dem wenigen Licht, das unter der Tür hindurch in die Kammer fiel, sah Emily, dass die Kleine vielleicht acht Jahre alt war und lange Zöpfe hatte, die ihr über das Nachthemd hingen. »Wo ist denn deine Kabine?«, fragte sie leise.
»Irgendwo ganz vorne im Schiff. Ich finde den Weg nicht mehr.«
Das Mädchen nickte wissend. »Ach so, vierte Klasse, Zwischendeck«, sagte sie. »Da kommt man von hier aus nicht hin. Aber ich weiß einen Weg.«
Vorsichtig öffnete sie die Tür und gemeinsam lugten sie in den Korridor. Der Steward hatte ihnen den Rücken zugewandt. »Komm schnell.« Sie nahm Emily bei der Hand und zog sie in die andere Richtung.
Eilig ging es einige Treppen hinunter, bis sie zu einer Metalltür kamen. »Schau, dahinter ist ein Gang. Der führt zu den Turbinenräumen. Und von dort aus kannst du durch die Kesselräume laufen. Du musst dann nur noch durch einen Gang, von wo aus du ins Treppenhaus für die vierte Klasse kommst«, sagte das Mädchen stolz.
»Woher weißt du das?«, fragte Emily.
Ein Schatten ging über das Gesicht des Mädchens. »Mein Bruder und ich, wir haben uns überall umgeschaut. Wegen dem, was auf der Titanic passiert ist. Damit wir nicht eingesperrt sind, wenn’s ein Unglück gibt … Auf der Titanic, da haben sie ja fast nur die reichen Leute gerettet.« Sie stockte und ihre Unterlippe zitterte. »Das muss schrecklich gewesen sein«, murmelte sie. »Meine Cousine Gertrud ist auch ertrunken, und deshalb hab ich schreckliche Angst vor dieser Schiffsfahrt gehabt.«
Emily schaute sie fragend an. Die Titanic? Das war doch über hundert Jahre her! Ihre Urgroßcousine meinte sie wohl.
»Eigentlich ist der Gang nur für die Besatzung, falls sie was an der Schiffswand reparieren müssen oder so«, erklärte ihr das Mädchen jetzt. »Aber Heinzi und ich, wir haben uns sogar schon mal in die Luxusklasse geschlichen. All die feinen Pinkel … Heinzi meint, das ist dort fast so schön wie beim Kaiser.«
»Aha«, erwiderte Emily immer noch irritiert.
Während das Mädchen Emily die Tür aufhielt, flüsterte sie: »Du musst gut achtgeben, wenn du im Kesselraum bist, dass sie dich nicht erwischen.« Sie schüttelte sich, als sähe sie ein Gespenst, sagte: »Atschüss, ich geh wieder ins Bett«, und schon rannte sie auf ihren nackten Füßen davon. Am Ende des Gangs drehte sie sich noch einmal um. »Es ist soo gruselig da!«
»Oh … und vielen Dank!«, rief Emily ihr zu. Dann schlüpfte sie in den schmalen Gang, in dem nur eine Notbeleuchtung für etwas Licht sorgte. Mit klopfendem Herzen machte sie sich auf den Weg.
Gruselig – das war es wirklich hier unten im Bauch des Schiffes, wo sie nur eine Metallwand vom Meer trennte. Und wie laut man die Schiffsmotoren hören konnte! Je näher sie dem ersten Turbinenraum kam, desto stärker wurde das Dröhnen. Angstvoll öffnete sie schließlich die Tür, die in den Raum mit den großen Turbinen führte. Hoffentlich war hier niemand. Sie traute sich nicht, sich umzuschauen, sondern lief mit gesenktem Kopf zum nächsten Raum. Wenn man so tut, als wäre man gar nicht da, dann wird man nicht so leicht entdeckt. Das hatte sie beim Versteckspielen gelernt. Und tatsächlich schaffte sie es durch beide Turbinenräume hindurch, ohne gesehen zu werden.
Dann kam der erste Kesselraum. Emily stemmte die schwere Tür auf – und prallte entsetzt zurück. Das war ja die Hölle! Ohrenbetäubender Lärm schlug ihr entgegen. Es war so heiß, dass sie kaum Luft bekam. Blinzelnd schaute sie in die düstere Halle, in der riesige, bestimmt fünf Meter hohe Stahlkessel standen. Alles war voller Kohlenstaub, sodass sie im ersten Moment die Männer kaum erkannte, die an den Heizkesseln arbeiteten. Sie hantierten mit langen Schaufeln und Stangen, um Kohle in die glühenden Öffnungen zu bugsieren.
Emily hielt sich die Ohren zu. Doch das Schaben der Schaufeln auf Metall, das Prasseln des Feuers, das Gebrüll der Heizer war mächtiger. Irgendwo zischte ein Ventil, eine Klingel schrillte, sie zuckte zusammen. Nein, unmöglich! Hier konnte sie nicht durch. Aber zurück wollte sie auch nicht. Und so ließ sie die Tür hinter sich zufallen und tastete sich Schritt für Schritt weiter. Heiß, laut und gefährlich war es hier – und doch auch faszinierend.
Plötzlich packte sie jemand am Arm und sie schnellte herum. Ein Riese, ein rußverschmierter Koloss! In seinem dunklen Gesicht leuchteten die Augen unnatürlich weiß. »Bist du lebensmüde? Was tust du hier?«, schrie er Emily an. Er packte sie auch noch am anderen Arm und hob sie in die Luft. Vor Schreck trat sie um sich, sodass sich auch der Heizer erschrak. Er ließ sie los und sie rannte wie ein Hase davon, an der Schar der schuftenden Männer und den Kesseln vorbei zum Ende des Raums.
Wieder eine Tür, noch solch ein Raum! Und auch durch diese glühend heiße Hölle rannte Emily, ohne anzuhalten. Keiner der Männer an den Kesseln folgte ihr. Sie hatten alle genug zu tun. Vielleicht waren sie auch zu müde und erledigt von ihrer schweren Arbeit. Als sie schließlich die letzte Tür hinter sich zuschlug und den rettenden Gang erreichte, der in den Bug des Schiffes führte, keuchte sie vor Anstrengung. Schwer atmend gelangte sie in das Treppenhaus, wischte sich den Schweiß von der Stirn und besah sich ihr Kleid, das von der Hitze getrocknet war. Sie war ja völlig verdreckt! Emily hätte nicht gedacht, dass es auf einem Luxusschiff wie der Queen Mary derart grässliche Orte gab, wo die Menschen so schuften mussten.
Hoffentlich fand sie jetzt endlich, endlich ihre Kabine. Wenn Papa noch immer im Queen’s Room auf sie wartete, könnte sie ihn auf dem Handy anrufen. Oh Mann, der dachte sicher, sie wäre über Bord gegangen. Und wenn sie später Mama erzählte, was sie alles erlebt hatte, durfte sie bestimmt nie wieder mit Papa allein verreisen.
3
Egal, welche Tür sie öffnete, ganz gleich auf welchem Deck, absolut nichts kam ihr bekannt vor. Hinter jeder Tür befanden sich Kabinen mit mehreren Stockbetten. In manchen Räumen schliefen bestimmt an die zwanzig Leute. Das war eine üble Luft und ein Geschnarche … Warum fand sie denn nur nicht die Etage, auf der das schöne Zweibettzimmer lag, das sie sich mit Papa teilte? Schließlich landete sie in einem Essraum mit langen Holztischen, wo sie sich verzweifelt auf einer der Bänke niederließ. Sie vergrub den Kopf in ihren auf dem Tisch verschränkten Armen. Was für ein blödes Schiff! Was für ein grässlicher zwölfter Geburtstag!
Vor Erschöpfung schlief sie fast ein. Und so dauerte es eine Weile, bis sie merkte, dass jemand sie antippte. Als sie aufschaute, sah sie in das Gesicht eines Jungen, der sie neugierig musterte. Er hatte braune Locken, sympathische Züge und war ein paar Jahre älter als sie.
»Hey, du brauchst keine Angst vor mir zu haben«, sagte er.
»Hab ich nicht«, antwortete Emily und setzte sich aufrecht hin.
»Ich wette, du bist ziemlich durcheinander. Du hast keine Ahnung, wo du bist, stimmt’s?«
Emily nickte stumm.
»Ich kann’s dir erklären«, fuhr der Junge fort und setzte sich neben sie auf die Bank. »Aber du wirst es mir leider nicht glauben.«
»Warum nicht?«
»Weil es ganz und gar unglaublich ist. Total abgefahren. Weil du nämlich …« Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Weil ich und du und auch Malik …« Wieder brach er ab und sah sich jetzt suchend um.
Da kam aus einer der schlecht beleuchteten Ecken des Essraums ein weiterer Junge auf sie zu. Er war deutlich jünger, vielleicht sieben, acht Jahre alt, und er grinste verlegen. Aus seinen großen schwarzen Augen schaute er sie prüfend an, während im Blick des Älteren eher Mitleid lag.
Emily saß plötzlich kerzengerade da. Irgendetwas schienen die beiden zu wissen, was sie nicht wusste. »Was soll das alles?«, fragte sie. »Was ist los auf diesem dämlichen Schiff? Ist das hier etwa so eine Sendung, wo sie mit versteckten Kameras die Leute hochnehmen?« Sie seufzte erleichtert. Klar, das war die Erklärung!
Der Junge mit den Locken schüttelte den Kopf. »Ich wünschte, es wäre so«, sagte er. »Übrigens, ich heiße Lorenzo. Das ist Malik.«
»Ich bin Emily«, erwiderte sie. »Und ich finde, jetzt könnte mal Schluss mit dem Blödsinn sein. Ich würde schrecklich gerne meine Kabine wiederfinden. Oder den Queen’s Room. Und meinen Papa. Ich hab doch heute Geburtstag!« Richtig laut wurde sie jetzt.
»Tja, Emily … dann herzlichen Glückwunsch … Aber …« Lorenzo trommelte nervös mit den Fingern auf der Tischplatte herum.
Malik, der immer noch neben ihnen stand, hielt es nicht mehr aus. »Aber deine Kabine gibt es nicht mehr. Meine auch nicht. Und auch nicht die von Lorenzo. Und dein Papa ist auch nicht da! Wir sind jetzt nämlich ganz woanders. Wir sind auf der Imperator. Das hier ist die vierte Klasse und da gibt es keine schönen Zweibettzimmer!« Immer aufgeregter haspelte er seine Sätze hervor. Emily konnte ihn kaum noch verstehen. »Und außerdem ist jetzt 1913! So, nun weißt du Bescheid!« Mit trotzigem Gesicht ließ er sich auf die Bank sinken.
Lorenzo zog ihn zu sich auf den Schoß und strich ihm über die stoppeligen schwarzen Haare. »Reg dich mal nicht so auf, Malik. Du machst ihr nur Angst.«