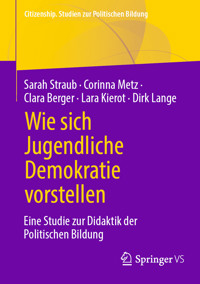9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Ein persönliches, ein helfendes Buch zur Demenz.« Bayern 1
Sarah Straub ist zwanzig, als ihre Großmutter, ihre engste Bezugsperson, an Demenz erkrankt. Von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr, wie es war. Sarah will die Krankheit verstehen, die ihre Oma so verändert hat, und widmet ihr Leben der Demenzforschung. Einfühlsam berichtet sie von ihren Erfahrungen als Angehörige und als Psychologin. Ihre praktischen Tipps machen ihr Buch zu einem verlässlichen Begleiter für Betroffene und ihre Familien – von den ersten Symptomen bis zum Endstadium.
»Dieses großartige Buch wird dazu beitragen, die Herzen der Menschen zu öffnen für eine Krankheit, die so unermesslich viel Leid mit sich bringen kann.« Konstantin Wecker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Autorin
Sarah Straub, geboren 1986, ist promovierte Diplom-Psychologin und arbeitet als wissenschaftliche Angestellte am Universitätsklinikum Ulm. Sie hält für unterschiedliche Organisationen regelmäßig Vorträge zum Thema »Frontotemporale Demenz«. Daneben ist sie leidenschaftliche Musikerin und erfolgreiche Liedermacherin. Sie veröffentlichte bis jetzt vier Alben, die letzten beiden in Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker.
www.sarah-straub.de
Das Buch
Als Sarah Straubs Großmutter dement wurde, prägte das die damals 20-jährige Enkelin sehr. Neben ihrem eingeschlagenen Weg zur erfolgreichen Musikerin studierte sie Psychologie, promovierte über Demenzerkrankungen und klärt heute über Demenz auf. Diese Erkrankung ist ein Thema, das immer drängender wird: Allein in Deutschland leben ca. 1,6 Mio. Demenzkranke. Und jeden Tag kommen rund 900 Neuerkrankte dazu.
Sarah Straub zeigt mit vielen Beispielen, was es bedeutet, wenn aus Vergesslichkeit Demenz wird, welche Aufgaben, aber auch Hilfsmöglichkeiten mit dieser Diagnose verbunden sind, wie der Lebensalltag mit einem Demenz-Erkrankten geregelt und das Endstadium dieser Erkrankung würdevoll gestaltet werden kann.
»Dieses großartige Buch wird dazu beitragen, die Herzen der Menschen zu öffnen für eine Krankheit, die so unermesslich viel Leid mit sich bringen kann. Ich bin mir sicher, dieses Buch wird seinen Weg gehen und von vielen Menschen gelesen werden.«
Konstantin Wecker
Dr. Sarah Straub
Wie meine
Großmutter
ihr ICH
verlor
Demenz – Hilfreiches
und Wissenswertes
für Angehörige
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der deutschen Ausgabe © 2021 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign GbR
Redaktion: Dr. Diane Zilliges, Bietigheim-Bissingen
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-27874-8V003
www.koesel.de
Inhalt
Vorbemerkung
Vorwort von Konstantin Wecker
Wie meine Großmutter ihr Ich verlor und ich dabei mich selbst fand
Was bedeutet Demenz?
Der Traum von der ewigen Jugend
Das alternde Gehirn
Alois Alzheimer und sein Vermächtnis
Volkskrankheit Demenz
Heutige Klassifikation der Demenzen
Die Alzheimer-Demenz
Die frontotemporale Demenz (FTD)
Weitere neurodegenerative Demenzformen
Die vaskuläre Demenz
Nur vergesslich oder schon dement?
Wann es Zeit wird, einen Arzt aufzusuchen
Zu jung für Alzheimer
Welcher Arzt ist der richtige?
Ablauf der Demenzdiagnostik
Der Faktor Vererbung
Es ist wichtig, eine Diagnose einzuholen
Diagnose bestätigt – was nun?
Lassen Sie sich gut beraten
Setzen Sie sich damit auseinander, dass sich die Beziehung zwischen Ihnen und dem Betroffenen ändern wird
Strukturieren und vereinfachen Sie Ihren Alltag
Helfen Sie bei der Freizeitgestaltung und beim Pflegen von Hobbys
Es ist nie zu spät: Gesund leben mit Demenz
Therapie der Demenz
Medikamentöse Therapie
Nicht-medikamentöse Therapie
Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung, Pflegegrade
Entlastungsangebote
Psychotherapeutische Begleitung
Über den herausfordernden Lebensalltag mit einem Demenzpatienten
Situationen, auf die man sich nicht vorbereiten kann
Wenn alles zu viel wird: Caregiver burden und seine Folgen
Aufnahme in ein Pflegeheim
Die Bedeutung des eigenen Zuhauses
»Endstation« Pflegeheim?
Wenn eine Heimunterbringung nicht gelingt
Ein Beispiel für eine alternative Wohnform im Alter: Projekt »Demenz-WG«
Abschied nehmen müssen
Palliative Versorgung
Das Sterben begleiten
Die Trauer beginnt schon lange vor dem Tod
Das Leben danach
Anhang
Danksagung
Glossar – Die wichtigsten Begriffe im Überblick
Hilfreiche Adressen für Angehörige von Demenzpatienten
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Vorbemerkung
Liebe Leser*innen,
aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei der Nennung von Personen, Patient*innen und Berufsbezeichnungen meist auf eine Differenzierung der Geschlechter verzichtet, selbstverständlich sind jedoch immer alle Geschlechtsformen gleichermaßen gemeint.
Vorwort
Sarah Straub lernte ich zunächst als Sängerin kennen. Sie hatte viel Erfolg mit englischsprachigen Songs und war – so sagte sie es mir – nach einem meiner Konzerte auf Kloster Banz von einigen meiner Lieder so tief berührt, dass sie sich daraufhin entschloss, deutschsprachige Lieder zu singen. Wir trafen uns in Würzburg, wo ich einen Abschlussabend mit meinen Student*innen meines Liedermacher-Seminars gestaltete. Dabei schlug ich ihr vor, ein Album mit Wecker-Liedern aufzunehmen. Die Idee gefiel ihr, und ich konnte damals noch nicht wissen, wie mich dieses Projekt selbst begeistern würde.
Sarah ist vierzig Jahre jünger als ich und sie interpretiert auf diesem wunderbaren Album Alles das und Mehr meine Lieder, als hätte sie sie selbst geschrieben. Für mich ist es unglaublich spannend, wie meine Texte und Melodien von dieser jungen Frau mit ihrer wunderschönen Stimme neu gedeutet, neu interpretiert, ja neu erfunden werden. Nach und nach begann sie dann, sehr schöne, eigene deutschsprachige Lieder zu schreiben, und ich war und bin richtig stolz, Mentor dieser begabten Künstlerin zu sein.
Sarah Straub hat nie mit ihrem Doktortitel geprotzt und es dauerte einige Zeit, bis ich überhaupt erfuhr, dass sie als Psychologin arbeitet. Irgendwann erzählte sie mir von ihrer Arbeit in der Klinik und dass sie in der Demenzforschung tätig sei.
Ich bat sie, bei der Demo »Break Isolation«, die wir während des ersten Lockdowns 2020 ins Leben riefen, eine Rede zu halten. Und ich war begeistert: Sie sprach mit einer solchen Empathie und einem so profunden Wissen über ihre Patienten, dass ich schon bald zwei Sarah Straubs vor meinen Augen sah: die Sängerin und die Wissenschaftlerin. Und je mehr ich mit ihr über das Thema Demenz sprach, um so bewusster wurde mir, wie wenig ich darüber weiß.
Klar, man hat was von Alzheimer gehört und weiß, dass mit dem Alter die Gefahr wächst, dement zu werden. Aber dass es so viele unterschiedliche Formen und Variationen dieser Krankheit gibt, dass schon Fünfzigjährige an bestimmten Ausprägungen der Demenz erkranken können – davon hatte ich bislang nichts gehört.
Ich wurde neugierig und fragte Sarah, ob sie nicht mal was über das Thema schreiben wolle. Irgendwann schickte sie mir ein paar Seiten über ihre Arbeit in der Klinik, und ich war ehrlich angerührt: Da zeigte sich mir schriftstellerisches Talent, von dem sie selbst wohl noch keine Ahnung hatte. Einerseits, quasi als Basis, ihr wirklich fundiertes Wissen. Und andererseits schrieb sie so flüssig und spannend, persönlich und gleichzeitig wissenschaftlich, dass ich unbedingt mehr erfahren wollte.
Ich dachte daran, diese Seiten vielleicht im Netz zu veröffentlichen – damals hatte ich noch ein Webmagazin – und immer noch nicht an ein Buch. Sarah war für mich in erster Linie immer noch die singende Kollegin.
Als sie mir die nächsten Seiten zuschickte, änderte sich das schlagartig. Ich war mir sicher, dass das viel mehr Menschen erfahren sollten als nur ich und ein paar Freunde. Es war einfach zu gut, um nicht veröffentlicht zu werden. Und so fragte ich Sarah, ob sie nicht ein Buch schreiben wolle.
Dann rief ich meinen alten Freund und Verleger vieler meiner Bücher an, Thomas Schmitz, und erzählte ihm von dem Thema. Er war sofort hellhörig, und nachdem er die ersten Seiten gelesen hatte, ebenso Feuer und Flamme für die Autorin Sarah Straub wie ich.
Ich bin mir sicher, dieses Buch wird seinen Weg gehen und von vielen Menschen gelesen werden. Zum einen begeistert Sarahs fundiertes Wissen, aber vor allem ihre aus jeder Zeile zu spürende Empathie für die Betroffenen und ihre mitleidenden Verwandten und Freunde. Eine Empathie, die gerade in diesem Fachgebiet so dringend nötig ist.
Immer wieder nimmt sie die Leser*innen an der Hand mit ihrer ganz persönlichen Geschichte, die Krankheit ihrer geliebten Großmutter betreffend. Sodass man manchmal – und das ist gut so – fast vergisst, dass es hier eben auch um ein großartig recherchiertes Sachbuch geht, ein Sachbuch über eine Krankheit, die nicht annähernd so populär ist und von den Medien aufgegriffen wie viele andere Krankheiten. Eine Krankheit, die vielleicht auch deshalb gern totgeschwiegen wird, weil es so wenig spektakuläre Heilungsmodelle gibt.
Sarah Straub will helfen, das spürt man in jeder Zeile, gerade weil sie in ihrem Beruf so viel Leid erleben muss – und auch vermeidbares Leid. Sie gibt Tipps für Verwandte, sie beschreibt konkret, an wen man sich wenden, wie man sich verhalten sollte und vor allem auch, was man sich nicht gefallen lassen soll und muss.
Dieses Buch ist durchaus auch ein freches und forderndes Buch und könnte und sollte so manche ihrer Kolleg*innen anstacheln, sich nicht nur als Mediziner*in, sondern vor allem auch als mitfühlender Mensch dieser unerbittlichen Krankheit zu stellen.
Besonders freut es mich, wenn meine Kollegin auch immer wieder mal auf die Heilkraft der Musik hinweist. Und da hat sie ja nun wirklich auch – wer, wenn nicht sie – die Kompetenz dazu. Ihr so einfühlsames Lied »Schwalben«, das ich oft schon mit ihr gesungen habe, entstand genau aus ihrer Arbeit und den Erfahrungen, die sie mit ihren Patient*innen schon so viele Jahre gemacht hat. Und so wird auch dieses Lied dazu beitragen, genau wie dieses großartige Buch, die Herzen der Menschen zu öffnen für eine Krankheit, die so unermesslich viel Leid mit sich bringen kann.
Genau das soll dieses Buch und wird dieses Buch auch erreichen: dass endlich über das geredet wird, was so lange fast geheim gehalten wurde, oft auch aus Scham verschwiegen. Denn nur wenn man sich den Problemen stellt, haben sie eine Chance, wirklich gebessert zu werden. Und dazu wird Wie meine Großmutter ihr Ich verlor beitragen.
Lassen Sie sich entführen in eine Welt, die den meisten von Ihnen sicher genauso unbekannt ist, wie sie es mir war, bevor ich dieses Buch gelesen hatte. In eine Welt des Schmerzes und durchaus auch der Hoffnung. Und lassen Sie sich von dieser jungen und engagierten Autorin Wege zeigen, diesen Schmerz zu lindern. Mit einer erfrischenden, manchmal fast poetischen Sprache geschrieben, die einen mitreißt und einem das Gefühl gibt, ebenfalls helfen zu wollen.
Sarah Straubs erstes Buch wird nicht ihr letztes sein. Da bin ich mir sicher.
Konstantin Wecker
Januar 2021
Wie meine Großmutter ihr Ich verlor und ich dabei mich selbst fand
Meine Großmutter war siebenundsiebzig Jahre alt, als sie eines Nachts fast ihr Leben und komplett ihr Ich verlor. Was damals wirklich geschehen ist, weiß bis heute niemand so genau. Fakt ist, dass sie ihr Bett verlassen hatte, um die Treppe ins Erdgeschoss zu nehmen. Vielleicht wollte sie in die Küche, um etwas zu trinken. Vielleicht wurde sie von ihrer Katze geweckt, die, verwöhnt wie sie war, rund um die Uhr um Futter bettelte. Vielleicht trieben meine Großmutter aber auch ihre finanziellen Sorgen um; trotz Jahrzehnten voller harter Arbeit war sie tatsächlich bettelarm. Dies sollte ich aber erst nach ihrem Tod erfahren, da meine Großmutter das Prekäre ihrer Lage über Jahre außerordentlich effektiv geheim gehalten hatte. Sie war eine stolze Frau und hatte lieber im Verborgenen nach und nach ihr Hab und Gut verkauft als ihre Familie um Hilfe zu bitten.
Kein Mensch stand mir in meiner Kindheit näher als sie. 1930 geboren, erlebte sie als Kind und Jugendliche die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, lernte früh, mit wenig auszukommen und genügsam zu sein, und widmete ihr ganzes Leben der Sorge um ihre Familie. Ich habe heute noch ihren Lieblingsspruch im Ohr: »Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude.« Dieses Zitat passt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, wir ließen es später für ihre Beerdigung sogar auf die Trauerbilder drucken. Dass meine Großmutter das Dritte Reich miterlebt hatte, spielte in unserer Familie keine große Rolle, sie sprach nicht gern darüber. Erzählungen über ihre Jugend blieben stets kryptisch, ließen jedoch durchaus erkennen, dass sie unter dem Eindruck einer Ideologie aufgewachsen war, welche wir hoffentlich nie wieder erleben müssen. Es waren eher kleine, unbedeutende Alltagsgegebenheiten, die mich immer wieder mal daran erinnerten, zu welcher Zeit sie erwachsen geworden war: So schmierte sie immer fast zentimeterdick Butter auf unser Abendbrot. Wie sollten wir uns auch sicher sein, dass wir morgen noch genug zu essen hätten?
Das Leben meiner Großmutter war ein Leben für ihre Familie, vor allem für meinen Bruder und mich. Wir waren jeden Tag bei ihr, lebte sie schließlich nur etwa fünfzig Meter von unserem Elternhaus entfernt. Meine Eltern waren beruflich immer viel unterwegs, sodass meine Großmutter einen großen Anteil an der Erziehung ihrer Enkelkinder hatte. Sie machte uns zu essen, half uns bei den Hausaufgaben und brachte uns oft abends ins Bett. Sie war neben unseren Eltern unsere wichtigste Bezugsperson und wir liebten sie über alles.
In jener Nacht, die ihr und mein Leben für immer verändern sollte, muss sie also am Rande der Treppe gestanden haben, um nach unten zu gehen. Vielleicht wurde ihr in diesem Moment schwindelig, vielleicht stolperte sie – all das ist nicht zu rekonstruieren. Sie verlor irgendwie den Halt und stürzte achtzehn Stufen hinab, schlug mit ihrem Kopf am Fuße der Treppe auf und zog sich dabei eine schwere Hirnblutung zu, die dann zu spät versorgt wurde.
Sie lebte nicht allein in ihrem Haus, ihr Sohn, der Bruder meines Vaters, wohnte bei ihr. Er bemerkte erst am nächsten Morgen, dass etwas nicht stimmte. Meine Großmutter muss am Fuße der Treppe irgendwann aufgewacht sein. Schwer verletzt und verwirrt wanderte sie stundenlang orientierungslos durchs Haus, bis ihr Sohn sah, dass sie aus den Ohren blutete und nicht reagierte, wenn er sie ansprach. Sie wurde in ein Klinikum gebracht, konnte nicht mehr sprechen, verstand nicht, wo sie war und was geschehen ist. Im Nachhinein kann ich sagen, sie wirkte wie eine Demenzpatientin in einem späten Stadium. Die Ärzte veranlassten eine Computertomografie (CT), sahen die schwere Hirnblutung und taten offenkundig: nichts. Aufgrund des Alters der Patientin und ohne Wissen darüber, dass meine Großmutter bis zu diesem Tag ihr Leben eigenständig gemeistert hatte, gingen die Mediziner davon aus, dass die Patientin schon vor dem Sturz dement gewesen sei. Sie versorgten also die Platzwunde und beließen es dabei. Ich war zu dem Zeitpunkt zwanzig Jahre alt und zum ersten Mal mit einer solchen Situation konfrontiert. Die Ärzte besprachen kurz und sachlich den Gesundheitszustand meiner Großmutter mit der Familie und ich versuchte meinerseits recht unbeholfen, zu erklären, dass sie vor dem Unfall geistig fit gewesen sei. Ich fand kein Gehör. Und so wurde sie nach kurzem stationärem Aufenthalt in ein Pflegeheim entlassen. Als Schatten ihrer selbst.
Wie genau sich die Hirnblutung damals dargestellt hat, kann ich bis heute nicht beurteilen, da kein Arzt sich die Mühe gemacht hatte, es zu erklären. Heute weiß ich, dass so eine Blutung das Gehirn quetscht und dadurch schwere Folgeschäden auslösen kann. Bei einem Patienten in jüngerem Alter hätte man wahrscheinlich versucht, die angestaute Flüssigkeit mithilfe eines neurochirurgischen Eingriffs abzulassen, um die Schwellung im Inneren des Schädels zu verringern und Langzeitfolgen zu minimieren. Da meine Großmutter aber als dement abgestempelt war, passierte dies nicht.
Die Situation im Pflegeheim empfand ich als verheerend. Meine Großmutter erholte sich zwar langsam, sprach mit der Zeit auch wieder einige floskelhafte Sätze, litt aber unter einem ausgeprägten Gedächtnisverlust. Verließ ich ihr Zimmer und kam eine Minute später zurück, begrüßte sie mich, als wäre ich nie dagewesen. Außer meinen Bruder und mich erkannte sie grundsätzlich kaum mehr jemanden. Wir, ihre Enkel, waren in ihrem verletzten Gehirn so »eingebrannt«, dass sie uns als vertraut erlebte. Ihre Söhne hingegen, meinen Vater und meinen Onkel, sah sie oft an wie Fremde. Sie war auch nicht orientiert und litt unter einer großen inneren Unruhe. »Weglauftendenzen« nannte man das dann, wenn sie rastlos und suchend auf den Gängen umherging. Ich hasse dieses Wort, es klingt, als sei der Wunsch, sich von so einem Ort entfernen zu wollen, ein pathologischer, also krankheitswertiger Zustand. Aber ist es nicht absolut nachvollziehbar, dass meine Großmutter aus dem Heim wegwollte? Dass sie nach Hause wollte? Ihre durch die Hirnblutung verursachte Demenz machte es unmöglich, ihr zu erklären, warum sie in einem kargen, kleinen Zimmer bleiben musste, in einem Haus voller fremder Menschen, die ihr nicht immer wohlgesonnen schienen. Ich empfand das Pflegepersonal als genervt, weil sie meine Oma ständig wieder »einfangen« mussten, wenn diese mal wieder den Ausgang suchte. Einmal hat sie es sogar geschafft, sich unbemerkt aus dem Gebäude zu schleichen und ein Auto auf der Straße anzuhalten, um sich mitnehmen zu lassen. Sie muss sehr verzweifelt gewesen sein.
Meine Großmutter war also eine Heimbewohnerin mit »herausforderndem Verhalten«. Und wie in vielen stationären Pflegeeinrichtungen waren die Arbeitsbedingungen dort schwierig, es war keine Zeit, sich um solche Bewohner hinreichend zu kümmern. Ich machte mir große Sorgen und fuhr so oft es ging zu ihr. Ich traf sie stets auf dem Gang an, während sie den Ausgang suchte. Sie roch streng, war ungewaschen und trug manchmal fünf Pullover und Hemden übereinander. Oft schien sie den ganzen Tag nichts getrunken zu haben. Mir wurde dabei immer wieder gesagt, dass das Pflegepersonal keine Zeit habe, die Bewohner ständig ans Trinken zu erinnern. Da seien schon die Angehörigen in der Pflicht, sich – als Teil des pflegerischen Versorgungskonzepts – einzubringen.
Ich verstehe das. Die Pflegekräfte stehen unter enormem Druck und Angehörige wie ich, die dann auch noch mit Vorwürfen aufwarten, machen die Situation noch angespannter. Das Personal gab sein Bestes. Und ich auch. Nur studierte ich zu der Zeit in Regensburg, fast drei Autostunden von meiner Großmutter entfernt, und konnte nicht jeden Tag bei ihr sein. Und so baute sie vor unser aller Augen jeden Tag ein bisschen mehr ab, vor allem körperlich. Ich hielt das irgendwann nicht mehr aus. Eines Tages setzte ich sie ins Auto und fuhr sie nach Hause. Ich merkte sofort, als sie an der Haustür stand, dass sie trotz der schweren Demenz wusste, wo sie war. Sie strahlte mich an, sagte: »Ich mach uns jetzt eine Suppe«, und lief zielgerichtet in ihre Küche. Ich war geschockt, überglücklich und weinte. Ich hatte ihr eine Riesenfreude gemacht, und dieser kleine, von ihr gesprochene Satz war so »typisch Oma«, dass ich tatsächlich die vage Hoffnung hatte, »sie würde noch mal werden«.
Natürlich war dem nicht so. In der Küche stellte sie eine Tupperdose auf den Herd und schaltete ihn ein. Die Dose schmolz bereits, als ich dazukam. Dieser Ort weckte mit Sicherheit bestimmte Erinnerungen in meiner Großmutter, jedoch lösten sie nur vollkommen wirres Verhalten aus. Die Toilette fand sie gar nicht mehr, sodass ich sie am Abend erst mal wie ein kleines Kind duschen und stundenlang das Haus putzen musste. Sie hatte ihr Geschäft in mehreren Zimmern verrichtet. Nachts schlief sie nicht und lief verwirrt umher, schon nach einem Tag war ich fix und fertig. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sie zurück ins Heim zu bringen, brach mir das Herz. Aber es ging nicht anders. Ich musste wieder zur Uni und ließ meine Großmutter in diesen fremden Räumen zurück, die sie vermutlich wie ein Gefängnis empfand.
Meine Familie bekam damals keine Beratung. Wir wussten nicht, welche Möglichkeiten es gegeben hätte, ihr zu helfen. Wir waren völlig allein gelassen und ich mit zwanzig nicht weitsichtig genug, um selbst aktiv werden zu können. Meine Großmutter lebte dann nur noch ein halbes Jahr. Sie starb an den Folgen einer Bauchfellentzündung, die im Heim unbemerkt geblieben war. »Wir können ja nicht bei jeder Kleinigkeit gleich den Notarzt rufen«, war die Aussage im Pflegeheim, als meine Großmutter sich vor Schmerzen wand. Als schließlich doch ein Arzt gerufen wurde, war es zu spät: Kurze Zeit später war sie tot.
Die Erfahrungen als Angehörige eines schwer kranken, älteren Menschen haben mich sehr geprägt. Ich studierte zu der Zeit Psychologie, wollte aber eigentlich als Musikerin meinen Lebensunterhalt bestreiten. Seit ich zwölf Jahre alt war, schrieb ich Songs und wollte damit auf die Bühne, was ich dann später auch in immer größerem Umfang tat. Die Musik ist meine größte Leidenschaft, mein Lebenselixier und meine Berufung. Aber eben nicht die einzige. Durch die Erkrankung meiner Großmutter und die so frustrierenden Erlebnisse mit unserem Gesundheits- und Pflegesystem fand ich eine zweite Lebensaufgabe. Ich begann, alles zum Thema Alter und Demenz in mich aufzusaugen, was ich kriegen konnte, richtete mein Studium auf Hirnfunktionsstörungen aus und beschloss, trotz meiner Ambitionen als Musikerin, nach meinem Abschluss in die Demenzforschung zu gehen. Ich musste einfach herausfinden, woran unser Gesundheitssystem krankt! Warum meiner Großmutter hatte passieren können, was ihr passiert war.
Ich trat eine Stelle am Universitätsklinikum Ulm an, um über Demenzerkrankungen zu promovieren, und lernte dort erst einmal, was »Demenz« wirklich bedeutet. Dieser Begriff, der im Volksmund meist mit »Alzheimer« gleichgesetzt ist, bedeutet lediglich: kognitiver, also das Denken betreffender Abbau. Und der kann viele unterschiedliche Ursachen haben. Ich lernte, dass auch junge Menschen an einer Demenz leiden können und viele neurodegenerative, also mit dem Absterben von Nervenzellen assoziierte Hirnerkrankungen erblich bedingt sein können. Ich lernte, dass die Menschen oft monate- oder sogar jahrelange Odysseen von Arzt zu Arzt hinter sich haben, bis sie beim richtigen Spezialisten vorstellig werden. Ich lernte, dass unser Gesundheitssystem nicht dafür ausgelegt ist, Demenzpatienten in jedem Fall ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Ich lernte, dass diese Erkrankung dramatische Folgen für ganze Familien bedeutet und nicht nur die Patienten, sondern auch die Angehörigen irgendwann am Ende sind. Ich lernte, dass wir trotz des immensen medizinischen Wissensstands in unserem Land immer noch hilflos zusehen müssen, wie Menschen an dieser Erkrankung sterben.
Ich musste erst Teil des Gesundheitssystems werden, um zu erfahren, dass meine Großmutter nach ihrem Unfall schnell hätte operiert werden müssen und die Chancen dann vielleicht gut gestanden hätten, dass sie kein Vollpflegefall wird. Dass die damaligen Ärzte einen in der CT ersichtlichen globalen Hirnschwund als Beweis einer Demenz angesehen hatten, obwohl die Studienlage beweist, dass ein Bildgebungsbefund allein noch keine Diagnose macht. Auch das gesunde alternde Gehirn schrumpft, also atrophiert, das muss aber noch lange nicht mit einer klinisch relevanten Demenz einhergehen. Ich musste erst selbst in der Demenzforschung arbeiten, um zu erfahren, dass meine Großmutter an einer vaskulären Demenz litt. Dass es spezifische Hilfsangebote für sie gegeben hätte, die auch eine häusliche Pflege erlaubt hätten. Dass es Therapiemöglichkeiten gegeben hätte, um noch vorhandene Fertigkeiten bestmöglich zu erhalten.
Um einige dieser Dinge wird es in den folgenden Kapiteln gehen. Dieses Buch wird dabei keinen vollständigen Überblick über Demenzen geben können. Zu umfangreich und komplex ist das Thema, um es für Lesende ohne fachliches Hintergrundwissen bis ins Detail verständlich darzulegen. Vielmehr möchte ich in den folgenden Kapiteln den immer wiederkehrenden Fragen und Nöten von betroffenen Familien Rechnung tragen, die mich in meiner Arbeit als Psychologin in den letzten zehn Jahren begleitet haben. Ich möchte, dass Sie die wichtigsten Formen der Demenzerkrankung kennenlernen und nachvollziehen können, warum es für die Forschung im Moment noch so schwierig ist, ein Heilmittel zu finden. Ebenso möchte ich Ihnen darstellen, wo unser Gesundheits- und Pflegesystem an seine Grenzen stößt und wo für Sie als Angehörige, Freunde und Bekannte von Menschen mit demenziellen Erkrankungen die größten Gefahren lauern, sich zu überlasten. Mein Wunsch ist es, dass Sie nach dem Lesen von Wie meine Großmutter ihr Ich verlor gestärkt sind für ein Leben an der Seite eines oder einer Demenzkranken, Sie sich weniger überfordert fühlen und erkennen, dass Sie nicht alleingelassen werden.
Was bedeutet Demenz?
Der Traum von der ewigen Jugend
Über eine Milliarde Menschen nutzen das soziale Netzwerk Instagram weltweit und auch ich lade dort regelmäßig Fotos und Videos hoch, um so eine mir großteils völlig unbekannte anonyme Masse an Internetusern an meinem Leben – zumindest als Musikerin – teilhaben zu lassen. Bevor man ein Bild veröffentlicht, hat man die Möglichkeit, es mithilfe eines sogenannten Filters zu bearbeiten, um es »aufzuhübschen«. Egal, wie viele Fältchen meine Augen umrahmen, egal, wie schal mein Teint wirkt oder wie müde meine Augen dreinblicken – mit einem einzigen Klick sehe ich wieder aus wie zwanzig. Dann raus damit in den »Äther« und mich feiern lassen für mein gutes Aussehen. Kaum jemand hinterfragt die Authentizität solcher Uploads, denn das Optimieren der eigenen Selbstdarstellung ist zu einer völligen Selbstverständlichkeit geworden. Dabei sind die Fotofilter bei Instagram ebenso wie andere Bildbearbeitungsprogramme, deren Ergebnisse uns von Werbetafeln oder aus Magazinen entgegenstrahlen, vor allem auf eines hingetrimmt: Jugend. Das ästhetische Ideal unserer Zeit ist zwangsläufig mit makelloser Haut und der ewigen Blüte adoleszenter Unverbrauchtheit verbunden. Der eigene Alterungsprozess wird so gut es geht kaschiert. Wer am Ende dann doch nicht mehr verschweigen kann, dass er die vierzig längst überschritten hat, ist zumindest »jung geblieben«, »gut erhalten« oder »Best Ager«. Die »Anti-Aging«-Industrie boomt ebenso wie Fitnesstempel, Selbstoptimierungs-Ratgeber werden zu Bestsellern und das Alter wird fast schon zu einem Tabu, einer Beleidigung, assoziiert mit Verfall, Endlichkeit, Tod.
Wir leben in einer von Leistungsdenken angetriebenen Welt, da macht es wohl Angst, zu wissen, dass Energie endlich, Kapazitäten begrenzt und Arbeitskraft austauschbar ist. Die meisten von uns wollen am liebsten für immer mitten im Leben stehen und setzen das Ende dieser Welt mit dem Eintritt ins Rentenalter gleich. Doch auch dann geht es im gleichen Stile weiter: Man hat beizeiten das Gefühl, aus dem Berufsleben ausgeschiedene Rentnerinnen und Rentner haben einen volleren Terminkalender als manch Dreißigjähriger. »Alte« Menschen, die mit dem Flow gegenwärtiger Lebensgestaltungstempi nicht mehr mithalten können, werden – so fühlt es sich zumindest oft an – an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Man will sich nicht damit auseinandersetzen, dass ewige Jugend ein Traum aus Grimm’schen Märchen ist. Doch wie sagte Willy Brandt so treffend? »Eine Gesellschaft, … die das Alter nicht erträgt, … wird an ihrem Egoismus zugrunde gehen.«
Das alternde Gehirn
Die Wahrheit ist: Wir können nicht verhindern, alt zu werden. Egal, wie sehr wir versuchen, den ins Land gegangenen Jahren mit allerlei Verjüngungskuren entgegenzuwirken, die Natur ist und bleibt erbarmungslos. Und um die Sache noch beklagenswerter zu machen: Nicht nur unser Körper wird alt, auch unser Gehirn. Gedächtnisprobleme, Wortfindungsstörungen, Schwierigkeiten, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun – wer ein höheres Alter erreicht, kommt zwangsläufig mit solchen Phänomenen in Berührung, egal wie »jung geblieben« er sich fühlen mag.
Unser Gehirn ist ein komplexer Hochleistungsprozessor, bestehend aus sechsundachtzig Milliarden Nervenzellen,1 die in komplexen Netzwerken miteinander verbunden sind und erst durch eben diese Gedanken, Zustände und Verhalten entstehen lassen. Während ich diese Zeilen schreibe, tobt in meinem Kopf ein Feuerwerk. Ich formuliere Gedanken aus, indem mein präfrontaler Kortex, also die Hirnrinde hinter meiner Stirn, in meinem Langzeitgedächtnis im Schläfenlappen kramt, um die dafür nötigen Informationen abzurufen. Gleichzeitig kommunizieren beide mit meiner motorischen Hirnrinde, die meine Finger auf der Computertastatur in Bewegung bringt, mein Sprachzentrum kümmert sich um Wortschatz und Grammatik, die Region an der Hinterwand meines Kopfes nimmt die visuellen Informationen meines Word-Dokuments von meinen Augen auf und bastelt sie mit vielen weiteren Hirnarealen zu dem Text zusammen, den Sie gerade lesen. Mein Gehirn liest mit, während ich schreibe, verarbeitet die Information wiederum in meinem Kurzzeitgedächtnis, speichert es mithilfe der Hippocampus-Struktur meines limbischen Systems im besten Fall in meinem Langzeitgedächtnis ab, meine Amygdala arbeitet und emotionalisiert mich, während ich mir der wahnsinnigen Leistung meines Gehirns bewusst werde. Ja und mein Bewusstsein, mein Ich, wo sitzt das in meinem Gehirn? Ich wünschte, ich könnte diese Frage beantworten.
Auf den Punkt gebracht: Die Nervenzellen unseres Gehirns arbeiten nicht isoliert voneinander. Gesund sind wir nur, wenn dieses unvergleichliche Netzwerk in seiner Kommunikation ungestört ist, unsere Abermillionen Zellen miteinander »sprechen« und sich abstimmen können.
Zu einer Zeit, in der es unmöglich war, Hirnprozesse mittels bildgebender Verfahren wie der Magnetresonanztomografie (MRT) darzustellen, war es Ende des 18. Jahrhunderts ein deutscher Mediziner, der geistige Eigenschaften, Verhaltensweisen und Zustände erstmals mit verschiedenen Hirnstrukturen systematisch in Zusammenhang bringen wollte. Franz Joseph Gall (1758–1828) begründete die »Lokalisationslehre«, in der er propagierte, dass bestimmte Charaktereigenschaften und Geisteszustände in klar voneinander abgrenzbaren Hirnarealen säßen. Er ging sogar so weit, zu behaupten, dass er an der Schädelform den Charakter, die Stärken und Schwächen eines Menschen ablesen könne. So meinte er, dass die Eigenschaft »Anhänglichkeit« am Hinterkopf zu verorten sei und dieser bei Frauen meist besonders lang sei. »Raufbolde« hätten einen besonders breiten Kopf hinter den Ohren, Menschen mit gutem Orientierungssinn seien an einer ausgeprägten Stirn zu erkennen. Galls Lehre war schnell überholt, da empirisch nicht begründbar. Dennoch war sie lange populär, zur Zeit des Nationalsozialismus wurde sie gar herangezogen, um der damaligen Rassenlehre ein wissenschaftliches Fundament zu verschaffen. Anhand von Schädelproportionen sollte die Bevölkerung in Rassen eingeteilt und die vermeintliche Überlegenheit der Deutschen bewiesen werden. Auch heute gibt es noch Ableger von Galls These. Als ich einmal einen Auftritt in der Abendschau des Bayerischen Fernsehens hatte, war neben mir eine Dame zu Gast, die ihr Geld damit verdient, Menschen anhand ihrer Schädelform zu analysieren. Dem Moderator sprach sie aufgrund seiner Schädelform ein besonders ausgeprägtes rhetorisches Talent zu. Ich war überrascht, womit man es heutzutage ins Fernsehen schafft.
Das menschliche Gehirn macht mit 1,2 bis 1,5 Kilogramm nur etwa 2 Prozent unseres Körpergewichts aus, verbraucht jedoch 25 Prozent unseres täglichen Energiebedarfs. Das ist nicht verwunderlich, arbeitet es doch unentwegt, jede Sekunde unseres Lebens muss es Informationen aufnehmen. Selbst wenn wir schlafen, ist es noch damit beschäftigt, Gelerntes, Gefühltes und Erlebtes zu verarbeiten. Viele Hochleistungssportler leben nach ihrer aktiven Karriere (und teilweise schon während dieser) mit den negativen Langzeitfolgen jahre- und jahrzehntelanger Ausreizung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit bis an die Belastungsgrenze. Erleben wir vergleichbare Prozesse in unserem Gehirn, wenn wir älter werden? Ist Altern stets mit Krankheit verbunden, weil unser Gehirn »sich abnutzt«? So einfach ist es tatsächlich nicht. Und die These, dass Altern stets mit Krankheit verbunden sei, ist an sich schon nicht richtig. Es gibt sogar ziemlich viele Studien zum Thema »gesundes Altern«, die vielleicht nicht immer ganz sachlich und somit wissenschaftlich höchst fragwürdig sind, jedoch ziemlich viel Spaß machen. Wussten Sie, dass es Studien gibt, die sagen, dass zwei bis drei Gläser Rotwein am Tag das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, um die Hälfte senken? Man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, solch eine These wirklich zu untersuchen, sind wir doch tagtäglich so vielen unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Demenzprävention kaum belegbar ist. Ferner muss differenziert werden, welche Inhaltsstoffe eines Weines wirklich nachweislich positive Effekte auf den Organismus haben und ob diese die grundsätzlich destruktive Wirkung von Alkohol aufwiegen können. Im Falle des Rotweins ist es der Stoff Resveratrol, der Winzer und Mediziner aufjubeln lässt. Er findet sich in einer Anzahl von Pflanzen, vor allem in Weintrauben, Himbeeren und Erdnüssen, und minderte in verschiedenen Studien pathologische Prozesse der Alzheimer-Erkrankung. Zugegebenermaßen in Tiermodellen, die Übertragbarkeit auf den Menschen sei dahingestellt. Dennoch erfreut sich dieses Ergebnis nach wie vor großer Beliebtheit und ist auch für mich an warmen Sommerabenden ein willkommenes Argument, eine Flasche zu öffnen.
Die gute Nachricht ist, dass wir tatsächlich aktiv dazu beitragen können, gesund zu altern, denn unser Gehirn besitzt eine großartige Eigenschaft: neuronale Plastizität. Wie schon beschrieben sind die Nervenzellen unseres Gehirns in riesigen Netzwerken miteinander verbunden. Jede Nervenzelle ist an ihren Fortsätzen über sogenannte Synapsen mit anderen Nervenzellen verbunden und diese Nervenzellverbindungen sind beeinflussbar. So meint das Konzept der neuronalen Plastizität die lebenslange Fähigkeit des Gehirns, seine Struktur und Organisation den jeweiligen situativen und biologischen Bedingungen anzupassen. Genau deshalb werden Patienten nach Schlaganfallereignissen in Reha geschickt. Es ist erstaunlich, in welchem Ausmaß unser Gehirn in der Lage ist, bestehende Schädigungen zu kompensieren, indem es sich neue neuronale Wege sucht und andere Nervenzellverbindungen stärkt, um Defizite auszugleichen.
Der Alterungsprozess in unserem Gehirn betrifft seine Moleküle, Zellen, Gefäßsysteme, seine Morphologie (Gestalt) sowie die kognitive Leistungsfähigkeit und wird durch ein komplexes Zusammenspiel aus genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen, Hormonen und Neurotransmittern (Botenstoffen) moduliert. Verschiedene Studien zeigten, dass unser Hirnvolumen nach dem vierzigsten Lebensjahr um etwa 5 Prozent pro Dekade abnimmt.2 Dabei ist es wohl weniger ein Zellsterben, das zum »Schrumpfen« unseres Gehirns führt, sondern eine Abnahme der Größe jeder einzelnen Zelle, welches das Organ dann auch als Ganzes kleiner werden lässt.3 Nicht alle Hirnregionen nehmen in gleichem Ausmaß ab. Besonders anfällig für den Alterungsprozess scheint das Hirnareal zu sein, das auch am spätesten in unserer Adoleszenz fertig ausgebildet ist: der präfrontale Kortex.4 Diese Region direkt hinter unserer Stirn ist in eine Vielzahl höherer kognitiver Funktionen wie Emotionsverarbeitung und Sozialverhalten involviert und steuert die »exekutiven Funktionen«, die beispielsweise die Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit, die Koordination zielgerichteten Verhaltens, kognitive Flexibilität, Problemlösefähigkeiten oder Handlungsplanung umfassen.5Neben einer Volumenabnahme sind weitere Veränderungen beobachtet worden: Die Nervenzellfortsätze im Gehirn arbeiten schlechter und Faserverbindungen gehen zugrunde,6 außerdem nehmen neuronale Aktivierungslevel ab. Wer in ein bestimmtes Alter kommt, kennt das: Man braucht etwas länger, um Sachverhalte nachzuvollziehen, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun überfordert schneller, die Konzentrationsfähigkeit ist herabgesetzt. Bis zu einem gewissen Grad ist das völlig normal, das Alter macht nicht vor unserer geistigen Leistungsfähigkeit Halt. Spannend ist die Frage, welche kognitiven Defizite im Rahmen des normalen Alterns einzuordnen sind und wo der Verdacht auf eine Demenzerkrankung beginnt. Viele besorgte Menschen kommen mit dieser Frage in unsere neurologische Hochschulambulanz, in unsere sogenannte Gedächtnissprechstunde, in der etwaige kognitive Beeinträchtigungen abgeklärt werden können. Wir nutzen hierfür beispielsweise die Neuropsychologie als Teildisziplin der Psychologie, die unter Zuhilfenahme von Leistungstests in der Lage ist, gut zwischen pathologischen und altersentsprechenden kognitiven Leistungen zu unterscheiden. Zusätzlich stehen uns inzwischen eine Vielzahl technischer Möglichkeiten zur Verfügung, um eine Demenz zu entdecken und einzuordnen. Pionier bei der Erforschung der Demenzerkrankung war ein Psychiater aus Frankfurt, der Anfang des 20. Jahrhunderts als Oberarzt an der »Anstalt für Irre und Epileptische« in Frankfurt am Main arbeitete: Alois Alzheimer.
Alois Alzheimer und sein Vermächtnis
»Ich glaube, ich habe Alzheimer.« Wer hat diesen Satz nicht schon einmal benutzt, wenn ihm etwas einfach nicht einfallen wollte? Im Sprachgebrauch wird Alzheimer immer wieder mit Demenz gleichgesetzt, was die medizinhistorische Bedeutung des Frankfurter Psychiaters bis heute eindrücklich deutlich macht, aber gleichzeitig auch das Unvermögen unseres Gesundheitssystems entlarvt, über den Demenz-Begriff und die sich dahinter verbergenden Syndrome ausreichend aufzuklären. Bis heute halten sich hartnäckig eine Reihe von falschen Annahmen in der Allgemeinbevölkerung, die im ungünstigsten Fall dazu führen, dass die betroffenen Familien viel zu spät einen Arzt aufsuchen. Zum Beispiel bekomme ich von Familien auf die Frage, ob es bei ihnen in früheren Generationen schon einmal Fälle von Demenz gab, recht häufig eine Antwort wie diese: »Ja, aber der Opa war halt schon achtzig und bekam dann eine normale Altersdemenz.« Was aber ist eine »normale Altersdemenz«? Es ist eben nicht normal, per se in höherem Lebensalter dement zu werden. Demenz ist immer eine Erkrankung.
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden demenzielle Symptome wenig wissenschaftliches Interesse, deutsche Mediziner sahen damals nicht einmal die Notwendigkeit, die senile Demenz systematisch zu beschreiben und zu erfassen, war sie doch als psychisches Leiden alter Menschen ohne Therapieoption höchstens eine Indikation für die dauerhafte Unterbringung in einer damals als »Irrenanstalt« bezeichneten Einrichtung. »Altersblödsinn« nannte man das Krankheitsbild, dem nicht nur keine organischen Ursachen zugeschrieben wurden, sondern dem sogar nachgesagt wurde, es sei auf einen unzüchtigen Lebenswandel zurückzuführen. Dass es sich hier aber um einen manifesten Erkrankungsprozess im Gehirn handelt, den man klar benennen kann, wies erst Alois Alzheimer nach und ließ ihn zusammen mit seiner Patientin Auguste Deter in die Geschichtsbücher eingehen.
Deter wurde 1901 von ihrem verzweifelten Ehemann in die Frankfurter »Anstalt für Irre und Epileptische« eingeliefert. Sie war deutlich verwirrt, konnte sich kaum an mehr als ihren Vornamen erinnern und wirkte so wie eine typische Patientin mit »Altersblödsinn«. Was ihren behandelnden Arzt Alois Alzheimer jedoch aufhorchen ließ, war ihr Alter: Die Dame war zum Zeitpunkt ihrer Einlieferung erst einundfünfzig Jahre alt. Alzheimer dokumentierte den Zustand der Patientin in gestochener Handschrift und Dialogform auf dreißig bis heute erhaltenen Aktenseiten. »Der Irrenarzt mit dem Mikroskop« wurde er genannt, denn er kümmerte sich nicht nur um die Kranken, sondern forschte nachts unbezahlt im Keller der Anstalt an den möglichen organischen Ursachen der ihm dargebotenen Erkrankungen. Alzheimer verfolgte auch den Fall Auguste Deter bis zu ihrem Tod 1906 nach, selbst als er eine neue Stelle an der Psychiatrischen Klinik in München antrat. Er ließ sich sogar das Gehirn der Patientin zuschicken, nachdem diese verstorben war, und untersuchte es, um die Ursachen dieser so frühen und eindrücklichen demenziellen Veränderungen herauszufinden, die vorher nur viel älteren Menschen zugeschrieben worden waren.
Was er fand, waren eine Menge abgestorbener Hirnnervenzellen und Eiweißablagerungen (sogenannte senile Plaques), also sehr wohl biologische Veränderungen, die für die Verschlechterung des geistigen Zustands der Patientin ursächlich waren und sich deutlich von einem gesund alternden Gehirn unterschieden. Bis heute sind die Arbeiten von Alois Alzheimer an der nach ihm benannten Erkrankung Grundlage unzähliger wissenschaftlicher Studien. Das Konstrukt des psychiatrisch bedingten »Altersblödsinns« hatte er eindeutig widerlegt. Dennoch sollte es noch Jahrzehnte dauern, bis die Erkrankung in medizinischen Lehrbüchern nicht mehr nur mit ein paar Zeilen bedacht wurde. Ein öffentliches Thema wurde die Alzheimer-Erkrankung erst durch das Leiden von Prominenten, allen voran der amerikanischen Schauspielerin und Tänzerin Rita Hayworth, die in den 1940er-Jahren als Hollywoods »Liebesgöttin« gefeiert worden war und sich ab ihrem fünfzigsten Lebensjahr zunehmend veränderte, begleitet von einer oftmals würdelosen und weltweit große Beachtung findenden medialen Berichterstattung der Regenbogenpresse. Die Künstlerin fiel seit Anfang der Siebzigerjahre wiederholt durch Skandale und peinliche Ereignisse auf, war zunehmend aggressiv gegenüber Kollegen oder musste Filmaufnahmen abbrechen, weil sie sich Texte nicht mehr merken konnte. Eine ihrer letzten Schlagzeilen machte die Schauspielerin Anfang der Achtzigerjahre, als Passanten sie völlig verwirrt vor einem Hotel vorfanden, während sie verzweifelt den Eingang suchte und nicht einmal mehr ihren Namen wusste. Fast ein Jahrzehnt war da seit den ersten Symptomen vergangen, ein Jahrzehnt, in dem die Künstlerin stets einfach als schwere Alkoholikerin abgestempelt worden war. Erst jetzt zogen Ärzte eine Alzheimer-Demenz in Betracht, so abwegig schien den Medizinern zum damaligen Zeitpunkt noch eine solche Diagnose. Als 1981 bekannt wurde, was die Ursache für Hayworth’s bizarres Verhalten war, wurden diese neurodegenerative Erkrankung und die damit verbundenen dramatischen Veränderungen eines Menschen erstmals einer breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt. So begann sich – knapp achtzig Jahre nach der Entdeckung durch Alois Alzheimer – ein Bewusstsein für diese Erkrankung zu entwickeln: 1982 rief die Tochter von Rita Hayworth zusammen mit dem US-Präsidenten Ronald Reagan die erste National Alzheimer’s Disease Awareness Week in den USA aus. Unzählige Initiativen weltweit folgten und Millionen an Forschungsgeldern fließen seitdem in die Kassen wissenschaftlicher Konsortien und Organisationen zur Erforschung der Demenzerkrankungen.
Volkskrankheit Demenz
Ich kam mit dem Thema Demenz nie in Berührung, bis meine Großmutter daran erkrankte. Ich wuchs, 1986 geboren, behütet in einem kleinen Dorf in Bayern auf, einem Zweihundert-Seelen-Ort mit kleinen landwirtschaftlichen Betrieben. Jeder kannte so gut wie jeden. Wir Kinder verbrachten unsere Zeit im Wald, um uns Hütten oder Baumhäuser zu bauen, sammelten mit der Oma Äpfel und Nüsse im eigenen Garten, fuhren mit unserem alten Traktor über die Felder und waren weiß Gott Teil einer »heilen Welt«. Ich kann mich nicht erinnern, dass es während meiner Kindheit im Ort jemand gegeben hätte, der an einer Demenz gelitten hat. Meiner Erinnerung nach traf man die Alten sonntags in der Kirche oder auf ihren Höfen auf Bänken sitzend, während wir Kinder mit unseren Fahrrädern durchs Dorf flitzten.
Heute bin ich mir sicher, dass es Demenzkranke gegeben haben muss, aber man sprach vielleicht nicht darüber. Ich bin mir deswegen sicher, weil die Häufigkeit dieser Erkrankung so hoch ist, dass theoretisch jeder Zweite von uns einen Patienten kennt oder sogar einen Angehörigen hat, der betroffen ist.7