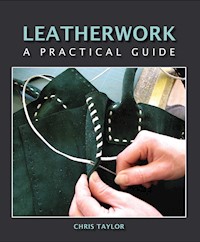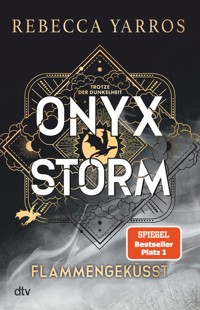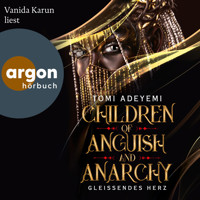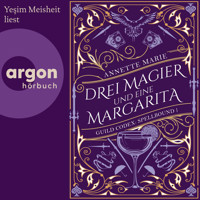6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der ultimative Guide durch das Universum von STAR WARS!
Ein junger Filmemacher namens George Lucas machte sich 1973 ein paar Notizen für einen bunten Weltraum-Film. Vier Jahrzehnte später sind aus diesen Notizen eine siebenteilige Filmreihe, ein Popkulturphänomen und ein milliardenschweres Merchandising- Unternehmen geworden – es gibt heute mehr Star-Wars-Produkte als Menschen auf dem Globus! Wie es dazu kam und was Star Wars aus unserer Kultur gemacht hat, das erzählt der Journalist Chris Taylor auf so packende wie unterhaltsame Weise. Ein Muss für jeden Fan – und alle, die es diesen Winter noch werden!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1038
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Im Frühsommer 1973 macht sich ein junger Filmemacher namens George Lucas ein paar Notizen zu einem bunten Weltraum-Abenteuerfilm. Vier Jahrzehnte später sind aus diesen Notizen eine siebenteilige Filmreihe, ein globales Popkulturphänomen und ein milliardenschweres Merchandisingunternehmen geworden. Wie kam es dazu, dass heute fast jeder Mensch schon einmal von Star Wars, den Jedi-Rittern und Darth Vader gehört hat? Und dass es heute mehr Star Wars-Produkte gibt als Menschen auf dem Globus? Der Journalist Chris Taylor geht dieser Frage nach und erzählt auf so packende wie unterhaltsame Weise die Geschichte des erfolgreichsten Film-Franchises der Welt. Dabei lässt er Wegbegleiter von George Lucas ebenso zu Wort kommen wie begeisterte Fans aus allen Jahrzehnten und vor allem die Stars seiner Filme selbst, um schließlich auch die jüngsten Entwicklungen des Star Wars-Universums zu betrachten. Denn eines zeichnet Star Wars von Anfang an aus – es geht immer weiter …
Der Autor
Chris Taylor studierte an der Oxford University und an der Columbia Graduate School of Journalism. Danach arbeitete er zwanzig Jahre lang als Journalist für die verschiedensten Zeitungen und Magazine, darunter für die Time, Business 2.0, Fortune Small Business und Fast Company. Inzwischen ist er der Herausgeber des Social-Media-Onlinemagazins Mashable. Er lebt in Berkeley, Kalifornien.
Mehr Informationen zu diesem Buch und zu Star Wars auf:
diezukunft.de
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
CHRIS TAYLOR
WIE
DAS UNIVERSUMEROBERTE
Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunfteines Multimilliarden-Dollar-Imperiums
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
HOW STAR WARS CONQUERED THE UNIVERSE – THE PAST, PRESENT, AND FUTURE OF A MULTIBILLION DOLLAR FRANCHISE
Deutsche Übersetzung von Michael Nagula
Deutsche Erstausgabe 12/2015
Redaktion: Rainer Michael Rahn
Copyright © 2015 by Chris Taylor
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-16884-1V002
diezukunft.de
INHALT
Einführung: Eine Navajo-Hoffnung
1 Marskriege
2 Das Land des Zoom
3 Plastik-Raumfahrer
4 Hyperraum-Antrieb
5 Was einen Jedi ausmacht
6 Buck Rogers im 20. Jahrhundert
7 »Home Free« – Freie Heimat
8 Mein kleines Weltraum-Ding
9 Krieg der Parodien
10 Star Wars hat seine Gang
11 Die erste Rolle
12 Erscheinen
13 Das Zufallsimperium
14 Hier kommen die Klone!
Bildteil
15 Wie man sich mit Fortsetzungen selbst übertrifft
16 Ein Leben als Boba
17 Das Ende der Jedi?
18 Zwischen den Kriegen
19 Das Universum expandiert
20 Die Rückkehr des Autors
21 Äußerst spezielle Editions
22 Die Warteschlange
23 Die Prequels erobern Star Wars
24 Charaktere aufbauen – buchstäblich
25 Dr. Young oder Wie ich lernte, die Prequels zu lieben
26 Unter Einsatz des Universums
27 Hallo, Disney!
Ausklang: Quer durchs Universum
Epilog: Das Erwachen der Macht
Danksagung
Für Jess, die wahre Auserwählte
EINFÜHRUNG
EINE NAVAJO-HOFFNUNG
George James senior war achtundachtzig Jahre alt, als ich ihm im Juli 2013 begegnete, doch im purpurnen Schein der untergehenden Wüstensonne machte er einen beinahe zeitlosen Eindruck. Er hatte ledrige Haut, eine schmale Statur, tief liegende kohlschwarze Augen und trug einen weißen Stetson; wegen des Granatsplitters, der seit 1945 in seinem Rücken saß, ging er ein wenig gebeugt. James ist ein Tohtsohnnii, die zum Großen Wasserklan vom Volk der Navajos gehören, und wurde dort geboren, wo er heute noch lebt: in den Bergen unweit Tsaile, Arizona.
Mit siebzehn wurde James eingezogen und zu einem der außergewöhnlichsten Veteranen im Zweiten Weltkrieg – einem Code Talker. Er war einer von fünf Code Talkern, die den Strand von Iwo Jima stürmten und in ihrer Eingeborenensprache mehr als achthundert lebenswichtige Nachrichten zwischen der Insel und dem Befehlsstand vor der Küste hin- und herschickten. Ihr Code war praktisch nicht entschlüsselbar, weil es damals außerhalb des Stammes auf der ganzen Welt nicht einmal dreißig Menschen gab, die die Navajo-Sprache beherrschten. Darüber hinaus half der 83 Kilo schwere James auch noch, einem bewusstlosen anderen Gefreiten das Leben zu retten, indem er dessen 100 Kilo schweren Körper über den schwarzen Sand von Iwo mitten in einen Fuchsbau schleppte. Die Ruhe, die er unter Beschuss wahrte, bestimmte den Ausgang der schrecklichen Schlacht und wohl auch des Krieges mit. »Ohne die Navajos«, sagte ein Major in Georges Division, »hätten die Marines Iwo Jima niemals einnehmen können.«
James’ Erzählung vom Krieg genügte schon, dass mir die Kinnlade herunterfiel, als ich ihm begegnete. Doch da war noch etwas, was ihn beinahe ebenso unglaublich machte. George James war die erste Person, die mir nach einjähriger Suche untergekommen war, die offenbar keinen blassen Schimmer von dem Spielfilm zu haben schien, den wir uns ansehen wollten: etwas, das sich Star Wars nannte.
»Als ich den Titel hörte, dachte ich: ›Die Sterne führen Krieg?‹«, meinte James und zuckte mit den Achseln. »Ich gehe nicht ins Kino.«
Es gab keine Lichtspielhäuser hier in Window Rock, Arizona, der sonnengebleichten Metropole der Navajo-Nation, seit das letzte 2005 schloss. Window Rock ist ein Kaff mit einem McDonald’s, einem Einkaufsladen, ein paar Hotels, dem natürlichen Sandsteinbogen, dem es seinen Namen verdankt, und einer Statue zu Ehren der Code Talker. Es gibt hier jede Menge Bildschirme, aber die sind privat: Teens blättern auf Parkplätzen in ihren Smartphones; es gibt iPads, Fernseher und WLAN in Window Rock, wie in jeder anderen Westernstadt des 21. Jahrhunderts auch. Doch es gibt keine große öffentliche Leinwand, vor der die Leute – sie werden Diné, Navajo oder einfach nur Leute genannt – zusammenkommen und sich gemeinsam an einem projizierten Traum erfreuen können.
Aber 2013 änderte sich das für eine Nacht. Am 3. Juli wurde der erste in einer amerikanischen Eingeborenensprache synchronisierte Kinofilm im Rodeogelände auf eine gewaltige Leinwand projiziert, die mit der Seite eines Zehn-Tonnen-Trucks verschraubt war. Nicht weit vor der Stadt, auf dem Highway 49, hing das einzige Plakat, das dieses historische Ereignis bewarb, auf einer Reklametafel mitten in der Wildnis, die für diese Zeit zur heißesten Attraktion am Straßenrand an der Grenze zwischen Arizona und New Mexico wurde: »Star Wars Episode IV: A New Hope, übersetzt in die Sprache der Navajo«, war dort neben einem Kinoplakat von 1977 zu lesen.
Ich muss dieses Star Wars-Plakat wohl schon eine Million Mal gesehen haben, doch von Gallup kommend, auf dieser von mit Sträuchern bedeckten Tafelbergen umgebenen Landstraße, gelang es mir beinahe, es mit einem frischen Blick zu sehen. Der Junge im weißen Gewand streckt anscheinend eine Art Stablampe in den Himmel; eine junge Frau mit eigenartigen Haarknoten posiert neben ihm mit einer Pistole. Hinter ihnen erhebt sich ein riesiges Gasmaskengesicht mit toten Augen und einem Samurai-Helm. Was für ein seltsamer Traum dieser Film sein musste.
Gleich hinter dem Ortseingang befindet sich das Navajo Nation Museum, das die letzten drei Jahre damit verbrachte, LucasArts von einer Zusammenarbeit bezüglich dieser Star Wars-Version zu überzeugen. Ich fragte mich, warum sie so lange nicht locker ließen und sich nicht einfach ein anderes Übersetzungsprojekt suchten – und dann betrat ich das Büro des Museumsdirektors Manuelito Wheeler und sah ein Regal voller Boba-Fett-Figuren, die dort stolz ihren Platz behaupteten. Manny, wie er genannt wird, ist ein Bär von einem Mann mit regloser Miene und silbernen Flecken in seinem schwarzen Pferdeschwanz. Einen entspannteren und unprätentiöseren Museumsdirektor kann man sich nicht vorstellen. Seit unserem Telefonat nennt er mich »Kumpel«. Er sagte mir, dass er die Original-Trilogie liebte, seit er sie als Endzwanziger zum ersten Mal auf VHS gesehen hatte. Beim traditionellen Austausch von Star Wars-Zitaten anlässlich der Begrüßung zwischen Nerds schlug er sich mehr als wacker. (Als ich mich zu einem Anschlusstreffen mit ihm verspätete, schickten wir einander einen Dialog aus dem Flug durch die Todesstern-Gräben: »Halte auf das Ziel zu.« »Ich kann nicht mehr manövrieren!« »Halte auf das Ziel zu.«)
Wheeler konnte über den Zweck der Aufführung, die das Museum sich zur Förderung und Bewahrung der Navajo-Sprache ausgedacht hatte, ins Schwärmen geraten, doch er verstand auch, dass diese Gründe, wenn die Kampagne wirklich erfolgreich sein wollte, auf die gleiche Weise angegangen werden musste wie Star Wars selbst: voll Überschwang und Leichtigkeit.
Nicht dass es nicht eine große Notwendigkeit darstellen würde, die Navajo-Sprache zu erhalten. Die Muttersprache dieser Menschen, ebenfalls als Diné bekannt, liegt im Sterben. Nicht einmal die Hälfte der dreihunderttausend Angehörigen der Nation können sie überhaupt noch sprechen, davon weniger als einhunderttausend fließend. Nur einer von zehn kann Diné lesen. Zu George James’ Zeiten brachte man den Kindern in den Reservatsschulen Englisch bei, Diné sprachen sie zu Hause. Heutzutage wird Diné zwar an den Schulen unterrichtet, aber die Kinder des 21. Jahrhunderts haben keine große Lust, es zu lernen, wo doch auf ihren Smartphones, Tablets und Fernsehern alles auf Englisch abläuft? »Wir sind jetzt Klugscheißer«, seufzte Wheeler. »Wir müssen uns selbst neu erfinden.«
Was die nächste Generation der Diné braucht, findet er, sei genau das, was George Lucas für die Jugend der 1970er vorgeschwebt hatte: Abenteuer, Nervenkitzel, Gut gegen Böse, ein Märchen, in Raum und Zeit vom Hier und Jetzt völlig losgelöst und doch in vertrauten Themen und Mythen verwurzelt. Die Geschichte, an der Lucas jahrelang gearbeitet hatte, war in vieler Hinsicht ein Produkt seiner Zeit und der Epochen, die ihr vorausgegangen waren, doch der Traum, den er auf Zelluloid einfing, stellte sich als absolut geschmeidig und übertragbar heraus. Star Wars besaß vielleicht die Macht, Diné wieder cool zu machen.
Aber ist das nicht einfach eine Art von amerikanischem Kulturimperialismus, bei dem ein Eingeborenenvolk sich der Macht Hollywoods unterwirft? Wheeler hat für diesen Gedanken drei Worte parat: »Also echt, Kumpel.« Star Wars ist nicht Hollywood. Es ist das geistige Produkt eines überzeugten unabhängigen Filmemachers aus Marin County, der Hollywood hasste und einen Haufen Spezialeffekte-Freaks aus der noch jungen Gegenkultur rekrutierte und in einer Van-Nuys-Lagerhalle zusammenbrachte. Der Schurke dieser Geschichte, das Imperium, war vom amerikanischen Militär in Vietnam inspiriert, die Ewoks vom Vietcong, der Imperator von Präsident Nixon. Das Märchen war bezaubernderweise gnädig genug, diese Tatsache zu verschleiern, und jetzt finden sich alle Kulturen auf der ganzen Welt in der Rebellenallianz wieder. Doch die subversive Geschichte gab es bereits von dem Augenblick an, als Lucas sich zum ersten Entwurf niedersetzte. »Star Wars weist einen sehr ausgeklügelten sozialen, emotionalen und politischen Kontext auf, in dem es fest verankert ist«, sagte Lucas im Jahr 2012. »Aber dessen war sich natürlich niemand bewusst.«
Und es gibt noch einen Grund für die Navajo, Star Wars mehr als die meisten Kulturen bereitwillig anzunehmen. »Es hat etwas Spirituelles an sich«, meint Wheeler. Er weist darauf hin, dass Joseph Campbell, der Gigant der weltweiten Mythologie, sich auf die Navajo-Kultur stürzte. Das war das Thema von Campbells erstem Buch Where the Two Came to Their Father (1943), das drei Jahre vor Der Heros in tausend Gestalten erschien. Wenn dieses Buch George Lucas so sehr beeinflusste, wie er behauptet, sagt Manny, »dann schließt sich durch Star Wars in Navajo-Sprache der Kreis«.
Ich fragte Wheeler, was denn die Älteren – Senioren werden in der Diné-Kultur hoch geschätzt – von dem Film hielten. Er hob einen Finger, zog sein iPhone heraus und zeigte mir Aufnahmen von der Premiere vor der Belegschaft, einer Privatvorführung, zu der er einhundert Ältere eingeladen hatte. Er blätterte rasch durch Bilder alter Frauen in hellblauen und roten Kleidern. »Es ist eine matriarchale Kultur«, sagte er, »und wenn Prinzessin Leia auf der Leinwand erscheint, diese kraftvolle Gestalt, dann packt es sie.« Wheeler grinste und deutete auf seine Großmutter. »Und sie ist total vernarrt in Obi-Wan.«
Es freute mich für Wheelers Großmutter, aber meine Enttäuschung war deutlich sichtbar. Er konnte es nicht wissen, aber dadurch, dass er die Älteren zu einer Privataufführung für die Mitarbeiter eingeladen hatte, war meine letzte Hoffnung zunichte gemacht, jemanden zu finden, irgendjemanden, der wirklich noch nie etwas von Star Wars gehört hatte.
Der Weg, der mich nach Window Rock führte, hatte kurz vor dem fünfunddreißigsten Geburtstag von Star Wars im Jahr 2012 seinen Anfang genommen. Bei einem Meeting, um auf Mashable, der Website, für die ich arbeite, über diesen Meilenstein zu berichten, stellte sich heraus, dass einer von uns – die Feuilletonistin Christine Erickson – noch nie einen Star Wars-Film gesehen hatte. Unsere unmittelbare Reaktion: Wie hat sie das so lange überlebt? Ihr ganzes Leben hatte Christine unverständliche Redewendungen gehört wie »Möge die Macht mit dir sein« und »Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht«. Christine erinnerte sich: »Ich musste die Leute einfach fragen, wovon sie reden.« Die Reaktion ihrer Freunde lief immer auf etwas hinaus, »was zwischen Verachtung und lautem Gelächter« lag.
Mit Star Wars vertraut zu sein – oder zumindest mit dem Film von 1977, der so viele Fortsetzungen, Prequels, Fernsehadaptionen und andere Spin-offs hervorgebracht hatte, dass einem ganz schwindlig wird, und von dem das Buch, das Sie gerade in Händen halten, seine Berechtigung erfährt –, ist das sine qua non unserer modernen, mediengetränkten weltweiten Kultur. Schande und Verachtung ist das Wenigste, was jemand wie Christine erwarten kann. »Man hat mir gesagt, wir könnten keine Freunde mehr sein«, meint Natalia Kochan, eine Studentin, der es irgendwie gelungen war, den Film nicht zu sehen, obwohl sie George Lucas’ Alma Mater besuchte, die University of California.
Mir fiel allmählich auf, wie sehr das moderne Leben von Star Wars durchsetzt ist; Verweise darauf tauchen an den unmöglichsten Stellen auf. Ich besuchte einen Yogakurs; die Kurzfassung des Lehrers für die Atemtechnik Ujjayi lautete: »Atmen Sie einfach wie Darth Vader.« Ich ging zu Facebook wegen einer Pressekonferenz über den Algorithmus, der darüber bestimmt, welche Storys wir in unseren Newsfeeds vorgesetzt bekommen; die Referentin erklärte es, indem sie zeigte, dass aufgrund der unterschiedlichen Verwandtschaftsverhältnisse Yoda andere Postings von Luke Skywalker zu sehen bekommt als diejenigen, die Darth Vader und Prinzessin Leia auf ihren Feeds sehen. Niemand in dem Raum zuckte auch nur mit der Wimper. Star Wars war zu einer Spielfilmserie geworden, bei der es in der modernen Gesellschaft immer vollkommen akzeptabel war, über Spoiler zu diskutieren. (Vader ist übrigens Luke Skywalkers Dad.)
Vielleicht sollte man so etwas im Hauptquartier von Facebook erwarten. Sein Gründer Mark Zuckerberg war Nerd genug, um seine Bar Mitzwa unter dem Thema Star Wars abzuhalten. Aber man braucht nur einmal die neuesten Feeds durchzugehen, um zu sehen, wie häufig Star Wars gedanklich und als Verweis in den sozialen Medien auftaucht. Während ich dies hier schreibe, haben bereits 268 Millionen Facebook-Nutzer den ursprünglichen Film »geliked«.
Wenn Sie etwas altmodischer an die Sache herangehen wollen, schalten Sie doch einfach mal den Fernseher an. Der Sender spielt dabei fast keine Rolle. 30 Rock, Alle lieben Raymond, Archer, Big Bang Theory, Bones, Community, The Daily Show, Family Guy, Friends, The Goldbergs, House, Ink Master, Just Shoot Me, King of the Hill, Lost, Myth-Busters, NewsRadio, The Office, Saturday Night Live, Die Simpsons, South Park, Scrubs, Die wilden Siebziger – all diese Shows und noch mehr haben beiläufig auf Star Wars Bezug genommen, auf Star Wars beruhende Handlungen gebracht oder sogar spezielle Star Wars-Episoden produziert. Die populäre, neun Jahre alte Sitcom How I Met Your Mother wurde in ihrer Star Wars-Besessenheit zum Sprachrohr für ganze Generationen. Der Held der Show lernt, niemals eine Frau zu daten, die die ursprüngliche Trilogie nicht gesehen hat; der Schürzenjäger der Show hat mitten in seinem Apartment einen Sturmtruppler-Anzug stehen. Es gab eine Zeit zwischen den Trilogien, als Star Wars an den zerfransten Rändern der Nerd-Gesellschaft dahinvegetierte. Das ist vorbei. Jetzt scheint uns die Gesellschaft sagen zu wollen, dass Star Wars einem zu Flirts, One-Night-Stands und dauerhaften Beziehungen verhilft.
Andernorts in der Welt ist Star Wars kein bisschen weniger wichtig als in Amerika. Im Vereinigten Königreich gibt es eine beliebte Fernsehsendung und Radioshow, bei der Gäste gebeten werden, etwas zu tun, von dem sie schamvoll zugeben müssen, dass sie es sich bisher nie getraut haben; sie heißt Never Seen »Star Wars« (Noch nie Star Wars gesehen). Japan ist besonders verrückt nach Star Wars. In Tokio begegnete ich einem Amerikaner, der in dieses Land gezogen war, um mit seinem Freund zusammenzuleben, und immer noch, Jahre später, von den traditionsbewussten japanischen Eltern seines Freundes fast unablässig mit Häme überschüttet wird – nicht wegen seiner sexuellen Orientierung, sondern weil der arme Kerl noch nie Star Wars gesehen hat. »Ständig werfen sie mit Zitaten um sich«, beklagte er sich.
Wir von Mashable durften nicht zulassen, dass dieser Zustand der Unwissenheit und Scham bei einem von uns weiter andauert. Pläne wurden geschmiedet für einen Live-Blog. Wir hatten Christine den ursprünglichen Film gezeigt. Sie hatte darüber getwittert; wir waren uns alle einig gewesen. Das Twitter-Hashtag für das Event lautete #starwarsvirgin [Star Wars-Jungfrau]. Mashables Community war in Aufruhr. Wie sah jemand Star Wars mit frischem Blick? Würde es Christine wegfegen? Würden wir den flüchtigen Geist von 1977 noch einmal einfangen können, wenn auch nur für einen kurzen Moment?
Nun ja, nicht ganz. Christine war von der Action eigentlich recht angetan, das schon, aber … so vieles davon wirkte eigenartig vertraut. Jeder Spezialeffekte-Film mit großem Budget seit Star Wars hat sich der Elemente des ursprünglichen Films bedient – so viele, dass es jetzt lauter wiedererkennbare Tropen waren. (Zum Beispiel war das »abgenutzte Universum« – dieser Stil, Technologie und futuristische Kostüme echt, schmutzig und abgetragen aussehen zu lassen – eine Star Wars-Erfindung. Praktisch jeder Science-Fiction-Film seit Anfang der 1980er hat ihn aufgegriffen, von Blade Runner bis Mad Max und weiter.) Auch waren Star Wars-Jungfrauen nicht vor der Werbewelt geschützt, die eine wachsende Zahl an Star Wars-Huldigungen präsentiert. Verizon brachte 2013 eine Halloween-Anzeige, auf der ganze Familien in Star Wars-Kleidung gezeigt werden, und dies wurde nicht einmal groß herausgestellt, denn trägt das nicht jeder? Christines Reaktion, als sie R2D2 und C3PO zum ersten Mal sah: »Ach, daher kommen also die Smartphones.« (Verizon und Google lizensieren den Namen »Droid« von Lucasfilm.) Sie erkannte R2D2 als Pepsi-Kühlvorrichtung, die an der Highschool weit verbreitet war. Darth Vader? Christine kannte dieses Kostüm. Ein Kind hatte es bei der Volkswagen-Werbung für den Super Bowl 2011 getragen. Und ja, selbst sie wusste bereits, dass Vader Lukes Vater war.
Jede vermeintliche Star Wars-Jungfrau gleich welchen Geschlechts hat eigentlich schon eine recht ansehnliche Zahl von Spoilern in ihrem Leben aufgeschnappt – das war meine Hypothese. Ich beschloss, dies durch ein größeres Experiment auf die Probe zu stellen. Am 4. Mai – dem Star Wars-Tag, einem Ereignis, das ein britischer Abgeordneter unabsichtlich ins Leben rief, als er über »May the Force« witzelte, was genau wie »4. Mai« [May the Fourth] klingt, und das richtig große Kreise zog, als es 2013 zum ersten Mal als Feiertag begangen wurde –, am 4. Mai also bat Mashable Lucasfilm und die Petitions-Website Change.org um Zusammenarbeit bei einer Vorführung des ursprünglichen Films für #StarWarsnewbies (»Star Wars-Neulinge«), denn das Wort »Jungfrauen« war uns ein wenig zu heiß. Diese Vorführung sollte im Hauptquartier von Change.org in San Francisco abgehalten werden.
Als Erstes fanden wir heraus, wie schwer es ist, im 21. Jahrhundert in der Bay Area jemanden zu finden, der noch nie irgendeinen Star Wars-Film gesehen hat. Schließlich sprachen wir hier vom Einschlagsort der ersten Kulturbombe; es hatte nur bis Ende 1977 gedauert, ehe die Anzahl der Menschen, die eine Eintrittskarte gekauft hatten, um in der Stadt Star Wars zu sehen, die 750000er-Marke überschritt. Selbst in Anbetracht der gemeinsamen Rekrutierungsbemühungen von StarWars.com, Change.org und Mashable gelang es uns lediglich, dreißig Neulinge zu finden, neben einer erheblich größeren Anzahl von Freunden und Verwandten, die einfach nur sehen wollten, wie die Neulinge den Film zum ersten Mal sahen.
Vor der Vorführung wurden die Neulinge interviewt, um festzustellen, wie viel genau sie wussten. Erneut überraschten sie uns. »Ich weiß, dass sie aus dem Rahmen fallen«, sagte Jamie Yamaguchi, 32, eine Mutter aus Oakland, Kalifornien, über das Set aus sechs Filmen. »Das fand ich schon immer seltsam.« (Der strikte religiöse Kodex, nach dem ihre Eltern lebten, hatte dafür gesorgt, dass sie überhaupt erst sehr wenige Spielfilme kannte.) Die Charaktere waren ihr vertraut: Prinzessin Leia, Obi-Wan Kenobi, Erzwo, Luke, »der goldene Typ und dieser Nervtöter, der so eigenartig spricht. Ach ja, und Darth Vader.«
Viele Antworten liefen ungefähr auf diese (ebenfalls authentische) Antwort hinaus: »Ach, die Namen der Typen kenne ich eigentlich gar nicht – bis auf Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi und Yoda. Mehr weiß ich nicht.«
»Ich kenne die große Offenbarung am Schluss«, sagte Tami Fisher, eine Lehrerin am UC Hastings College of the Law und frühere Angestellte des Obersten Gerichtshofs von Kalifornien. »Die Vater-Sohn-Beziehung zwischen den beiden, wie immer sie auch heißen mögen.«
»Meine Kinder haben mich mal gefragt, ob Luke und Leia denn wüssten, dass sie Bruder und Schwester sind«, meinte Yamaguchi. »Meine Reaktion war: ›Sind sie das?‹«
Es wird zunehmend schwerer, Star Wars-Spoilern aus dem Weg zu gehen. Sie bombardieren uns von Geburt an, ob wir es wollen oder nicht. Eine ganze Anzahl Eltern haben sich, als ich dieses Buch schrieb, mit der Frage an mich gewandt, wie es denn sein könne, dass ihre jüngeren Kinder all die Namen all der Charaktere und Planeten in Star Wars wüssten und die obskursten historischen Details hinter fast jedem Aspekt des Franchise zitieren könnten, obwohl diese Kinder noch viel zu jung wären, um irgendeinen der sechs Kinofilme gesehen zu haben. Ich antwortete ihnen mit einer Gegenfrage: »Woher stammt Luke Skywalker?« oder »Wie werden diese Teddybären-Wesen in Die Rückkehr der Jedi-Ritter genannt?« Wenn die Eltern daraufhin »Tatooine« sagten oder »Ewoks«, meinte ich nur: »Sehen Sie? Dieser Planet wurde im ursprünglichen Star Wars-Film gar nicht genannt, genauso wenig wie diese Teddybären-Wesen in irgendeinem der Kinofilme. Sie haben ihre Namen irgendwo anders aufgeschnappt.« (Ich entdeckte mit vier, Jahre bevor ich Star Wars sah, den Namen Tatooine auf der Rückseite einer Cornflakes-Schachtel; die Enthüllung der Ewoks erfolgte 1983 in einem Sammelalbum für Sticker, Monate vor Die Rückkehr der Jedi-Ritter.)
Wie weit hat sich diese gutartige kulturelle Infektion ausgebreitet? Gibt es noch irgendjemanden auf dem Planeten, der nicht ein kleines bisschen vom Star Wars-Kodex in seinem Kopf trägt? »Wir wissen nicht, wie viele Einzelpersonen einen Star Wars-Spielfilm in einem Kino gesehen haben«, sagte mir ein Sprecher von Lucasfilm, »was wir jedoch wissen ist, dass für die sechs Filme weltweit annähernd 1,3 Milliarden Karten verkauft worden sind.« Das scheint mir noch eine konservative Schätzung zu sein, und es wäre gleichermaßen konservativ, eine weitere Milliarde Home-Video-Zuschauer hinzuzurechnen, gemessen an den 6 Milliarden US-Dollars, die das Franchise durch VHS- und DVD-Verkäufe im Laufe der Jahre verdient hat. Und dabei sind noch nicht einmal Leih-DVDs und der riesige Markt der Raubkopien mitgerechnet. Wie viele weitere Milliarden Menschen haben die Filme im Fernsehen gesehen oder eine Anzeige oder auch nur ein kleines Stück der 32 Milliarden US-Dollars schweren lizensierten Star Wars-Produkte erworben, die es auf dem Planeten gibt? Oder, um die Frage einmal andersherum anzugehen, wie viele Milliarden oder Millionen Menschen haben es geschafft, jedem einzelnen dieser Fallstricke des Star Wars-Franchise aus dem Weg zu gehen? Und wer sind diese Menschen?
Ich war naiv genug zu glauben, ich könnte einfach irgendwohin kommen wie nach Window Rock und jemanden dabei erwischen, wie er mit großen Augen zum ersten Mal Star Wars sieht. Aber diese Hoffnung zerschlug sich in dem Moment, als die in Albuquerque und Salt Lake City stationierten Garnisonen der 501st Legion, eine auf Wohltätigkeit ausgerichtete Star Wars-Organisation kostümierter bad guys, nach einer unglaublich langen Anfahrt in Window Rock eintrafen, ihre Uniformen anlegten und bei Sonnenuntergang in das Rodeogelände einmarschierten. Sie wurden mit tosendem Applaus begrüßt von den dicht gedrängten Zuschauern – ein Willkommen, das ungleich herzlicher ausfiel als jedes andere, das ich auf einer Comic-Con oder einer Star Wars-Celebration für eine 501st Legion erlebt hatte. Sie marschierten herein, gesäumt von den Reihen der Zuschauer, die sich schon seit Stunden in der 41-Grad-Hitze versammelten – ein Sturmtruppler, ein Schneetruppler, ein Biker Scout, ein Imperialer Gardist, ein Kopfgeldjäger und natürlich ein Dunkler Lord der Sith persönlich. Darth Vader war dicht umdrängt; Babies wurden ihm in die Arme gedrückt, während aufgeregte Mütter mit ihren iPads Aufnahmen machten.
Ich bemerkte auch einen Haufen geschäftstüchtiger Kinder, die Lichtschwerter verkauften. Sie trugen Sturmtruppler-T-Shirts mit der Aufschrift »Das sind nicht die Dinés, nach denen ihr sucht«. Ich fragte Wheeler, ob er die T-Shirts gemacht habe, aber er zuckte mit den Achseln. Er stellte nur die funkelnden »Navajo Star Wars«-Oberteile für seine eigene Mannschaft her. Dann schlenderte er davon, um sich mit Boba Fett fotografieren zu lassen.
Helft mir, Ältere, dachte ich. Ihr seid meine einzige Hoffnung.
Und dann, als auf den Hochebenen das Purpur des Sonnenuntergangs dem Indigo des Zwielichts wich und in der Ferne ein Gewitter zu grollen begann, begegnete ich George James senior, Veteran von Iwo Jima und Star Wars-Jungfrau. Es war, als hätte man mir gerade ein Einhorn vorgestellt, das über einen doppelten Regenbogen gesprungen kam. Es war zu schön, um wahr zu sein. Ich ging eine Liste mit Namen durch: Skywalker. Solo. Lukas. Wookiee.
James schüttelte bei jedem verständnislos den Kopf.
Ich deutete auf einen Hochgewachsenen mit schwarzem Helm, der gerade mit einer Anzahl Typen zu tun hatte, die auf ihre Kehle deuteten und dagegen stießen: Sie wollten ein Foto machen für ein beliebtes Internet-Mem namens Vadering, bei dem man in die Luft springt und vorgibt, von Darth Vader mittels der Macht gewürgt zu werden. James war perplex. Er hatte wirklich keinen Schimmer, warum die Kinder aus seinem Stamm sich mit glühenden Stäben Schwertkämpfe lieferten. Als Wheeler wieder auftauchte, um mir den hiesigen Navajo-Voiceover-Sprecher vorzustellen, musste ich James sagen, dass dies nicht der Herr Lucas sei, von dem ich gerade gesprochen hatte.
Dann, kurz bevor das Flutlicht heruntergefahren wurde und das Logo der Twentieth Century Fox auf der Leinwand erschien, geschah etwas mit James. Er hatte mal bei jemandem, fiel ihm ein, einen Clip über einen Weltraumfilm gesehen. »Ich sah wilde Vögel«, meinte er.
Wilde Vögel im Weltraum? Was könnte das sein? Ich dachte eine Sekunde nach. Dann hob ich die Arme und ließ sie im 45-Grad-Winkel wieder sinken. »Etwa so?«
James nickte; seine Augen leuchteten im Erkennen auf.
»Wilde Vögel.«
X-Wing-Jäger.
Selbst der achtzigjährige George James senior, der in den Bergen lebt und unter Schaffellen in einem Zuhause schläft, das so abgelegen ist, dass es manchmal für Monate von Schnee blockiert wird, trug in seinem Kopf ein kleines Stück des Star Wars-Kodex – genau wie Sie und ich und so ziemlich jeder andere auf der Welt auch.
Die Fanfare der Twentieth Century Fox endete, die Leinwand wurde schwarz, und ein elektrisierender Aufschrei ging durch die Menge. Vertraute blaue Buchstaben erschienen auf der Leinwand – doch diesmal, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, wurde die vertraute Redewendung »Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis« in so eigenartigen Worten wiedergegeben, dass sie von der amerikanischen Regierung verboten worden waren, so unvertraut für den Rest des Planeten, dass sie im Zweiten Weltkrieg zur Verschlüsselung eingesetzt wurden:
Aik’idaa’ yadahodiiz’aadaa,
Ya’ ahonikaandi …
Mehr war nicht nötig. Die Menge brüllte so laut auf, dass ich kaum noch die Eröffnungsakkorde der Filmmusik hören konnte. Und so ganz nebenbei eroberte Star Wars eine weitere Kultur der Erdenbewohner.
Dieses Buch ist eine Biografie des Franchise, das den Planeten Erde in den Planeten Star Wars verwandelte.
Es verfolgt zweierlei Ziele. Zum einen will es die erste vollständige Geschichte des Franchise von ihren fantastischen Ursprüngen bis hin zu Disneys 4,05 Milliarden teurem Erwerb von Lucasfilm im Jahr 2012 erzählen, dem Studio, das die Filme erfand. Zum anderen – und das ist vielleicht noch interessanter – soll das Buch die andere Seite der Beziehung beleuchten: Wie Star Wars seinen Planeten voller Fans beeinflusste und von ihnen seinerseits beeinflusst wurde.
Die Geschichte des Franchise Star Wars selbst zeigt Kreativität in höchster Vollendung. Es ist die Geschichte davon, wie etwas, das den Titel »The Journal of the Whills« trug, einige wenige Seiten undurchsichtiger Flash Gordon-Fan-Fiction, mit Bleistift hingekritzelt und dann von seinem Schöpfer im Stich gelassen, sich in ein gewaltiges Universum verwandelte, das über die ganze Welt verteilt Merchandising-Artikel im Wert von 32 Milliarden US-Dollar (und weiter steigend) verkauft hat. (Zählt man Eintrittskarten, Lizenzgeschäfte und andere Einnahmequellen hinzu, hat Star Wars von 1977 bis 2013 wahrscheinlich sogar schon mehr als 40 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.) Ein Großteil dieses Erfolgs verdankte es der harten Arbeit einer kleinen Gruppe hingebungsvoller Gläubiger, die nicht George Lucas hießen. Aber Star Wars hat Millionen äußerst ergebener Anhänger weit jenseits dieser ursprünglichen Kabale: Sammler und Kostümgruppen, Droidenbauer und Lichtschwert-Liebhaber, Parodisten und Satiriker – und die meisten dieser Gruppen sind auf unerwartete Weise selbst zu einem Teil dieses Franchise geworden.
Sogar Lucas persönlich, in messianischer Attitüde, hat anerkannt, dass er wenigstens für ein Drittel dessen, wovon wir reden, wenn wir über Star Wars sprechen, verantwortlich war. »Ich bin der Vater unserer Star Wars-Kinowelt – der gefilmten Unterhaltung, der Features und Fernsehserien«, sagte er 2008. »Ich habe sie errichtet, und ich habe die Leute ausgebildet und sie auf den Weg gebracht. Ich bin der Vater; das ist mein Werk. Dann haben wir die Lizenzierungsgruppe, die sich um die Games, das Spielzeug und all die anderen Sachen kümmert. Sie nenne ich den Sohn – und der Sohn macht so ziemlich das, was er will. Dann haben wir noch die dritte Gruppe, den Heiligen Geist, der aus den Bloggern und Fans besteht. Sie haben ihre eigene Welt erschaffen. Ich kümmere mich um die Welt des Vaters. Der Sohn und der Heilige Geist können ihren eigenen Weg gehen.«
Seit Lucas diese Worte sprach, ist auch der Vater seinen eigenen Weg gegangen. Nach dem Verkauf von Lucasfilm ging Lucas in Rente, und während neue Star Wars-Features gleich tonnenweise auf die Multiplexkinos der Erde zurollen, geschieht dies unter dem wachsamen Auge der Stiefmutter dieses Franchise, der erfahrenen Filmproduzentin Kathleen Kennedy. Wenn der nächste Star Wars-Film in den Kinos anläuft, wird es historisch der erste sein, der ohne den umfassenden väterlichen Beistand des Schöpfers1 selbst auskommt.
Jetzt, da Star Wars in eine neue Phase seiner langen Geschichte eintritt, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um innezuhalten und eine Bestandsaufnahme der Schöpfung vorzunehmen. Es lohnt sich dabei, darauf hinzuweisen, dass hinter den Kulissen die Welt von Star Wars nie so einheitlich war, wie Lucas’ Metapher von der Heiligen Dreieinigkeit suggeriert. Je mehr man sich in das Franchise verliebt, desto mehr wird einem offenbar klar, wie wackelig die Grundlagen dieses Weltraummärchens sind. Die größten Fans des Erweiterten Universums (der kollektive Name für die vielen Hundert Star Wars-Romane, vielen Tausend Star Wars-Comics und zahllosen Video Games und anderen Medien, die außerhalb der Star Wars-Filme selbst Charaktere und Handlungen entwickelt haben) sind die Ersten, die einem brühwarm auftischen, wie es darin von inneren Widersprüchen und falschen Bezügen wimmelt. Und viele Freunde von Star Wars sind blinde Anhänger der Filme und verteidigen sie bis aufs Blut. Fans der ursprünglichen Trilogie (der Episoden IV bis VI, die 1977 bis 1983 herauskamen) sind wie besessen über jede Veränderung in Lucas’ verbesserten Versionen hergefallen (die für die Wiederaufführungen 1997, 2004, 2006 und 2011 optimiert wurden) und aufs Äußerste zwiegespalten hinsichtlich der Prequel-Trilogie (der Episoden I bis III, die 1999 bis 2005 herauskamen). Dieser Zwiespalt von Liebe und Hass ist ein ebenso ständiger Begleiter für Star Wars-Fans, wie Jedi und Sith es sind oder die Zwillingssonnen von Tatooine.
Im Jahr 2005 erlebte ein Zwanzigjähriger in Vancouver mit Namen Andrey Summers am eigenen Leib die tiefe Spaltung im Star Wars-Fandom, als er eine Mitternachtsvorführung von Episode III besuchte. Der Vorführung ging ein Kostümwettbewerb voraus, und Summers war schockiert, als ältere Fans die selbstgemachten Kostüme jüngerer Fans doch tatsächlich auszubuhen begannen. »Da wurde mir klar«, erzählte mir Summers, »dass diese Mistkerle nicht auf Spaß aus waren. Denen ging es um peinlich genaue Wiedergaben.« Er ging nach Hause und schrieb eine Kolumne für ein Online-Magazin namens Jive, die er »Die komplexe und erschreckende Realität des Star Wars-Fandoms« nannte. Wie das meiste bei Star Wars selbst war sie halb ironisch gemeint, bediente sich aber eines ernsten Tonfalls.
Der Ansatz war, dass Summers es schwer damit hatte, seiner Freundin das Fandom zu erklären, weil echte Fans alles an Star Wars hassen, von Mark Hamills weinerlicher Darbietung des Luke Skywalker in der ursprünglichen Trilogie bis zu dem desaströsen CPG-Einsatz des Jar Jar Binks in den Prequels. »Wenn dir welche über den Weg laufen, die behaupten, dass sie das Franchise für recht vergnüglich halten und die Originalfilme eigentlich genauso mögen wie die Prequels und sogar alles auf DVD haben und obendrein noch ein paar Bücher, dann sind diese Schwindler keine Star Wars-Fans«, schrieb er.
Das Jive-Magazin gibt es inzwischen nicht mehr, aber Summers Kolumne hat sich verbreitet. In mehrere Sprachen übersetzt wurde es im Internet von Forum zu Forum weitergereicht. Amüsierte Fans, die genau verstanden, was er meinte, und wütende Fans, die es einfach nicht begriffen, bombardierten ihn mit E-Mails. Summers hatte eindeutig einen Nerv getroffen, als er darauf hinwies, dass Liebe und Hass Zwillingstugenden jedes echten Star Wars-Fans sind – und obwohl er es nicht wusste, war seine Kolumne der Widerhall von etwas, das in den hochheiligen Hallen von Lucasfilm selbst die Runde machte.
»Um Star Wars zu machen, muss man Star Wars hassen« – diesen Leitspruch habe ich in Lucasfilms Designabteilung von mehr als einem Veteran gehört. Sie meinen damit, wenn du dich zu genau auf das Vorangegangene beziehst, bist du verloren. Du musst rebellieren und alles infrage stellen. Das Franchise muss sich ständig selbst erneuern, indem es nicht zusammenpassende Dinge aus einer Wundertüte äußerer Einflüsse zieht, wie Lucas persönlich von Anfang an erklärte. Genauso muss das Fandom sich ständig durch neue Generationen von Zuschauern selbst erneuern, die durch die Prequels mit ins Spiel gebracht wurden, durch kürzlich in den Kanon aufgenommene Ergänzungen wie die animierten Fernsehserien The Clone Wars und Rebels – und in Kürze durch die Fortsetzungen der ersten beiden Trilogien.
So wie neue Fans wesentlich sind, um Star Wars gesund und am Leben zu erhalten, müssen auch übersättigte Altfans sich ständig erneuern, indem sie zu der Sache zurückkehren, die ihnen ursprünglich Freude bereitet hat. »Um ein Star Wars-Fan zu sein«, schrieb Summers in seiner Kolumne, »muss man die Fähigkeit besitzen, eine Million verschiedener Fehler und Katastrophen zu sehen und sie dann doch zu einem größeren Bild der Vollkommenheit zusammenzusetzen. Jeder echte Star Wars-Fan ist ein Luke Skywalker, der seinen verkorksten bösen Vater anblickt und irgendwie das Gute in ihm sieht.«
»Wir hassen alles an Star Wars«, endet Summers, bevor er mit einer Zeile auftrumpft, in die jeder Fan auf der Welt nur einstimmen kann. »Aber die Idee von Star Wars – diese Idee lieben wir.«
In Window Rocks zerriss ein Blitz den Nachthimmel über den fernen Bergen, aber nur wenige im Publikum schienen es zu bemerken oder etwas darauf zu geben. Die Leute jubelten wie verrückt über den Vorspann beim Start des Films, in dem jedes Wort auf Diné war. Als die Dialoge einsetzten, herrschte die ersten fünfzehn Minuten lang nur Gelächter – nicht dass der Film oder die Darbietung verlacht worden wäre, es war das glückliche Lachen von Menschen, die zum ersten Mal einen Film in ihrer Muttersprache sahen.
Für einen Zuschauer wie mich, der mit der ursprünglichen englischsprachigen Fassung von Star Wars aufgewachsen war, klang ein überraschend hoher Anteil des Films genau gleich. Lucas liebte coole Sounds und reißerische Musik und das Geplapper von Dialogen mehr, als ihn der Dialog selbst interessierte. Einen Großteil des Films über wird gar nicht gesprochen, oder es ist das unverständliche Kauderwelsch von Aliens und Droiden. Denken Sie an Erzwo, an die Jawas: absichtlich unverständlich, und dafür lieben wir sie. Denken Sie daran, wie viel Zeit draufgeht für den Austausch von Blasterschüssen oder das Tosen von TIE-Jägern (in Wahrheit ein verlangsamtes Elefantentrompeten) oder das Summen von Lichtschwertern (ein kaputter Fernseher, ein alter Projektor). Als ich erfuhr, dass es Wheelers Übersetzerteam gelungen war, den Film in nur sechsunddreißig Stunden aus dem Englischen in die Navajosprache zu übertragen, war mir das wie eine übermenschliche Leistung erschienen. Tatsächlich ist aber gar nicht so viel Englisch in Star Wars, wie Sie sich vielleicht zu erinnern meinen.
Einige Worte sind nicht übersetzbar und bleiben auf Englisch. »Prinzessin Leia« trägt weiter diesen Titel, da es in Diné das Konzept des Adels nicht gibt. Genauso verhält es sich mit dem »Imperialen Senat« und der »Rebellenallianz«. (Die Navajo sind von Natur aus dermaßen egalitär, dass die US-Regierung sie zwingen musste, ein Verwaltungsgremium einzusetzen, mit dem sie verhandeln konnte.) Und obwohl der übersetzte Dialog eine Art Mischmasch ist – die Übersetzer sprechen drei verschiedene Diné-Dialekte –, spielt das, wie sich herausstellt, gar keine Rolle. Schließlich klingt es auch für den Englisch Sprechenden nicht seltsam, dass die Schauspieler im Film zur einen Hälfte Briten und zur anderen Hälfte Amerikaner sind. (Carrie Fisher scheint sich beider Akzente zu bedienen, aber wir haben uns daran gewöhnt, auch das gut zu finden.)
Humor übersetzt sich natürlich anders. Das Publikum schien über jedes Wort zu lachen, das Dreipeo sagt. Das mag teilweise daran liegen, dass der Droide etwas Feminines hat. Die Synchronsprecherin Geri Hongeva-Camarillo hat seinen gezierten Tonfall denn auch perfekt getroffen. (Einige Monate später erzählte ich Anthony Daniels, dem ursprünglichen Dreipeo, von diesem Geschlechtertausch. »Die Navajo müssen eine ziemlich verwirrte Nation sein«, sagte er in seiner Dreipeo-Stimme größter Ahnungslosigkeit, bevor er abwinkte und mich daran erinnerte, dass der Konzeptkünstler Ralp McQuarrie – einer der großen unbesungenen Helden von Star Wars – Daniels’ Charakter ursprünglich als dürren weiblichen Roboter angelegt hatte.)
Den größten Lacher des Abends erzielte jedoch Leias Spruch an Bord des Todessterns: »Governor Tarkin, ich hätte es mir denken können, dass Vader nach Eurer Pfeife tanzt. Ich bemerkte Euren fauligen Gestank bereits, als ich an Bord gebracht wurde.« Diese Formulierung hat offenbar etwas Derbes an sich, das auf Navajo besonders lustig klingt, obwohl sie für Fisher zu den schwierigsten gehörte, die sie im Film an den Mann zu bringen hatte. Peter Cushing, der Tarkin spielt, »roch eigentlich nach frischen Laken und Lavendel«, meinte sie.
Wie seltsam war es, Star Wars in einer fremden Sprache zu sehen und dennoch voll einzutauchen. Ich staunte wieder darüber, wie makellos sich die Handlung entfaltet. Dann kamen die CGI-Monster von Mos Eisley, der Shot auf Greedo, das ganz und gar unpassende Erscheinungsbild des computerisierten Jabba, und ich zuckte zusammen. Ich wurde daran erinnert, dass Lucasfilm für die Bewilligung dieser Adaption darauf bestanden hatte, dass Wheeler die neueste Special-Edition-Version mit der höchsten Qualität verwendet.
Bei der Szene mit der Müllpresse hängt der Film ein wenig durch. Vor allem die Kinder schienen abgelenkt zu sein und lieber in den Gängen mit ihren Lichtschwertern zu spielen; die Idee des Star Wars-Films hatte es ihnen jetzt mehr angetan als Star Wars selbst. Familien erhoben sich und gingen noch vor dem Grabenrennen auf dem Todesstern, da es bereits elf Uhr abends war und die Kinder längst im Bett sein sollten. Aber für die vielen Hundert, die blieben, bis die Lichter wieder angingen, erschuf der Film seinen eigenen kleinen feierlichen Kult, so wie es in jeder anderen Kultur auch geschehen war, in die er Eingang fand. Anschließend gab es eine Autogrammstunde mit den wichtigsten sieben Synchronsprechern, und die Schlange derer, die sie kennenlernen wollten, führte um das ganze Stadion herum. Die Sprecher waren alle Amateure (Darth Vader beispielsweise wurde von dem lokalen Sportcoach Marvin Yellowhair gespielt) und unter 117 Leuten ausgewählt worden, die für die Rollen vorgesprochen hatten; das Auswahlkriterium war ihre schauspielerische Leidenschaft gewesen, nicht ihre Kenntnis in Diné. Es hatte funktioniert: Ihre Überschwänglichkeit und ihre Vertrautheit mit dem dargebotenen Material hatten den Sieg davongetragen.
Ich machte mich auf die Suche nach Reaktionen der wenigen Älteren, die ich in der Schlange sah. Näher sollte ich nie mehr herankommen an eine Erfahrung mit völligen Star Wars-Neulingen im Erwachsenenalter. Jeder Einzelne der Älteren, mit dem ich sprach, teilte George James’ Verwirrung über den Titel: Warum führen die Sterne Krieg gegeneinander? Die Älteren wiederholten auch eine der häufigsten Beschwerden, die schon 1977 über Star Wars vorgebracht worden war: Es lief zu schnell ab. (Das moderne Publikum betrachtet es natürlich als zu langsam; der Ethos von Star Wars half bei der Hervorbringung des MTV-Ethos.) Einige waren verwirrt darüber, wofür genau die beiden Seiten eigentlich kämpften. Man kann »gestohlene Datenbänder« in Navajo übersetzen, aber man kann dem keinen Sinn verleihen.
Dann lernte ich etwas Spirituelles von dieser Gruppe: Manny hatte recht damit gehabt, dass sich für Star Wars der Kreis schließt, wenn man die Verbindung zu Joseph Campbell zieht. »Möge die Macht mit dir sein«, so stellte sich heraus, ist fast die wörtliche Übersetzung eines Navajo-Gebetes. »Die Macht« lässt sich in ihrer Sprache am besten als eine Art positives, lebendiges, übersinnliches Kraftfeld beschreiben, das sie umgibt. »Wir beten um Kraft, um Schutz vor Negativität«, sagte mir Thomas Deel, 82, durch einen Dolmetscher.
Einige der Älteren erkannten teilweise ihr Glaubenssystem in George Lucas’ Schöpfung wieder. »Das Gute will das Böse überwinden und bittet dafür um Schutz«, fasste Annette Bilgody zusammen, eine 98-Jährige im traditionellen Gewand einer Diné-Großmutter. Sie sprach auch das größte Lob des Abends aus: »Mir hat es genauso viel Spaß gemacht wie meiner Enkelin.«
Damit stand sie nicht allein. In den folgenden Monaten startete Wheeler eine Roadshow mit seiner übersetzten Version des Films und führte sie auf Filmfestivals überall in den USA vor Gemeinschaften der amerikanischen Urbevölkerung auf. Die DVD mit Star Wars auf Navajo verkaufte sich hervorragend in den Walmarts-Filialen im Südwesten. Die gesamten Einnahmen gingen an die Twentieth Century Fox und Lucasfilm, aber das spielte für Manny keine Rolle. Wirklich wichtig war ihm, sagte er, »dass das Konzept aufging«. Er hörte, wie immer wieder in der ganzen Nation eine Frage gestellt wurde: Welche Filme auf Navajo sollten wir als Nächstes machen? Es gab sogar Interesse, in Window Rocks ein Kino zu errichten.
Und George James senior? Er entschuldigte sich nach zehn Minuten Vorführung und kehrte nicht mehr zurück. Vielleicht wollte er als Veteran von Iwo Jima niemanden sehen, der mit Blastern um sich schoss, die den militärischen Handfeuerwaffen des Zweiten Weltkriegs nachempfunden waren. Vielleicht hatte er als Code Talker auch keinen Gefallen an einer Geschichte gefunden, in der eine Unschuldige für das Verbrechen gejagt wird, eine Nachricht zu befördern. Aber mir gefällt der Gedanke, das James dadurch, dass er so früh ging, etwas von dem Mysterium bewahrte, um das er den Abend bereichert hatte, und dass er immer noch dort draußen in seinem Zuhause ist und darüber staunt, dass wilde Vögel und die Sterne Krieg gegeneinander führen.
1 So lautet Lucas’ Spitzname, den er sich 2007 selbst verlieh, nachdem Präsident George W. Bush ihn überschwänglich als »Entscheider« bezeichnet hatte. Auf die Frage des Talkmasters Conan O’Brien, ob die Fans für ihn nicht eine Herausforderung darstellten, ließ Lucas ihn wissen, dass er ein zweiter George W. ist. Er sagte zu seinem Gastgeber: »Ich bin mehr als der Entscheider. Ich bin der Schöpfer!«
1
MARSKRIEGE
Keine Frage: Star Wars ist ein großartiges, Galaxien umfassendes Epos. Aber halt mal, eigentlich handelt es sich ja um ein Märchen für die ganze Familie über unbekannte Welten. Natürlich nur, solange man es nicht als Samuraigeschichte betrachtet oder vielleicht als Actionabenteuer im Stil des Zweiten Weltkriegs.
Seit dem ersten Film aus dem Jahr 1977 verrenken sich Fans und Kritiker in alle Richtungen, um den Reiz von Star Wars unter Bezugnahme auf ein Dutzend verschiedener Genres zu erklären. Und niemand ist in dieser Hinsicht aktiver als George Lucas selbst, der die Filme abwechselnd mit einem Italowestern, Low Fantasy, 2001: Odyssee im Weltraum, Lawrence von Arabien, Unter Piratenflagge und dem gesamten James-Bond-Franchise verglich – und das alles, ehe der Originalfilm überhaupt gedreht wurde. Lässt man dieses Asteroidenfeld der Einflüsse hinter sich, entdeckt man im Zentrum von Star Wars ein einfaches, schrulliges Subgenre: Space Fantasy.
Space Fantasy verhält sich zu ihrem Übergenre Science-Fiction wie Luke Skywalker zu Darth Vader. George Lucas näherte sich mit seinem ersten Film THX 1138 an die Science-Fiction an, gab sie aber wieder auf, weil es ihm zu nah an der Realität, zu trostlos, zu unbeliebt an der Kinokasse war. Science-Fiction projiziert ein Bild der Zukunft durch die Linse der Gegenwart. Der Fokus liegt auf Technologie und ihren Begleiterscheinungen. Man bemüht sich zumindest im Ansatz, die physikalischen Gesetze des Universums zu berücksichtigen. Science-Fiction ist Fiktion über Wissenschaft, wohingegen Space Fantasy … nun ja, Fantasy ist, die im Weltraum spielt.2 Science-Fiction spiegelt unsere Welt wider, Space Fantasy transzendiert sie. Sie ist nostalgisch und romantisch, freier in ihrer Abenteuerlichkeit, und sie betrachtet Technologie als bloßen Ausgangspunkt. Die physikalischen Gesetze werden dem Spaß geopfert. »Ich hatte Angst, dass Science-Fiction-Fans Zeug sagen würden wie ›Du weißt schon, dass es im Weltall keinen Klang gibt‹«, meinte Lucas 1977. »Ich wollte die Wissenschaft einfach vergessen.« Im Weltall kann jeder das Pew-Pew deines Lasers hören.
Diese tiefe Kluft in der Fantastik – das Mögliche gegen das rein Unterhaltsame – geht zurück auf die Rivalität zwischen dem französischen Science-Fiction-Pionier Jules Verne und seinem emporkömmlerischen englischen Zeitgenossen H. G. Wells zur Zeit des Fin de Siècle. Verne war erklärtermaßen kein Wissenschaftler, wollte aber wissenschaftlich plausibel sein. In Von der Erde zum Mond (1865) schickt Verne seine Mondforscher in einer Kapsel ins All, die von einer gigantischen Kanone abgeschossen wird. In dem mutigen Versuch, die Möglichkeit seiner Idee zu beweisen, fügt er seitenlange exakte Berechnungen ein.3 Wells dagegen interessierte sich so wie Lucas stets mehr für die Funktionsweise von Gesellschaft und Individuum als für die Mechanik der Wissenschaften. Als Wells 1901 mit Die ersten Menschen auf dem Mond einen eigenen Mondroman veröffentlichte, ließ er seinen Wissenschaftler erklären, dass er noch nie von Vernes Buch gehört habe. Im weiteren Verlauf entdeckt er die Antischwerkraft-Substanz »Cavorit«, die ihn und einen Geschäftsmann, der gerade zu Besuch ist, in seiner Kapsel einfach zum Mond schweben lässt. Verne ackerte so hart an den Details, dass seine Abenteurer erst in einem Folgeroman den Mond erreichen; Wells wollte seine Helden so schnell wie möglich dorthin verfrachten, damit sie die fantastische Mondzivilisation erkunden konnten, die er erfunden hatte. (Was Verne dermaßen ärgerte, dass er eine spöttische und ziemlich am Thema vorbeischießende Forderung an Wells stellte: Ich kann dir Schießpulver zeigen, also zeig du mir Cavorit!) Als Lucas beschloss, seine Version des Weltalls mit dem Lärm von Laserfeuer und kreischenden Jets zu füllen, reihte er sich damit in die Wells’sche Tradition ein.4
Bezüglich der Mittel waren Verne und Wells zwar uneins, doch sie verband das starke Bedürfnis, die Landschaft der menschlichen Vorstellungskraft zu erweitern. Mythen, wie Lucas einmal anmerkte, spielen unausweichlich an »jenem Ort gleich hinter dem Hügel« – hinter der nächsten Grenze, real genug, um Interesse zu wecken, aber auch unbekannt genug, um geheimnisvoll zu wirken: entfernte griechische Inseln im Zeitalter der Klassik, der dunkle Wald im mittelalterlichen Märchen, das Amerika des Kolumbus. Im 20. Jahrhundert, als der Planet Erde größtenteils erforscht war, wurde das Weltall zum letzten verbleibenden Ort gleich hinter dem Hügel. Und eine Ecke des Weltalls faszinierte Autoren und Leser ganz besonders und wurde zur Abstammungslinie von Star Wars: der Mars.
Der Mars-Hype breitete sich immer weiter aus, nachdem der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli 1877 die berühmten Kanäle (canali) auf dem Roten Planeten entdeckte. Britische und amerikanische Zeitungen, die den Unterschied zwischen den canali und künstlich erschaffenen Kanälen nicht kannten oder einfach ausklammerten, veröffentlichten mit Leidenschaft umfänglich illustrierte und rein spekulative Beiträge über Zivilisationen auf dem Mars, besonders, nachdem der Hobbyastronom Percival Lowell eine Trilogie von »Sachbüchern« verfasste, in der er ausführlich beschrieb, wie diese Zivilisation aussehen könnte. Autoren ohne wissenschaftlichen Hintergrund fingen an, Romane über Marserkundungen zu Papier zu bringen. Die Methoden, mit denen sie den Roten Planeten erreichten, gingen stark auseinander. In Across the Zodiac (1880) schickt der englische Journalist Percy Greg seine Kundschafter in einer Antischwerkraftrakete ins All, die den Namen Astronaut trägt (womit er den Begriff prägte). Gustavus Pope, ein Arzt aus Washington, D.C., der zuvor ein Buch über Shakespeare geschrieben hatte, veröffentlichte 1894 Journey to Mars. In seinem Buch begegnet ein amerikanischer Marineleutnant auf einer kleinen Insel nahe dem Südpol Marsianern, die ihn schließlich in einem Antischwerkraft-»Äthervolt-Wagen« mit auf ihren Planeten nehmen. (Wells durchbrach derweil die Genregrenzen, indem er in seinem Klassiker Krieg der Welten von 1897 seine Angreifer vom Mars die Erde per Kapseln erreichen ließ, die von marsianischen Kanonen abgeschossen wurden – Verne, nur umgekehrt.)
Zu einem allerersten Aufeinandertreffen zwischen Mars und Space Fantasy kam es jedoch in einem Buch, das man wohl getrost als den unmöglichen Urgroßvater von Star Wars bezeichnen kann. Edwin Lester Arnold, englischer Schriftsteller und Sohn eines Zeitungsmoguls, beschloss, dem Thema Raumfahrt vollständig aus dem Weg zu gehen. In Lieutenant Gullivar Jones: His Vacation (1905) lässt er einen weiteren Marineleutnant auf den Mars fliegen, diesmal auf einem magischen Perserteppich. Arnolds Mars ist überraschend mittelalterlich. Das Volk von Hither, träge und von starkem Wein beseelt, wird von den barbarischen Horden von Thither belagert. Das Volk von Hither hat eine Sklavenklasse, einen König und eine schöne Prinzessin. Als die Prinzessin als Tribut nach Thither gebracht wird, macht sich Jones auf eine Reise quer über den ganzen Planeten, um sie zu befreien. Er ist ein seltsam unsympathischer Protagonist mit einer Neigung zu langen Ansprachen: Für einen Helden ist er zu blasiert, für einen Antihelden zu rechtschaffen. Auf seiner Reise meißelt er das Wort »USA« in eine Bergflanke. Arnold schien sich nicht entscheiden zu können, ob er nun eine Abenteuergeschichte oder eine antiamerikanische Satire schreiben wollte, und der Roman floppte. Bestürzt gab er das Schreiben auf. (In den USA wurde sein Roman erst 1964 veröffentlicht).
Arnolds Fantasie-Mars wurde, fünf Jahre nachdem er Lieutenant Gullivar Jones: His Vacation geschrieben hatte, von unerwarteter Seite gerettet – von dem 35-jährigen Manager einer Gruppe von Bleistiftanspitzervertretern aus Chicago. Der Bleistifttyp hatte jede Menge Zeit übrig, einen Haufen Schreibwaren in seinem Büro und einen Drang nach Ruhm, der ihm einfach keinen Frieden lassen wollte. Er las Pulp-Magazine, und als er bemerkte, dass die meisten Geschichten »Blödsinn« waren, versuchte er sich selbst an einer. Wie Arnolds Roman wird auch seiner von einem amerikanischen Offizier erzählt, der auf magische Weise zum Mars transportiert wird – diesmal in Sekundenschnelle durch reine Willenskraft. Kein Cavorit, keine Teppiche, nur ein Mann, »mit der Plötzlichkeit eines Gedankens durch die straßenlosen Weiten des Raums gezogen«. Wie Jones begegnet der Protagonist des Bleistifttypen fremdartigen, menschenähnlichen Gestalten und Affenmenschen und kämpft heldenhaft um die Hand einer Prinzessin. Der Bleistifttyp fand seine Geschichte kindisch und lächerlich. Also bat er darum, sie unter einem Pseudonym zu veröffentlichen, das wohl den Eindruck geistiger Gesundheit wecken sollte: Normal Bean. Seinen echten Namen fand er für einen Schriftsteller unpassend. Er lautete Edgar Rice Burroughs.
Die Fortsetzungsgeschichte, aus der Die Prinzessin vom Mars wurde, erschien erstmals im Februar 1912 in einem monatlich erscheinenden Pulp-Magazin namens All-Story. Sie war ein überragender Erfolg. Burroughs’ legendärer Held (und fiktionaler Onkel) Hauptmann John Carter gewann eine Anhängerschaft, von der Gullivar Jones nur träumen konnte. Hier findet sich keine wirre Satire: In Burroughs’ Büchern gibt es eine klare Trennlinie zwischen Gut und Böse. Carter ist nicht so wortreich – im ersten Drittel des Buchs findet sich nicht eine einzige Zeile Dialog – und schwebt viel häufiger in Gefahr als Jones. Ab dem ersten Kapitel, in dem ihn (ausgerechnet) amerikanische Ureinwohner in Arizona angreifen, wird Carter mit Speeren, Schwertern, Gewehren und Klauen zugesetzt. Die geringere Schwerkraft auf dem Mars (den Burroughs »Barsoom« tauft) verschafft Carter den ausreichenden Kraftvorteil, der ihm die Überwindung dieser beträchtlichen Widrigkeiten ermöglicht. Er kann mit einem Satz über Gebäude springen. Damit treibt Carter das Fantasy-Genre nicht nur in neue Höhen – er kann auch von sich behaupten, der erste Superheld zu sein: Er ist der Vorläufer von Superman und Luke Skywalker.
Burroughs kaufte die Ranch Tarzana im heutigen L. A., gab den Bleistiftjob auf und produzierte wie am Fließband drei Folgeromane, die ebenfalls als Fortsetzungsgeschichten erschienen – plus Tarzan bei den Affen, die Geschichte, deren Helden er nach seinem neuen Zuhause benannte –, noch ehe Die Prinzessin vom Mars überhaupt in Buchform herausgebracht wurde. Während seines verbleibenden produktiven und wohlhabenden Lebens kehrte Burroughs in noch elf weiteren Büchern nach Barsoom zurück.5 Barsoom ist ein faszinierender Planet und beispiellos in seiner Vermischung von Gedankengut aus Vergangenheit und Zukunft. Barsoom ist eine sterbende und ziemlich barbarische Welt, die von einer Atmosphärenfabrik am Leben erhalten wird. Es gibt dort militärische Flugmaschinen, Radiumpistolen, Telepathie, Städte unter Kuppeln und Medikamente, die die Lebenserwartung auf tausend Jahre verlängern, aber auch eine Menge Schwertkämpfe, höfische Ehrenkodizes, ein mittelalterliches Bestiarium und eine Reihe von Häuptlingen, die mit Lanzen bewaffnet auf ihren edlen Rössern herumreiten. Die exotische Wüstenumgebung stammt direkt aus Tausendundeine Nacht.
Die Barsoom-Geschichten folgen einem bewährten Rezept. Fluchten, Rettungen, Duelle und Kriege sind die Hauptattraktion, aber dazwischen enthüllt Burroughs mit dem Selbstvertrauen eines guten Reiseschriftstellers immer neue Aspekte dieser eigentümlichen Welt. Die Territorien werden klar umrissen. Grüne Tharks sind weitgehend barbarische Nomaden, die roten Bewohner von Helium rationale Aristokraten. In seinem zweiten Buch Die Götter des Mars stoßen wir auf blonde, weißhäutige Barsoomianer, ein Volk bösartiger, dekadenter Mörder, das die Bewohner des Planeten mit falschen Heilsversprechen ausbeutet.
Burroughs war bescheiden und betonte stets, er würde nur für Geld schreiben. Doch das ist Tiefstapelei. Auch heute noch steckt man sich beim Lesen schnell mit der mitreißenden, reinen, kindlichen Freude an, die den Autor beim Schreiben erfüllte. Barsoom hat moralisch eindeutige Helden von mythologischer Tiefe zu bieten – wenn man nur versucht, zu seinen Geheimnissen vorzudringen. Der Nervenkitzel des Erkundens und das Staunen über eine Welt, die uns dazu bringen kann, unseren Unglauben für einen Moment zu vergessen, stehen in derselben Tradition wie die Geisteshaltung, die Lucas in seinen Filmen später als »überschäumenden Leichtsinn« bezeichnen würde – die gleiche Geisteshaltung, die sich auch in den Arbeiten von so verschiedenen Künstlern wie J. R. R. Tolkien und Stan Lee findet. Ja, sie passt besonders gut zur Denkweise von Jugendlichen, aber sie ist allen zugänglich und hat das Zeug zu wahrer Größe. Arthur Conan Doyles Epigraph zu Die vergessene Welt (1912) erklärte dieses Prinzip so gut, dass es später auch das Pressematerial für den Star Wars-Originalfilm zierte:
I have wrought my simple plan
If I give one hour of joy
To the boy who’s half a man
Or the man who’s half a boy.6
Diese Aussage war in einer Hinsicht falsch: Es stellte sich schnell heraus, dass auch Frauen und Mädchen auf das Zeug standen. Dejah Thoris, John Carters barsoomianische Frau, die von ihm befruchtete Eier legte (wie das möglich sein konnte, wissen wir nicht. Ich kann nur noch einmal wiederholen: Es handelt sich um Space Fantasy!), ist nach den Maßstäben des 21. Jahrhunderts alles andere als eine emanzipierte Heldin. (Carter muss sie Dutzende Male und in elf verschiedenen Büchern aus angedeuteten Vergewaltigungssituationen retten.) Aber die namengebende Prinzessin aus dem ersten Buch ist Wissenschaftlerin, Kundschafterin, Verhandlungsführerin; ihre berühmten kurvenreichen Porträts von Fantasy-Künstler Frank Frazetta aus den 1960er-Jahren machten sie zur Sex-Ikone, wurden ihr aber kaum gerecht. Nach damaligem Standard war Dejah Thoris Frauenrechtlerin. Prinzessin Leia hat eine lange Reihe von Vorgängerinnen, die auf Dejah zurückgeht.
Burroughs veröffentlichte seine letzten Barsoom-Geschichten im Jahr 1943 und die letzte aus der ganz ähnlichen Venus-Reihe im Jahr 1942, acht Jahre vor seinem Tod.7 Inzwischen wurde das Genre abwechselnd als Space Fantasy, Science Fantasy, Space Opera, Planetenroman und Sword & Planet bezeichnet und war von Burroughs’ vielen Nachfolgern überschwemmt worden. Am nennenswertesten ist wohl seine Kollegin Leigh Brackett, später zur »Königin der Space Opera« gekrönt. 1940 stieg sie im Alter von 25 Jahren kometenhaft aus dem Nichts auf und verkaufte in nur vier Jahren unglaubliche 26 Geschichten in Folge an verschiedene Pulp-Magazine. Sie alle spielten in dem später so titulierten Brackett-Sonnensystem. Ihre Konzeption der verschiedenen Planeten war nicht unbedingt neu – ihr Mars und ihre Venus ähnelten stark denen von Burroughs –, allerdings hatte Brackett ein herausragendes Talent für die Beschreibung von interplanetaren Konflikten. Das Spielfeld hatte sich erweitert – von Marskriegen zu Sonnenkriegen. Auch Bracketts eigenes Spielfeld wurde größer: Sie begann, an Hollywood-Drehbüchern wie Tote schlafen fest zu arbeiten. Erst 1978, als sie als Autorin des Erstentwurfs zu Das Imperium schlägt zurück genannt wurde, gelang es ihr, diese beiden Karrieren zusammenzuführen.
Bracketts Ehemann Edmond Hamilton leistete ebenfalls einen Beitrag zu Stars Wars, wenn auch in nicht ganz so offensichtlicher Form. In seiner 1933 in dem Pulp-Magazin Weird Tales veröffentlichten Geschichte Kaldar, Planet of Antares findet sich die bahnbrechende Beschreibung der Waffe seines Helden – ein Schwert aus Licht:
Auf den ersten Blick schien das Schwert nichts weiter als ein langes Metallrapier zu sein. Doch er stellte fest, dass er, wenn er seinen Griff um das Heft verstärkte, auf einen Riegel drückte, der eine ungeheure, im Heft gespeicherte Kraft in die Klinge abgab, die sie in hellem Licht erstrahlen ließ. Er fand heraus, dass die Kraft der leuchtenden Klinge alles, was von ihr berührt wurde, umgehend vernichtete.
Er erfuhr, dass die Waffe als Lichtschwert bezeichnet wurde.
Hamiltons Geschichte wurde 1965 als Taschenbuch wiederaufgelegt, acht Jahre bevor ein junger Filmemacher namens George Lucas anfangen sollte, jede Science-Fiction-Pulpgeschichte zu verschlingen, die er in die Finger bekam.
Die Pulp-Magazine, die Hamilton, Brackett und ihresgleichen als Podium dienten, waren in vieler Hinsicht neben Burroughs die anderen Großeltern von Star Wars. Zwei der wichtigsten Geschichten in der Vorgeschichte des Franchise erschienen zeitgleich in der August-Ausgabe 1928 von Amazing Stories. Das Cover zeigte einen Mann mit Raketentornister. Er war der Star der Abenteuer der Skylark, einer Geschichte von E. E. »Doc« Smith, einem Lebensmittelchemiker, der als Hobby Belletristik schrieb, wenn er nicht gerade versuchte, den perfekten Donut zu entwickeln. Smith vereinte in sich Burroughs’ sprudelnden Enthusiasmus mit dem Verlangen, tiefer ins Weltall vorzustoßen. Seine Helden nutzen ein Raumschiff, das von dem Element »X« – einer Art Cavorit auf Steroiden – betrieben wird, das sie in der ersonnenen Geschichte zum ersten Mal aus dem Sonnensystem zu den Sternen befördert. Sie hüpfen von Planet zu Planet, als wären sie auf einem Tagesausflug in einer alten Schrottkarre unterwegs; ein planetenweiter Krieg beschert ihnen weniger Ärger als eine Doppelhochzeit und die folgende Medaillenverleihung. In Skylark, das später zu einer Serie ausgebaut wurde, finden sich die ganze Geschwindigkeit, die Romantik und der Humor von Star Wars. Danach schrieb Smith den Lensman-Zyklus – Geschichten über mystische interstellare Ritter, die eines Tages Lucas’ Konzept der Jedi beeinflussen würden. Smith erweiterte das Spielfeld des Konflikts auf die gesamte Galaxie.
Aber diese Ausgabe von Amazing Stories war wegen einer anderen Geschichte sogar noch wichtiger: Armageddon 2419 A. D. Der Name des Helden, der im 20. Jahrhundert versehentlich mit Gas in Schlaf versetzt wird und im 25. Jahrhundert wieder aufwacht, lautete Anthony Rogers. Seinen heute legendären Spitznamen verlieh ihm sein Erfinder, der Zeitungskolumnist Philip Nowlan, erst, als er ein nationales Comic-Syndikat darauf ansprach, ob man nicht einen regelmäßig erscheinenden Comicstrip mit seiner Figur veröffentlichen könne. Na ja, sagte der Verband, »Anthony Rogers« klingt zu förmlich für den Unterhaltungsteil. Wie wäre es mit etwas Cowboymäßigerem, sagen wir Buck?«
Buck Rogers ist im Wesentlichen John Carter in der Zukunft: ein beherzter, heldenhafter Fisch auf dem Trockenen. Aber fünf Jahrhunderte alt zu sein verleiht ihm noch keine Superkräfte. Und hier bietet sich der perfekte Aufhänger für die Einführung seiner Version von Dejah Thoris: Wilma Deering. Wilma ist Soldatin, so wie alle Amerikanerinnen des 25. Jahrhunderts, in dem Nordamerika von Mongolenhorden überrannt wurde. Sie ist intelligenter und geschickter als Buck. In einem der ersten Comicstrips wird sie dabei gezeigt, wie sie zu Bucks Erstaunen aus einem Haufen Elektroteile ein Radio zusammenbaut. Als sie gefangen genommen und vom mongolischen Imperator gezwungen wird, ein Kleid zu tragen, ruft sie: »Was ist das hier, ein Singspiel?« Welch einen Unterschied doch das Wahlrecht machte!
Buck hält durch und entwickelt sich weiter. Nach ein paar Jahren werden die Mongolen durch einen neuen Feind ersetzt: den Verräter Killer Kane. Buck und Wilma bekommen ein Raketenschiff und machen sich auf den Weg in den Weltraum – zum ersten Mal wird diese Grenze in einem Comic dargestellt. Der Strip stößt in neue Welten vor, mit Piraten vom Mars, Adligen vom Saturn und interstellaren Monstern. 1932 wurde Buck Rogers zu einer viermal wöchentlich ausgestrahlten CBS-Radioserie umgearbeitet. Bei dieser Gelegenheit strich man den Handlungsstrang um die Mongolen vollständig, und Buck wird nach fünf Jahrhunderten einfach vom Space Corps wiederbelebt.
Andere Comic-Syndikate wurden auf den lukrativen, medienübergreifenden Erfolg von Buck Rogers