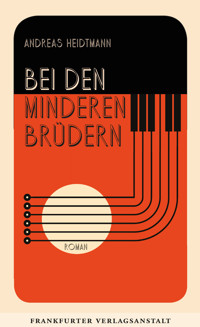Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unglaubliches geschieht im Frühjahr 1974: Die schwedische Popgruppe Abba gewinnt den Eurovision Song Contest und wird über Nacht weltberühmt. Ben Schneider und seine Freunde wittern Verrat: Ihre musikalischen Helden heißen Hendrix, Lennon und Dylan, in deren Songs geht es um Existenzielles, um Revolte, Drogen und Utopien. Sie leiden darunter, dass ihnen fortan aus Hitparaden und Jugendclubs Waterloo entgegenschallt. Gegen die dörfliche Tristesse am Rande des Ruhrgebiets hilft Ben manchmal nur das Spiel auf einem alten Klavier, das neben dem Grundig- Musikschrank wie ein Fremdkörper wirkt. Ein elektrisierendes Alter in einer dörflich entschleunigten Zeit, die Ben und seine Freunde jedoch nicht vor den Tragödien des Lebens bewahrt. Denn wo steht geschrieben, wie man ein Mädchen das erste Mal küsst, oder wie man verkraften soll, dass ein Klassenkamerad stirbt? Es beginnt ein Sommer der stillen Revolte und der ersten Liebe. Alles könnte so leicht sein, aber das ist es nicht – denn das Herz funktioniert anders als der Verstand und das Unbehagen ist allgegenwärtig, schielt aus muffigen Partykellern und gepflegten Vorgärten und lässt sich nur gemeinsam ertragen – mit Freunden, exzessiver Musik und der Hoffnung auf rauschhafte Momente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kirmes
Zug nach Nirgendwo
Slim Size
Don’t let it be
Tequila Sunrise
Wild Thing
Pelikan
Galeere
Xox
You got that something
Dark Side of the Moon
Here Comes the Sun
Perlonzauber
Sommerhimmel
Allegro barbaro
Sunshine of My Life
There’s nothing left to be desired
Kreidestaub
Geh nicht vorbei
Transposition
Heroes Are Hard to Find
Easy Living
Aria
Klimmzüge
Herbstflammen
Ferngespräche
Ich grolle nicht
Nach der Dämmerung
Quasi una cadenza
Baldeneysee
Love Hurts
Cantabile
Something in the Air
Fast Blues
The Revolution Will Not Be Televised
Across the Universe
Kirmes
Es kümmerte uns nicht, dass wir zu früh waren, um mit dem Autoscooter zu fahren. Auch die Sonne an diesem Freitagnachmittag kümmerte uns nicht oder irgendeine der Kirmesbuden, die gerade ihre Läden aufstießen. Die Wagen standen wie eine Verheißung am Rand der blanken Metallfläche und wussten noch nichts vom Trubel, der sie erwartete. Und von Susanna und mir. Vielleicht träumten sie in ihrer unangetasteten Ordnung von zurückliegenden Kirmestagen. Wer nichts Besseres zu tun hatte, trieb sich auf dem Schotterplatz herum, einige rauchten, offen oder heimlich. Man kannte sich, so wie jeder im Ort jeden kannte, was nicht hieß, dass jeder mit jedem sprach. Im Gegenteil, es war besser, mit den meisten nicht zu sprechen.
Wir saßen da, Susanna und ich, saßen auf dem schmalen Geländer und schauten auf die Wagen, die mir überaus friedlich erschienen, wie für die Ewigkeit hingestellt unter den noch dunklen Lichterketten. Verzerrt sahen wir uns in den verspiegelten Stützen. Die Junisonne wärmte unsere Rücken. Wir klemmten unsere Füße unter die Holme des Geländers. Langweilten uns, was aufregend war und mir wie eine besondere Form der Vertrautheit zwischen uns vorkam. Susanna zeigte auf einen der metallicfarbenen Wagen, dessen Lack in der Sonne aufschien, und sagte: Mit dem will ich fahren!
Ich schaute mich um – irgendwo stapelte jemand Getränkekisten, die klirrend aneinanderstießen – und zog meine Camelschachtel hervor. Natürlich rauchte Susanna nicht, sie war dreizehneinhalb, ein Jahr jünger als ich, und lebte gesund, aß Obst, trank Mineralwasser und begann ihren Morgen mit gymnastischen Übungen. Glaubte ich. Ich inhalierte den Rauch meiner Zigarette, meine Gesundheit war mir egal. Die Camelwerbung klang idiotisch, schon der Spruch des Helden, der nach langem Fußmarsch durch Dschungel oder Steppe seine Füße hochlegte: Ich geh’ meilenweit für eine Camel Filter. Die staubigen Sohlen waren durchgelaufen. Zur Entspannung, so das unverzichtbare Ritual, zündete er sich eine Camel an. Wer Camel rauchte, durfte man annehmen, wollte weg, wollte sich als souveräner Bezwinger der Welt fühlen. Für die daheimgebliebenen Väter hingegen, sofern sie noch rauchten, hatte man das HB-Männchen erfunden, eine Zeichentrickfigur, die ihnen verblüffend ähnelte und so lange von einem Missgeschick ins nächste schlitterte, bis sie rot anlief und eine Stimme aus dem Off mahnte: Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur HB.
Wenn wir mit dem roten Wagen fahren wollen, sagte ich, der zugegebenermaßen der schönste ist, haben wir ein Problem.
Susanna hob ihre fein gezeichneten Brauen und schaute mich an, was nichts anderes hieß als: Und das wäre?
Ich blies den Rauch an ihr vorbei in Richtung des Wagens, der weit hinten stand, zugeparkt, so dass es einige Songs dauern konnte, bis der Weg für ihn frei würde.
Aber er ist der schönste, sagte sie.
Ich stellte mir von Zeit zu Zeit vor, wie ich etwas Eindrucksvolles, etwas Großartiges zu ihr sagte, wie zum Beispiel jetzt über ihr Äußeres, dass sie umwerfend aussehe und dass dahingehend bei einem Wagen von Schönheit gar keine Rede sein könne. Es mangelte nicht an Einfällen, wenn sie auch meist zum falschen Zeitpunkt kamen. Eher mangelte es an der Kunst, sie auszusprechen, am Ton oder – Camel hin oder her – der alles ermöglichenden Lockerheit. Im Innern bauschte sich etwas auf, das den Worten, die mir vorschwebten, ihre Selbstverständlichkeit nahm. Alles in der Welt hätte ich für die Unerschütterlichkeit des durch nichts zu bezwingenden Camelhelden gegeben. Das Klügste wäre gewesen, auf einem fernen Kontinent die Füße hochzulegen und die armselige Idylle Lippfelds hinter sich zu lassen. Einschließlich der Erhabenheit seines Schotterplatzes und seiner trostlosen Kirmes darauf.
Am gläsernen Kassenhäuschen, das wir beide im Blick hatten, war ein hagerer Mensch mit leuchtendem Stirnband aufgetaucht, in der Hand eine Schachtel mit Plastikchips. Das aufgekrempelte Hemd gab die tätowierten Unterarme frei. Zwischen seinen Lippen hing eine Zigarette, deren Rauchschleier dicht vor seinem Gesicht aufstieg. Aus der Entfernung hätte man ihn, mit oder ohne Rauchschleier, für Keith Richards halten können.
Irgendwie erinnert er mich an Keith Richards, sagte ich zu Susanna, und im selben Moment ging überraschenderweise die Musik an, brach regelrecht über uns herein und gab mit dröhnender Wucht dem bislang so beschaulichen Nachmittag eine verheißungsvollere Wendung. Waterloo. Also ABBA. Also alles andere als Keith Richards. Aber hier und jetzt effektvoll, denn als wäre mit den ersten Tönen ein unsichtbarer Magnet im Zentrum der Scooterhalle wirksam geworden, drehten sich alle, die bislang planlos herumgestanden hatten, erwartungsvoll her.
Scheiß ABBA, sagte ich. Susannas rechter Fuß hatte im Takt zu wippen begonnen. Unvorstellbar, zu den pompösen Klängen in einen der Wagen zu steigen und unter den endlosen Wiederholungen des Waterloo-Refrains dahinzugleiten.
Dass ABBA beim Grand Prix Eurovision de la Chanson mit Waterloo triumphiert hatte, konnte nur Schockstarre hervorrufen oder ein lautes Lachen, in das irgendwann alle einstimmten. Mein in diesem Sommer bester Freund Mick war entsetzt und zog die zweite Variante vor. Mein Bruder Paul, der Soziologie studierte und alles analytisch betrachtete, erklärte uns, die Gruppe sei nicht authentisch, sondern eine Erfindung für Kleinbürger mit Plüschgarnitur und zu viel Ohrschmalz in den Gehörgängen.
Ich fand die Einschätzung scharfsinnig und so einleuchtend, dass ich sie gern wiederholte, wenn jemand ABBA erwähnte. Zwei glattgebügelte Paare in glitzernden Kostümen auf Plateausohlen, sagte mein Bruder, der zukünftige Soziologe. So was von peinlich, riefen wir im Chor. Es war Verrat – jedenfalls für uns, die wir Jimi Hendrix hörten, die Stones, John Lennon, Janis Joplin, Deep Purple und allenfalls noch etwas Glam Rock duldeten. Was anderes sollten wir tun, als uns eine Camel anstecken, den Fernseher aus dem Fenster schmeißen, Pink Floyd auflegen und uns schwören, nie so affig zu grinsen, nie eine so schnulzige Show hinzulegen und nie in so schauriger Kostümierung aufzutreten? Und als wir das alles gesagt hatten, fühlten wir uns wieder besser. Doch ABBA war schwer im Kommen in diesem Sommer und sorgte jetzt, am späten Nachtmittag, für Stimmung unter den Leuten, ein Hauch von Disco war plötzlich in der Luft, als hätte jemand unvermittelt die Gemütslage von gelangweilt auf elektrisiert gestellt.
Weißt du, sagte ich zu Susanna, ABBA ist eine Erfindung für Kleinbürger mit Plüschgarnitur und zu viel Ohrschmalz in den Gehörgängen.
Ihre Stirn, eben noch makellos glatt, bekam Falten. Wahrscheinlich fehlte ihr jemand, der Soziologie im vierten Semester studierte oder ihr aus dicken Taschenbüchern die Welt erklärte. Unverändert wippte ihr rechter Fuß zur Musik. Sie trug weiße Socken, was ich bei alledem ungeheuer verführerisch fand. Da sich ihre Jeans etwas hochgeschoben hatte, sah man den gerippten Abschluss der Socke und die fast ebenso weiße Haut darüber. Nur ein paar Zentimeter Blöße bis zum Ansatz der Wade. Alles sehr zierlich, so dass man Lust bekam, das Fußgelenk zu umfassen oder die Stelle zu berühren, wo der Knöchel prägnant hervorstand. Wäre dieser mich bremsende Mechanismus nicht gewesen, hätte ich todsicher gesagt: Du hast den schönsten Fußknöchel der Welt. Womm! Hin und wieder war es hilfreich, nicht kundzutun, was einem durch den Kopf ging. Irgendwie war jedes Gefühl am Ende unangebracht. Man musste es nur mit dem Abstand von ein paar Tagen oder Stunden betrachten, manchmal reichten auch Minuten.
Der Himmel schob ein paar dunklere Wolken heran, als wollte er damit der Lightshow des Autoscooters einen wirkungsvolleren Hintergrund verschaffen. Irgendwie war es plötzlich aufregend, auch wenn es ABBA-Rhythmen waren, auch wenn es Lippfelds Dorfplatz war, aber der Magnetismus wirkte unvermindert fort, und inzwischen standen Gruppen von Leuten da, und jeder, der vorher noch als hinterwäldlerischer Dörfler allenfalls Mitleid hätte erwarten dürfen, war jetzt, da er zu den stampfenden Bässen, den glamourösen ABBA-Harmonien und der Lightshow an der verspiegelten Säule lehnte, ein Held, ein verwegener Star, ein welterfahrener, begehrenswerter und geheimnisvoller Typ. Es war Zauberei. Es war Illusion. Wie auch immer. Ich blies den Rauch meiner Camel in die vibrierende Luft und zählte vergewissernd die Markstücke in meiner Tasche. Es war nicht viel, was ich an Münzen ertastete, doch ich hoffte, es würde reichen, um Susannas Wunsch zu erfüllen.
Auf dem Weg zum Kassenhäuschen dachte ich daran, den Satz mit dem Fußknöchel ins Tagebuch zu schreiben. Es war ein Spleen, alles, was mir wichtig schien, darin festzuhalten. Und jedes Mal, wenn ich etwas notierte, hatte ich das Gefühl, es sei etwas Außergewöhnliches und gewänne dadurch, dass ich es notierte, eine über den Tag hinausreichende Bedeutung. Allerdings wäre mein Tagebuch ohne Susanna ein weitgehend leeres Heft geblieben. Bei Bedarf konnte ich nachschlagen, wann wir uns wo getroffen hatten oder wann wir uns wo geküsst hätten, wenn wir uns jemals geküsst hätten. Ich hätte jederzeit nachlesen können, dass ich glaubte oder mir einbildete oder es für gut möglich hielt, dass ich sie liebte, und dass ich mich fragte, ob sie mich liebte oder glaubte, mich zu lieben, oder es für gut möglich hielt, dass sie mich liebte.
Ich strich die drei Fahrchips ein, die ich für mein Geld bekam, und hob meine Hand, als ich Kai Hendricksen sah. Er war zwei Jahre älter und wohnte drei Häuser weiter, was nicht so bemerkenswert war wie seine Begabung, immer ein tolles Mädchen neben sich zu haben. Und dass er es küsste, war so sicher, wie dass er kein Tagebuch schrieb und als Typ irgendwo zwischen smart und halbstark toll ankam. Bestimmt half ihm, dass er schön gescheiteltes Haar und sehr blaue Augen hatte und einen mittelblonden Flaum auf der Oberlippe. Entspannt lag sein Arm auf der Schulter seiner Freundin, die Rechte hing locker herab und am Gelenk glänzte ein filigranes Kettchen, wie es in Mode war, mit einem silbernen Plättchen, in das man seinen Namen oder den seiner Freundin eingravieren konnte. Im Idealfall trug die Freundin das Gegenstück. So oder so, mir kam es ein bisschen albern vor.
Hallo Kleiner, sagte Kai Hendricksen.
Hallo Großer, sagte ich.
Ich kenne dich irgendwoher, sagte seine Freundin, die meines Wissens Mona Michalak hieß und einen Kaugummi im Mund hatte, der kurzzeitig zwischen ihren Schneidezähnen hervorschimmerte.
Gut möglich, sagte ich. Muss ich das jetzt bedauern?
Na, sagte Kai Hendricksen, zisch ab.
Schönes Kettchen, sagte ich und wies auf das glitzernde Metall an seinem Gelenk. Tatsächlich trug seine Freundin die gleiche Kette.
Neidisch? fragte sie und schüttelte ihr dünnes Haar aus dem Gesicht.
Und wie, hätte ich sagen können, wäre ich nicht schon weg gewesen.
Susanna saß da, saß auf dem Geländer, wippte mit ihrem Fuß, allerdings nicht mehr zu ABBA, sondern zum silbrig-psychedelischen Sound von George McCrae, was auch nicht viel einladender war, und schaute auf meine Hand, die ich in der Art eines Zauberers öffnete, um ihr die Chips zu präsentieren.
Du fährst, sagte sie.
Kein Problem, sagte ich.
Und wer war das? Sie hob ihr Kinn in die Richtung, aus der ich gekommen war.
Ach, irgendwer halt, sagte ich.
Sie nickte und stieß sich vom Geländer ab: Also los!
Alles klar, sagte ich. Dabei hatte ich nicht die geringste Ahnung, wie unsere Fahrt losgehen sollte, denn der rote Wagen stand nach wie vor zugeparkt am Rand. Keine Chance, ihn halbwegs elegant von dort wegzusteuern. Hineinsetzen und warten war keine Option, die ich ernsthaft erwog. Es fiel mir schwer, mir nicht die denkbar unangenehmsten Situationen auszumalen. Und die aktuelle Situation hatte alle Voraussetzungen für die denkbar unangenehmste Situation, die man sich ausmalen konnte. Wir, Susanna und ich, im roten Wagen sitzend, wartend und allmählich erstarrend, während nahe und ferne und fernste Freunde und Nichtfreunde am Hallenrand stehen und uns belächeln oder schon winkend, kreischend und johlend ihre Runden drehen. Ich konnte mir sagen, stopp, es reicht, doch es half nichts, die Szene lief – wie zum Hohn – vor mir ab. Manchmal war Auf-der-Stelle-tot-umzufallen nicht das schlechteste Schicksal. Ich hätte den Kirmeshelden spielen und mit meinen drei Fahrchips die Wagen, die den Weg versperrten, wegfahren können. Der Reihe nach. Dann hätten mir die Chips für die eigentliche Fahrt gefehlt. Und am Ende wäre mir vermutlich Keith Richards dazwischengekommen, der neben den abgestellten Wagen stand und in kurzer Zeit vom Chipzähler zum Hallenaufseher aufgestiegen war.
Ohne Vorwarnung steuerte Susanna auf einen Wagen zu, der garantiert nicht rot war und aus dem ein Paar sprang. Lachend schwang sie sich auf den Sitz, als habe sie nie etwas anderes vorgehabt, als mit diesem Wagen zu fahren. Während sie mich anstrahlte und ich mich neben sie auf die Wagenbank fallen ließ, dachte ich an den Camelhelden. Du bist am Zug, sagte er entspannt und ersparte sich all die kleinlichen Vorstellungen und Zweifel.
Alles in Ordnung? fragte Susanna.
Und bei dir? fragte ich. Mein Herz war aus dem Rhythmus gekommen, schlug doppeltes Tempo, doch das musste niemandem auffallen. Ich klopfte mit dem Plastikchip aufs Fahrzeugblech. Hörte mein Herz. Es war unvermeidlich, sich auf dem Sitz, so eng er uns zusammenrücken ließ, als Paar zu fühlen. Und vielleicht gehörte es dazu, dass George McCrae Rock Your Baby sang. Das Signal, das schrill die Musik übertönte, löste in mir einen kleinen Taumel aus. Ich ließ den Chip wie ein durch nichts aus der Ruhe zu bringender Held in die Tiefe des Schlitzes rollen – und wir starteten.
Was wollte ich mehr, als zum synthetischen Pulsieren aus den Lautsprechern ohne Anstrengung Runde um Runde zu drehen? Mir kam es idiotisch vor, auf andere Wagen zuzuhalten oder gar frontale Zusammenstöße zu inszenieren. Mit den kreischenden, sich anrempelnden Kleingeistern hatten wir nichts zu tun. Susanna lehnte ihren Kopf an meine Schulter. Es war perfekt. Mehr als perfekt, wenn mehr als perfekt möglich war. Drehte ich ein wenig mein Gesicht, konnte ich den leichten, an Kamille erinnernden Duft ihres Haars ahnen. Es war keine Frage: Wenn ich den Moment beurteilt hätte, so bedenklich mir meine Beurteilungsneigung schien, hätte ich eine unüberbietbare Punktzahl vergeben. Und obwohl Bewertungen kindisch waren, konnte ich auf der Mittelseite meiner Tagebuchkladde von einer bewerteten Szene zur nächsten eine Linie ziehen, wodurch sich eine Zickzackfigur mit sanfter Aufwärtstendenz ergab. Als Kommentar zur Bewertung schwebte mir diese Zeile vor: Open up your heart and let the lovin’ start.
Zug nach Nirgendwo
Hinter uns verebbte der Lärm der Karussells und mit ihm das Kreischen und Lachen. In der tiefstehenden Sonne gingen uns zwei längliche Schatten voraus. Susannas Schatten kam mir trotz seiner verzerrten Proportionen elegant vor. Natürlich hätte ich sagen können: Ich kenne niemanden, der einen schöneren Schatten wirft als du! Oder: Dein Schatten macht die Welt heller. Die schimmernden Streifen ihres Sweatshirts, das ihr ausgezeichnet stand, vermisste ich allerdings. Ich probierte ein paar Figuren, die komisch aussehen sollten, hob zwei Finger, die neben meinen Ohren hervorwuchsen. Susanna winkte, als wollte sie unsere Schatten grüßen. Ich legte den Arm um ihre Schulter, und die Umrisse rückten zusammen. Allein das Gebärdenspiel unserer Doppelgänger gab mir die Freiheit dazu. Ohne Grund hätte ich nie meinen Arm um ihre Schulter legen können. Doch sie hätte sicher auch ohne Grund, wenn ich ohne Grund meinen Arm um sie gelegt hätte, ihren Kopf an mich gelehnt. Es kam mir vor, als würde die sinkende Sonne im Rücken uns sanft vorantreiben. Zweige tauchten neben uns auf, Dachfirste, die wir überschritten. Vögel flogen durch uns hindurch.
Dann bogen wir ab und verloren die Schatten aus dem Blick. Weiße Bungalows standen zwischen Lebensbäumen und schmalen Birken. Mein Vater hatte einmal behauptet, im Winter könne man auf den flachen Dächern der Bungalows Schlittschuh laufen. Ich hatte geglaubt, es sei ein architektonischer Clou, vergleichbar mit den Swimmingpools in den Gärten. Aber natürlich, wer fuhr schon auf dem Dach seines Hauses Schlittschuh? Dafür waren die Bungalows zu klein. Auch die Swimmingpools waren nicht mit den Swimmingpools in amerikanischen Spielfilmen vergleichbar. Für den Ordnungssinn der älteren Lippfelder war es eine Herausforderung, dass die Bungalows nicht wie mit dem Lineal gezogen dastanden, sondern gestaffelt. Der Fußweg verlief sensationell im Zickzack. Irgendwie sah alles moderner aus, und ich stellte mir vor, dass man hier zum Einzug Simon & Garfunkels Bridge over Troubled Water auflegte, während man bei uns im Viertel Nana Mouskouri oder Freddy Quinn bevorzugte.
Seitdem die Schatten uns nicht mehr vorausgingen, blendete die Sonne von rechts. Schuf helle Konturen. Susannas Gesicht leuchtete. Ihre Haut war die empfindlichste Haut, die es gab. Verletzlich. Und verletzt. Auf eine zarte, atemberaubend aparte Art. Wer flüchtig hinschaute, entdeckte nicht einmal die Spuren der Akne, die verheilenden Narben, abgedeckt von einer Creme. Nur wenn es kälter wurde, zeigten sie sich als violette Erhabenheiten in ihrem Teint.
Stimmt was nicht? fragte sie.
Die Schatten sind verschwunden, sagte ich.
Ich komme zu spät, sagte sie.
Meist verließen wir uns auf die Kirchturmuhr, die sich alle 15 Minuten mit einem blechernen Glockenschlag meldete und mit einem tieferen Ton die Stunden zählte. Bis zur letzten Weide der Ortschaft. Doch ich hatte nicht mitgezählt.
Okay, sagte ich. Es war ihre Entscheidung. Ob sie pünktlich war oder nicht. Ob sie Ärger bekam oder nicht. Auch wenn ich ihr keinen Ärger wünschte. Ihre Mutter hatte nicht nur einen sehr genauen Zeitsinn, sondern auch einen Hang, einfache Dinge kompliziert zu sehen. Schon deswegen machten wir ein kleines Stück vor den Bungalows Halt, um uns zu verabschieden. Es gab eine alte Bank, durch deren Holzlatten Brennnesseln und Wilder Rhabarber wuchsen. Auf dem Straßenschild stand Kilianscher Winkel, aber wir sagten nur Brennnesselplatz. Das Auffallendste war eine Kastanie, die hoch über die Flachdächer hinausragte und gewiss schon an dieser Stelle gestanden hatte, als noch niemand daran dachte, in Lippfeld Bungalows zu errichten.
Susanna schwang sich auf die Lehne, setzte die Füße auf die gebrochenen Holzlatten. Trat gegen ein paar hervorspringende Brennnesselspitzen. Offenbar meinte sie es ernst mit ihrer Unpünktlichkeit. Ich griff nach meiner Camelschachtel, wenngleich ich nicht wusste, ob Susannas Bereitschaft zur Unpünktlichkeit genügend Zeit ließ, eine Zigarette zu rauchen.
Weißt du eigentlich, sagte sie, dass Christian Anders unglaublich gut aussieht?
Mir gefielen ihre Bemerkungen aus dem Nichts, auch wenn sie mich verwirrten, und ich sagte: Ist mir, ehrlich gesagt, neu.
Er wurde zum bestgekleideten Showstar Deutschlands gekürt!
Wow!
Mein Vater, der am liebsten in lila Hemden herumgelaufen ist, muss komisch neben ihm ausgesehen haben.
Du kannst ja nichts dazu, sagte ich.
Natürlich wäre es spannender gewesen, er wäre mit Elton John aufgetreten.
Dann wäre er vermutlich nicht in Lippfeld gelandet.
Wir alle nicht!
Wie schön, sagte ich.
Susanna, der meine Ironie erwartungsgemäß missfiel, drohte, mich von der Bank zu stoßen. Als wäre das eine Antwort, legte ich meinen Arm um ihre Schultern, so dass aus unserem lockeren ein enges Nebeneinandersitzen wurde. Sie protestierte nicht. Sacht blies ich den Rauch meiner Zigarette in Richtung Kastanienwipfel und fühlte mich, als liefe mein Leben im Augenblick großartig. Wahrscheinlich hatte ihr Vater es wirklich als Schlagzeuger nicht weit gebracht, wenn nichts als Christian-Anders-Nostalgie blieb, unspektakuläre Auftritte oder anonyme Studioaufnahmen. Immerhin, ich konnte mir schlechtere Jobs vorstellen, als Schlagzeug zu spielen.
Dramatisch finde ich, wie meine Schwester ihn anhimmelt, sagte Susanna. Ihr Fuß stieß nach einer blühenden Distel, doch der biegsame Stängel schwankte nur, ohne zu brechen.
Sie hat alles über ihn herausgefunden. Sogar, dass Christian Anders in Wahrheit Gustav Schinzel heißt. Und regelmäßig in einer bekannten Kölner Disco aufkreuzt – Love Story.
Bewundernswert, sagte ich.
Sie interessiert dich, sagte Susanna spöttisch.
Unbedingt, sagte ich so ironisch wie möglich und zog an meiner Camel. Ihre Schwester Britta war etwas jünger als mein Bruder, 19 oder 20, ich hatte sie einmal zusammen vor der Godden Stowe gesehen, was wohl Zufall war, denn sie hätten es garantiert nicht lang miteinander ausgehalten, weil mein Bruder auf gar keinen Fall über Schnulzensänger gesprochen hätte oder auf ein Christian-Anders-Konzert gegangen wäre. Ihm konnte allerdings nicht entgangen sein, dass Susannas Schwester in ihrem persilweißen Kittel und mit ihrem streng zurückgekämmten Haar rasend gut aussah. Eine Zeitlang konnte man sie in der Arztpraxis als angehende Arzthelferin bewundern und sich freuen, wenn man krank war.
Jedes Mal, sagte Susanna, wenn mein Vater von einer Tour heimkam, nahm er erst einmal ein Bad. Und jedes Mal hatte ich Angst, dass er in der Badewanne ertrinkt. Keine Ahnung warum. Ich stand da und horchte an der Tür. Als könnte ich durch die Tür hindurch feststellen, ob er noch atmete. Manchmal hörte ich das gleichmäßige Tropfen des Wasserhahns. Plopp plopp plopp. Oder wie er eine Melodie vor sich hinsang. Dann wieder plopp plopp plopp. Tatsächlich summte er manchmal Songs wie Es fährt ein Zug nach Nirgendwo. Du weißt schon. Solange er summte, lebte er. Und alles war in Ordnung. Also hätte er die ganze Zeit summen sollen. Das hätte mich beruhigt. Manchmal hörte ich, wie er sich was zu trinken eingoss. Mir war klar, dass es kein Mineralwasser war, sondern das, was er auch in den Nächten getrunken hat, wenn er mit der Band spielte. Cocktails. Oder die wahren Drinks. Die er so liebte, wie er Humphrey Bogarts Filme liebte. Gin, Scotch, Martini, Bourbon. Er hat sogar das grässlichste aller grässlichen Getränke geliebt: Eierlikör. Verpoorten. Eine Art flüssiger Vanillepudding. Eiterfarben. Wenn ich das Zeug roch, das er sich einschenkte, musste ich aus dem Zimmer rennen. Anscheinend war die Musik, die mein Vater machte, so schlecht, dass er Eierlikör trinken musste. Meine Schwester, die künftige Arzthelferin, hatte damals schon ihre Diagnose parat und behauptete, er sei Alkoholiker. Ich fand das ungerecht. Er war Musiker. Er war Humphrey-Bogart-Fan, er war Christian-Anders-Schlagzeuger, er war vor allem unser Held. Und tausend anderes. Gut, er hat uns Kindern auch gezeigt, wie sich der Whiskey in seinem kleinen Glas entflammte, wenn er das Feuerzeug dranhielt. Solche Vorführungen waren nicht im Sinne meiner Mutter, die übrigens auch zur Alkoholiker-Diagnose neigte. Egal. Ich stand da, vor der Badezimmertür, überzeugt, er würde in der Badewanne ertrinken. Es war wie ein kleiner Film: Seine Lider wurden schwerer, er sackte in seiner Benommenheit langsam weg und sein Körper glitt sanft unter den Schaum, vor allem Kinn und Nasenspitze, möglicherweise war er längst ohnmächtig, wie auch immer, er ging im Rausch unter. Bei dieser Vorstellung wäre ich am liebsten ins Bad gestürmt, jederzeit, um ihn aus der Wanne zu jagen mit irgendeinem blödsinnigen Vorwand wie Es brennt, es brennt. Doch nichts wäre lächerlicher gewesen, als ins Bad zu stürmen und Es brennt, es brennt zu rufen, während er gerade noch Es fährt ein Zug nach Nirgendwo summte.
Klar, sagte ich, lächerlich. Oder paranoid. Das Wort hatte ich von meinem Bruder, und es klang ziemlich nach Bescheidwissen, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob es passte.
Du hättest natürlich, sagte ich, auch wirklich das Haus anstecken können.
Diese Szene, sagte sie, ohne auf meine Bemerkung einzugehen, geht mir nicht aus dem Kopf, wie mein Vater langsam, aber unaufhaltsam tiefer rutscht. Auf dem Wasser treiben Schauminseln. Und es riecht nach Fichte. So hat es immer gerochen, wenn er das Schaumbad benutzte, das auf dem Wannenrand stand. Dummerweise ist es meiner Vorstellung egal, dass er nicht ertrunken ist, sondern an Klinikschläuchen weggedämmert. Meine Schwester glaubt fest, dass er am Alkohol krepiert ist. Okay, nicht nur am Eierlikör. Am Humphrey-Bogart-Gesöff. Direkt oder indirekt. Geradezu unheimlich war es, dass seine Bandkollegen zur Beerdigung tatsächlich Christian Anders gespielt haben, keine Ahnung, was es war, ich hab geheult und nicht viel mitbekommen. Meine Mutter fand den Bandauftritt nicht so toll, denn es waren die Kollegen, mit denen er auf seinen Tourneen gesoffen hatte. Das Allerschlimmste aber war, das Allerverrückteste, dass niemand sie davon abbringen konnte, den Sarg in einem Rolls-Royce durch seine Heimatstadt Gelsenkirchen zu fahren. Meine Schwester ist überzeugt, es war das Auto von Christian Anders. Christian Anders ist übrigens nicht nur der bestgekleidete Schlagersänger Deutschlands, er fährt auch einen vergoldeten Rolls-Royce, laut meiner Schwester, einen Phantom IV, wie die Queen oder General Franco. Nur eben gold lackiert. Damit hätte er die Königin von England und General Franco von Spanien übertrumpft. Als Showstar. Als Schlagerheld. Als der Größte überhaupt. Wahnsinn, oder?
Wahnsinn, sagte ich. Auch wenn ich mir nicht sicher war, ob ich die Geschichte mit dem vergoldeten Rolls-Royce glauben sollte. Auch ein nicht vergoldeter Rolls-Royce hätte in Gelsenkirchen sicher schon für Aufsehen gesorgt.
Susanna zog eine durchsichtige Plastikhülle aus der Hosentasche, kaum größer als ein Ausweis, und hielt sie auf ihrem rechten Oberschenkel fest. Ihr Zeigefinger tippte auf das Foto, das in der Hülle steckte, ein abgegriffenes Polaroid.
Hier, sagte sie und zeigte auf die Figur in der Mitte. Mich interessierte allerdings mehr die Person daneben, die acht oder neun war und einen Stofflöwen in der Hand hielt. Ihr Haar viel länger als jetzt. Ihr Vater blies dem Betrachter den Rauch seiner Zigarette entgegen und trug ein Hemd mit allerlei floralen Stickereien, die auf dem Bild eine Färbung zwischen Pink und Violett angenommen hatten. Richtung Be sure to wear some flowers in your hair. Dabei sah er mit seinem krausen Haar eher wie Jimi Hendrix aus oder doch mindestens wie Paul Breitner.
Ziemlich spät, sagte Susanna und steckte das Polaroid wieder weg, als erscheine es ihr im Nachhinein unangemessen, es mir gezeigt zu haben.
Hast du das Foto immer dabei? fragte ich.
Geht dich nichts an, sagte sie.
Tschuldigung, sagte ich und schnippte meine Zigarette weg. Susanna rutschte von der Lehne. Ich hatte mit meiner glimmenden Kippe fast einen schwarzen Käfer getroffen, einen Totenkäfer, der über eines der riesigen Rhabarberblätter krabbelte und immer wieder abrutschte. Unwahrscheinlich, dass er es je über den Blattrand schaffen würde.
Susanna beugte sich vor, während ich noch den Käfer im Blick hatte, und berührte mit den Lippen meine Wange. Verrückt. Ich war verwirrt. Mit einem Bis-dann trat sie aus dem Schatten der Kastanie und ging ohne Eile in Richtung Bungalows, gerade so, als seien zu ihren leicht wiegenden Schritten die Klänge von Bridge over Troubled Water zu hören. Ich holte tief Luft. Schaute ihr nach. Ein leichter Wind kam auf. Die ganze Welt hatte Platz in meiner Brust.
Slim Size
Es gab Szenen, von denen ich glaubte, es gäbe sie nur im Film. Aber es gab sie auch in Lippfeld. Eigentlich war es nur eine Ohrfeige. Die allerdings hatte, zumindest aus meiner Sicht, etwas Filmreifes. Auch wenn es Kai Hendricksen und seine Freundin Mona Michalak mit ihrer Darbietung sicher nicht zu Schauspielerruhm gebracht hätten. Vermutlich hätte ich den Vorfall nicht einmal bemerkt, hätte Susanna an meiner Seite gesessen. Oder die Ohrfeige wäre uns nur ein Achselzucken wert gewesen. Wie im Film, hätte ich gesagt. Aber nur fast, wäre Susannas Antwort gewesen. Ins Tagebuch hätte ich schreiben können: Ohne dich ist jedes Kirmesfest ein Trauerspiel. Ich ging davon aus, dass Susannas Zuspätkommen am Vorabend schuld daran war, dass ich ohne sie dasaß.
Der Music Express, den wir Raupe nannten, rauschte mit schrillem Hupen an mir vorbei. Kai Hendricksen stand etwas oberhalb am Gang. Beide Ellbogen hatte er nach hinten über das Geländer geschoben, das Silberkettchen schimmerte an seinem sehr entspannt wirkenden Handgelenk. Mona Michalak – und in dem Moment erst bemerkte ich sie – löste sich aus dem Kirmesgedränge, nahm Kurs auf die Raupe, schritt mit klackenden Plateaustiefelschritten dicht an mir vorbei und hielt auf Kai Hendricksen zu, der, beschienen von den Spots der Raupe, in seinem weißen Hemd regelrecht leuchtete. Egal, was gerade aus den Lautsprechern schallte, es war laut genug, um das, was Mona Michalak in Richtung ihres Freundes schrie, zu übertönen. Die Aufregung veränderte sie zu ihrem Vorteil, wie ich fand. Außer sich zu sein, stand ihr. Erstaunlich, wie sie ihr langes Haar mehr zurückwarf als zurückstrich. Mit einem Mal war sie gar nicht mehr blass. Auf ihren Ansturm reagierte Kai Hendricksen mit einem feinen Lächeln, ohne sich auch nur einen Millimeter zu rühren. Ihre volle Wirkung entfaltete die Szene, als Mona das Kettchen, das sie offensichtlich bis jetzt getragen hatte, von ihrem Gelenk riss, um es Kai Hendricksen mit Effekt vor die Füße zu schleudern. Dazu stampfte sie auf. Sein Lächeln wurde breiter, zog sich, bis es ein echtes Grinsen war. Dann öffnete er die Hände wie jemand, der sich für etwas, für das er im Grunde nichts kann, entschuldigt und dabei noch andeutet, dass alles gar nicht so schlimm sei. Das war die Sekunde der Ohrfeige. Es sah nach einer schallenden Ohrfeige aus. Reflexhaft hob Kai Hendricksen seine Rechte ans Gesicht und rieb, mehr beleidigt als leidend, seine Wange. Mona drehte ab, ein Zapp!, und stampfte mit wehendem Haar davon, mindestens so energisch, wie sie gekommen war. Sie rief noch etwas, allerdings gar nicht mehr an ihn adressiert, sondern mehr für sich oder für den Rest der Welt, wahrscheinlich etwas wie: Scheißkerl. Was sehr passend gewesen wäre. Oder: Ich hasse dich.
Was mich nicht weniger erstaunte, war Kai Hendricksens nächste Reaktion. Während Mona Michalak in der Menge verschwand, beugte er sich langsam hinab, um das Kettchen aufzuheben. Da sein Name darin eingraviert war, hatte es für ihn wahrscheinlich einen gewissen Wiederverwendungswert. Wenn er in dieser Sekunde daran dachte, wie ich vermutete, verdiente sein unaufgeregtes Handeln Anerkennung.
Wahnsinn, sagte neben mir Manfred Abend, den ich fast vergessen hatte und den wir meist Manni nannten, ohne dabei an Geld zu denken.
Klar, sagte ich.
Wahnsinn, sagte Manni wieder und hob seine Bierflasche in Richtung der Lautsprecherboxen, aus denen, wie mir nun erst klar wurde, die Rolling Stones zu hören waren. Ich ging davon aus, dass es Mick Jagger war, der das Lied Mona sang, einen Song, der mir, was Text und Melodie anging, ein bisschen penetrant vorkam. Ich nahm Manni die Bierflasche aus der Hand, um ein paar Schlucke zu trinken.
Witzig, sagte Manni, der Titel passt, wie für Mona Michalak bestellt.
Nur ein bisschen penetrant, sagte ich.
Rolling Stones, sagte Manni, 1964. Er war Spezialist, was mich nicht störte, obwohl es paradox war, dass er kaum aktuelle Titel hörte, sondern irgendwo zwischen Heartbreak Hotel und Let It Be hängengeblieben war. Dazu kamen stapelweise Platten aus der Hochphase der Kinks und ein erlesener Dual 1229-Plattenspieler, um den ihn jeder beneidete. Keine Ahnung, wie er an das Gerät gekommen war. Sein Vater, der im nahen Kieswerk arbeitete, leistete sich alle zwei Jahre das neuste Audi-Modell, während mein Vater nur einen VW Käfer fuhr, als wäre jeder andere Wagen für ihn eine Form von Klassenverrat.
Das Original, sagte Manni, ist von Bo Diddley, Ende der Fünfziger.
Trotzdem ätzend, sagte ich und krächzte wie Mick Jagger: Oh, Mona, oh, Mona.
Ignorant, sagte Manni.
Oh, Mona, krächzte ich.
Gib die Flasche zurück! sagte Manni.
Klappe! sagte ich und wusste selbst nicht, warum ich plötzlich alles nur noch mies fand.
Der Abend war gelaufen, so oder so, mir ging die Kirmesstimmung auf die Nerven, das Geschrei, die Betrunkenen, vor allem die in Uniformen herumlaufenden Schützen, die mit Vorliebe Kunstrosen für ihre kichernden Freundinnen schossen. Mir gingen ihr albernes Getue, ihre dünnen Beine und ihr Gejauchze auf die Nerven. Mein letztes Geld reichte für zwei Flaschen Bier, die ich kurz hintereinander leerte in der Hoffnung, meine Laune könnte sich aufhellen. Sonderbar weich war mir in den Knien, aber es war eine angenehme Weichheit. Schwerelos ging ich quer über den Platz, quer durch den Lärm, durch ein verqueres Konzert ineinanderfließender Melodien, gemixt mit Marschmusiktakten aus dem Schützenzelt, dazu von fern Grillschwaden und Bratapfelduft, und weiter ging ich federleicht in Richtung Mittelstraße und Schwanenteich. Im dunklen Wasser spiegelten sich die Lichter der Kirmeskarusselle wie aus einer fernen Galaxie. Gern wäre ich, um mich zu erfrischen, hineingesprungen. Leider war der Teich nur ein mit Seerosen und Schwänen garniertes Schlammloch von einem halben Meter Tiefe.
Hinter mir klangen noch schwach die Beats, ein endlos abspulendes Chirpy Chirpy Cheep Cheep, während ich von der nahen Parkbank ein Schluchzen hörte. Nur der Mond spendete etwas Licht, so dass ich Mona Michalak nicht sofort erkannte, jedenfalls nicht, bevor ich die Bank erreichte. Ihr Blond allerdings schimmerte auch im Halbdunkel. Sie trug ein ziemlich auffälliges Kleid, mit unruhigen rotgrünen Kurven und Kreisen. Dazu ihre halbhohen Stiefel mit Plateausohlen. Ich war fast vorbei, als aus ihrem Schluchzen ein halblautes He zu mir drang.
Weitergehen, dachte ich, was hatte ich mit Mona Michalak zu tun, die im Grunde ja Kai Hendricksens Freundin war, zumindest noch in meinem Kopf, und mindestens ein Jahr älter als ich. Und bestimmt Middle of the Road gut fand. Mona, oh, Mona, hörte ich Mick Jagger krächzen.
Ehe ich noch ganz vorbei war, kam wieder das He, lauter diesmal. Also verlangsamte ich meine Schritte. Drehte mich um. Sah sie an. Sagte ein bisschen distanziert: Ja, bitte?
Hast du Feuer? fragte sie sehr leise.
Feuer? wiederholte ich und suchte nach meinen Streichhölzern. Es war etwas merkwürdig, wie sie zu mir herschaute, ihre Augenpartie vom Weinen gerötet, die Schminke verwischt, ein gequält wirkendes Gesicht. Offenbar war sie nicht halb so cool wie Kai Hendricksen, der gewiss nirgends auf einer Parkbank hockte und heulte. Ihre schmale Handtasche hatte das Muster ihres Kleides, was ein wenig manieriert wirkte. Daraus zog sie eine Schachtel Kim hervor.
Auch eine? fragte sie.
Ich war, milde gesagt, entsetzt. Sah ich aus, als rauchte ich Kim? Ganz so weit konnte es nicht mit mir gekommen sein. Wenn ihre Zigaretten auch, wie ich zugeben musste, elegant aussahen, schon wegen der Länge. Slim Size eben. Für Männerhände viel zu chic. Offenkundig bewegte ich mich geistig bereits auf einem Nachtflug, was ich dem Alkohol oder dem versauten Abend zu verdanken hatte, auf jeden Fall dachte ich plötzlich: Sie hat hübsche Beine, zwischen Anmut und Verführung, so kam mir ihre Erscheinung vor, vom knappen Kleid bis zum hellen Stiefelschaft, Beine, grazil und makellos wie ihre Kim. Und als hätte sich blitzschnell mein IQ halbiert oder jemand mich einer Gehirnwäsche unterzogen, sagte ich: Okay, gib mir eine!
Na, setz dich, sagte sie. Warum war mir bisher nie aufgefallen, wie sehr sie Agnetha Fältskog ähnelte?
Das Zündholz flammte auf, und ich hielt es unter ihre Zigarettenspitze. Wenn ich mich nicht täuschte, schillerten ihre lackierten Nägel im selben Rotton wie die Spiralformen auf ihrem Kleid. Mit so viel Mühe, wie sie darauf verwandte, ihr Äußeres herzurichten, hätte sie es aufs nächste Bravo-Cover schaffen können.
Scheiß Tag, was? Ihre Kim schmeckte wie 4711, allerdings so, als habe man sich vor einer Woche damit parfümiert.
Sie schluchzte unvermittelt auf, bedeckte mit der Linken ihre Augen, während sie die Rechte mit der glimmenden Zigarette geziert von sich streckte. Vielleicht wollte sie mit der Glut den Nachthimmel entflammen. Kleine Erschütterungen liefen durch ihren Körper und ließen die Zigarettenspitze zittern. Es war alles andere als beruhigend, dass ihr Schluchzen heftiger wurde und in ein regelrechtes Weinen überging, ein anfangs noch halbwegs unterdrücktes, doch dann immer weniger kontrolliertes Weinen. Ihr Kopf sank auf meine Brust, und ich musste, schon weil ich nicht wusste, wohin mit meinen Händen, den Arm um ihre Schultern legen. Ihr Körper fühlte sich fremd an, soweit mir ein Vergleich möglich war, als verliefen tausend Mal mehr Nerven unter ihrer Haut. Eine geradezu beängstigende Feinnervigkeit. Tatsächlich bekam sie ihren Weinkrampf nicht unter Kontrolle. Ich spürte, wie ihre Tränen auf mein T-Shirt liefen, warm, beinahe heiß, was mich mehr und mehr irritierte. Scheißescheißescheiße, dachte ich, während ich mich gegen den Impuls wehrte, aufzuspringen, die parfümierte Kim ins Wasser zu werfen und abzuhauen. Dabei lösten ihre Tränen etwas aus, das dafür sorgte, dass meine Jeans eng wurde, eine Erregung, die stärker schien als mein Wunsch, mich davonzumachen.
Mona drehte ihr Gesicht zu mir, ihre Hand mit der Slim-Size-Kim berührte meinen Nacken, und unsere Lippen lagen mit einem Mal aufeinander. Keine Chance, zu verschwinden, ohne für alle Zeiten als Feigling dazustehen, als elender Zauderer. Ihre Lippen öffneten sich, ihre Zungenspitze war da, drängte sanft gegen meine Zunge und suchte ihren Weg. Es fühlte sich an, als wäre im Innern ein Sprengsatz gezündet worden. Ich war mir sicher, dass sich mein Blut in Magma verwandelte, während ihre Hand an meinem Nacken mir bedeutete, nicht zurückzuweichen, mich ganz der Nähe hinzugeben, der sich ausbreitenden Wärme, dem Duft ihres Parfüms und der eigenen Verwegenheit.
Ich kam mir heldenhaft vor, weil ich derjenige war, der sie küsste, obwohl sie eben noch in Begleitung des lässigsten aller Begleiter gewesen war, samt Silberkettchengravur, auch wenn sie wie Agnetha Fältskog aussah, was kein Handicap sein musste, wenn man Blond mochte. Ich kam mir heldenhaft vor, leichtsinnigerweise, während wir uns in einen nicht nachlassenden Rausch küssten. Es war der aufregendste, der betörendste, der schwindelerregendste Moment, der mir denkbar schien, und zugleich ein Moment, von dem ich nicht einmal wusste, ob es ihn geben sollte.
In meiner Kühnheit legte ich meine Rechte auf ihr Knie und ließ sie, gleichsam als Begleitung unseres ungestümen Kusses, unter ihrem Kleid hinauffahren. Dass sie als Antwort ihre Hand auf meine Jeans legte, machte mich nervös, und mit leichtem Unbehagen sah ich dem Moment entgegen, wenn ihre Finger die unter dem Stoff tastbare Sperrigkeit erreichten. In ihrem Auf und Ab schienen die Finger entschlossen, die Hitze bis zu einem Punkt zu führen, an dem die letzte Kontrolle verloren ging.
Ich bedauerte es nicht, als ich Stimmen in der Nähe hörte. Betrunkene Kirmesgäste, Kilianschützen, die irgendeinen Schlager sangen, der, wenn auch sehr schräg, nach Tony Marshall klang. Ich löste mich vorsichtig von Mona, während die Gruppe, zwei Paare, an uns vorbeischwankte. Die Frauen winkten und warfen Kusshände. Schöne Maid, oho, schrie der größere Typ. Schöne Maid! Oho. Dann riss er sich Schuhe und Socken von den Füßen, was nach Slapstick aussah, da er sich nur mit Mühe auf jeweils einem Fuß hielt, und wankte auf den Schwanenteich zu. Schöööne Maid, grölte der andere und schwenkte eine Sektflasche. Der Größere, der tatsächlich eine Uniformjacke trug, taumelte ins Wasser hinein. Stoppte noch einmal, um seine Hose aufzukrempeln. Die anderen johlten und applaudierten. Weiter! schrie der mit der Sektflasche: Weiter! Ein paar Enten, die der Größere aufscheuchte, flatterten dicht über dem Wasserspiegel davon. Mona zuckte neben mir zusammen.
Oh, Gott, sagte ich.
Vorsichtig wischte sie mit ihren Fingern etwas aus dem Auge und sagte: Wahrscheinlich sehe ich furchtbar aus.
Schöne Maid, sang der grünuniformierte Schütze im Schwanenteich. Er war jetzt bis zu den Knien im Wasser, und mit etwas Glück, so hoffte ich, brachte ihn der nächste Schritt so weit in den Schlick hinein, dass der nächtliche Tümpel ihn verschluckte.
Ich muss noch mal wohin, sagte Mona.
Ah, sagte ich.
Allein, sagte sie und strich über mein T-Shirt, das sich noch etwas feucht anfühlte. Ich musste zugeben, Kim hin oder her, sie war mir beinahe sympathisch. Mit Betonung auf beinahe.
Willst du dein Kettchen suchen? fragte ich.
Spielt das eine Rolle? fragte sie.
Ich steh nicht auf Kettchen, sagte ich.
Siehst du, sagte sie und stand auf.
Danke für die Zichte übrigens, sagte ich.
Danke fürs Feuer, sagte sie.
Aber gern, sagte ich.
Sie strich ihr Haar glatt und suchte in dem Handtäschchen ihren Taschenspiegel. Zückte den Lippenstift. Zog rasch und konzentriert das Rot ihrer Lippen nach. Schaute am Spiegel vorbei zu mir, musterte mich sehr ernst und sagte: Wir haben nie auf dieser Bank gesessen!
Ich war erstaunt, wie rasch sie mit ein bisschen Kosmetik zur Sachlichkeit zurückfand.
Alles klar, sagte ich und runzelte die Stirn: Ich weiß nicht, von welcher Bank du sprichst.
Don’t let it be
Es kam vor, dass ich in einem schmalen Buch blätterte, das ein Zufallsgriff aus dem Regal meines Bruders war. Seine Sammlung erschien mir wie der Versuch, die Welt auf kleinstem Raum mit Erklärungen auszustatten. Ihm zuliebe stöberte ich gelegentlich darin, und sicherlich hätte es ihm gefallen, mich mit Nietzsches Also sprach Zarathustra zu sehen. Ein Buch, dessen Titel rätselhaft klang. Nicht zum ersten Mal fragte ich mich, ob das Also eher auf Al oder auf so zu betonen sei. Die erste Möglichkeit schien mir zu alltäglich, die zweite zu gewählt, wenngleich sie zum Stil des Buches gepasst hätte.
Der Abendwind hielt die leere Hollywoodschaukel in Bewegung. Ich saß abseits auf dem Rasen und war schon über die ersten zwanzig Zarathustra-Seiten hinaus. Ein paar dunkelviolette Pflaumen lagen vor mir im Gras, eine der wenigen Obstsorten, die genießbar waren im Unterschied zu den Sauerkirschen und Stachelbeeren, die meine Mutter in großem Stil einkochte. Von irgendwoher hörte ich den Gong der Tagesschau, und während ich noch nicht wusste, ob ich den Zarathustra-Text für genial oder abstrus halten sollte, tauchte Manfred Abend hinter der Gartenmauer auf.
Du liest? fragte er.
Es war mir egal, was er dachte, und ich sagte mit feierlichem so-Akzent: Also sprach Zarathustra.
Glaub ich jetzt nicht, sagte er.
Fliehe, mein Freund, in Deine Einsamkeit!
Heute ist Party, rief Manfred Abend, Mensch! Er schwang seine Hände in die Höhe, als wollte er eine Schar Tauben aufscheuchen: Party!
Ich sehe dich betäubt vom Lärme der großen Männer, sagte ich, und zerstochen von den Stacheln der Kleinen.
Hör auf mit dem Scheiß, sagte Manni.
Ich hätte mich dafür entschuldigen müssen, dass ich nicht an seinen Geburtstag gedacht hatte, trotz seiner freundlichen Einladung, von der ich sogar etwas gerührt war – denn richtige Freunde waren wir seit Grundschulzeiten nicht mehr. Andererseits war es ein Versäumnis, das nicht schwer wog, wenn ich daran dachte, dass Party bei Manni bedeutete, mit ein paar Flaschen Cola, einem Haufen Chips und ein paar Gleichaltrigen in seinem Dachgeschosszimmer herumzuhängen und seine Plattensammlung durchzuhören. Bestenfalls hatte er Sven Westerrode eingeladen, der Gitarre spielte, was zwar niemanden umwarf, aber origineller war als Mannis Oldiearchiv. Sollte ich mich wundern, dass ich lieber Zarathustra las, als mit ihm und seinen Gästen im Halbdunkel Elvis oder The Animals zu hören?
Sorry, sagte ich und klappte das Buch zu, ließ aber meinen Zeigefinger noch zwischen den Seiten.
Jetzt komm, sagte er, die anderen warten.
Langsam, langsam, sagte ich. Wenn ich Glück hatte, endete Mannis Partyspuk vor Mitternacht, so dass späterhin Zeit blieb, sich wieder dem Zarathustra-Text zuzuwenden – oder dem Tagebuch, das ich seit Tagen vernachlässigt hatte. Begreiflicherweise. Denn ich wusste nur, worüber ich nicht schreiben konnte: beispielsweise über den verführerischen Duft eines fremden Parfüms, über die Eleganz einer Zigarette der Marke Kim, über eine Bank am Schwanenteich, auf der ich nicht allein gesessen hatte. Dass Susanna auf einer Klassenfahrt war, hinterließ ein Vakuum an notierwürdigen Ereignissen. Allerdings hatte sie mir eine Karte geschickt. Eine Ansichtskarte. Ein romantisches Motiv mit zwei Burgen, die malerisch aus bewaldeten Felsen wuchsen. Manderscheider Burgen stand auf der Absenderseite. Darunter hatte Susanna geschrieben: Heute haben wir zwei Burgen besichtigt, und ich habe an uns gedacht. (Okay, vergiss einmal, dass es Ruinen sind.) Bis Montag am Brennnesselplatz.
Mannis Party, die keine richtige Party war, war so trist, wie ich es mir vorgestellt hatte, oder doch noch etwas trister, als man sich eine Party, die keine Party ist, vorstellen kann. Ein kleiner Lichtblick: Sven Westerrode saß in der Ecke, direkt unter der Kuckucksuhr, die Gitarre neben sich, und drehte eine Zigarette. Wer rauchte, musste ans offene Fenster gehen, damit Mannis Eltern nichts rochen. Auf der Tischtennisplatte, die als Büfett diente, lagen mehrere Chipstüten, die wie aufgeblasene Ballons aussahen. Es hatte Applaus gegeben, als Manni mich ins Zimmer geschoben hatte. Kein gutes Zeichen, wenn allein mein Kommen schon einen Applaus wert war. Nimm dir, nimm dir, sagte Manni und zeigte auf die Paprikachips, dann auf das Bier, greif zu, sagte er, ein bisschen übereifrig in seiner Gastgeberrolle. Nimm dir! Diesmal zeigte er auf den Kartoffelsalat, der, wie ich wusste, im Wesentlichen aus Mayonnaise und hart gekochten Eiern bestand. Nimm dir! Als hätte ich zu Hause nicht genug zu essen. Bier oder Cola? Wir haben Pepsi, rief jemand aus einer anderen Ecke. Es war Achim Klein, der jetzt ganz dick mit Manni befreundet war und Jeans mit Bügelfalten trug, nicht freiwillig, wie ich mal unterstellte, sondern weil seine Mutter es nicht besser wusste.
Wir haben König Pilsener!
Dann Köpi mit Fanta, sagte ich aus Spaß. Aber Manni hatte schon ein Glas parat, um für mich Limonade und Bier zu mischen.
Und nimm dir, sagte er wieder. Es gibt auch Brühwürstchen mit Senf. Oder mit Ketchup. Und Chipsfrisch!
Alles klar, sagte ich und setzte mich neben Weste, der eigentlich Sven Westerrode hieß, doch von uns zu Recht Weste genannt wurde, weil es kürzer war und weil er tatsächlich gern blütenbestickte Westen trug, die aussahen, als könnte man damit auch in San Francisco herumlaufen.
Hi, sagte Weste.
Super Party, sagte ich.
Du hast die Wahl zwischen Kartoffelsalat und Brühwürstchen!
Rein theoretisch, sagte ich. Weste war zweifellos gescheiter als der Rest der Klasse, Leo Keppler mal ausgenommen, der ein Abo auf Einsen hatte und nebenbei Jugendkreismeister im Tischtennis war. Vor allem verfügte Weste über das Talent, Lehrern mit launigen Zwischenfragen und treffenden Bemerkungen auf die Nerven zu gehen. Auch hatte er von allen die längsten Haare, fast wie Brian Jones, bevor er ertrunken war. Sein einziges Handicap war, dass er Tabak rauchte und ziemlich krumme Zigaretten mit eingelegten Filtern drehte.
Lächelnd bot ich ihm eine Camel an. Natürlich blieb er bei seinem Drum, auch wenn das Päckchen nur noch trockene Krümel hergab.