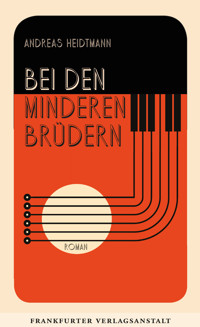
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die 1970er Jahre im Ruhrgebiet: Ben Schneider steht vor dem Abitur, als er wegen der Erkrankung seiner Mutter in das Internat eines Franziskanerklosters am äußersten Rand des Ruhrgebiets geschickt wird. Eine abgeschottete klösterliche Welt mitten in einer Kleinstadt zwischen Gelsenkirchen und Recklinghausen, in der die Patres ihr Regiment führen – ein trotz aller Reglementarien durchaus mildes und mit kleinen weltlichen Gaben und Genüssen zu bestechendes Umfeld, in dem die Halbstarken ihre Rangordnung in verbalen Schlagabtäuschen ausfechten, Bens Telefonate mit seiner ersten großen Liebe Rebecca in abgezählten Minuten Raum finden müssen und sich seine Liebe zur Musik in nächtlichen Improvisationen am mondbeschienen Flügel der Marke Feurich ausdrückt. Das bereits brüchige und disparat-schwebende Gefüge von Bens Lebenswirklichkeit gerät in eine Phase des Umbruchs und des Abschieds, als sich das Gerücht über den Abriss des Klosters zugunsten eines Woolworth-Einkaufscenters als Tatsache herausstellt. Zwischen Musikikonen wie Hendrix und Pink Floyd, die ebenso allgegenwärtig sind wie die Gebete der Patres oder Mahler und Chopin, entfaltet der Roman so seine ganz eigene versöhnlichheitere Atmosphäre. »Selten kam Desillusionierung mit einem so heiteren, ja liebevollen Verständnis für Illusionen daher«, schrieb die Presse über Andreas Heidtmann; und auch jetzt, im dritten seiner autofiktionalen Romane, erzählt Heidtmann seine Geschichte mit Heiterkeit und großem Einfühlungsvermögen und folgt mit Sympathie den Abenteuern und Verwerfungen des Lebens seines jugendlichen Alter Egos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die 1970er Jahre im Ruhrgebiet: Ben Schneider steht vor dem Abitur, als er wegen der Erkrankung seiner Mutter in das Internat eines Franziskanerklosters am äußersten Rand des Ruhrgebiets geschickt wird. Eine abgeschottete klösterliche Welt mitten in einer Kleinstadt zwischen Gelsenkirchen und Recklinghausen, in der die Patres ihr Regiment führen – ein trotz aller Reglementarien durchaus mildes und mit kleinen weltlichen Gaben und Genüssen zu bestechendes Umfeld, in dem die Halbstarken ihre Rangordnung in verbalen Schlagabtäuschen ausfechten, Bens Telefonate mit seiner ersten großen Liebe Rebecca in abgezählten Minuten Raum finden müssen und sich seine Liebe zur Musik in nächtlichen Improvisationen am mondbeschienen Flügel der Marke Feurich ausdrückt. Das bereits brüchige und disparat-schwebende Gefüge von Bens Lebenswirklichkeit gerät in eine Phase des Umbruchs und des Abschieds, als sich das Gerücht über den Abriss des Klosters zugunsten eines Woolworth-Einkaufscenters als Tatsache herausstellt. Zwischen Musikikonen wie Hendrix und Pink Floyd, die ebenso allgegenwärtig sind wie die Gebete der Patres oder Mahler und Chopin, entfaltet der Roman so seine ganz eigene versöhnlichheitere Atmosphäre.
»Selten kam Desillusionierung mit einem so heiteren, ja liebevollen Verständnis für Illusionen daher«, schrieb die Presse über Andreas Heidtmann; und auch jetzt, im dritten seiner autofiktionalen Romane, erzählt Heidtmann seine Geschichte mit Heiterkeit und großem Einfühlungsvermögen und folgt mit Sympathie den Abenteuern und Verwerfungen des Lebens seines jugendlichen Alter Egos.
»Andreas Heidtmann besitzt eine beneidenswerte Gabe: Er findet immer wieder Sätze, die seinen Lesern ein Lächeln ins Gesicht zaubern, leichte Formulierungen voller Wahrheit und Melancholie.« FAZ
Andreas Heidtmann
Bei den Minderen Brüdern
Roman
»Keiner werde Erster genannt.Alle sollen einfach Mindere Brüder heißen.«
Franz von Assisi
»So, therefore, the belief comes in throughelectricity to the people, whatever.«
Jimi Hendrix
I
Kein zweites Hemd
Das Zimmer mit Blick auf die Reste des alten Stadtwalls hätte mir gefallen, wäre es kein Internatszimmer gewesen. Gleich hinter dem Wall öffnete sich die Lippestraße, deren Lichter am frühen Abend herüberschienen. Geschätzte Entfernung: unendlich. Pater Heribert hatte mir an der Pforte ein Faltblatt überreicht, das, wie ich fürchtete, jede Form von Glück hinter den Mauern des Konvikts untersagte. Immerhin, die Fenster waren nicht vergittert. Dass der sparsam möblierte Raum wenig Einladendes bot, traf meine Stimmung und sagte mir: Du bist hier nur Gast.
Über dem Bett hing ein Porträt des heiligen Franz von Assisi: Giovanni Bernardone, geboren im Jahre 1181, Begründer des Ordens der Minderen Brüder. Mit einer Heftzwecke hatte jemand, der vor langer Zeit hier gelebt haben musste, einen Zettel darunter befestigt, auf dem in akkurat geschwungener Schrift stand: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd!
Sicher hätte Pater Heribert mir erklären können, wie dieser Anspruch zu verstehen war. Es gehörte jedenfalls nicht zu den Aufgaben der Franziskaner, vor den Klostermauern um Almosen zu bitten. Oder ohne Proviant durch die Gegend zu ziehen. Dabei hätte es mich beeindruckt, wenn die Patres täglich mit Klingelbeuteln durch die Fußgängerzone gepilgert wären.
Zu den Büchern, die ich aus meiner Tasche zog, gehörten Trotzkis Permanente Revolution, Sartres Wörter und ein zerlesener Band mit amerikanischer Lyrik. Als Letztes die Briefe Mozarts oder genauer, seine Briefe aus Paris, die Rebecca mir überlassen hatte. Womöglich dachte sie, ich könnte meinen Stil daran schulen. Mehr versprach ich mir von den Gedichten, die einer schrieb, bevor er im 8. Stockwerk aus dem Fenster sprang. Ich hatte nur die Möglichkeit, mich aus dem zweiten Stock zu stürzen, was mir anschaulich bewies, dass in Amerika einfach alles besser war.
Abgesehen von Büchern, Noten und meinem Tagebuch enthielt meine Tasche vor allem zu wenig Wäsche. Nicht mal ein zweites Hemd, was Giovanni Bernardone vermutlich gefallen hätte. Ich würde von Zeit zu Zeit mit der Vestischen ans Ende der Welt fahren, wo Jimi Hendrix neben der stillstehenden Kuckucksuhr meines Zimmers auf einem Poster Gitarre spielte, und mich nach und nach mit allem Nötigen eindecken, für Wochen oder Monate, je nachdem wie lange meine Mutter in der Kurklinik benötigte, ein weniger trauriger Mensch zu werden. Ein Mensch, der seine Tage nicht im Halbdunkel verbrachte, sondern sich entsann, was Leichtigkeit bedeutete. Der sich allmählich wieder an den Sinn eines Lebens erinnerte, zu dem ein Haus, ein Garten mit Hollywoodschaukel und das abendliche Fernsehprogramm gehörten. Was alles vernünftig klang, obwohl ich selbst nicht hätte sagen können, warum jemand in ein solches Leben zurückkehren sollte.
Ich hatte Rebecca versprochen, ihr zu berichten, wie sich der Ortswechsel auf meinen Leidenspegel auswirkte. Vorher nahm ich das Kreuz von der Wand und verstaute die bronzene Figur in der Schublade des Schreibtisches. Auf keinen Fall durfte ich die Ritter Sport vergessen, ohne die Pater Albert das Telefon nicht freigab. Es war ein Tipp von Felix Schiller, an dessen Zimmertür der Satz stand: Komm ruhig rein, du störst sowieso. Wahrscheinlich war es ein Handicap, dass ich nicht Pater Alberts bevorzugte Sorte Sahne-Mocca hatte auftreiben können, sondern nur eine dunkelblaue Ritter Sport Nugat.
Das Treppenhaus gab jedem Schritt ein kleines Echo. Licht fiel durch wandhohe Fenster. Für Wunder blieb wenig Raum. Geblendet vom Weiß, durfte man an eine friedvolle Zukunft glauben. Im Kellergeschoss existierte vielleicht noch ein altes Gewölbe mit Reliquien für jene Patres, die nichts vom Geist der Erneuerung hielten.
Vor dem Gemeinschaftszimmer, das Pater Heribert Clubraum genannt hatte und zu dem eine Bücherecke, ein Kickerautomat und ein Fernsehgerät gehörten, sah ich eine Dreiergruppe, aus der Siggi Kinzel winkte. Er galt als bester Langläufer der Schule, obwohl er regelmäßig unter der Raucherrobinie stand. Bisher war ich ihm aus dem Weg gegangen, denn mir gefiel sein Lachen so wenig wie sein nervöses Blinzeln. Manchmal erkannte ich aus den Augenwinkeln, wie er seinen Oberkörper zurückbog, als wolle er mit dem offenen Mund Regen aus der Luft fangen. Ich nickte und beschleunigte meinen Schritt, doch ehe ich an ihm vorbei war, fragte er: Sagt man nicht Guten Tag, wenn man neu ist?
Guten Tag, sagte ich.
Wie?, fragte Siggi Kinzel. Das ist alles?
Schönen guten Tag, sagte ich.
Na, geht doch! Siggi Kinzel zupfte an meinem Hemd, dem einzigen, das ich hatte. Zog die Camelschachtel aus meiner Brusttasche. Dass er einen halben Kopf größer und zwei Klassen über mir war, gab ihm offenbar das Recht dazu.
Ich sehe schon, du wolltest Zigaretten spendieren, sagte er.
Klar, sagte Louis neben ihm.
Ein bescheidener Auftakt, sagte Siggi Kinzel und reichte die Camelschachtel an Louis weiter.
Er weiß sicherlich noch gar nicht, dass es sich gehört, einen kleinen, na, wie sagt man …
Obolus?, fragte Arne, der Jüngste der drei, der ein Sunkist-Päckchen in der Hand hielt. Geschmacksrichtung Orange.
… Obolus zu entrichten, wenn man in den Clubraum will.
Ihr habt eine beneidenswerte Fantasie.
Wir werden dir die Regeln nur einmal erklären, sagte Siggi Kinzel.
Leider will ich in keinen Clubraum, sagte ich.
Blitzschnell griff Siggi Kinzel nach der Ritter Sport und fragte: Jemand Schokolade?
Nugat!, rief Louis und senkte den Daumen.
Mir fielen Filmszenen ein, in denen Kämpfer à la Bruce Lee ihre Gegner spektakulär ausschalteten. Natürlich war es mir – ganz im Sinne Giovanni Bernardones – angenehmer, die Dinge friedlich zu regeln.
Na, troll dich und schieb Pater Albert die Schokolade in den Arsch, sagte Siggi Kinzel.
Aber gern, antwortete ich und sah zu, dass ich weiterkam. Ich konnte nur hoffen, dass ich mich nicht jedes Mal, wenn ich am Clubraum vorbeikam, auf Siggi Kinzels Spielchen einlassen musste. Auf Dauer hätte es mir den Aufenthalt mehr verdorben als Heilige an der Zimmerwand oder tägliche Vaterunser.
Und noch was …, rief Siggi Kinzel mir hinterher.
Ich drehte mich um und beobachtete, wie er die Klinge seines Taschenmessers ausklappte. Umständlich begann er, sich die Fingernägel zu säubern.
Bin schwer beeindruckt!
Genau, sagte Arne, wir spendieren dir auch gern eine Maniküre.
Wenn er’s darauf anlegt, sagte Louis.
Ich leg’s darauf an, euch mitzuteilen, dass ihr Arschlöcher seid, sagte ich.
Pater Albert saß über ein Kreuzworträtsel gebeugt und blickte nicht auf, als ich ins Foyer trat. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass ein Pater sich mit so banalen Fragen wie Honigsaft mit drei Buchstaben oder Anderes Wort für waagrecht mit zehn Buchstaben abgab. Das Kreuzworträtsellösen war in jedem Fall eine unbedenklichere Leidenschaft als das Horten von Schokolade und stand wahrscheinlich nicht im Widerspruch zum Gebot der Genügsamkeit.
Unser Neuer, sagte Pater Albert, als ich mit einem Räuspern vor ihm Halt machte. Dabei schaute er über den kantigen Rahmen seiner dunklen Brille. Ehe ich meine Bitte vorbringen konnte, hob er seinen Kreuzworträtselstift wie einen kleinen Dirigierstab in die Luft und sagte: Ausgang bis 19 Uhr, danach nur noch Einlass an der Klingel.
Nein, nein, sagte ich.
Oh doch, sagte er.
Ich wollte nur telefonieren …
Sag mal, fragte er, du spielst doch Klavier? Er senkte seinen Stift aufs Heft und las: Halbton unter c mit drei Buchstaben. Mir kommt da nur h in den Sinn.
Wie wäre es mit ces?, fragte ich.
Ces?
Eine Tonart mit sieben Vorzeichen.
Quinque minuta, sagte er und schob mir den schwarzen Telefonapparat hin. Deutete in eine Nische, wo man sich geschützt wähnen konnte, aber davon ausgehen musste, dass jemand, der es darauf anlegte, jedes Wort mitbekam. Meine Ritter Sport Nugat ließ sich mit etwas Glück bei nächster Gelegenheit einsetzen. Ich kramte den Zettel mit Rebeccas Telefonnummer hervor und drehte mich so, dass ich in Richtung Wand sprach, dabei jedoch Pater Albert im Blick behielt. Man konnte nie wissen. Es war beruhigend, dass er sich wieder seinem Kreuzworträtsel zuwandte. Am Ende boten vielleicht auch schlichte Formen des Rätsellösens einen Weg zu geistiger Erkenntnis. In jedem Fall hätte ich eine Frage beisteuern können, die selbst für einen Pater nicht schwer zu beantworten gewesen wäre: großes Gefühl mit fünf Buchstaben.
Distanzen
Ich hatte keine Ahnung, wie viele Geräusche es auf der Welt gab, aber das, was an mein Ohr drang, hörte sich an, als wäre ein Großteil von ihnen in der Telefonleitung versammelt. Schloss ich die Augen, stand ich in einem Dschungel. Dabei führte die Verbindung durch eine übersichtliche Region, fern jeder Wildnis, fünfhundert Kilometer zwischen Rebecca und mir. Dazu eine Grenze, die das Land teilte. Ich nahm an, dass sich entlang der Leitung Scharen von Horchposten formierten, um Wort für Wort zu sortieren und jede Nuance einzufangen. War Sehnsucht verdächtig? Summende Gerätschaften protokollierten jeden Laut und schufen aus dem endlosen Strom der Telefonsätze ein großes Epos der Nichtigkeit.
Ich war erleichtert, als sich aus der Ferne eine Stimme meldete. Es hätte mir um einiges besser gefallen, wenn es Rebeccas Stimme gewesen wäre und nicht die ihrer Schwester. Ins schwächer werdende Rauschen rief ich meinen Namen.
Rebecca übt gerade, antwortete Maren.
Wir sind verabredet, sagte ich.
Sie lässt sich ungern stören.
In diesem Fall wird sie sich freuen.
Sagst du.
Weil sie auf meinen Anruf wartet.
Besser, du probierst es später noch mal.
Ich muss sie jetzt sprechen!
Wahrscheinlich bricht sie heute ihren eigenen Rekord im Klavierspielen.
Ich bildete mir ein, Maren blickte bei ihren Worten ungeniert auf ihre Fingernägel, die sie kirschrot lackiert hatte. Oder schwarz. Sie waren lang genug, um jedem zu signalisieren, dass mit ihnen kein Instrument, schon gar keins mit Tasten, zu bedienen war. Es klackte in der Leitung, und tatsächlich war ich im selben Moment allein mit den Geräuschen. Ein Zittern durchlief meine Hand, und ich musste achtgeben, mich nicht heulend in die Ecke zu werfen.
Das waren kurze fünf Minuten, sagte Pater Albert.
Die Technik, sagte ich.
Gibt es überhaupt ein Stück in Ces-Dur?
Ich denke schon, sagte ich, um nicht sein Wohlwollen zu verspielen. Allerdings beschäftigten mich andere Fragen als die nach einer entlegenen Tonart, die allenfalls für Harfenisten von Interesse war.
Mit Ces-Dur, sagte ich, sind Sie den höheren Sphären ein Stück näher als mit jeder anderen Tonart!
Da ich fürchtete, vor dem Clubraum wieder auf Siggi Kinzel zu treffen, wandte ich mich zum Ausgang. Ich konnte an der Franziskanerkirche vorbei zum Markt gehen und von dort zur Lippe, um die Zeit bis zum nächsten Anrufversuch zu überbrücken. Leider empfing mich vor dem Konvikt ein scharfer Wind, der Schübe von Nässe mit sich führte. Alles, was ich trug, war mein Baumwollhemd, das wie ein Frotteetuch den Regen aufsog. Bei Kaiser’s durchstöberte ich das Süßwarenangebot nach Ritter-Sport-Sorten. Ich war mir nicht sicher, wie viele es gab, neun oder zwölf, angefangen von der hellblauen Vollmilch bis zur Joghurtvariante in Weiß, aber ausgerechnet die von Pater Albert bevorzugte Sahne-Mocca-Tafel fehlte. Verrückt! Ich kaufte eine Schachtel Camel, filterlos, und reihte mich an der Kasse ein.
Nass geworden?, fragte jemand und stellte zwei Flaschen Korn aufs Warenband. Ich verschwand aus der Neonhelle in den stürmischen Novemberabend. Tatsächlich war es wie auf einen Schlag dunkel geworden, oder ich hatte über das Stöbern im Süßwarenregal jedes Zeitgefühl verloren. Gleich nebenan leuchtete das Schaufenster des Buchladens König. Mein Geld reichte bedauerlicherweise nicht für eines der ausliegenden Bücher. Das Wort Nobelpreis schmückte die Cover des Autors Saul Bellow. Mir gefiel Reiner Kunzes Titel Die wunderbaren Jahre. Mick, der einen Besuch angekündigt hatte, konnte geradewegs in ein Geschäft gehen und ohne viel Aufhebens Zigaretten oder ein paar Riegel Mars unter sein Leopardenhemd stecken, um damit ganz selbstverständlich den Laden wieder zu verlassen. Mit fehlte die Gelassenheit. Ich war kein Aneignungstalent. Also musste ich bis auf Weiteres auf die wunderbaren Jahre verzichten.
Inzwischen spürte ich die Nässe bis auf die Haut. Plötzlich empfand ich es als empörend, dass Maren einfach aufgelegt hatte. Vielleicht war der Regen schuld, dass ich ihr Verhalten erst jetzt im triefend nassen Hemd als entwürdigend empfand, auch wenn sie nichts für den Regen konnte oder für Leute, die über mein Aussehen spotteten.
Pater Albert löste immer noch Kreuzworträtsel, als wäre es eine Art Denksport, der Trost versprach. Ich fror, und meine Finger zitterten, als ich den Zettel mit der Telefonnummer hervorzog. Dummerweise hatte er Nässe abbekommen, sodass einige Ziffern nicht mehr zweifelsfrei zu erkennen waren.
Dürfte ich noch einmal, Pater Albert?, fragte ich mit Blick zum Telefonapparat und bemühte mich, weder frustriert noch verärgert zu wirken.
Ein Internat ist kein Telefonamt, sagte Pater Albert.
Mir kamen tausend Erwiderungen in den Sinn, eine treffender als die andere und keine sehr diplomatisch. Am Ende entschied ich mich für die einzige Antwort, die funktionierte, und holte die dunkelblaue Ritter Sport hervor. Schob sie vorsichtig auf die Theke, nicht wie ein Angebot, sondern wie etwas, was man kurz ablegt, um es später wieder an sich zu nehmen.
Pater Albert schüttelte traurig den Kopf.
Es ist ein Notfall, sagte ich, Sie wollen doch sicher nicht, dass ich mich aus dem achten Stock stürze.
Das Haus hat nur drei!
Umso schlimmer!
Tria minuta, sagte Pater Albert und streckte zur Verdeutlichung drei Finger in die Luft, was wie ein Schwur aussah.
Gratias!, sagte ich und schnappte den Apparat, um mich in den Telefonwinkel zurückzuziehen. Bei der letzten Ziffer musste ich raten. Doch wenn das Rauschen und Surren etwas verriet, so besagte es, dass es dieselbe Distanz war. Dasselbe Gewoge an- und abschwellender Laute. Vier, fünf Sekunden vergingen, ehe sich eine Stimme meldete. Wie schön, wäre dort, am andern Ende der Wildnis, Rebeccas Stimme gewesen und nicht die ihrer Schwester. Wahrscheinlich hätte ich das Kreuz in meinem Zimmer nicht leichtfertig abhängen dürfen.
Du hast Pech, sagte Maren.
Solange ich nicht wusste, was sie gnädig stimmte, fragte ich: Was übt Rebecca denn?
Etwas mit vielen Tönen, sagte Maren.
Du könntest an ihrer Tür klopfen.
Wäre das nicht unhöflich?
Was hältst du eigentlich von Somebody to Love? Wenn uns etwas verband, war es eine gewisse Begeisterung für Queen. Und natürlich für Freddie Mercury und seine unvergleichliche Stimme.
Hast du es mal bei der Telefonseelsorge probiert?, fragte sie.
Na, sagte ich spaßhaft, ich habe ja dich.
Im selben Moment hörte ich ein Geräusch, als falle etwas zu Boden. Gleich darauf ein Türenschlagen. Helle Rufe. Ein Kichern. Dann plötzlich – überraschend klar – Rebeccas Stimme. Obwohl ich im durchnässten Hemd dastand und fror, hätte ich in dieser Sekunde auf ihre Frage, wie es mir gehe, ohne Zögern geantwortet: Wunderbar! Aber Rebecca fragte mich nicht, sondern rief in den hallenden Flur hinein, dass es unmöglich und eigentlich eine Unverschämtheit sei, was ihre Schwester sich herausnehme.
Tut mir leid, sagte sie mit einem Mal sehr nah.
Kein Weltuntergang, sagte ich.
Maren ist einfach in einer Phase … was soll ich sagen, dreizehn eben!
Bin schon zu alt, um mich daran zu erinnern.
He, wie lebt es sich unter den Erleuchteten?
Glück sieht anders aus, antwortete ich und bedauerte, dass ich die Gelegenheit verpasst hatte, zu sagen: Wunderbar!
So schlimm?, fragte Rebecca.
Ich habe nur drei Minuten, sagte ich.
Jetzt grimassiert sie auch noch!
Dreizehn eben.
Ich werde dich auf jeden Fall besuchen!
Spätestens an der Pforte wirst du scheitern.
Pessimist!
Augenblick mal, sagte ich, da im Hintergrund Pater Albert mit seinem Stift aufs Holz zu klopfen begonnen hatte. Das rhythmische Ticken machte mich nervös, allerdings konnte ich schlecht sagen: Lassen Sie das bitte mal, ich habe ein dringendes Gespräch zu führen. Pater Albert deutete auf die Uhr im Foyer. Es war einfach Pech, dass ich nicht die richtige Ritter Sport gefunden hatte. Ab sofort würde ich jeden Laden, den ich aus welchem Grund auch immer betrat, zuerst daraufhin sichten, ob er die Sorte Sahne-Mocca führte, und falls ja, das Angebot für Pater Albert aufkaufen. Andererseits war es kein Drama, sich sein Leben in Briefen zu erzählen. Ohne die vielen Briefabende vergaß man wahrscheinlich irgendwann seine Wünsche und die des anderen und wusste nicht mehr, warum man zusammen war.
He, fragte Rebecca, bist du noch da?
Wir lassen uns etwas einfallen, sagte ich.
Wie lange musst du bleiben?
Keine Ewigkeit.
Komm, flüsterte sie, küss mich!
Pater Alberts Stift klopfte ungeduldig, und ich rief aus meinem Winkel: Eine Sekunde noch, Pater Albert!
Wir könnten natürlich auch heute Nacht im selben Augenblick aneinander denken!
Das können wir, sagte ich. Wie immer Rebeccas Vorschlag zu verstehen war und woher immer wir wissen wollten, wann der gemeinsame Moment gekommen war.
Die Verbindung brach ab, als wäre das Aneinanderdenken das Stichwort für die Gesprächsunterbindung. Kein Rauschen mehr, kein letztes Bis bald. Was ich ans Ohr presste, war ein beliebiges Stück Plastik.
Pater Albert sah nicht von seinem Kreuzworträtselheft auf, als ich den Apparat zurückstellte. Dorthin, wo es noch andere Schalter gab, bis hin zum Tastenfeld, mit dem er Verbindungen in geistliche Welten aufbaute oder profane Gespräche kappte. Die Ritter Sport war vom Tresen verschwunden. Gut so. Ihr Verschwinden verriet immerhin, dass Pater Albert einen Rest an Anpassungsfähigkeit bewahrt hatte. Obwohl er sicher schon Ewigkeiten an der Pforte saß und in stiller Verzweiflung Rätsel löste, die keine waren. Wer immer ihm diese Buße auferlegt hatte.
Feurich
Wer so gläubig war, dass er ein Gebet nicht als Strafe empfand, konnte unter den Patres glücklich werden. Selbst wenn er hin und wieder gegen Regeln verstieß. Es war kein Unglück, zu spät zu kommen oder auf dem Zimmer zu rauchen, wenn man bereit war, drei oder mehr Vaterunser zu beten. Das Strafmaß variierte, doch es bedurfte keiner in Stein gemeißelten Ordnung. Dabei schien es niemanden zu wundern, dass all den ins Nichts gemurmelten Gebeten eine läuternde Wirkung zukommen sollte. Man hatte uns von einer Glaubensgemeinde berichtet, die täglich dreihundert Vaterunser betete. Freiwillig. Insofern konnten wir uns nicht beklagen.
Es gab gravierendere Verstöße als Zuspätkommen. Am Ende der Skala drohte, rein theoretisch, der Verweis. Ich zweifelte nicht, dass Siggi Kinzel die Liste der Regelverletzer anführte. Dafür musste man mehr riskieren, als im Clubraum Bier zu trinken oder sich im Flur eine Zigarette anzuzünden. Sein Vater leitete den Bau eines Atommeilers in Südamerika und war vor einer Generation Schüler im Internat gewesen, das er seither, so gut er konnte, unterstützte. Schwer vorstellbar, dass man Siggi Kinzel dorthin verbannte, zumal auf seiner Schultasche ein gelber Button mit der Aufschrift klebte: Atomkraft? Nein danke.
Ich war zum Glück nicht zu spät, obwohl ich noch ein paar Sätze ins Tagebuch geschrieben hatte. Zwei, drei Patres sprachen mit gedämpfter Stimme, während die meisten schon in stiller Konzentration auf ihre Teller blickten. Felix Schiller hatte mir einen Platz freigehalten, weit ab von Siggi Kinzel. Ich dankte ihm, während ich mich setzte. Die allabendlichen Katastrophen der Tagesschau blieben den Versammelten erspart. Fast bedauerte ich, dass zur Ausstattung des Speisesaals kein Fernseher gehörte. Man musste schon mit dem Bild an der Wand vorliebnehmen, auf dem Jesus unter den zwölf Aposteln beim Abendmahl saß.
Lukas Hadick fiel die ehrenvolle Aufgabe zu, das Tischgebet zu sprechen. Auswendig. Mir war klar, dass mein Aufenthalt beendet sein musste, ehe ich an die Reihe käme. Weil ich mir nur merken konnte, was mir wichtig war, würde es mir nie gelingen, ein mehrstrophiges Gebet auswendig zu sprechen. Ich hätte allenfalls die Zeilen eines Songs wie Me and Bobby McGee aufsagen können, wo es im Grunde auch um Freiheit und Besitzlosigkeit ging. Es war etwas verwegen, anzunehmen, die Patres ließen sich im Falle eines Falles auf eine Version in englischer Sprache ein. Zur Not konnte man den Song ins Lateinische übersetzen. Wenn man Orte wie New Orleans und Kentucky durch La Verna und Perugia ersetzte und ein passendes Wort für Mundharmonika fand.
Lukas Hadick hatte schon seinen Platz neben Pater Heribert eingenommen und wartete auf das Startzeichen. Diejenigen, die leise miteinander gesprochen hatten, verstummten. Das erste Mal seit hundert Jahren faltete ich die Hände. Rebellion sah anders aus, zugegeben, doch letztlich war mein Händefalten nur eine Konsequenz daraus, dass meine Mutter in einer Kurklinik und ich im Refektorium eines Konvikts war.
Wenn ich Lukas Hadick schon einmal gesehen hatte, musste ich es wieder vergessen haben. Von den Schuhen bis zum gescheitelten Haar wirkte er unscheinbar. Abgesehen von den Ohren, die, als wären sie der Entwicklung vorausgeeilt, vom schmalen Kopf abstanden. Wenn alles gutging, würde er vom bedauernswerten Quartaner zum geachteten Athleten werden und durch rapides Wachstum die körperlichen Proportionen wieder herstellen.
Sein Gebet erinnerte an ein Lied, dessen Refrain zu häufig wiederkehrte. Leider hatte ihm niemand erklärt, dass man nicht jede Wiederholung im gleichen Tonfall sprechen sollte. Ob jemand zuhörte, war den Gesichtern am Tisch nicht anzumerken. Nach dem hingemurmelten Amen sah Pater Heribert in meine Richtung und sagte: Wir freuen uns, einen neuen Schüler in unserer Gemeinschaft begrüßen zu können – Ben Schneider aus der Obersekunda.
Ich fand die offizielle Vorstellung ein wenig überraschend und bemühte mich, nicht allzu verblüfft auszusehen. Pater Heribert ergänzte: Vor allem freue ich mich, dass er, wie ich hoffen darf, unser musikalisches Leben bereichern wird. Der Flügel im Musikzimmer hat ihm gefallen, und mich hat beeindruckt, was er darauf gespielt hat! Auch an der Orgel unserer Kirche wird er zu hören sein. Lieber Ben, herzlich willkommen!
Alter, sagte Felix Schiller und stieß mich unter dem Tisch an, toller Einstand!
Ich dankte Pater Heribert mit einem Nicken. Natürlich wäre ein Auftritt der Crazy Hearts spektakulärer gewesen als eine Andacht mit Kirchenorgel, egal, ich war ab sofort ein berühmter Mann im Kloster, nicht ganz wie Franz von Assisi, aber es hatte geklungen, als wäre ich nahe daran. Und das nur, weil ich Klavier spielte. Oder Orgel.
Rechts von mir saß Wolf Kanne, der offenkundig stark erkältet war und schon während des Gebets wiederholt seine Nase hochgezogen hatte. Geradezu ungeniert. Während er seine Suppe aß, atmete er schwer und schien sich nicht weiter darum zu sorgen, dass gelbe Schlieren aus seiner Nase rannen und in die Suppe tropften.
Schon mal was von Taschentüchern gehörte?, fragte ich leise.
Wolf Kanne drehte sein gerötetes Gesicht her und sagte: Wir reden hier nicht bei Tisch!
He, du Spinner, sagte ich.
Im nächsten Moment riss er seine Hand hoch, als säße er im Klassenzimmer, und sah in Pater Heriberts Richtung, um dann, als der herschaute, zu rufen: Ben Schneider hat mich beschimpft!
Wir hören dich auch, wenn du nicht schreist, sagte Pater Heribert.
Er hat Spinner gesagt!
Ich sagte: Ob er kein Taschentuch hat, habe ich gefragt.
Felix Schiller sagte: Es ist wirklich nicht schön, wie Wolf Kanne beim Essen schnauft.
Pater Heribert sagte: Ich darf wohl erwarten, dass wir die Mahlzeit friedlich zu Ende bringen. Wenn Wolf erkältet ist, rufen wir einen Arzt. Und nun, eine gesegnete Mahlzeit. Oder möchtest du dich vorher schon zurückziehen?
Ich habe Hunger, sagte Wolf Kanne.
Also gut, schön, dass du Appetit hast, sagte Pater Heribert.
Wolf Kanne rief: Ich habe so was von Appetit, Pater Heribert!
Mir war noch nicht klar, wie ich die Zeremonie mit einem Dutzend Patres und drei Dutzend Schülern Tag für Tag durchstehen sollte. Über Wochen. Schlimmer stellte ich mir nur noch vor, zu Gast beim berühmten Abendmahl zu sein, das an der Stirnwand des Speisesaals zu sehen war. Obwohl dort keinem die Nase tropfte. Und keiner als Kleindealer à la Siggi Kinzel auftrumpfte. Immerhin saß Judas mit einem Geldsäckchen unter ihnen. Und neben ihm blitzte in einer mysteriösen Hand ein Messer auf.
Kannst du dir vorstellen, fragte Felix leise, alles, was du verdienst, abzugeben und nur ein Taschengeld zu behalten, um dir Pfefferminzbonbons oder eine Busfahrkarte zu kaufen?
Ich mag keine Pfefferminzbonbons, sagte ich.
Sicher gehst du auch lieber zu Fuß, sagte Felix.
Aus der Gruppe der Patres sah jemand mahnend auf, und ich nickte freundlich, nahm einen Löffel von der Suppe, die eigentlich nicht viel außer Wasser und kleinen Linsen enthielt. Dafür aber überraschend scharf gewürzt war.
Sie nennen ihr Linsengericht Aqua et ignis, erklärte Felix, und ich war mir nicht sicher, ob es wieder nur ein Scherz war.
Wie schön, flüsterte ich.
Dabei behielt ich für mich, dass ich die Suppe, so dünnflüssig sie war, in Ordnung fand, genauso wie das Brot. Wolf Kanne brach Stücke von der Kruste ab, bis sein Teller mit Krümeln übersät war. Wahrscheinlich würde er als Nächstes seinen Zeigefinger in den porig-feuchten Laib wühlen. Ich war bereit, die Gebetszeremonien und allen Aufwand hinzunehmen, solange es dieses Brot gab. Man hätte aus dem Inneren kleine Kugeln kneten können, um sie sich genüsslich in den Mund zu schieben. Es war mir egal, dass ich Leonardo da Vincis Abendmahlgruppe im Blick hatte. Die Jünger tranken Wein, während die Schüler Tee tranken oder, sofern sie alt genug waren, ein halbes Glas Bier bekamen. Meinen Vater hätte es erstaunt, dass es, ausgerechnet im Konvikt, zu den Mahlzeiten Bier gab. Er übertraf in seiner Genügsamkeit zweifellos die Mönche. Auch er bezog nur ein Taschengeld, wenn man bedachte, dass er sich von seinem Lohn selbst nichts gönnte, seine Schuhe drei Jahre trug, seine Hemden sieben Jahre, seinen Mantel zwanzig Jahre, bis meine Mutter es nicht mehr mitansehen konnte und ihm drohte, seinen Mantel, den sie einen Fetzen nannte, wegzuwerfen, damit er sich einen neuen zulegte. Während die Patres verführbar waren – selbst Pater Heribert sah man gelegentlich rauchen –, benötigte mein Vater weder HB-Pausen noch Ritter Sport. Er war der größte Franziskaner nach Franz von Assisi. Er brauchte nicht mal Gott!
Beim Hinausgehen sagte Siggi Kinzel zu mir: Ich habe noch was Feines. Dabei hob er einen Riegel in Stanniolpapier.
Besten Dank, sagte ich.
Du verpasst was!
Gern verpasse ich was.
Louis sagte: Für dich machen wir einen Sonderpreis.
Wir sind einfach zu großzügig, sagte Siggi Kinzel. Zückte sein Taschenmesser und tat, als müsse er seine Fingernägel säubern.
Ich hatte die Wahl zwischen Musikzimmer und Clubraum, zwischen Tagebuch und Mozarts Briefen. Nichts lag mir ferner, als mit den anderen den Kickerautomaten zu umlagern. Ich hätte auch mit Siggi Kinzel rauchen und Freundschaft schließen können. Stattdessen stieg ich durchs Treppenhaus hinauf, wo ich mir mit jeder Stufe leichter vorkam. Erreichte das Musikzimmer im obersten Geschoss. Öffnete die Tür. Der Raum lag in weichem Dämmerlicht. Der zwischen schweren Wolken schimmernde Mond stand über dem Dachfenster. Leise fing das Fensterglas den Regen ein. Natürlich hätte man einen langsamen Beethoven-Satz anstimmen können oder ein Nocturne, doch ich entschied mich für einen weniger klassischen Einstieg. Probierte einige Takte im Stil der Crazy Hearts. Überließ mich den Rhythmen. Suchte im freien Spiel nach brauchbaren Motiven, wobei ich nicht davon ausging, dass mir gleich am ersten Tag hinter den Klostermauern ein neuer Song einfiel.
Es war vermutlich die erste Rockimprovisation an einem Ort, an dem sonst nur Psalmen und Fürbitten erklangen. Rollende Bässe und dissonierende Läufe scheuchten die Geister aus den Nischen. Der Flügel gab eine erstaunliche Klangfülle her. Vorsorglich nahm ich die Dynamik etwas zurück. Niemand sollte sich durch die Fulminanz in seiner abendlichen Meditation gestört fühlen. Es gab keinen Grund, sich zu beschweren, solange ich Tag für Tag und Abend für Abend den Flügel an die Grenzen seiner Möglichkeiten führen konnte. Schön fand ich den Namen Feurich, der in silbrig schimmernden Lettern über der Tastatur prangte.
Als ich mich nach dem letzten Akkord aufschwang, hörte ich aus der Dunkelheit ein beifälliges Klatschen. Es klang verloren in der Weite des Raums. Ich stoppte, spähte ins Halbdunkel und hoffte auf die Hilfe des Mondes. Dort, wo ich niemanden vermutet hatte, sechs, sieben Schritte entfernt, erkannte ich die Umrisse einer Gestalt.
Nicht erschrecken, sagte sie.
Pardon, sagte ich.
Natürlich, wer seine Meditationen in ein Musikzimmer verlegte und Stille erwartete, war am falschen Ort. Fortan musste er auf Rock-Songs, Chopin-Etüden und donnernde Oktaven gefasst sein.
Ich bin Pater Vincent!, sagte die Gestalt. Lass dich nicht verwirren, ich sitze öfter hier.
Nicht der schlechteste Platz, sagte ich.
Wenn man so alt ist wie ich, darf man sich manches herausnehmen. Obwohl ich jedes Mal etwas bedauere, nicht im Refektorium zu sitzen. Andererseits fehlt es mir an nichts. Was ich vermissen würde, wäre das Zwielicht. Siehst du?
Pater Vincent hob seine Hand und deutete zum Mond, der gerade wieder heller hervorleuchtete. Es musste am bleichen Licht liegen, dass er mir fremdländisch vorkam. Die Augen auffallend schmal, der Bart weiß und am Kinn spitz zulaufend. Sicher hatte er alle Kontinente der Welt durchstreift und war in Wahrheit ein Nomade.
Im Alter, sagte Pater Vincent, wird selbst der Umtriebigste sesshaft. Du musst im Übrigen keine Bedenken haben, wenn du improvisierst. Dein Spiel ist mir willkommen. Außerdem bleibt mir der Rest der Nacht.
Pater Vincent reckte seinen Hals und hob sein Gesicht wieder ins Mondlicht, als sollte ich ihn besser betrachten können. Tatsächlich sagte er vollkommen ernst: Du wirst mein Alter nicht erraten!
Anscheinend legte er es darauf an, dass man ihn seines Alters wegen bewunderte. Dabei erweckte er nicht den Eindruck, als habe er noch ein langes Leben vor sich. Ich wollte keineswegs unhöflich sein, blickte zu den Tasten des Flügels, die ich nicht zählen musste, und sagte: Achtundachtzig.
Sehr schmeichelhaft, sagte er.
Neunundneunzig, sagte ich.
Hundertzwei, sagte Pater Vincent.
Ich sagte: Das reicht für drei Leben.
Das wären kurze Leben.
Ich hatte Freunde, die damit auskommen mussten.
Gern hätte ich ihnen von meinen Jahren abgegeben.
Vielleicht werden Sie ja gar nicht sterben.
Ich bete natürlich auch für deine Mutter, sagte Pater Vincent. Wie ich überhaupt alle in meine Meditation einschließe. Ohne dieses Licht hätte ich nicht die Kraft, Winter für Winter zu überstehen. Ich kann mich an Jahre erinnern, in denen ich nicht so unbeschwert war wie jetzt. Sieh mal!
Pater Vincent löste sich mit verblüffender Wendigkeit aus seinem Schneidersitz und richtete sich unter dem Dachfenster auf. Balancierte auf einem Bein. Streckte seine Arme aus und sagte: Ich hatte Tage, in denen ich mich nicht einen Millimeter rühren konnte. Nicht weil Gicht mich plagte oder Migräne mir zusetzte. Es war die Seele. Jetzt traue ich mir sogar das Stehen auf einem Bein zu, was natürlich ein Risiko ist, denn bei einem Sturz werden meine morschen Knochen brechen. Genauso wichtig wie ein wenig Gymnastik für den Körper ist die tägliche Frage: Wozu das alles? Quid te felicem facit? Je schneller du gute Antworten findest, umso jünger ist dein Geist. Wenn dir nichts mehr einfällt, gehen die Lichter aus. Aber nun, ich danke dir für dein Spiel, es bereichert mich, es gibt mir eine weitere Antwort auf die Frage, wozu? Und bitte, miss den kleinen Erschwernissen des Alltags nicht zu viel Bedeutung bei, Pater Albert hat seinen Lebenssinn im Kreuzworträtsellösen gefunden. Es muss zwanzig Jahre her sein, dass er mir einmal einen Tango am Cello vorspielte. Dass er beim Biertrinken kein Maß hielt und Naschereien aus der Küche stahl, brachte ihm anspruchslosere Dienste ein. Sehr bedauerlich. Wenn die Pförtnerloge auch keine unmenschliche Strafe ist. Zumal ihm das Gehen schwerfällt. Ich denke, er hat sich damit abgefunden, als gewissenhafter Hüter des Telefons auf praktischer Ebene zu dienen. Ob er sich für die Heiligkeit dort oben noch interessiert, bezweifle ich. Da geht es ihm wie dir. Obwohl das Kreuz an der Wand seiner Kammer noch hängt. Wie auch immer. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht!
Sehr leise zog ich die Tür ins Schloss und stieg die Treppe hinunter. Meine Lippen brannten, als wirke die wässrige Suppe mit ihren scharfen Gewürzen nach. Auf dem Absatz stoppte ich, blickte hinaus zum Mond, der kurzzeitig als volles Rund über den fernen Giebeln sichtbar war. Wolken glitten wie zerklüftete Raumschiffe vorbei. Darüber Sternenpunkte. Von dort konnte man auf die Erde als einen ins Dunkel geworfenen Planeten hinabsehen und sich unerheblich vorkommen. Alles verlor sein Gewicht.
In den alten Autos
Ich war der Letzte im Clubraum und hätte mich auf mein Zimmer zurückziehen können, wären mir nicht immer neue Bücher aufgefallen, die mir lesenswert schienen. Dass sich auf manchen Staub gesammelt hatte, hinderte mich nicht, sie aufzublättern. Was immer sich hinter der Philosophie der Materie oder dem Wesen des Christentums verbarg. Ich wusste, dass Pater Heribert ein kompliziertes Verhältnis zur Obrigkeit hatte, und schloss nicht aus, dass er das religiöse Ritual als Spiel betrachtete. Mutmaßlich war er zur falschen Zeit auf Gott gestoßen und hatte zu spät erkannt, dass alles mehr oder weniger Bluff war. Fortan lebte er als aufgeklärter Nichtgläubiger in der Rolle des Paters, zugegeben, eine verwegene These, auf die ich nicht mein letztes Hemd verwettet hätte.
Beim Rundgang hatte er mit Blick zum Bücherregal erklärt, es gebe drei Arten von Schülern, die sich danach unterschieden, wie sie ihre Zeit im Clubraum verbrachten. Die Suchenden, die Spielenden und die Selbstvergessenen. Die Suchenden sah er als die Leser. Die Spielenden zogen den Kickerautomaten vor, und die Selbstvergessenen versammelten sich vor dem Fernsehgerät oder hörten die Charts im Radio.
Hätte ich mich, anstatt zu lesen, auf mein Zimmer zurückgezogen, hätte ich nicht gehört, wie etwas gegen die Scheibe schlug. Es konnte ein zufälliges Geräusch sein. Oder eins, das mich meinte. Das Fenster gab nichts preis, sondern zeigte nur mein Spiegelbild. Ich löschte das Zimmerlicht. Draußen, ein Stück unterhalb der Fensterbank, winkte jemand. Er stand auf Zehen und streckte seine Hände herauf, die nicht ganz bis an die Fensterkante reichten. Ich hätte mich gern getäuscht, doch der, der dort auf dem schmalen Rasenstück stand, trug ein lila Jackett. Und schwenkte die Arme. Sicher wäre es klüger gewesen, niemanden über meinen neuen Aufenthaltsort zu informieren. Zumindest hätte ich klarstellen sollen, dass ich nichts von Besuchern hielt, die mir spätabends auflauerten. Ich öffnete das Fenster einen Spalt und rief mit gedämpfter Stimme: Du hier?
Mick lachte schräg und sagte: Ich bitte um Aufnahme in den Bettelorden!
Geht’s noch lauter?
Nee, sagte Mick, jetzt bleib mal entspannt.
Ich bin entspannt!
Stell dir vor, sagte Mick, wir fahren durch die Gegend, und plötzlich sagt Lina, was ist eigentlich mit Ben, dem Unglücksvogel? Genau, sage ich, der hockt hinter meterdicken Klostermauern und fristet sein Dasein unter einsiedlerischen Mönchen, und da ruft Alex: Mensch, wie können wir nur so kaltherzig sein und ihn seinem Schicksal überlassen?
Was man im Allgemeinen Fehleinschätzung nennt, sagte ich.
Was man im Allgemeinen Geistesblitz nennt, sagte er.
Und jetzt?
Aufbruch, Flucht, Errettung!
Es war offensichtlich, dass Mick es ernst meinte und sich nicht ohne Weiteres abwimmeln ließ. Ich klemmte Das Wesen des Christentums zwischen Fenster und Rahmen, ließ mich über die Brüstung hinunter und landete im feuchten Gras.
Gratulation, sagte Mick.
Fragt sich nur, wer mir zurückhilft.
Es regnete, wenn auch schwach, ein Nieseln, das überall dort, wo es als Silberschimmer durch die Lichtkegel der Straßenlaternen fiel, schöner aussah, als es war. Ich trug, da ich keinen Ausflug geplant hatte, nur mein Hemd. Niemand außer uns war in der Lippestraße unterwegs. Die Schaufenster waren erleuchtet, als gäbe es irdisches Leben.
Du zitterst ja, Alter, sagte Mick und streifte seine Jacke ab, um sie mir über die Schultern zu legen. Auch ein lila gestreiftes Jackett schützte vor Regen. Noch vor einer halben Stunde hätte ich alles darauf verwettet, nie in meinem Leben in einer solchen Glimmerkostümierung durch eine Straße zu laufen. Zum Glück durch eine, in der uns nur der Regen begleitete. Der steinerne Bug der Franziskanerkirche ragte als dunkler Koloss in die Einkaufsstraße. Drei elegante Damen in Persianer blickten aus einem Schaufenster, in dem der Winter schon angebrochen war und einen Haufen Styroporkügelchen herangeweht hatte.
Wir bogen zum Markplatz ein, wo der Wind leise pfiff. Vor dem noch erleuchteten Hotel Koop sah ich Alexanders Opel. Vom Fuchsschwanz, der traurig an der Antenne hing, rann der Regen auf die Rallyestreifen. Neben Alexanders Wagen schimmerte Kuddels orangefarbener Käfer. Wir alle hatten gestaunt, als er wenige Tage nach seinem achtzehnten Geburtstag mit Clementine














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














