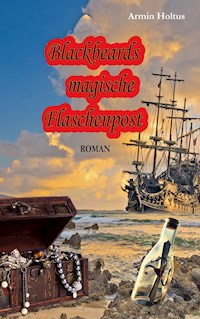Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Danilo Baltius verlässt nach dem tragischen Tod seiner Frau Bremen und siedelt auf Einladung eines Freundes aus Torquay nach Südwestengland über. Dort lebt er fortan auf seiner Yacht in der Marina, malt und schreibt Romane. Er unterhält eine lockere Beziehung zu Liz, der Tochter des dortigen Grafen. Ein Schatz wird gefunden und Familienverhältnisse neu geordnet. Intrigen und anderes Unrecht wecken Lust zu erleben, ob am Ende die Strolche ihrer gerechten Strafe zugeführt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Danilo Baltius verlässt nach dem tragischen Tod seiner Frau Bremen und siedelt auf Einladung eines Freundes aus Torquay nach Südwestengland über. Dort lebt er fortan auf seiner Yacht in der Marina und bereichert sein Leben durch Malerei und Schreiben von Romanen. Er unterhält eine lockere Beziehung zu Liz, einer der beiden Töchter des dortigen Grafen. Weit weg von seiner Heimat wird er bald durch eine wundersame Begegnung mit dieser konfrontiert, wobei diese Erinnerungen an seine Jugendliebe wachrufen.
Ein Schatz wird gefunden und Familienverhältnisse neu geordnet. Intrigen und anderes Unrecht wecken Lust zu erleben, ob am Ende die Strolche ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Ein heiterer Roman, bei dem auch die Erotik nicht zu kurz kommt.
Dr. jur. Armin Holtus, geboren 1957 in Bremen, arbeitet als Rechtsanwalt in Delmenhorst. In seiner Freizeit steht er gern auf der Improvisations-Theater-Bühne oder erfrischt seine Seele mit dem Schreiben von Gedichten oder Romanen. Mit diesem Roman hat er sich seinen Traum erfüllt, einmal wie Quincy auf einem Schiff zu leben. Aber sein Traum, eines Tages einmal seine Anwaltskanzlei auf seiner Segeljacht an der Schlachte in Bremen zu betreiben, ist noch nicht ausgeträumt.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Letztes Kapitel
Kapitel 1
Ein paar Möwen segelten elegant und scheinbar noch nicht ganz wach der Morgensonne entgegen. Hier und da ein müder Flügelschlag, mehr war allerdings auch nicht nötig. Aus Torquay hörte ich die alte Glocke von St. Mary träge und schlaftrunken sieben Male schlagen. Irgendwo bellte ein Hund, als wollte er es sich verbitten, so früh schon von St. Mary geweckt zu werden. Der Bäckerlehrling Jim kurvte gerade mit seinem alten Fahrrad um eine Hausecke und sang verträumt:
„Morning has broken, like the first morning, black bird has singing, like the first bird, praise for the morning, praise for them singing ...“
während er auf das Meer schaute und Fräulein Sonne anhimmelte. In den Körben auf seinem Rad rieben sich die Brötchen vergnügt aneinander und der Wind zupfte seine Lieder an den Lieken der Segeljachten.
Ich stand auf der Mahagonitreppe im Ausgang meiner „Esperanza“ und hatte diese ersten Eindrücke des neuen Tages gut gelaunt aufgenommen. Ich nahm nun die letzten Stufen der Treppe, die unter meiner Last merkwürdigerweise heftig stöhnten. Im Bereich um das schwere eichene Steuerrad herum mit den wunderbaren Instrumenten aus Messing, die auf einer Holzkonsole angebracht waren, befand sich eine gemütliche hölzerne Sitzecke mit einem kleinen runden Tisch in der Mitte. Hier stellte ich mein Tablett ab, sah auf zur Sonne, dankte ihr, dass sie offenbar vorhatte, uns abermals einen schönen Tag zu bescheren, reckte mich und spürte eine große Dankbarkeit im Herzen, dass es mir so gut ging. Liebevoll deckte ich den Tisch, während ich dankbar und genüsslich die frische, salzige Seeluft einatmete. Das Rührei mit Schinken zwinkerte mir zu und ich nahm diesen Wink dankbar und voller Appetit auf. Ich hob jetzt meine Kaffeetasse und prostete der Sonne zu. Ich lauschte dabei den Wellen, die sanft gegen meine Segelyacht klatschten. Ich hatte sie „Esperanza“ getauft, was „Hoffnung“ heißt. Vor fünf Jahren war ich in der Tat voller Hoffnung, als ich meine Anwaltsrobe ausgezogen und beschlossen hatte, meine Hobbys, die Malerei und das Schreiben, zu meinen neuen Berufen zu erheben. Mein Haus in Bremen hatte ich kurzerhand verkauft und von einem Freund dessen 15 m lange Yacht „Schlüssel von Bremen“ erstanden, die ich dann auf „Esperanza“ umgetauft hatte. Es soll ja Unglück bringen, ein Schiff umzutaufen. Das hatte ich aber erst viel später erfahren, als mir zufällig das Buch: „Logbuch der Angst“ in die Hände fiel. Darin ging es um die authentische Geschichte der „Wappen von Bremen“, die von dem Erwerber in „Appollonia“ umgetauft worden war. Und tatsächlich wurde der neue Eigner später von einem Mitsegler auf hoher See erschossen. Als ich das Buch las, erschütterte mich dieses Schicksal schon sehr. Den neuen Schiffsnamen behielt ich aber dennoch bei. Ich glaubte nicht an Dinge, die per se entweder Glück oder Unglück bringen. Die Dinge erzeugen allenfalls in den Menschen eine gewisse Vorstellung, die je nach Persönlichkeit unterschiedliche Kräfte freisetzt und den Menschen ggf. zum Spielball dieser Vorstellung macht.
Mit meiner Esperanza war ich dann nach Torquay in Süd-West-England gesegelt, wo ich früher schon oft mit meinen Eltern Urlaub gemacht hatte und wo es mir sehr gut gefiel. Nicht zuletzt war ich jedoch einer Einladung meines Freundes Robert Hurst gefolgt, der in Torquay eine florierende Kunsthandlung unterhielt. „Dany“, hatte Robert damals gesagt, „Du solltest Dein Talent nicht mit Paragrafenreiterei verschwenden. Du bist ein begnadeter Maler, mit Blick für das Motiv und der Fähigkeit, mit künstlerischen Mitteln dieses in Öl so umzusetzen, dass Du vielen Menschen damit eine große Freude bereiten könntest. Du weißt, ich sage das nicht aus reiner Sympathie, sondern als Profi, der den Markt kennt. Die Menschen, die hier leben, und die Touristen, die nach Torquay kommen, haben eine seltsame Affinität zu den maritimen Motiven, die sie ohnehin hier vorfinden – Bildern, auf denen Marinas zu sehen sind und gemütliche Hafenkneipen, vor denen Seeleute oder heimliche Verbündete mit verklärtem Blick auf die Segelschiffe schauen und von der Südsee und kaffeebraunen Schönen träumen. Wenn diese Menschen Deine Bilder sehen, werden sie in diesen ihre Träume wieder finden und – da jeder gern in Tuchfühlung mit seinen Träumen steht – Dir buchstäblich Deine Bilder aus der Hand reißen“.
Ich trank meine Tasse leer und schenkte mir nach, während auf irgendeinem Nachbarschiff eine Frau plötzlich so herzhaft und mitreißend lachte, dass auch ich mitlachen musste, ohne zu wissen, warum. Aber war das so wichtig? Das Lachen der Frau hatte in mir die angenehmen Dinge des Lebens erweckt und mich kurz eintauchen lassen in den Strom, der in die Freude mündet.
Über das Gespräch mit Robert hatte ich oft nachgedacht, wenn ich in meiner Kanzlei in Bremen saß und mich mit nicht gerade weltbewegenden Dingen wie zum Beispiel Nachbarstreitigkeiten zu befassen hatte, bei denen sich ein Nachbar darüber beklagte, dass der andere seinen wilden Wein drei Zentimeter in seinen Luftraum hineinragen ließ. Auch mit meiner Frau Roseanne hatte ich dieses Thema eines möglichen Berufs- und Ortswechsels nächtelang diskutiert. Roseanne war wie ich Anwältin, die ich während meines Referendariats in Bremen kennengelernt hatte. Nach 10-jähriger Ehe hatte sie mich plötzlich wegen eines unbestimmten Herzversagens für immer verlassen. Kurze Zeit später war mein Entschluss gefasst, dem Ruf meines Freundes nach Süd-West-England zu folgen – nicht zuletzt auch, um dort die nötige Zerstreuung zu finden, um über ihren Tod hinwegzukommen. Wenn uns auch keine Liebe miteinander verband, so hatten wir uns zeitlebens sehr geschätzt – als Menschen, Vertreter des anderen Geschlechts und nicht zuletzt als Kollegen. Und Zerstreuung konnte ich in der 120.000-Einwohner-Stadt Torquay reichlich finden!
Torquay ist durch die Flussmündungen von Dart im Süden und Exe im Norden begrenzt. Im milden Klima gedeihen Palmen und bei Sonnenschein kommt tatsächlich so etwas wie Riviera-Stimmung auf. Torquay ist auf sieben Hügeln erbaut. Seine palmengesäumte Promenade, die Hotels und die eleganten viktorianischen Villen, die Bars und Restaurants, die mondäne Atmosphäre und die Vergnügungsmaschinerie aus Bingo-Hallen und Auto-Skootern geraten zu einer einzigartigen Kombination aus Exotik und Englishness. Hier setzen sich die wohlhabenden Geschäftsleute zur Ruhe und ihre Witwen finden hier genügend Abwechslung und Entertainment, um nicht auf trübe Gedanken zu kommen. Obwohl ich noch nicht soweit war, dass ich mich zur Ruhe setzen konnte, fühlte ich mich sofort wohl in dieser Stadt am Meer. Ich lebte auf meiner Esperanza und das maritime Ambiente in der Marina von Torquay ließ meine künstlerische Kreativität nur so sprießen. Und dieser kreative Frühling sollte lange anhalten.
Neben der Malerei schrieb ich Romane. Als Rechtsanwalt war ich mit Lügengeschichten vertraut und an diesen beteiligt, meist ohne es zu wissen. Nur manchmal hatte ich eine gewisse Ahnung, wenn mich Mandanten spinnengleich mit Seemannsgarn vertäuten. Wenn mir dann auf Nachfrage, wer denn das im Streitfalle beweisen könne, Zeugen benannt wurden, hatte ich meine Schuldigkeit getan. Ich hatte stets zu glauben, was meine Mandanten mir erzählten und ich sah meine Aufgabe darin, sie dahin zu belehren, wie es um ihren Rechtsstreit bestellt sei für den Fall, dass die eine oder andere entscheidungserhebliche Tatsache von der einen oder anderen Partei – je nach Beweislast – nicht bewiesen werden könnte. Das Spannende am Anwaltsberuf ist, dass sich oft erst am Ende eines Prozesses herausstellt, wer die Prozessbeteiligten mit Seemannsgarn eingesponnen hatte. Beim Romanschreiben hatte ich mehr Einfluss auf den Ausgang einer Geschichte. Das wusste ich zu schätzen und hatte daher meinen Entschluss bis heute nicht bereut.
Von irgendeiner Nachbaryacht vernahm ich nun ein fröhliches Stimmengewirr, an dessen Ende ich wieder dasselbe herzhafte und mitreißende Lachen der Frau hörte, auf die ich eben schon einmal aufmerksam geworden war. Gern nahm ich auch diese unverbindliche Einladung zum Mit-Fröhlich-Sein an. Ich freute mich in solchen Augenblicken, dass es auch anderen Menschen gut erging.
Während ich in das mit Schafskäse bestrichene Brötchen biss, dachte ich an den Termin um 10 Uhr mit Jonathan Marlowe, meinem Verleger vom Verlag Seemöwe, mit dem mich Robert seinerzeit bekannt gemacht hatte, als die Verlegung meines ersten Romans anstand. Ich hatte jetzt meinen zweiten Roman vollendet und Marlowe zur prüfenden Lektüre überlassen. Ich war fest entschlossen, mich dieses Mal teurer zu verkaufen, zumal die erste Auflage meines ersten Romans binnen Monatsfrist vergriffen war und nunmehr die siebte Auflage anstand. Jeder macht sicher zu Beginn seiner Berufsausübung Fehler, aus denen man Konsequenzen für die Zukunft ziehen kann und somit die Chance erhält, diese nicht zu wiederholen. Normalerweise zähle ich mich zu den Menschen, die .gewisse Fehler immer wieder machen, weil sie neuen Situationen aus möglicherweise falsch verstandenem Gerechtigkeitsgefühl immer wieder die gleichen Startchancen einräumen. Natürlich spielt sich in neuen ähnlichen Situationen die Erfahrung ein und sendet Warnsignale. Doch diese werden dann mit vernünftigen humanitären Argumenten zum Schweigen gebracht. Hier sollte es ausnahmsweise einmal anders werden.
Nachdem ich die Esperanza ordnungsgemäß verschlossen hatte, sprang ich mit einem mächtigen Satz entschlossen auf den schwimmenden Bootssteg und schritt an den Nachbaryachten vorbei – nicht ohne einen Seitenblick auf die Dame, die mich vorhin mit ihrem herzhaften Lachen so angenehm emotional erfrischt hatte. Sie saß gemütlich auf dem Vorschiff und schaute nun verträumt in den Ort, genüsslich an ihrer Kaffeetasse nippend. Als sich unsere Blicke trafen, lächelte sie mir zu.
„Vielen Dank für Ihr herzhaftes Lachen vorhin, Frau Nachbarin. Es war sehr mitreißend“, gestand ich ihr.
„Ach bitte, gern geschehen. Das passiert bei mir öfter“, sagte sie mit einem süffisant um ihren Herzmund spielenden Lächeln und zwinkerte mir dabei zu.
„Ich jedenfalls hätte nichts dagegen“, entgegnete ich ihr und setzte ebenfalls zwinkernden Auges meinen Weg sicher über den schwankenden Steg fort, der mir inzwischen so vertraut und zu so etwas wie „Heimat“ geworden war.
„Scharfer Hase“, dachte ich, als ich schon am Bäcker vorbei war und wunderte mich selbst über mein spätes Urteil. Ich war in der Fleet-Street angekommen und schritt an vielen schönen alten Häusern vorbei, die aus allerlei verschiedenem Gestein kunstvoll und mit viel Liebe errichtet respektive restauriert worden waren. Einige Häuser waren teils mit wildem, teils aber auch mit echtem Wein oder anderen Kletterpflanzen berankt, wieder andere wurden von Palmengewächsen geziert. Diese Eindrücke gepaart mit der Wahrnehmung einer angenehmen Duftvielfalt und eines milden Klimas ließ in mir nicht gerade den Eindruck entstehen, mich in merry old England aufzuhalten. Bei so manchem Haus fragte ich mich, ob dort früher wohl einmal ein Kapitän oder Pirat gewohnt haben mochte. Ich ließ mich von dem äußeren Eindruck des Hauses inspirieren und schon fielen mir dazu einige Lebensläufe der Seeleute ein, die früher auf hoher See von ihrer Frau und Kindern sowie dem schönen Heim in Torquay träumten, an dem ich jetzt gerade – vielleicht 200 Hundert Jahre später – vorbeischlenderte.
Die Pimlico-Street, auf der ich jetzt entlang ging, stammte wohl noch aus der Postkutschenzeit. Hier herrschte jetzt munterer Verkehr. Überwiegend Frauen jeden Alters machten ihre tägliche Runde, damit es den Lieben zuhause wohl erginge. Die meisten hatten es nicht eilig und schritten nur langsam voran – in der durchaus gerechtfertigten Erwartung, auf ihrem Weg viele Möglichkeiten zu einem kleinen Pläuschchen zu finden. Innerhalb kurzer Zeit waren sie mit den wesentlichen Neuigkeiten aus Torquay versorgt, die sie nicht selten erst Tage später in der Tageszeitung nachlesen konnten. So gesehen waren diese Kontakte nicht nur in vielerlei Hinsicht nützlich, sondern zuweilen sogar existentiell bedeutsam.
Gelegentlich fuhr ein Lieferwagen vorbei, zum Teil von der Spezies, die ich noch aus den alten Edgar Wallace Filmen her kannte. Ihr Haltbarkeitsdatum müsste doch längst abgelaufen sein, dachte ich.
Hier und da traf ich auf Bekannte, die ich zunächst grüßend passierte. Da ich gut in der Zeit lag, ließ ich mich später ebenfalls auf das eine oder andere Schwätzchen ein.
Ich war gerade in der Market Street in ein solches Schwätzchen mit Rose, meiner alten Lieblings-Blumenverkäuferin, verstrickt, als ein alter dunkelblauer Jaguar E Cabrio mit quietschenden Reifen aus Pots Cavern um die Ecke geschossen kam, mit seiner Stoßstange einen Mülleimer erwischte und diesen gegen einen Fischstand schleuderte, wobei dieser ebenso zusammenklappte wie der Fischhändler Bean, der gerade dabei gewesen war, einen Seelachs einer nicht uninteressierten Dame in den schillernsten Farben anzupreisen. Als die Geräusche verklungen waren, richtete sich die Aufmerksamkeit zunächst auf Bean, der neben seinem zusammengeklappten Fischstand auf dem Straßenpflaster des Marktplatzes lag und dessen Kopf jetzt ein Seelachs zierte. Die Emotionen der Umstehenden schlugen jetzt mehrfach um:
Während das offenbar zu schnelle, grob verkehrswidrige und rücksichtlose Fahren des Jaguarfahrers zunächst noch für offene Empörung gesorgt hatte, war nun wiederum die sich anschließende Kettenreaktion mit dem fischverschnörkelten Fischhändler zu komisch, so dass sich gar mancher heimlich zu einem ausgeprägten Schmunzeln hinreißen ließ. Im nächsten Augenblick schlug auch dieses Gefühl wieder um in äußerste Empörung: „Haste das geseh`n? Der hält nich´ mal an“ schäumte Rose und ihr Gesicht färbte sich dabei rot ein vor Entrüstung, während sie mit weit geöffnetem Mund nur ihren Kopf langsam drehte, um den flüchtenden Jaguar mit ihren Augen zu verfolgen. „So was hab` ich mein Lebtag noch nich` geseh`n“, flüsterte Rose jetzt, als hätte sie den Leibhaftigen erlebt. Ob der wohl über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte?
Der Jaguar hatte tatsächlich seine Fahrt scheinbar unbeeindruckt von dem von ihm verursachten Schaden fortgesetzt und fuhr jetzt unmittelbar an uns vorbei. Am Steuer saß ein schräger Mittvierziger im grauen Hochglanz-Edel-Anzug und Sonnenbrille. Auf dem Beifahrersitz vernahm ich eine Blondine, vielleicht etwas jünger als der Fahrer, im blütenweißen Kostüm und – natürlich ebenfalls inkognito mit schwarzer Sonnenbrille – für den Kontrast! Ich zuckte kurz zusammen, als sich unsere Augenpaare trafen und ich vermeinte, eine ähnliche Reaktion bei ihr wahrgenommen zu haben. Einige Wimpernschläge lang sah ich verschwommene Bilder aus meiner Jugend, taumelte kurz, als mir plötzlich alles schwarz vor Augen schien und strich dann reflexartig mit meiner Hand über Augen und Stirn, was mich davor bewahrte zu stürzen. Ich nahm Rose in den Arm, teils aus Zuneigung, teils aus Gründen ungenügender Erdung.
Für Rose wiederum schienen sich die Ereignisse wahrhaftig zu überschlagen. „Is Dir nich wohl, Dany?“, fragte meine Lieblings-Blumenverkäuferin überrascht und konnte irgendwie mit meiner Person in ihren Armen nicht so recht etwas anfangen.
„Entschuldige, Rose. Ich weiß nicht, was mit mir eben passiert ist. Ich habe die Frau im Jaguar gesehen, dann sah ich verschwommene Bilder aus meiner Jugend in Bremen und dann plötzlich sah ich gar nichts mehr und ich suchte Deinen Halt, um nicht zu stürzen“.
Rose streichelte mir mit ihrem rauen Handrücken über die Wangen und sah mich dabei forschend an. „Kanntest Du die Frau?“
„Ich weiß nicht“, antwortete ich zögernd. „Ich meine, diese Frau schon einmal irgendwo gesehen zu haben und die Intensität meiner Reaktion zeigt mir, dass die mögliche damalige Begegnung mit dieser Frau keine unbedeutende gewesen sein kann. Aber ich habe im Augenblick überhaupt keine Bilder dazu. Ich erinnere mich nicht, wer das gewesen sein könnte. Wahrscheinlich sah diese Frau aber auch nur irgendeinem Mädchen aus meiner Jugend ähnlich, die mir mal etwas bedeutet hat. Wer auch immer die Gefährtin aus alten Tagen gewesen sein mag, an die ich durch den Anblick dieser Frau hier erinnert worden bin: Sie kann es jedenfalls nicht gewesen sein! Was sollte dieses Mädchen hier zu beschicken haben?“ Ich stutzte kurz, da mir einfiel, dass ein Außenstehender in Bezug auf meine Person dieselbe Frage hätte stellen können: Was macht Danilo Baltius aus Bremen in Torquay? Hatte ich nicht schon einmal auf demselben Campingplatz in der Nähe von Rijeka in Kroatien bei zwei Besuchen jedes Mal einen Bekannten getroffen? Beim ersten Mal einen Kommilitonen aus Göttingen und beim zweiten Mal wurde ich – emsig mit dem Zeltaufbau beschäftigt – aufgeschreckt durch eine bekannte Stimme hinter mir, die einen Begleiter fragte: „Sag` mal, ist das nicht Danilo?“ Und wer war es? Der Nachbar meiner Eltern aus Bremen! Trotzdem! Es wäre ein zu großer Zufall, wenn ich hier schon wieder einen Bekannten treffen würde – so fern der Heimat! Heimat? Ja Heimat! Irgendwo war Bremen natürlich noch meine Heimat. Dort war ich aufgewachsen, dort hatte ich noch Freunde aus alten und jüngeren Tagen und könnte dorthin jederzeit zurückkehren und würde dort willkommen sein. Aber zurzeit war Torquay meine – ja sagen wir: zweite Heimat. Wie kam ich da jetzt drauf? Ach ja! Egal! Ich schaute auf die Uhr. Es war gleich 10 Uhr. Ich musste los. Ich verabschiedete mich herzlich von Rose, die mich sorgenvoll-nachdenklich über ihre Brille anschaute und mir wieder mit ihrem rauen Handrücken über meine braunen Wangen strich.
„Muss ich mir Sorgen um Dich machen, Dany?“, fragte sie bekümmert.
„Nein, Rose, ist schon wieder gut“, beschwichtigte ich sie.
„Na dann mach`s gut, Dany, bis bald. Lass` es Dir gut gehen!“
Noch in Gedanken versunken und grübelnder Weise erreichte ich in der Babbacombe Road den Torbogen zum Verlag „Seemöwe“ und trat ein. Eine krächzende Stimme begrüßte mich: „Geh` doch mit Deinem Manuskript zum Teufel“.
„Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, ich wünsche Dir ebenfalls einen schönen Tag, lieber Morgan. Und ich kann Dir schon jetzt versichern, wenn Dich nicht eines Tages selbst der Teufel holt, dann koche ich Dich persönlich in meiner süßen, kleinen Kombüse“, erwiderte ich gereizt dem Verlagspapagei. Obwohl ich um diese herzerfrischende Begrüßung wusste, erschrak ich mich doch merkwürdigerweise jedes Mal wieder erneut über wechselnde Begrüßungsformeln dieses an sich und im Großen und Ganzen recht unterhaltsamen Zeitgenossen. Ich würde natürlich niemals so weit gehen und einen Papageien kochen. Wo denken Sie hin? Gebraten entfaltet er seinen Geschmack viel besser! Sie merken schon: Die Begrüßung mit dem Manuskript hatte mich doch narzisstisch nicht unerheblich gekränkt!
Die Wände des Foyers waren holzvertäfelt und davor türmten sich Bücher bis zur Decke. Sofort umtrieb eine Mischung aus dem Duft frischer und alter Bücher sowie Holz meine Nase und drang in sie ein. Ich mochte diesen Geruch! Er hatte etwas Beruhigendes und gleichsam Bewegendes, welcher einen gedanklich auf die Reise schickt zu den Orten, wo man schon einmal derlei wahrgenommen hatte.
Im Zentrum des Foyers bäumte sich ein mächtiger rundlicher Kamin auf, der im Winter wohl das ganze Anwesen zu wärmen vermochte. Ich stellte mir vor, wie an manchen unwirtlichen Winterabenden hier Lesungen gehalten würden und die Besucher dicht an dicht um diesen Kamin herumhocken würden – teils aus Verbundenheit mit der Literatur, teils weil man sich gern mit dem Besuch exklusiver Kreise schmückte oder aber einfach ganz schlicht engen Kontakt zu anderen Menschen suchte.
Butzenfenster teilten den Blick auf den großen Garten, in dessen Mitte ein kleiner See lag, in den hinein eine alte Trauerweide ihre langen Tränen tropfen ließ. Wer Bücher liebt, der musste zwangsläufig auch dieses harmonische Ambiente lieben.
„Einen frohlockenden und herzerfrischenden Morgen, liebe Miss Winterbottom“, ließ ich mich genüsslich vernehmen.
„Guten Morgen, Mr. Baltius, schön dass Sie da sind. Und natürlich pünktlich wie die Maurer“, begrüßte mich eine an den richtigen Stellen üppige, fesche Frau mittleren Alters mit schwarzer Brille, wallendem schwarzem Haar und ebenso wallendem Faltenrock und lächelte mir ihr strahlendes Lächeln entgegen. Freundlicher konnte eine Begrüßung wirklich kaum sein!
„Na, wie laufen die Geschäfte“, fragte ich sie aus.
„Gut, gut, sehr gut sogar – vor allem Ihre, wenn ich das mal so nebenbei bemerken darf“, warf sie ein und zwinkerte mir dabei mit einem einladenden Lächeln zu, das mir zu denken gab.
„Ja, aber freilich dürfen Sie das mal eben so nebenbei bemerken, verehrte Miss Winterbottom. Für Informationen dieser Couleur habe ich doch stets ein offenes Ohr – wenn Sie wissen, was ich meine – und wenn ich das mal so eben nebenbei bemerken dürfte, schäkerte ich und blinzelte ihr dabei ebenso viel sagend zu wie sie zuvor mir. „Na, denn mal auf in den Kampf!“.
„Auf in den Kampf!“, bestätigte Miss Winterbottom mit einem Hauch militärischer Direktive, schlug salutierend die Hacken zusammen und hauchte mir dabei durch eine Bewegung mit ihren Armen eine Kostprobe ihres süßen, anziehenden Parfüms entgegen, dass ich es schade fand, auf ihre weitere Anwesenheit verzichten zu müssen. Während ich die Treppe zu ihrem Chef hinaufging, zwickte mich irgendetwas an meinem Heck – wahrscheinlich elektrisiert durch die Blicke der Dame, die auf dieses fokussiert waren (eingebildeter Affe, der ich bin) und dieses Zwicken wurde ich erst wieder los, als ich hinter der Tür des Verlegers verschwunden war. „Wie merkwürdig“, dachte ich kurz, bevor ich das repräsentative Zimmer von Jonathan Marlowe leicht hüstelnd betrat.
„Ah, Mr. Baltius, treten Sie doch erheblich näher“, sagte eine sonore Stimme ohne Körper - versteckt hinter einem Bücherberg, der sich auf und neben seinem mächtigen Schreibtisch erhob. Ich nahm die Einladung an und trat näher und sah den etwa Mitte fünfzigjährigen Verleger Notizen – offenbar bezogen auf die Lektüre eines ihm angediehenen Werkes – kritzeln, ohne aufzuschauen. Ich setzte mich aber nicht auf den mir offenbar angedachten Stuhl ihm gegenüber, sondern ließ mich genüsslich eintauchen in einen gemütlichen, wohl duftenden Ledersessel inmitten der benachbarten Sitzgruppe und schaute aus dem Fenster.
„Soooo!“, stöhnte endlich Marlowe, erhob sich mühsam von seinem Schreibtischsessel, um dann im ersten Schritt über einen kleinen, unscheinbaren Bücherhaufen am Boden zu stolpern, fiel aber nicht, sondern erlangte nach drei gestolperten, kleinen und schnellen Schritten sein Gleichgewicht zurück und streckte mir seine mächtige Pranke entgegen.
„Guten Morgen, Mr. Marlowe, das war eben gar nicht mal so leicht, nicht zu stürzen; alle Achtung, wie Sie den sicheren Sturz mit der Eleganz eines Tigers aus dem sibirischen Dschungel abgewandt haben. Das macht Ihnen so leicht keiner nach“, log ich nicht einmal, denn ich war tatsächlich überrascht von den gezeigten Fähigkeiten, die ich in diesem bulligen Körper nicht im Entferntesten vermutet hatte.
„Och, jetzt übertreiben Sie aber, mein Lieber, das war eine ganz normale Reaktion, nichts Besonderes. Sie müssen nämlich wissen, ich bin darin sehr geübt, da mir das leider öfter passiert. Ich habe nur leider noch nicht die Zeit gehabt, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Sie hätten mich mal früher sehen sollen, als ich noch Fast Forward unserer Universitätsmannschaft in Cambridge war. Da hatte ich noch die Eleganz von ganz anderen Tieren als dem, was Ihnen eben zu mir eingefallen ist“, erwiderte Marlowe blinzelnd.
„Eins zu Null für Sie, Mr. Marlowe, dieser Ball war unhaltbar. Aber Spaß beiseite! Wie stehen die Aktien am Büchermarkt?“, fragte ich.
„Ach, die Aktien!“ Er überlegte und vergrub dabei seine rechte Hand in seinem Bart. „Ja, die Aktien! Die stehen schlecht, sehr schlecht“, stöhnte Mr. Marlowe und ließ sich wie in einem Anflug plötzlicher Ohnmacht in den Sessel fallen. „Sie könnten wahrhaftig besser sein!“, seufzte er jetzt wieder. Der Büchermarkt steckt seit der Euroumstellung in der schwersten Krise seit dem Krieg“.
Wie gut, dass in England die Euroumstellung nicht vollzogen ist, amüsierte ich mich insgeheim über die in sich unschlüssige Argumentation von Marlowe.
„Der Absatz sinkt, gleichzeitig explodieren die Kosten und pulverisieren den Gewinn“.
Eine Herz zerreißende Geschichte - wenn ich nicht zuvor von Miss Winterbottom über ganz andere Entwicklungen informiert worden wäre. „Ja, Sie haben Recht. Viele Wirtschaftszweige werden grob beschnitten und müssen ihren Standort neu bestimmen. Aber nun zu meinem Roman! Wie finden Sie ihn?“
„Nicht schlecht, nicht schlecht“, antwortete Marlowe bedächtig und kraulte dabei erneut seinen roten Vollbart. Ich könnte mir durchaus eine Fortsetzung unserer Zusammenarbeit vorstellen – unter bestimmten Voraussetzungen“, fügte er zögernd und lang gedehnt an.
„Das freut mich zu hören, dass Sie von meinem Werk begeistert und diesmal gern bereit sind, Wertschätzung für das Werk und Honorar in einen ausgewogenen Einklang zu bringen“.
Marlowes Augen weiteten sich nicht unerheblich, bevor seine Stimme geistesgegenwärtig umschlug. „Nun ja, das ist ja klar, es sollte schon ein wenig mehr sein als bei Ihrem Jungfernwerk. Ich gebe aber zu bedenken, dass Sie auf dem Büchermarkt sozusagen noch ein Newcomer sind“.
„Und ich gebe zu bedenken, dass das – mit Verlaub - sachfremde Erwägungen sind, Mr. Marlowe“, bemerkte ich nicht ohne Kampfgeist – abgeschwächt durch ein leichtes Lächeln. „Wäre ich Lehrling in Ihrem Verlag, würde ich Ihnen vielleicht Recht geben – müssen. Ich bin aber nun mal nicht Ihr Lehrling, Mr. Marlowe. Ich muss mich in Ihrem Verlag nicht hochdienen, um dasjenige zu erhalten, was mir zusteht. In dieser Sache stehen wir zwei uns als gleichberechtigte Partner im Geschäftsverkehr gegenüber, wobei jeder von uns frei darin ist, mit dem anderen oder aber mit irgendeinem beliebigen Dritten zu kooperieren. Und entscheidend bei der Bewertung meines Anteils am Verkaufspreis dürfte doch unter anderem sein, ob Nachfrage besteht oder aber Buchladenhüter produziert worden sind, ob der Verlag in der Gewinnzone liegt oder nicht. Und liegt der Verlag in der Gewinnzone, wäre die nächste Frage, wie der Gewinn angemessen zwischen Verlag und Autor aufgeteilt werden könnte. Ich bin dabei der Ansicht, dass eine Aufteilung des Gewinns zu gleichen Teilen …“ sofort weiteten sich die Pupillen von Marlowe und er schluckte heftig, als ich von dieser Quote sprach – „angemessen wäre, da die geistige Schöpfung nach allgemeiner Anschauung über der rein mechanischen Arbeit steht, die heutzutage überwiegend von Computern oder Robotern erledigt wird“.
Marlowe war inzwischen in seinem Sessel tiefer gerutscht und wirkte ein wenig desillusioniert.
„Aber nicht einmal diese an sich gerechte Aufteilung des Gewinns beanspruche ich“.
Marlowes Gesichtszüge entspannten sich sofort und neugierig beugte er sich wieder nach vorn.
„ Ich habe mir lediglich eine Anhebung des Honorars auf ein halbes Pfund pro verkauftes Buch vorgestellt. Das stellt zwar eine Steigerung von 100 % dar gegenüber dem vereinbarten Honorar für mein erstes Buch. Aber ich denke, Sie und Ihr Verlag können damit sehr gut leben. Was halten Sie von diesem Angebot?“
Marlowe schaute inzwischen schon wieder freundlicher. Er erhob sich spontan und schlurfte zu einem kleinen verglasten Schränkchen und kehrte freudestrahlend mit zwei Gläsern und einer Flasche zurück. „Seeleute trinken doch immer Sherry, nicht wahr?“, fragte Marlowe und schenkte feierlich und als handelte es sich dabei um eine ganz kostbare Ware, die unter keinen Umständen verschüttet werden dürfe, beide Gläschen voll.
„Nicht immer, aber manche immer öfter“, erwiderte ich, wobei ich dabei aber eher an Marlowe selbst dachte. Wir schauten uns an und lachten, während wir miteinander anstießen.
„Ich nehme hiermit Ihr Angebot an, Mr. Baltius“, verkündete Mr. Marlowe feierlich freudestrahlend und kippte sich den Rest des Gläschens hinter die Binde. „Sagen Sie, Mr. Baltius, wie ist das eigentlich so, auf einem Schiff zu leben?“ „Ach, zuweilen sehr schwankend. Und dieses Schwanken hat etwas sehr Beruhigendes, Mr. Marlowe. Vielleicht weckt es unterbewusst Erinnerungen an alte Kindheitstage, wo ich in der Wiege lag und meine Mutter mir „Weißt Du wie viel, Sternlein stehen …?“ vorsang und mich dabei gleichmäßig in der Wiege hin und her schaukelte“.
„Von der Warte habe ich das Schwanken auf einem Schiff bisher noch gar nicht betrachtet“.
„Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten, Mr. Marlowe?“
Er trat neugierig in stiller Vorfreude auf eine Sensation einen Schritt näher:
„Gern, Mr. Baltius. Sie wissen, ich kann schweigen“.
„Ich habe das Schwanken bisher auch noch nicht unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Dieser Gedanke ist mir gerade jetzt erst gekommen. Im Übrigen mangelt es mir auf meinem Schiff an nichts. Ich habe in einem gemütlichen Ambiente mit viel Mahagoni und Messinginstrumenten – wovon ich schon als kleiner Junge geträumt habe – Platz genug auf drei Ebenen. Ich habe von fast allen Punkten meines Schiffes der zweiten und dritten Ebene über die Bullaugen einen vortrefflichen Rundumblick. Ich sehe die sieben Hügel der Stadt, die Palmen gesäumte Promenade, die viktorianischen Villen, Old Pirate`s Inn und die anderen gemütlichen Hafenkneipen, Restaurants und den Pavillon, ich sehe die anderen Schiffe in der Marina, die Kalkfelsen, Abbey Sands und – ich sehe das schöne Meer, das im Sonnenlicht türkis-bläulich schimmernde Meer, bald rau, bald spiegelglatt. Das Meer ist mein Fundament, das mich an einen Hafen bindet und mir jederzeit die Möglichkeit eröffnet, jeden anderen Hafen dieser großen weiten Welt unter Gottes schönem Himmelszelt anzusteuern – vielleicht Antigua, Barbados, Bremen oder Torquay. Allein die jederzeitige Möglichkeit, meinen Standort auf der Erde mit allem, was mir lieb und teuer ist, zu verändern, ist ein großes Geschenk und ich danke Gott dafür, dass ich im Augenblick hier in Torquay zu Gast sein darf. Wenn es mir in den Sinn kommt, schreibe ich – manchmal bis tief in die Nacht, dann bei Kerzenschein. Ich sitze dabei in einer gemütlichen Rund Ecke mittschiffs, nippe gelegentlich an einem Gläschen Cabernet Sauvignon und schaue dabei auf die beleuchtete Strandpromenade und das übrige Lichtermeer der Stadt auf der einen – und das Meer auf der anderen Seite – Gegensätze, die mich anziehen und die mich zuweilen zwischendurch auf ein Päuschen auf das Top-Deck locken. Dort stehe ich dann – am Steuerrad angelehnt – und drehe mich langsam, wobei ich abwechselnd zu den Sternen hinauf sehe und dann wieder zum Meer und zur Stadt. Wenn ich dabei das Meer zart gegen meine Esperanza schlagen höre, laufe ich im Herzen über vor Glück und Zufriedenheit – Sensationen und Eindrücke, die meine Phantasie mit neuen Impulsen befeuern und zum Weiterschreiben anregen. Schreiben ist für mich ein Vehikel, etwas auszudrücken, was ich mir in der Wirklichkeit nicht immer zutrauen würde. Und wenn ich keine Lust habe zu schreiben, fahre ich mit der Zahnradbahn über bewaldete Klippen zum Oddiscombe Beach, um zu schwimmen. Auch gehe ich gern spazieren, setze mich vielleicht vor irgendeine Hafenkneipe, vorzugsweise Old Pirate`s Inn und beobachte für die Dauer einer großen Piratentasse Kaffee das illustre Treiben der Geschäftsleute, der oft lustigen und reichen Witwen, der Touristen, der Kinder und der fliegenden Händler, die mir die nutzlosesten Dinge mit einer bemerkenswerten Eloquenz als die lebensnotwendigsten anpreisen. Nicht selten kommt es dabei vor, dass meine Aufmerksamkeit anlässlich solcher Betrachtungen von Wahrnehmungen gefesselt wird, die mich spontan dazu veranlassen, Papier, Farben und Pinsel vom Schiff zu holen und zu versuchen, das Erlebte mit den Mitteln der Malerei wiederzugeben. So ist es in groben Zügen, auf einer Segelyacht zu leben“.
Marlowe schaute mich noch für einen kurzen Moment an, beugte sich dann vor, um an seinem Glas zu nippen: „Ihr Leben scheint sehr interessant; ich beneide Sie um Ihre scheinbar stressfreie Sorglosigkeit und die Möglichkeit, jederzeit gerade das machen zu können, was Ihnen Spaß macht. Und das Tollste ist: Das, was Ihnen Spaß macht, ebnet Ihnen den pekuniären Horizont, um auch künftig sorglos das tun zu können, wozu Sie Lust haben. Ein wahrer Engelskreis – im Gegensatz zu dem oft bemühten und weniger erfreulichen Teufelskreis“.
„Mr. Marlowe, ich schäme mich fast, bestätigen zu müssen, dass Sie mit Ihrer Einschätzung meiner Situation voll ins Schwarze getroffen haben“.
Kapitel 2
Ich hatte gerade das Licht der Minors Lamp gelöscht, meine Arme hinterm Kopf verschränkt und schaute durch die halb geöffnete, gläserne Luke in den Sternenhimmel. Es war eine sternenklare Nacht und zunehmender Mond. Die See lag ruhig; nur leise, zufrieden glucksende Laute waren zu vernehmen aus dem harmonischen Zusammenspiel von Meer und im Hafen sicher vertäuter Yachten. Irgendwo grölte jemand nicht unerheblich angeheitert:
„What shall we do with the drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor, early in the morning ...“
Ich fühlte mich wohl unter meiner Bettdecke und erkannte jetzt am Sternenzelt den Großen Wagen. Ob er mich wohl auch erkannte? Oder irgendeiner seiner Bewohner mich vielleicht mit einem riesigen Fernrohr in Peilung nahm? Jetzt fiel mir wieder der kleine Wagen ein, nämlich der Jaguar E von heute Morgen. Ich sah auch wieder die Blondine vor mir. Ich bekam plötzlich eine Gänsehaut, die wie ein Lauffeuer meinen ganzen Körper zunehmend in Beschlag nahm. „Wieso ist mir die Ähnlichkeit mit Florence nicht schon heute Morgen aufgefallen?“ Florence war meine alte Jugendliebe aus der Nachbarschaft. Wir beide besuchten das Gymnasium an der Parsevalstraße in Bremen. Ich war zwei Klassen höher – dafür war sie mir aber in so mancher Hinsicht mindestens zwei Klassen voraus! Aber sie kann es unmöglich gewesen sein! Das wäre wirklich ein zu großer Zufall. Hatte der Jaguar nicht ein englisches Kennzeichen? Aber er könnte ja auch hier auf der Insel gemietet worden sein. Und schließlich kannte sie Torquay aus meinen Urlaubsberichten von damals. Vielleicht hat sie sich daran erinnert und ihren Mann – oder wer auch immer ihr Begleiter gewesen sein mochte – von Torquay vorgeschwärmt. Möglich. Aber Schluss jetzt damit! Durch Grübelei werde ich diese Frage heute Nacht nicht aufklären können“, rationalisierte ich und drehte mich jetzt seufzend auf die Seite und schaute durch die Bullaugen auf die See, auf die der Mond einen zarten Lichtschleier gelegt hatte.
Meine Gedanken wanderten jetzt zu Elizabeth. Ich hatte sie schon eine Woche vernachlässigt. Würde sie böse auf mich sein? Wohl kaum. Möglichkeiten, den Tag zu gestalten, sind reichlich vorhanden. Sie spielt leidenschaftlich gern Tennis, Golf und Rommé. Darüber hinaus reitet sie gern und macht fast alles im und auf dem Wasser: schwimmen, tauchen, surfen, segeln. Sie hat viele Freunde und Freundinnen, die jederzeit gern bereit sind, die Gesellschaft mit Liz über gemeinsame Interessen zu teilen. Vor allem der neureiche Makler Brian Turner. Dieser widerliche Kerl umwirbt sie nach allen Regeln der Kunst frei nach dem Motto: „Solange Gräfin Elizabeth Nightingale noch nicht verkauft ist, kann sie von mir noch erworben werden!“ Da hat er allerdings nicht ganz Unrecht“, fiel mir ein, ohne jetzt allerdings ernsthaft über einen Heiratsantrag nachzudenken, um Brian zuvorzukommen. Liz hatte mir leichtsinnigerweise eröffnet, dass Männer, die ihr dergestalt intensiv nachstellen und sie mit Aufmerksamkeiten jedweder Couleur eindecken, bei dem Ansturm auf ihr Herz eher chancenlos sind. Nicht zuletzt hatte ich aber auch den unbestimmten Eindruck, bei Liz noch nicht angekommen zu sein – um mit ihr meine zweite Lebenshälfte zu gestalten.
Durch die Nacht dröhnte von irgendeinem Schiff das Hornsignal und ich stellte mir vor, es sei die „Astor“ auf ihrem Weg in die Karibische See. Die meisten Reisenden auf diesem Schiff sind sicher um diese Zeit in Hochstimmung – entweder an der Bar, auf dem Tanzparkett – oder in der Koje – mit wem auch immer. Hauptsache, die lange Reise in die Karibik wird nicht langweilig! Zeit zum Nachdenken hatte man ja schließlich zuhause genug.
Noch in Gedanken auf der Astor hörte ich jetzt Schritte auf dem Steg. Sie kamen näher. Es waren keine Bootsschuhe, das war schon einmal sicher. Danach zu urteilen, wie jeder einzelne Schritt pointiert gesetzt wurde, war es der unnachahmliche und von mir sehr geschätzte modus operandi einer Frau, die wusste, was sie wollte und die fest entschlossen war, sich bei ihrem Vorhaben von niemandem aufhalten zu lassen. Es waren Pumps, die dort ihren Eindruck auf den Steg und bei so manchem in der Koje der von dem liebreizenden Klang erreichbaren Yachten machten, der nicht einschlafen konnte, wobei dieser verführerische Klang zweifelsohne nicht dazu angetan war, an deren Schlaflosigkeit etwas zu ändern.
Ich war gespannt wie die Saiten einer Violine. Welches Ziel mögen die sicher schönen Beine in den Pumps wohl haben? Wer mag der Glückliche sein? Ich hörte jetzt, wie die Frau ein Schiff in meiner unmittelbaren Nähe bestieg. Ich setzte mich auf als ich vernahm, dass die hölzerne Eingangstür meiner Esperanza langsam aber vernehmlich knarrte. Ich war in meiner Spannung dergestalt sensibilisiert, dass ich ein Blütenblatt auf dem Schiffsboden meiner Koje hätte landen gehört. Zielbewusst und sicheren Fußes fanden die Pumps ihren Weg durch Kajüte und Dunkelheit, ohne irgendwo anzustoßen. Das zarte Licht des zunehmenden Mondes beleuchtete schwach durch die Bullaugen die Pumps auf ihrem unaufhaltsamen Weg – wohin? Die Pumps blieben stehen. Im Eingang zu meiner Koje sah ich die Silhouette einer Frau. Sie trug eine weiße Bluse, die selbst im Kojendunkel kein Geheimnis aus ihrem üppigen und wohlgeformten Inhalt machte. Ich hatte nicht die zarteste Ahnung, wer diese Dame war. Meine Anspannung, ja ich darf wohl sagen: meine Erregung, erreichte Spitzenwerte. Träume ich? Diese Frage war ganz eindeutig zu verneinen! Denn optische und körperliche Wahrnehmung standen durchaus in einem adäquaten Zusammenhang! Die körperlichen Auswirkungen nahm ich deutlich wahr und war dafür dankbar. Selten zuvor hatte ich mich in einer ähnlich prickelnden Situation befunden!
Die Dame war bekleidet mit einem weit geschlitzten weißen Rock. Sie winkelte jetzt ihr rechtes Bein an. An den Fesseln funkelten im Mondlicht kleine Kettchen. Sie zog mit dem linken Pumps den rechten halb aus und – schleuderte diesen gekonnt – als würde sie es immer so machen - im hohen Bogen durch die etwa 12 qm große Kabine in Richtung meiner Koje. Der linke folgte und landete auf einem alten eichenen Weinfass neben meiner Koje. Zwei geschickte Handbewegungen und der Rock sauste hinunter wie ein ungebremster Fahrstuhl und bedeckte ihre nackten Füße. Sie hielt inne, so als wollte sie die ohnehin kaum steigerbare Spannung durch die sich aufdrängende Frage, was denn wohl jetzt geschehen würde, noch weiter ausbauen. Langsam und lässig stieg sie jetzt über den Rock. Ihre Augen waren dabei die ganze Zeit – vermutlich – auf mich gerichtet. Genau erkennen konnte ich ihr Gesicht immer noch nicht. Sie trat jetzt wie auf Samtfüßen – das Schiffsparkett zärtlich streichelnd – einen Schritt näher – noch einen und hielt dann wieder inne. Langsam knüpfte sie ihre Bluse auf, zog sie am Ende aus und warf sie wie befreit in meine Richtung. Über die Bluse drang ein aufregendes Parfüm in meine Nase. Eine weitere geschickte Handbewegung und ihre üppigen und wohlgeformten Brüste waren unbedeckt. Nach wenigen, aber verzögerten, überaus reizenden und spannenden Hüftbewegungen hatte die Lady sich ihres Slips entledigt. Hitze stieg in mir auf wie in einem Hochofen. Mein Herz hörte ich kräftig schlagen. Die Hände der Frau bewegten sich jetzt zu ihrem eigenen Hinterkopf und nach einem Wimpernschlag – in der Situation schienen für mich Minuten zu vergehen – rauschten wasserfallartig ihre langen, glatten blonden Haare herunter. Jetzt trat sie noch einen Schritt näher, kniete sich auf die Koje und bewegte sich ganz langsam auf allen Vieren vorwärts, während sich unsere nackten Körper berührten. Ihre Brüste legten sich auf meine, als sie sich beugte. Sie küsste mich leidenschaftlich und ausgiebig.
„Schön, dass Du gekommen bist“, sagte ich.. Es war Liz – jedenfalls hatte sie die Formen von Liz. Ich vermisste jedoch ihr Parfum – Chanel Coco, das auf ihrem Körper so herrlich anziehende Wirkung auf mich ausübte. Das Parfum hier war ein anderes, welches ich stets an ihrer Zwillingsschwester Audrey wahrgenommen hatte. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich jetzt in einem Zustand befand, in dem ich auf diese Nuance keine Rücksicht nehmen konnte. Schließlich konnte mir – rein äußerlich betrachtet – keiner einen Vorwurf machen, da ich in den Glauben versetzt wurde, es wäre Liz. Ich vermied nachfolgend auch überflüssige Kommunikation, die geeignet gewesen wären, die Unterschiede der beiden Schwestern ans Licht zu befördern.
Etwas Wind kam auf, die Wellen klatschten angenehm – wie Verbündete - gegen die Esperanza und ein zarter Wolkenschleier legte sich über den Mond.
Kapitel 3
Robert Hurst hatte sich schon um 8 Uhr an Bord seiner Yacht „Cezanne“ begeben, alle Termine für diesen und den nächsten Tag seiner Yacht gewidmet, die dringend einer Unterwasserreinigung bedurfte, weil Muscheln und andere Lebewesen aus Flora und Fauna den Schiffsrumpf seiner Cezanne verzierten. Darüber hinaus war das Teak-Deck zu lasieren. Der Tag war für dieses Vorhaben wie geschaffen: Die Sonne schien, es war mild und absolut windstill.
Nachdem er mit Sauerstofflasche und Taucherbrille einige Zeit unter Wasser anstrengende Arbeit verrichtet hatte, tauchte er wieder auf, um sich ein kleines Päuschen zu gönnen. Auf dem Steg nahm er einen etwa elfjährigen Jungen wahr, der mit einem Bein in der Nordsee herumrührte und dabei seine Cezanne anschaute. An Deck entledigte sich Hurst seiner Taucherutensilien und setzte sich an den runden Tisch in unmittelbarer Nähe des eichenen Steuerrades, welches das Zentrum dieses geselligen Teil des Schiffes an Deck bildete. Um das Steuerrad waren allerlei, in Holz eingefasste Messinginstrumente herumgebaut. Auf der Steuerbordseite neben dem Steuerrad war auch die hölzerne Eingangstür, von der aus eine steile Treppe nach unten ins Schiffsinnere zu diversen Kabinen und die Kajüte führte. Er schenkte sich aus einer Thermoskanne eine Tasse Kaffee ein. Dieser war noch so heiß, dass der Dampf ihm sichtbar in seine Nase stieg – in Begleitung des anregenden und mit vielen angenehmen Erinnerungen besetzten Duftes. Robert genoss die ersten Züge als Belohnung für die Mühen unter Wasser. „Die Muscheln und das andere Zeug haben sich ganz schön in den Schiffsrumpf hineingefressen. Das war gar nicht mal so leicht, meine Cezanne davon zu befreien“, dachte Robert. Als er seinen Blick zum Steg hinüberschweifen ließ, sah er, dass der Junge seinen Blick von seiner Yacht nicht abgewandt hatte. Als sich jetzt ihre Blicke trafen, schaute der Junge rasch auf das Wasser. In den Blicken jedoch, die Hurst in einem unbeobachteten Moment eingefangen hatte, vermeinte er, die vollkommene Sehnsucht nach Erlebnissen fernab der Heimat ausgemacht zu haben.
„Guten Tag, Sir“, sagte Hurst und nahm dabei offensichtlich gespielt eine förmlich militärische Haltung ein. „Mein Name ist Robert Hurst, ich bin Kunsthändler hier in der Stadt und Kapitän dieser Yacht. Hast Du nicht Lust, auf meinem Schiff anzuheuern?“
Die Augen des Jungen weiteten sich merklich – ebenso sein Mund. Nach einigen Wimpernschlägen stotterte er:
„Aye, aye (hier fiel sein Stottern noch nicht auf) Sir! Mm – ma – mein Name ist Ke – Kevin Miller. Ich bin in der 6. Klasse der Agatha-Christie-Schule und wü – wür – würde nichts lieber tun als auf der Cezanne anzuheuern. Wie hoch ist denn die Heu – Heuer und was muss ich denn machen?“, fragte Kevin interessiert.
„Na, Du scheinst ja genau zu wissen, worauf es ankommt, Leichtmatrose Kevin. Kaufst wohl nicht gern die Katze im Sack, wie? Und ich sage Dir was: das ist vollkommen richtig! Bevor man die Bedingungen nicht kennt, sollte man besser noch keine Zusagen machen. Aber ich sag` Dir die Bedingungen ohne Umschweife: 3 Pfund die Stunde – bei freier Kost und Logis“.
„Das klingt nicht übel. Wann stechen wir in See, Kapitän?“
Hurst war ganz überrascht von der Entwicklung dieses Gesprächs und den Wortschatz des Jungen, der auf eine Liebe zum geschriebenen und gesprochenen Wort schließen ließ. Aber da sie schon einmal so weit gekommen waren, wollte er auch keinen Rückzieher machen. Ganz im Gegenteil! Jetzt war er ganz gespannt, wie dieses Gespräch wohl weiter gehen würde.
„Hast Du denn überhaupt schon einmal irgendwo angeheuert, kleiner Matrose?“, wollte er wissen.
„Nee – ähm – ich meine: Nein, Sir. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal“, stellte Kevin überzeugend fest.
Robert schmunzelte - und Kevin auch, als er die Reaktion bei Robert mitbekam.
„Ich würde gern mal mit auf große Fahrt gehen – eine kleine Fahrt würde mir aber auch schon reichen
„Heute und morgen habe ich Schiffspflege angesetzt. Die nächste Fahrt ist erst für Sonnabend geplant. Wenn Du mit willst: Wir legen morgens um 8 Uhr ab“.
„Na klar – ähm – ich meine: Aye, Sir, ich bin dabei! Ich muss natürlich noch meine Mutter fragen. Aber ich denke schon, dass sie nichts dagegen hat“.
„Na dann bis Sonnabend! Ich werde mich jetzt mal wieder meiner Arbeit widmen“.
„Kann ich Ihnen vielleicht ein bisschen mithelfen? Ich bin auch ein guter Taucher!“
Robert stutzte für einen Augenblick angetan.
„Warum eigentlich nicht? Schließlich hast Du ja angeheuert und gehörst quasi zur Besatzung. Da kann man ja auch als junges Crewmitglied schon mal einen kleinen Schlag ran hauen. Na dann komm` mal an Bord, Leichtmatrose! Die Heuerzusage von eben hat selbstverständlich noch Bestand“.
„Ja prima, da wird meine Mutter aber Augen machen und mächtig stolz auf mich sein, wenn ich ihr meine erste Heuer auf den Küchentisch lege. Meine Mutter und ich leben nämlich allein und wir haben nicht so viel Geld, müssen Sie wissen. Was soll ich denn machen?“
„Was hältst Du davon, wenn ich Dir erst mal die Cezanne zeige? Ich finde, wenn man auf einem Schiff arbeitet, geht einem die Arbeit umso leichter von der Hand, je mehr man sich mit ihm angefreundet hat“.
Ein Strahlen huschte über Kevins Gesicht. Im nächsten Augenblick war er auch schon auf das Schiff geklettert.
„Ehrlich gesagt, war ich noch nie auf einer Segelyacht. Solche tollen Schiffe habe ich von innen bisher nur mal in Büchern gesehen. Was heißt eigentlich „Sesam“?“
„Cezanne wird es ausgesprochen. Da ich beruflich etwas mit Kunst zu tun habe und meinen Beruf sehr liebe, habe ich mein Schiff naheliegender Weise nach einem Maler benannt, dessen Bilder und dessen persönliche Geschichte ich sehr mag. Paul Cezanne lebte im 19. Jahrhundert in Frankreich und brach gegen den Widerstand seines Vaters sein Jurastudium ab. Die Malerei hat er sich selbst angeeignet. Das war nur möglich, weil ein großes Talent in ihm schlummerte, was er wohl gespürt haben muss. Von ersten Misserfolgen hat er sich nicht abschrecken lassen und hat seinen Stil vervollkommnet. Er hatte auf diese Weise eine neue Art zu malen begründet, die sich durch ganz außergewöhnliche Farben, Formen und Helligkeitswerte ausgezeichnet und dadurch von den Werken seiner Zeitgenossen und Vorgänger deutlich abgehoben hat. Damals hätte keiner für möglich gehalten – vor allem keiner seiner schärfsten Neider, dass man fast 200 Jahre später nur noch ihn – Paul Cezanne – ihn Erinnerung behalten würde und keinen seiner Kollegen, die damals immerhin einen gewissen örtlichen Ruhm für sich in Anspruch nehmen konnten. Aber so ist es oft im Leben: Hat irgendein Mensch, der auf einem bestimmten Gebiet noch gänzlich unbekannt ist, eine bestimmte Lösung für ein Problem oder eine neue Gestaltungsidee, dann wird dieses Werk des Neuen von den Alten angegriffen in der Hoffnung, dass der Neue die Segel streicht und die Neutralen den Bluff nicht durchschauen. So weit zu dem Namensgeber meines Schiffes. Auch ich musste mich im Leben – wie Cezanne – insbesondere im beruflichen Bereich gegenüber vielen Widerständen behaupten und so drängte sich der Name „Cezanne“ geradezu auf. Du sagst, Du hättest noch nie ein Segelschiff von innen gesehen? Na, dann wird`s ja höchste Zeit! Wo lebst Du denn eigentlich, Leichtmatrose Kevin?“
„Ich wohne mit meiner Mutter da hinten“ – er zeigte mit dem ausgestreckten Arm Richtung Kalkfelsen und Hopes Nose – „in einer kleinen Kate auf einer Wiese, zusammen mit Schafen und toll duftenden Blumen“.
„Dein Vater wohnt nicht dort?“
„Nein, leider nicht“, sagte Kevin bedrückt und schaute dabei nach unten. „Mama und ich wissen nicht, wo er ist. Er ist schon ganz lange weg“.
„Dann hat er Dich auch nicht verdient“, sagte Robert entschlossen und in einem warmherzigen Ton; er ließ es sich jedoch nicht anmerken, dass ihn diese letzte Mitteilung von Kevin tief im Herzen berührte. Er konnte emotional nicht nachvollziehen, wie man einen so tollen Jungen wie Kevin – überhaupt Kinder - im Stich lassen konnte. Gibt es denn etwas Schöneres als mitzuerleben, wie das eigene Kind aufwächst, zunächst vieles auf lustige Art und Weise daneben geht, dann aber allmählich Fortschritte macht und immer mehr dazulernt? Gibt es etwas Schöneres als die Liebe des eigenen Kindes zu erfahren und ganz deutlich zu spüren, dass das eigene Herz voll der Liebe für das Kind ist? Um welchen Preis mag der Vater von Kevin auf all diese Dinge verzichtet haben? War es eine andere Frau und die Angst, durch Unterhaltsforderungen diese andere Frau nicht halten zu können? War diese Frau das wert? Er kannte die Frau nicht – wenn sie der Grund gewesen sein sollte. Er kannte aber Kevin jetzt ein bisschen – wenn auch erst seit eben – und er spürte in diesem Augenblick ganz deutlich, dass keine Frau der Welt berechtigt war, Kevin den Vater zu entziehen und es wahrscheinlich keine Frau der Welt wert war, ihr zuliebe auf die Liebe Kevins und zu Kevin zu verzichten. Wie hielt der leibliche Vater diesen emotionalen Druck nur aus? Fragte er sich nicht, was sein kleiner Sohn wohl mache, wie es ihm gehe, wie er wohl aussehe, wie er lache, wie es sei, wenn er mit Freunden spiele, wie er sich in der Schule mache und: ob sein Sohn wohl über ihn nachdenke, traurig sei, dass er augenscheinlich kein Interesse an ihm habe? Wenn der Vater ein Herz hatte, sich solche Fragen stellte und es schaffte, nicht den Kontakt zu seinem Sohn zu suchen, musste er zwangsläufig bereits depressiv abgetaucht sein. Wie schade um Vater und Sohn! Wie würde es wohl sein, wenn Vater und Sohn sich irgendwann begegneten? Würden sie sich die Hand geben und sagen: „Guten Tag, ich bin Dein Vater! Wie geht`s?“ Oder würden sie gar nichts sagen und sich freudetrunken-selig in die Arme fallen und sich minutenlang nur festhalten und spüren? Würden sie ohne emotionale Regung aneinander vorbeigehen oder würde es heftige Vorwürfe seitens des Sohnes geben? Robert wunderte sich, dass er, der ja keine Kinder hatte, sich so intensiv in eine Vater-Kind-Beziehung hineintasten konnte.
„So, jetzt wollen wir mal in die Unterwelt der Cezanne hinabtauchen und sehen, was es hier alles zu entdecken gibt!“
Sie stiegen die steile Holztreppe hinunter. Kevin interessierte sich offenbar besonders für Augenschmankerl wie kleine Lamellen-Mahagoni-Hängeschränkchen mit Bullaugen, Glasenuhren, Hygrometer, Tiedenuhren, Barometer und andere Messinginstrumente, Fischernetze und Schiffstaue, die geschmackvoll so manchen Winkel der Cezanne zierten. Kevin hatte Mühe, seinen Blick von diesen Kostbarkeiten ab- und den nächsten zuzuwenden, geradeso, als wollte er sich jedes Detail ganz genau einprägen und ein Gefühl für das Objekt der Betrachtung zu entwickeln. Diese Dinge schienen für Kevin der Inbegriff der angenehmen Seite des sonst so rauen Seemannslebens zu sein.
Robert fiel jetzt auf, dass der Junge immer, wenn er wieder ein paar Schritte zum nächsten Objekt seines Interesses machte, sein linkes Bein nicht so bewegte wie das andere. Kevin hatte den stutzenden Seitenblick von Robert aufgenommen und erklärte: „Ich bin mal als kleiner Junge überfahren worden - und der Fahrer ist einfach weitergefahren“.
Robert zögerte sichtlich berührt – nunmehr zum zweiten Male – bevor er erwiderte:
„Manche Menschen verhalten sich in bestimmten Situationen so, dass man kaum glauben kann, dass man es mit zivilisierten Menschen zu tun hat. Aber auch wenn wir wissen, dass Menschen sich manchmal so verhalten, werden wir uns kaum daran gewöhnen können. Und das ist gut so! Wieso konnte man den Täter eigentlich nicht ermitteln?“
„Es geschah auf der einsamen Ilsham Marine Drive hinter den Kalkfelsen. Das Auto hat mich von hinten erfasst, durch die Luft geschleudert und irgendwie bin ich irgendwo gelandet. Tja, so ist das mit meinem Bein passiert“.
„So eine Gemeinheit!“, schimpfte Robert. Solchen Menschen sollte man für den Rest ihres Lebens täglich zwei Stunden lang mit der neunschwänzigen Katze beackern und dreimal Kiel holen. Was meinst Du? Was würdest Du mit dem Täter machen, wenn er Dir über den Weg laufen würde?“
„Ich hab` mir das schon oft in meiner Fantasie ausgemalt, was ich alles machen würde. Ehrlich gesagt, trau` ich mich gar nicht, Ihnen das zu sagen – so schlimm ist das!“
„Das glaube ich gern. Das würde mir genauso gehen!“
„Wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden Fußball spiele, kann ich nur ins Tor. Dabei würde ich viel lieber Tore schießen!“
„Ich glaube, wenn mir ein solches Unrecht passiert wäre, würden meine Rachefantasien auch durchgehen wie ein aufgescheuchtes Wildpferd“.
„Dann brauche ich also kein schlechtes Gewissen zu haben?“, fragte der Junge.
„Nein, ganz bestimmt nicht. Es ist durchaus menschlich, dass man dem Menschen weh tun will, der einem auch ein Leid zugefügt hat – insbesondere, wenn er sich ohne Entschuldigung aus dem Staub macht, ohne sich um den Verletzten zu kümmern“.
Fischernetze, starke Taue als Handlauf, die von starken o-förmigen Ringen aus Messing gehalten wurden, Bilder von Segelschiffen auf hoher See und in fernen Häfen zierten den Treppenaufgang, den sie jetzt über das Deck verließen.
„Na, was hältst Du von der Cezanne?“
Kevins Augen strahlten, als er sagte: „Die Cezanne ist `ne Wucht! Und hat so viele schöne Sachen! - die bestimmt mit sehr viel Liebe gemacht und eingebaut worden sind. Bestimmt ist das auch alles sündhaft teuer! Ich träume schon lange davon, später, wenn ich ordentlich was gelernt und viel Geld gespart hab`, auch einmal ein so tolles Schiff wie die Cezanne zu haben. Ich würde dann alles verkaufen, was ich habe und nur noch auf dem Schiff leben“.
Robert schmunzelte dabei und dachte dabei an mich.
„Natürlich würde ich zum Arbeiten mein Schiff verlassen müssen. Das ist ja mal klar“.
Ich hatte die letzten Sätze der Unterhaltung der beiden mitgehört und enterte nun die Cezanne, die Nachbarin meiner Esperanza, allerdings ohne den vorschriftsmäßigen Enterhaken.
„Guten Morgen, Robert. Na, bist Du gerade in ernsthaften Verhandlungen mit dem Klabautermann – mit dem Ziel, ihn gnädig für die nächste Kaperfahrt zu stimmen?“, fragte ich gut gelaunt und geistig noch frisch und aufgeräumt.
„Du hast gelauscht, Du alter Seewolf! Das ist ja nun nicht gerade die feine englische Art“, lachte Robert und schlug mir dabei freundschaftlich und herzlich, aber kräftig – wie es bei den meisten Männern usus ist, weil sie eine subtilere Art des Ausdrucks von Zuneigung gegenüber Personen des gleichen Geschlechts nicht gelernt hatten – auf die Schultern. Er strahlte dabei so, dass Mundwinkel und Ohrenansatz ineinander überzugehen schienen – während ich mich vor Schmerzen krümmte – natürlich nur innerlich: Denn auch ich hatte eine semi-indianische Ausbildung dergestalt genossen, dass einem Indianer Schmerzen fremd zu sein haben. Also strahlte ich ins selbe Horn – mein alter Deutschlehrer pflegte derartige Stilblüten stets mit einem roten Kreuzfehler am Seitenrand zu quittieren – und sagte nur knapp:
„Ich muss mir ja wohl als Gastarbeiter über die feine englische Art keine ernsthaften Gedanken machen, oder?“
„Da hast Du allerdings Recht, mein Freund und Kupferstecher Sauerkraut. Kevin“, sagte Robert zu dem Jungen gewandt: „Das ist mein bester Freund Danilo Baltius aus Bremen in Deutschland. Er ist zwar ohne festen Wohnsitz, aber trotzdem ist er halbwegs zivilisiert“, freute sich Robert über seine scheinbar gelungene Formulierung.
„Wieso bin ich ohne festen Wohnsitz?“
„Na, weil Du auf einem mehr oder weniger schwankenden Schiff hin und her schwankst, Du Ameisenbär! Kann man unter solchen Umständen mit Fug und Recht behaupten, man könne einen festen Wohnsitz vorweisen?“
Robert strahlte immer noch – und ich wieder! Ich hatte nun endlich seinen Scherz begriffen. Von Natur aus bin und bleibe ich nun mal ein Spätzünder!
„Aber, nun mal im Ernst, Dany. Der Klabautermann ist kein Klabautermann, sondern hat soeben bei mir angeheuert und heißt Kevin Miller“.
„Aha, freut mich, ein neues Crewmitglied auf dem Schiff meines Freundes kennen zu lernen“. Ich ergriff die Hand des Jungen zum Gruß, schaute ihm dabei in die Augen und erblickte darin eine große Sehnsucht – wonach, sollte ich erst später erfahren.