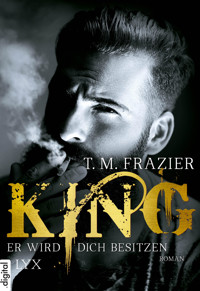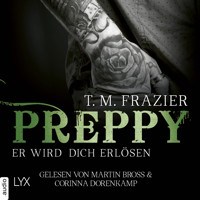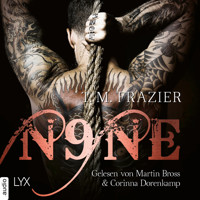9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Outskirts
- Sprache: Deutsch
Sie wusste nicht, dass so etwas wie Liebe tatsächlich existiert. Doch dann traf sie ihn
Ein alter Camper und ein Stück Land im Nirgendwo von Florida ist alles, was Sawyer Dixon nach dem Tod ihrer Mutter geblieben ist. Weit weg von ihrer Vergangenheit will sie einen Neuanfang wagen. Doch sie hat nicht mit ihrem Nachbarn Finn gerechnet. Der gut aussehende Einzelgänger ist wenig begeistert davon, dass Sawyer vor seiner Haustür campt - und Gefühle in ihm weckt, die er seit Jahren tief in seinem Herzen verschlossen hält!
"Unberechenbar, rau, bewegend und unglaublich fesselnd!" USA TODAY
Band 1 der OUTSKIRTS-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin T. M. Frazier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungZitatProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. Kapitel32. Kapitel33. Kapitel34. Kapitel35. Kapitel36. Kapitel37. Kapitel38. Kapitel39. Kapitel40. Kapitel41. Kapitel42. KapitelDie AutorinWeitere Romane von T. M. Frazier bei LYXImpressumT. M. FRAZIER
Wild Hearts
Kein Blick zurück
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anja Mehrmann
Zu diesem Buch
Ein kleiner Wohnwagen und ein Stück Land im Nirgendwo von Florida ist alles, was Sawyer Dixon nach dem Tod ihrer Mutter geblieben ist. Sie bricht auf ins Ungewisse und will Tausende Kilometer von ihrem alten Leben entfernt einen Neuanfang wagen. Doch der gestaltet sich schwieriger als gedacht: Auf den letzten Metern gibt nicht nur ihr Auto den Geist auf, ihr Grundstück ist auch noch völlig unbewohnbar. Sawyer campt kurzerhand auf dem angrenzenden Gelände, doch sie hat nicht mit Finn Hollis gerechnet, dem Besitzer des Nachbargrundstücks. Der verschlossene (und furchtbar attraktive) Einzelgänger ist wenig begeistert davon, dass Sawyer direkt vor seiner Haustür wohnt, schließlich hält er seit Jahren sehr erfolgreich all seine Mitmenschen auf Abstand. Er gibt Sawyer mehr als deutlich zu verstehen, dass sie so schnell wie möglich wieder verschwinden soll! Doch wenn Sawyer sich eins geschworen hat, dann, dass sie für ihr Glück kämpfen wird – auch wenn das bedeutet, herauszufinden, was sich hinter den Gefühlen verbirgt, die Finn bei jeder Begegnung in ihr hervorruft …
Für
Logan & Charley
Furcht und Liebe ähneln einander sehr.
Beide lassen dein Herz rasen und deinen Körper zittern.
Sie lassen dich beben vor Erwartung.
Verzehrende Gedanken bringen dich zur Verzweiflung.
Die Furcht anzunehmen ist dasselbe, wie die Liebe anzunehmen.
Es tut weh.
Es hört irgendwann auf.
Alles ist verloren.
Und alles lässt sich wiederfinden.
PROLOG
FINN
Die Geräusche um dich herum verraten viel über dein Leben. Es ist verdammt beängstigend, wie schnell sie sich verändern können, ohne jede Vorwarnung.
Heute sind es die Schreie der jubelnden Menge beim Spiel der lokalen Mannschaft. Das Klirren von Bierflaschen. Das erotische Lachen einer Frau.
Morgen ist es das Geräusch eines Radios, das hastig ausgeschaltet wird.
Keuchen.
Schreie, auf die das Schlimmste überhaupt folgt.
Stille.
Wenn du gut aufpasst, kannst du noch mehr hören. Ein Geräusch, so unverwechselbar, dass man es nicht für etwas anderes halten kann, als es tatsächlich ist.
Das Geräusch deines eigenen Herzens, das bricht.
1. KAPITEL
SAWYER
Ich habe nicht geweint.
Keine einzige Träne.
Was für eine Sorte Mensch muss man sein, um beim Begräbnis der eigenen Mutter nicht zu weinen?
Ich habe keine Ahnung, warum ich mir diese Frage überhaupt stellte, denn die Antwort lag auf der Hand.
Ich hatte keine Tränen mehr.
Genau wie meine Mutter.
Stattdessen dachte ich ununterbrochen daran, wie sehr Mutter diesen Gottesdienst gehasst hätte. Die Männer saßen vorn, während die Frauen hinten standen, wie es in unserer Kirche eben Brauch war.
Alle waren schwarz gekleidet.
Mutter hasste Schwarz.
»Die Familie ist der Grund, warum Gott uns auf die Erde gesandt hat. Die Familie kann uns aufbauen oder in den Abgrund ziehen. Es ist ein trauriger Tag, wenn wir ein Mitglied unserer Gemeinschaft verlieren. Eine Mutter. Eine Ehefrau. Eines von Gottes treu ergebenen Kindern«, predigte Reverend Desmond.
Sooft er meiner Mutter im Lauf der Jahre auch begegnet war – er wusste nichts über sie. Was durchaus Sinn ergab, denn er hatte nie mit ihr gesprochen. Vater war der, der redete, wenn es um die Belange unserer »Familie« ging, während Mutter und ich hinter ihm standen, gehorsam mit gesenktem Kopf und gefalteten Händen, die Augen auf den Boden gerichtet.
Und weil er meine Mutter nicht kannte, war die Predigt des Reverends bestenfalls nichtssagend.
Kalt.
Keinerlei persönliche Details.
Was er sagte, war, dass meine Mutter sich nun an dem Ort befand, der ihr schon immer bestimmt gewesen war: sicher und glücklich in den Armen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus.
Ich brach in unkontrollierbares Gelächter aus, und als die Köpfe der Gemeindemitglieder zu mir herumfuhren, tat ich so, als schluchzte ich vor Kummer. Was zwar besser als Lachen, aber dennoch inakzeptabel war.
Ohne auch nur aufzublicken, spürte ich die Wut meines Vaters, der in der ersten Reihe saß, aber ich hatte den Lachanfall nicht unterdrücken können. Diese Scheinheiligkeit war einfach zum Schreien komisch.
Sicher in den Armen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus?
Die Church of God’s Light glaubte daran, dass Selbstmord eine Fahrkarte in die Hölle war. Klar, alle taten, als wäre es ein Unfall gewesen, aber ich wusste es besser.
Mutter war nicht zufällig überfahren worden.
An jenem Tag war sie wissentlich und vorsätzlich vor die fahrenden Autos gelaufen.
Mein Vater wusste das entweder nicht oder es war ihm egal oder er leugnete einfach die Möglichkeit, dass es kein Unfall gewesen sein könnte. Aber das überraschte mich nicht. Er glaubte immer nur das, was er glauben wollte, und von den anderen erwartete er, dass sie es ebenfalls glaubten. Selbst wenn es sich um Lügen handelte.
Auch wenn diese Lügen ihn selbst betrafen.
Wie die, dass er ein aufrechter Bürger war.
Eine Führungspersönlichkeit der Kirche.
Ein hingebungsvoller, liebender Ehemann und Vater.
Ein Mann Gottes.
Vater spielte seine Rolle gut. Mit gesenktem Kopf saß er da und gab überzeugend den gramgebeugten Witwer. Während er tatsächlich nur versuchte, nicht einzuschlafen, nachdem er am Morgen eine Whiskeyflasche geöffnet und fast ausgetrunken hatte.
»Sie war eine fügsame Frau …«, fuhr der Reverend in seiner Predigt der Halbwahrheiten fort.
Fügsam? Mehr fiel ihm nicht zu ihr ein? Sie war fügsam?
Bei seinen Worten wurde mir schwindelig.
Tatsächlich war meine Mutter, Caroline Dixon, ein Mensch, der nur selten lächelte. Sie lebte in einem Haus, in dem permanent die Angst regierte. Sie verließ es nur selten. Sie entschuldigte sich sehr oft. Wenn jemand darüber Buch geführt hätte, wäre »Es tut mir leid« der meistgesagte Satz ihres Lebens gewesen, und auch diese Worte hatte sie stets kaum hörbar und mit gesenktem Kopf geflüstert.
Eine Erkenntnis traf mich so heftig, dass es sich anfühlte, als hätte mir jemand ein Knie in den Magen gerammt. Ich krümmte mich und taumelte zurück, murmelte den Frauen, die ich anstieß, eine Entschuldigung zu, sodass sie hoffentlich glaubten, ich hätte eine Art Anfall, weil der Kummer mich überwältigt hatte.
Vater spähte über die Schulter, und obwohl er auf alle anderen mitfühlend wirkte, als er mir ein trauriges Lächeln zuwarf, wusste ich es besser und erkannte die Wut, die sich hinter seinen kalten Augen zusammenbraute. Auf keinen Fall würden meine Gefühlsausbrüche ungestraft bleiben.
Langsam wich ich weiter zurück, bis ich dem Zelt und damit der Menge entkommen war. Ich ließ mich auf den Boden fallen, landete mit dem Rücken im Gras, mein Scheitel berührte einen glänzenden Grabstein aus Granit.
Die Offenbarung, die ich gerade erlebte, würde sich als der Gedanke herausstellen, der tausend Schiffe in Bewegung setzte. Ich war nicht die schöne Helena, aber an jenem Tag veränderte sich mein Leben für immer; ich schlug einen Weg ein, von dem es keine Wiederkehr gab.
Wenn ich genauso weiterlebte wie bisher. So, wie meine Mutter gelebt hatte. Unterwürfig und gefügig. Missbraucht. Misshandelt. Dann würde diese Predigt mit genau den gleichen nichtssagenden Worten und Lügen über ein Leben, das nie gelebt worden war, eines Tages bei einer anderen Beerdigung gehalten werden.
Bei meiner eigenen.
2. KAPITEL
SAWYER
Ruhelos war die Untertreibung des Jahrhunderts.
Mein rechtes Knie wippte so schnell auf und ab, dass der dunkle Jeansrock nur noch ein verschwommener Fleck war. Ich saß auf dem Bettrand und klopfte so heftig mit der Ferse auf den Boden, dass ich ein Loch in den Boden stampfen und ins Erdgeschoss stürzen würde, wenn ich lange genug so weitermachte, dessen war ich mir sicher.
Ruhelosigkeit war in diesem Haus verboten.
Genauso wie Kleidungsstücke strengstens verboten waren, die mehr als eine Fessel oder einen Ellbogen entblößten, und Handys oder Internetanschlüsse, die für etwas anderes benutzt wurden als für Zwecke, die er im Voraus genehmigt hatte.
Mutters Beerdigung lag einige Stunden zurück. Vater nahm an der Versammlung nach dem Gottesdienst teil, zu der nur Männer zugelassen waren.
Ich betrachtete mich in dem kleinen Spiegel über meiner Kommode. Meine Haare waren zwar braun mit einem Stich ins Rötliche, während die Haare meiner Mutter von einem sonnigen Blond gewesen waren, aber trotz der fiesen Ansammlung von Sommersprossen auf meinem Nasenrücken ließ sich nicht leugnen, dass es ihr Gesicht war, das mich aus dem Spiegel anblickte.
Dann betrachtete ich meine Hände. Ich drehte sie um und untersuchte sie genau von beiden Seiten.
Es waren auch ihre Hände.
Und da die Stille der Feind war, stand ich auf und lief in meinem engen, spärlich eingerichteten Zimmer auf und ab. Das einzige Bild an der weißen Wand war ein kleines Gemälde der Jungfrau Maria, die das Jesuskind auf dem Arm hielt.
Mein Vater hatte mir empfohlen, meinen Kummer durch Gebete zu heilen, und falls das nicht funktionierte, sollte ich es auf die altmodische Tour mit harter Arbeit versuchen.
Mit Putzen zum Beispiel.
Putzen.
Um über den Tod meiner Mutter hinwegzukommen, hatte er mir tatsächlich geraten, ich sollte … putzen.
Dieser Ratschlag war das Problem. Nicht mein Kummer. Mein Vater ahnte nicht, dass die Trauer mich bislang verschont hatte. Ich fühlte mich betäubt. Frustriert. Wütend. Aber die Trauer ließ sich Zeit, und ich hatte beschlossen, das Licht auszuschalten, anstatt wach zu bleiben und auf ihre Ankunft zu warten.
Ich tigerte in meinem Zimmer auf und ab und stieß dabei einen Stifthalter um, der auf meinem Schreibtisch gestanden hatte, also ging ich auf die Knie und sammelte die Stifte ein. Als ich unter dem Bett nach einem Stift tastete, der daruntergerollt war, streifte meine Hand etwas Hartes.
Bei näherem Hinsehen entpuppte sich der Gegenstand als ein Karton.
Ein Karton, den ich dort nicht hingestellt hatte.
Ich zog das Ding unter dem Bett hervor, setzte mich und stellte ihn auf meinen Schoß. Es war ein abgewetzter Schuhkarton. Verblasstes Rosa mit weißer Schrift. Ein dicker Umschlag, einer von der Art, in der man große Dokumente verschickt, klebte im Deckel, und darauf hatte meine Mutter, offenbar in Eile, meinen Namen gekritzelt.
Das erste Blatt auf dem dicken Stapel, den ich aus dem Umschlag zog, war ein Brief. Während ich ihn leise las, hörte ich die Stimme meiner Mutter.
Sawyer,
mein wunderschönes Mädchen, es gibt so vieles, was ich Dir gern noch gesagt hätte.
Aus Dir wird irgendwie trotz allem eine freundliche, kluge und fähige junge Frau werden. Du hast der Welt so viel zu geben – viel mehr als Du weißt.
Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es zwei Arten von Menschen gibt: die schwachen und die starken. Wirklich starke Menschen versuchen, andere aufzurichten, damit die sich ebenso stark fühlen. Schwache Menschen tun hingegen alles, damit andere sich ebenso hilflos vorkommen wie sie selbst. Umgib Dich mit starken Menschen, Sawyer.
Verlieb Dich in jemanden, der stark ist.
Verbring Dein Leben mit jemandem, der Dir hilft, dem Sturm zu trotzen, anstatt Dich davor zu verstecken.
Ich werde mir niemals verzeihen, dass ich Dir nicht das Leben bieten konnte, das Du verdienst, aber Du sollst wissen, dass ich Dich von ganzem Herzen geliebt habe, und am Ende warst Du es und nur Du, an die ich gedacht habe. Du bist das größte Geschenk, das ich je bekommen habe. Lass nur die Menschen in Dein Leben, die das genauso sehen.
Ich hoffe, dass der Inhalt dieses Kartons Dir helfen wird, mich besser kennenzulernen und dabei vielleicht gleichzeitig auch etwas über Dich selbst zu erfahren. Nimm meine Geheimnisse, und mach sie Dir zu eigen.
Ich liebe Dich, mein süßes, hinreißendes Mädchen, und ich werde Dich immer lieben, bis in alle Ewigkeit.
Du hast jede Sekunde an jedem unerträglichen Tag auf dieser Erde lebenswert gemacht.
Es tut mir schrecklich leid.
Deine Mutter
Jede andere Frau, die einen Brief von ihrer gerade verstorbenen Mutter las, wäre vermutlich in Tränen ausgebrochen, aber ich war zu verwirrt.
Zu zornig.
Wie konnte sie es wagen, Tapferkeit von mir zu verlangen! Wie konnte sie es wagen, mir einen Brief zu schreiben, anstatt lange genug am Leben zu bleiben, um mir all das persönlich zu sagen!
Ich legte den Brief zur Seite.
Der Schuhkarton selbst war mit verschiedenen Aufklebern und Kritzeleien wie Is mit herzförmigem Punkt und Os mit Smiley-Gesicht bedeckt.
»Was hattest du nur vor, Mom?«, fragte ich mich laut. Diese Frage wurde noch drängender, als ich ein Polaroidfoto von einem rostigen alten Pick-up entdeckte, der einen kleinen Wohnwagen zog. Soweit ich wusste, hatte meine Mutter nicht mal einen Führerschein. Nie zuvor hatte ich sie hinter dem Lenkrad gesehen.
Rusty und Blue, 1995, stand in verblichener schwarzer Tinte und in ihrer Handschrift darunter.
In dem Karton lag ein Schlüsselanhänger mit mehreren Schlüsseln in verschiedenen Farben und Größen, dazu ein weiterer Brief von meiner Mutter.
Du findest Rusty und Blue bei Storage Queen, Lagereinheit #23. Behandle sie gut.
Darüber hinaus lag in dem Karton eine zarte goldene Halskette mit einem Anhänger in Form einer Sonnenblume. Schmuck, der keinem religiösen Zweck diente, war streng verboten. Wie lange hatte Mutter diese Kette besessen, und wie um alles in der Welt hatte sie ein Schmuckstück und eine Lagereinheit voller Fahrzeuge vor meinem Vater geheim halten können?
Und vor mir?
Ich stellte den Karton ab und schob den Brief von dem Stapel hinunter, sodass das Dokument darunter zum Vorschein kam und damit ein weiteres sorgsam gehütetes Geheimnis.
Es war eine notarielle Urkunde, die mir, der Verwalterin, ein Stück Land in einer Stadt namens Outskirts überließ.
Outskirts?
Mutter hatte den Namen nie erwähnt, daran hätte ich mich erinnert. Sie war auch niemals allein irgendwohin gefahren, und wenn sie reiste, dann nur mit meinem Vater im Sommer anlässlich der Zeltgottesdienste.
So viele Fragen ich auch hatte, mir blieb keine Zeit zum Nachdenken, denn vor meinem Fenster leuchteten die Scheinwerfer eines Wagens auf, der in die Auffahrt einbog. Ich schob die Papiere wieder in den Umschlag und den Karton unter mein Bett zurück.
Ich rannte die Treppe hinunter, gerade rechtzeitig, um dem alltäglichen Hassblick meines Vaters zu begegnen, der durch die Tür hereinkam, die die Garage mit der Waschküche verband.
Schweigend huschte ich an ihm vorbei in die Küche, den Blick auf den Boden gerichtet. Seine schweren Schritte folgten mir dichtauf.
Ich hielt mich beschäftigt, indem ich das Abendessen für ihn zubereitete, während Vater den Kühlschrank öffnete, um ein Bier herauszunehmen, sich dann aber dagegen entschied, die Tür wieder zuknallte und stattdessen eine Flasche Wild Turkey aus der Vitrine holte.
Ein Abend mit Whiskey war niemals ein guter Abend.
Ich roch den Alkohol, noch ehe er die Flasche öffnete, denn wie üblich hatte er bereits getrunken.
Wann hat er denn mal nicht getrunken? Die Worte, die meine Mutter mir wenige Wochen zuvor zugeflüstert hatte, gingen mir durch den Kopf.
Bei der Erinnerung musste ich, ohne es zu merken, laut gelacht haben.
»Was genau ist denn so lustig?«, schnauzte Vater und füllte sein Glas mehr als zur Hälfte mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit.
»Nichts, Sir«, antwortete ich mit der Routine lebenslang geübter falscher Höflichkeit. Ich holte ein Huhn aus der Gefriertruhe und ein paar Kartoffeln aus dem Kühlschrank. »Ich war gerade dabei, meine Gebete zu beenden.«
»Beten sollst du, wenn du vor Gott kniest, nicht in der Küche!«, schimpfte er und legte einen dicken Umschlag von der Bank auf die Küchentheke, ehe er in das Wohnzimmer nebenan ging. »Du musst das Geld gleich morgen früh für mich zur Bank bringen.«
»Ja, Sir.« Eine Idee, die in meinem Geist nach und nach Gestalt angenommen hatte, erschien mir nun immer sinnvoller. Eine Idee, die mir zum ersten Mal auf der Beerdigung meiner Mutter gekommen war und dann noch einmal, als ich den Karton oben in meinem Zimmer entdeckt hatte. Nun starrte ich auf den Umschlag auf der Theke, und der Gedanke kroch mir mitten ins Hirn und ließ sich nicht mehr daraus vertreiben. Jetzt hatte ich mehr als nur eine Idee.
Ich hatte einen Plan.
Vater knallte sein Glas auf den Tisch, und mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ich versuchte, mit den Vorbereitungen für das Abendessen weiterzumachen und die Wut zu ignorieren, die ihn umgab wie eine Wolke, als er den Sessel zurückschob und wieder in die Küche gestapft kam, aber es war unmöglich, ihn nicht zu beachten, sobald er diesen Blick bekam. Vor dem, was jetzt folgen würde, gab es kein Entkommen.
Egal, was ich sagte.
Egal, was ich tat oder nicht tat.
Es war immer dasselbe.
»Ich habe deinen Ausbruch von vorhin nicht vergessen. In der Öffentlichkeit hast du zu schweigen, es sei denn, du wirst angesprochen. Dass deine Mutter nicht mehr da ist, ändert nichts an den Regeln. Nicht an meinen und nicht an Gottes Regeln.« Vater stand hinter mir, und ich hörte das Geräusch, das ich hasste wie kein anderes auf dieser Welt. Seine Gürtelschnalle klirrte, als er sie durch die Schlaufen zog. Er ließ den Ledergürtel durch die Luft schnalzen, ein Vorgeschmack auf das, was kommen würde. Ich beugte mich über die Küchentheke und stützte die Arme darauf, wie ich es schon tausend Mal zuvor getan hatte.
»Der Herr duldet diese Art von Aufsässigkeit nicht, und ich dulde sie auch nicht«, stieß er hervor und ließ den Gürtel auf meinen unteren Rücken knallen. Der Schlag fühlte sich zuerst wie ein Stich an und verwandelte sich dann in ein lang anhaltendes Brennen, das immer heißer wurde, während er seinen Zorn auf die Welt an mir ausließ, Schlag für Schlag.
Glücklicherweise war ich gar nicht da.
Nach dem ersten Hieb empfand ich keinen Schmerz mehr. Mein Geist wanderte zu dem Brief meiner Mutter. Zu den Schlüsseln. Zu der Urkunde für ein Stück Land, von dem ich nicht gewusst hatte, dass sie es besaß und mir hinterlassen hatte.
Ich ertappte mich dabei, dass ich unter Schmerzen lächelte.
Ein letztes Mal schlug Vater zu, dann versetzte er mir einen Stoß gegen die Schulter, und ich landete auf Händen und Knien auf den Fliesen vor der Vitrine.
»In zwanzig Minuten steht das Essen auf dem Tisch«, sagte er wie ein König, der seinem Diener einen Befehl erteilt. Er warf den Gürtel auf den Boden. »Heb das auf.«
Er stapfte zurück ins Wohnzimmer, erfüllt von der kranken Befriedigung, die es ihm bereitete, mich zu maßregeln. Sooft ich auch gehört hatte, Gott gefalle es, wenn Frauen häufig gezüchtigt werden – ich hatte nie daran geglaubt.
Ich glaubte kein Wort davon.
Ich legte die Hände auf die Arbeitsfläche und zog mich hoch. Ich nahm den dicken Umschlag für die Bank und wurde plötzlich von einem Gefühl übermannt, das mir völlig fremd war und das zusammen mit dem neu erwachten Willen zum Widerstand in mir gekeimt sein musste.
Macht.
Meine Schultern bebten. Ich stellte mich mit dem Rücken zum Wohnzimmer und hielt mir die Hand vor den Mund, damit kein Laut herauskam, aber auch diesmal konnte ich den Ausbruch nicht verhindern.
»Hör auf zu heulen. Deine Mutter ist tot. Wir können jetzt nur noch beten«, rief mein Vater aus dem Wohnzimmer.
Er hatte keine Ahnung, dass ich nicht weinte.
Sondern mit aller Kraft mein Lachen zu unterdrücken versuchte.
3. KAPITEL
SAWYER
Es war mein Geburtstag.
Während die meisten jungen Frauen (die außerhalb der Kirche natürlich) an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag ausgehen und diesen Meilenstein mit Freunden und der Familie feiern, hatten meine Pläne nichts mit Geschenken oder Partys zu tun.
Ich hatte etwas ganz anderes vor.
Ich wollte entkommen.
Rusty und Blue hatten genau an dem von meiner Mutter angegebenen Platz in dem Lagerhaus gestanden. Stets musste ich mich heimlich hinschleichen, meistens dann, wenn Vater beim Gottesdienst für Männer war und glaubte, ich sei ins Frauenzentrum gegangen, um bei der Essenszubereitung für das Treffen nach dem Gottesdienst zu helfen.
Rusty und Blue waren … alt. Doch als ich zum ersten Mal den Zündschlüssel umdrehte und Rusty röhrend zum Leben erwachte, schrie ich vor Begeisterung auf. Nachdem ich mir selbst eine Woche lang auf dem Parkplatz mithilfe eines Lehrbuchs das Fahren beigebracht hatte, klappte es zwar noch nicht wirklich gut, aber ich kam zumindest klar.
Um wirklich gut zu werden, fehlte mir die Zeit.
Die Haustür schlug zu. Voll unangenehmer Erwartung schreckte ich hoch.
Er war früher nach Hause gekommen.
»Komm runter, Sawyer!« Vaters tiefe Stimme drang aus dem Erdgeschoss zu mir hoch. »Das Geld von letzter Woche ist nicht eingezahlt worden.« Ich hörte, wie er sämtliche Schubladen in der Küche öffnete, den Inhalt durchwühlte und sie wieder zuknallte.
Instinktiv erstarrte ich, als könnte ich ihm, indem ich einfach stillhielt, weismachen, ich sei gar nicht da. Mein Herz schlug so laut, dass ich befürchtete, er könnte es durch die geschlossene Zimmertür hören. Einige Sekunden lang hielt ich den Atem an. Blut rauschte mir in den Ohren; sie brannten, als stünden die Wände meines Zimmers in Flammen.
Wenn ich es tun will, dann muss ich es jetzt tun.
Ich unterdrückte die aufsteigende Panik und fuhr fort, alle Klamotten in meiner Reichweite in einen Rucksack zu stopfen.
»Ich weiß, dass du da oben bist! Antworte mir, Mädchen!«, brüllte Vater. Diesmal war sein Lallen deutlich zu hören. Schwer dröhnten seine Schritte auf den Stufen. In dem Augenblick, in dem er den Treppenabsatz betrat, drang der Geruch nach Alkohol unter der Tür hindurch in mein Zimmer. »Wenn dir wieder eingefallen ist, wo du das Geld der Kirche hingelegt hast, kannst du dich auf die härteste Strafe deines Lebens gefasst machen.«
Er glaubt, dass ich es verlegt habe.
Rasch ließ ich dicke Gummibänder längs und quer um den alten rosa Schuhkarton schnappen und steckte ihn dann in meinen Rucksack.
Er rüttelte an der Türklinke, während ich den Reißverschluss zuzog, sehr vorsichtig, um den Karton nicht zu zerdrücken. Als es mir endlich gelungen war, ihn ganz zu schließen, setzte ich mir den Rucksack auf.
Etwas, das sich wie ein Faustschlag anhörte, knallte gegen die Tür. Zweimal. Beim dritten Schlag ertönte das Geräusch von splitterndem Holz. »Sawyer, du machst jetzt sofort diese verdammte Tür auf!«
Ich lief zum Fenster und schob ächzend die schwere, dicke Glasscheibe hoch. Ich saß schon mit baumelnden Beinen rittlings auf der Kante, da flog die Tür aus den Angeln und fiel auf den Boden meines Zimmers.
»Was glaubst du, wo du hingehst?«, schnauzte Vater. Er schwankte leicht, und als er seitlich an meine Kommode krachte und Bilderrahmen auf den Boden fielen, wusste ich, dass er betrunkener war als sonst an Wochentagen üblich.
Ich setzte die Füße auf das Dach unterhalb des Fensters. Die Fläche war schräg, und um nicht hinunterzustürzen, drehte ich mich so, dass ich mit der Schulter zur Fassade stand; dann tastete ich mich Schritt für Schritt auf die Rückseite des Hauses zu.
Endlich erreichte ich die Kante. Ich seufzte vor Erleichterung, als ich sah, dass die Leiter, die ich in einer Ecke unter dem überstehenden Dach an die Hauswand gelehnt hatte, noch immer dort stand.
Ich zog die Leiter hoch und ließ sie auf den Rasen hinab, die Muskeln in meinen Armen zitterten unter dem Gewicht des Metalls.
Hinter mir bewegte sich etwas, gleich darauf hörte ich Vaters Stiefel auf dem rauen Bitumen der Dachziegel.
Mir blieb keine Zeit, die Stabilität der Leiter zu überprüfen. Immer, wenn ich den Fuß auf die nächste Sprosse setzte, erzitterte sie. Vater kam auf mich zu gestolpert und griff bereits nach dem Rand des Daches, als ich erst die Mitte der Leiter erreicht hatte.
Er blickte zu mir herunter, und seine dunklen Augen glitzerten im Mondlicht, als er gegen die Leiter trat. Sie kippte um, ich fiel rückwärts ins Gras, und gleich darauf landete das schwere Metallteil auf mir.
Der gewaltige Aufprall ließ mir die Luft aus der Lunge weichen. Glücklicherweise bewahrte mich mein Rucksack vor größeren Verletzungen. Außer dass es mir den Atem verschlagen hatte, zog ich mir zwar Schrammen und blaue Flecken zu, blieb ansonsten aber unversehrt.
»Du lässt alles hinter dir, was du kennst. Du überlebst da draußen nicht, und ich werde nicht nach dir suchen. Für mich bist du tot, Sawyer. Tot!« Vater schwankte leicht, dann verlor er vollends das Gleichgewicht. Er fuchtelte mit den Händen in der Luft herum, um sich zu fangen, aber es war vergebens. Er fiel.
Das Adrenalin in meinen Adern ließ mich zittern, als ich mich aufrappelte. Unmittelbar bevor er auf derselben Stelle landete wie ich, war ich auf den Füßen.
Das Geräusch brechender Knochen nahm ich kaum wahr, so laut hämmerte mir das Herz in den Ohren.
Vater stöhnte vor Schmerz und griff sich an das Bein, das in einem unnatürlichen Winkel von seinem Körper abstand.
Hilf deinem Vater, diene und gehorche ihm.
Nein, nicht mehr.
Ich drehte mich um, und ohne die Angst, dass er mir folgen könnte, schlenderte ich gemächlich zum hinteren Zaun.
»Fuck you!«, schrie er mir hinterher. »Wage ja nicht, zurückzukommen. Dafür wirst du in der Hölle schmoren!«
»Keine Sorge, ich werde niemals zurückkommen«, sagte ich so ruhig, dass es mich selbst überraschte. Ich riskierte einen Blick über die Schulter und sah, wie er aufzustehen versuchte, aber sofort wieder hinfiel, weil sein Bein nicht mitmachte.
Vater meinte vermutlich tatsächlich, was er sagte, dennoch stimmte es nicht. Möglicherweise glaubte er, dass er nicht nach mir suchen würde, aber ich wusste es wie üblich besser. Ich klopfte mir auf die Rocktasche, genau die, in der die Urkunde steckte.
Zu schade für ihn, dass er mich niemals finden würde.
Ich hob meinen langen Rock and machte Anstalten, über den hohen Zaun zu klettern. Oben angekommen, hielt ich inne.
Als Vater merkte, dass ich beobachtete, wie er sich dort im Gras wand und krümmte, rührte er sich nicht mehr. Einen Augenblick lang waren wir in einem Krieg unausgesprochener Worte gefangen. Irgendwann einmal hatte es eine Zeit für Worte gegeben. Es hatte eine Zeit gegeben, in der ich Mitgefühl für ihn empfand. Eine Zeit, in der ich ihm zu Hilfe gekommen wäre, ohne Fragen zu stellen.
Diese Zeiten waren längst vorbei.
»Hilf mir«, bettelte Vater.
Ich löste den Blick von ihm und ließ mich auf der anderen Seite des Zauns hinunter.
»Saaaawyer!« Immer wieder hallte sein Schrei über den Weg. Die Wut, die er eine Weile verdrängt hatte, um mich um Hilfe zu bitten, war mit voller Wucht zurückgekehrt.
So war es immer.
Rustys Tür quietschte, als ich sie öffnete und hineinsprang und meine Tasche auf den Beifahrersitz warf. Dass ich es geschafft hatte, ihn und Blue auf diesen Weg zu bugsieren, war nichts Geringeres als ein Wunder. Nun war ich da und ließ den Motor an. Glücklicherweise übertönte der Lärm die Schreie meines Vaters.
Ich war nicht dumm. Ich wusste, dass ich ihn auch weiterhin hören würde. Kein Motor war laut genug, um ihn vollständig zu übertönen. Kein Abstand groß genug, um ihn wirklich zum Schweigen zu bringen.
Aber versuchen würde ich es trotzdem.
Ich atmete tief durch. Gefühlt hatte ich einundzwanzig Jahre lang die Luft angehalten, aber jetzt stellte ich den Schalthebel des Pick-ups endlich auf Drive. Ich fuhr hinaus in die Nacht. Ehe ich in die Straße einbog, die zum Highway führte, blickte ich in den Rückspiegel und flüsterte die letzten Worte, die ich je an diesen Mann richten würde, aus dem ein Monster geworden war.
»Lebewohl, Vater.«
4. KAPITEL
FINN
»Ich kann echt nicht glauben, dass es schon zwei Jahre sind«, sagte ich und spürte die Wirkung des Whiskeys, der meine Haut warm und meine Sinne stumpf werden ließ.
Perfekt.
»Zwei Jahre ohne dich«, fuhr ich fort. »Zwei Jahre, in denen ich jeden Tag an dich gedacht habe.«
Ich lachte leise in mich hinein. »Zwei Jahre lang sitze ich schon hier oben, führe Selbstgespräche und tue so, als wärst du noch hier.«
»Oh, sorry, Jackie.« Ich hörte das Lallen in meiner Stimme. Ich war längst über den Punkt hinaus, an dem ich mich darüber geärgert hatte, dass ich zu viel trank.
Zwei Jahre darüber hinaus, um genau zu sein.
»Ich habe dir ja gar nichts angeboten«, fuhr ich fort. »Erinnerst du dich noch an den hier?« Ich deutete auf das Etikett. »Dieses Zeug hier ist der widerliche Fusel, den wir immer nach einem Spiel getrunken haben. Weißt du noch? Es ist der billigste Sprit, den Donna vom GoMart zu bieten hat, aber uns hat sie ihn zum dreifachen Preis verkauft, weil wir minderjährig waren. Was für ein Beschiss.« Ich lachte und dachte daran, dass Jackie eine Expertin darin gewesen war, die Leute nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Das mochte seinen Preis haben, aber irgendwie hatte sie es immer geschafft.
Ich kippte die Flasche, goss eine großzügige Menge des billigen Zeugs auf die Rutsche und sah zu, wie es über die mit Graffiti bedeckte Plastikbahn wirbelte, bis ich es auf den Betonboden des leeren Pools darunter plätschern hörte.
»Also, auf ex.« Ich stieß mit der Luft an und leerte die Flasche mit wenigen großen Schlucken.
Meine Augen tränten, meine Kehle brannte. Ich hustete, und Whiskey lief mir über das Kinn. Ich wischte ihn mit dem Handrücken ab.
»Ich glaube, Whiskey ist nicht dafür gemacht, auf ex getrunken zu werden«, sagte ich und kicherte. »Aber das hat uns nie davon abgehalten, stimmt’s?«
Ich warf die leere Flasche in die Luft, sah zu, wie sie sich immer wieder um die eigene Achse drehte, dann ließ ich meinen Oberkörper rotieren, um die Bewegung nachzuahmen. Das Geräusch splitternden Glases hallte durch die Luft, als die Flasche viele Meter tiefer krachend auf dem Boden landete.
»Weißt du, irgendwie hasse ich dich«, sagte ich und schniefte laut. Das Wetter musste umgeschlagen sein, denn die Luft war heißer und schwüler als bei meiner Ankunft. »Wir wollten doch … ich meine nur, wir wollten doch viel mehr tun, als wir am Ende geschafft haben, oder?«
Ich zündete mir einen Joint an. »Josh hat neulich mal gesagt, ich hätte nicht richtig um dich getrauert.« Ich kratzte mir mit dem Daumen die Stirn. »Aber da irrt sie sich, weißt du. Kummer ist das Einzige, was ich noch fühle. In der ganzen Zeit habe ich nur eins falsch gemacht, und das war, dass ich mich gefangen habe. Über dich hinweggekommen bin. Kapier ich irgendwie nicht. Josh hat zwar ’nen Männernamen, aber sie ist eine Frau, absolut, und sie hat echt ’ne Mordswut. Näher als drei Meter geh ich nicht an sie ran.«
Ich schlug mir mit der Faust fest auf die Brust und knurrte vor Frustration.
»Weißt du, das tut verdammt weh.« Meine Stimme wurde rau, und ich räusperte mich.
»Es tut noch genauso weh wie vor zwei Jahren. Wenn du jetzt hier wärst, würde ich …« Beim Klang dieser Worte spürte ich ein Stechen in der Brust. »Ach, ist egal«, murmelte ich. »Du bist nämlich nicht hier.«
Mein Herz kam ins Stolpern, und ich musste husten. Als es wieder mit normaler Geschwindigkeit schlug, nahm ich einen tiefen Zug von meinem Joint und blies den Rauch in die Leere neben mir. Es war Jackies Platz. Dort hätte sie immer noch sitzen sollen.
Wenn ich nicht gewesen wäre, gäbe es sie vielleicht noch.
Ich hielt den Joint hoch. »Das ist zwar nicht das Zeug, das ich immer von Miller bekommen habe, aber es muss halt reichen.« Ich seufzte.
»Weißt du, ich habe ihn eine Weile nicht gesehen. Und Josh auch nicht. Nachdem du gestorben warst, konnte ich ihnen nicht in die Augen sehen. Sie haben mir den Abstand gelassen, den ich wollte, und der hat sich jetzt zu einem riesigen Abgrund zwischen uns dreien entwickelt. Ich kann sie auf der anderen Seite sehen, aber um zu ihnen zu kommen, müsste ich hineinspringen und sehen, was sich auf dem Grund von allem befindet.« Ich schüttelte den Kopf. »Dazu bin ich noch nicht bereit. Keine Ahnung, ob es je dazu kommt. Sie erinnern mich nur daran, dass es nie wieder wie früher sein wird. Dich zu verlieren, das war einfach zu viel, verdammt. Mich erinnert schon viel zu viel an dich«, erklärte ich.
Meine Augen wurden feucht. Hab den Rauch wohl nicht weit genug weggeblasen, zu nah an meinem Gesicht. »Jedes Gebäude in dieser verdammten Stadt. Jede Nebenstraße. Jedes Stückchen Moos und jeder Song erinnern mich daran, dass du nicht mehr da bist. Es hätte mich treffen sollen.« Ich kam auf die Füße und hielt mich am Geländer der Rutsche fest, um nicht zu fallen. »Das ist nicht fair, verdammt.« Das Geländer gab nach, und auf einmal blickte ich direkt auf den Boden weit unter mir, denn ich fiel nach vorn.
Unten sah ich Jackie stehen, die mich anlächelte. Perfektes blondes Haar und dazu passendes Lächeln. Sie winkte mir zu.
Wartete auf mich.
Jackie verschwand, als es mich mit solcher Macht zurück auf das Podest riss, dass ich auf dem Menschen landete, der mich festgehalten hatte.
»Jackie?«, fragte ich in meinem verwirrten, betrunkenen, berauschten Zustand, der einem Delirium ähnelte.
Ich wurde umgeworfen und dann hochgehoben. Mein Arm umschlang breite Schultern, die mir die klapprigen Metallstufen hinunterhalfen, während eine tiefe Stimme alle Flüche dieser Welt murmelte.
»Jackie, bist du das?«, fragte ich, unfähig, das Gesicht der Person vor mir scharf zu sehen, während der Hintergrund aus Bäumen und Sumpf sich um uns zu drehen begann. »Hast du’s endlich geschafft?«
»Jackie ist tot, Junge. Und zwar schon ziemlich lange«, sagte eine tiefe, raue Stimme.
»Ja, das weiß ich. Aber ich rede noch mit ihr … hicks … manchmal.«
»Gut zu wissen, dass du überhaupt mit jemandem redest. Versuch doch mal, dich auf die Leute zu konzentrieren, die noch da sind. Könnte dir guttun.« Ich konnte die vertraute Stimme nicht einordnen.
Andererseits konnte ich überhaupt nichts richtig einordnen, nicht mal die Füße konnte ich in der richtigen Reihenfolge hintereinander setzen. Ich stolperte, wurde aber festgehalten und dann weitergeschoben.
»Okay, Jackie. Was immer du willst«, lallte ich, als ich in ein Fahrzeug gehievt wurde.
Ich wusste nicht, ob es ein PKW oder ein Pick-up war. Für mein berauschtes Gehirn hätte es auch ein Schulbus sein können. Alles, was ich wollte, war schlafen. Unter dem Gewicht meiner Trunkenheit wurden mir die Lider schwer. »Ich liebe dich, Jackie. Immer schon. Und für immmmeeeeer.«
»Halte dich von dem verdammten Freizeitbad fern, sonst krepierst du am Ende auch noch«, sagte die Stimme und ließ den Motor an. »Und dann fühlen sich noch viel mehr Leute so, wie du dich jetzt fühlst. Als hätte man sie einfach im Stich gelassen.«
»Neiiin, so können sie sich nicht fühlen«, entgegnete ich.
»Ach ja, Rockstar? Und warum genau?«
»Weil ich schon tot bin«, erklärte ich, obwohl mich mein logisches Denkvermögen längst verlassen hatte, als ich nun den Kopf an die Scheibe legte und mir die Augen zufielen.
»Du kannst dich totstellen, so lange du willst, Junge, mich verarschst du damit nicht.« Eine Ohrfeige brannte auf meiner Wange, und zur Vergeltung schlug ich träge in die Luft. »Wird allmählich Zeit, dass du dich wieder fängst, verdammt.«
Ich wachte auf dem Fahrersitz meines Broncos auf, mit geschlossenem Sicherheitsgurt und einem Gefühl, als hätte ich bei einem Death-Metal-Konzert stundenlang direkt neben den Boxen gestanden … während eines endlosen Schlagzeugsolos.
Draußen war es noch dunkel, und ich hatte vor dem Haus geparkt, in dem ich schon seit Jahren nicht mehr wohnte. »Wie zum Teufel bin ich hierhergekommen?«, murmelte ich und ließ den Motor an.
Das hier war der letzte Ort, an dem ich sein wollte.
Ich sah auf die Uhr. Es war zehn Uhr abends. Ich erinnerte mich vage, dass ich irgendwann tagsüber in das Freizeitbad gegangen war.
Jackie.
Die Erinnerung an den Grund, warum ich das Spaßbad aufgesucht hatte, traf mich wie ein Hammerschlag gegen die Brust. Der Jahrestag ihres Todes.
Ich drehte das Radio lauter, um die Erinnerungen zu übertönen, die immer kamen, wenn ich an sie dachte. Ich zündete mir einen Joint an und stellte den Bronco auf Drive.
Ich war gerade auf den Highway gefahren, immer noch in einem Nebel aus Alkohol und Gedanken an Jackie, und hätte das Wohnwagengespann mitten auf der Straße beinahe übersehen.
Und das Mädchen auch.
Sie starrte mich an, während ich immer näher kam; ihr Gesichtsausdruck wirkte panisch. Wahrscheinlich fragte sie sich, warum ich nicht anhielt.
Die Frage war berechtigt.
Ich stieg auf die Bremse oder glaubte zumindest, dass ich das tat.
Im Schneckentempo erreichte der Befehl meines Gehirns meinen Fuß. Als er endlich gehorchte, kam der Wagen jäh zum Stehen. Die Bremsen quietschten, als Metall über Metall schrammte. Ich riss das Steuer herum, mein Pick-up brach seitlich aus und kam ins Schleudern.
Durch das offene Dach blickte ich zu den Sternen hinauf, die über mir am Himmel blinkten. Ich fragte mich, ob dies die Nacht war, in der ich endlich aufhören konnte, Jackie zu vermissen.
Denn es bestand die realistische Möglichkeit, dass ich sie bald wiedersehen würde.
5. KAPITEL
SAWYER
Der Highway wurde immer schmaler, bis ich mir sicher war, dass er bald einfach verschwinden würde. Der glatte Teerbelag war nun mit Schlaglöchern übersät, gemischt mit Abschnitten, die nur aus Erde oder Geröll bestanden. Vor lauter Auf und Ab tat mir das Steißbein weh.
Ich fuhr an einer Ausfahrt vorbei, die aussah, als wären die Bauarbeiten aufgenommen, aber nie beendet worden. Kaum zwei Meter abseits der Straße ging das rissige Pflaster in Erdboden über, auf dem hohes Unkraut wucherte. Grellgelbe Sperren, die meisten ziemlich verbeult, blockierten den Weg, der vom Highway hinunterführte.
War das die Ausfahrt, die ich nehmen musste?
Es gab kein Hinweisschild, aber ich wusste, dass ich kurz vor dem Ziel war.
Ich wusste auch, dass ich in gewisser Weise verloren war.
Die Stadt namens Outskirts war kaum mehr als ein Punkt auf der alten, verblassten Landkarte im Handschuhfach. Sie lag an den nördlichen Ausläufern der Everglades, in der Mitte zwischen den Küstenlinien Floridas. Ich war zwei Tage lang durchgefahren, doch je schwerer meine Lider wurden, desto entschlossener war mein Geist.
Ich drückte auf das Gaspedal, um das Tempo irgendwie über Oma-Level hinaus zu bringen, aber nichts passierte.
Der einzige andere Wagen auf dem Highway zischte an mir vorbei, und das lag nicht daran, dass er beschleunigt hatte – nein, ich wurde immer langsamer.
Viel langsamer.
Unter der Motorhaube explodierte etwas, und der Knall ließ mich vor Überraschung aufschreien. Weißer Rauch stieg in die Nacht wie ein winziger Atompilz.
»Nein, nein, nein!«, schrie ich keinen anderen als Rusty an, denn der Name passte hervorragend zu ihm, und nun stotterte und hustete er auch noch.
Sämtliche Lichter am Armaturenbrett gingen gleichzeitig aus, und Rusty der Pick-up rollte mitten auf dem verlassenen Highway einfach aus, traurig und hochdramatisch.
»Nicht jetzt. Bitte. Ich tue alles, was du willst. Ich stelle dich in den Schatten. Ich wasche dich jeden Tag. Ich singe dir nachts was vor. Aber bitte, bitte, bleib jetzt nicht stehen!« Ich versprach dies und alles, was mir sonst noch einfiel, um den Wagen am Leben zu erhalten, aber er ließ mir mit einem letzten Todesröcheln das Herz in die Hose sinken, ohne jede Hoffnung auf spontane Wiederbelebung.
Rusty war nicht mehr.
Ich biss die Zähne zusammen, hämmerte mit der Faust aufs Lenkrad und sog scharf die Luft ein, weil sich der Schmerz aus meiner Handkante in Wellen bis zum Ellbogen fortsetzte. »Aua!«, schrie ich, als hätte das Lenkrad zurückgeschlagen.
Ich sprang auf die Straße hinaus und trat mehrmals gegen die Fahrertür, woraufhin sie sich aus den Angeln löste. Kleine Stücke von Rost und abgeplatztem Lack fielen auf den rissigen Asphalt. Mit einem letzten frustrierten Knurren drehte ich mich um und blickte den dunklen, leeren Highway hinunter. Ich ließ mich auf den Boden sinken und lehnte mich mit dem Rücken an den abgefahrenen Vorderreifen, den Kopf zwischen die Knie gesenkt.
»Was mache ich jetzt bloß, verdammt?«, murmelte ich und blickte auf, als eine dunkle Wolke sich vor die Sterne schob und die dunkle Nacht zu einer schwarzen machte. »Was ist mit dir, Blue? Lässt du mich auch bald im Stich?«, fragte ich den Wohnwagen, der an Rustys Kupplung hing.
Blues metallene Verkleidung war oben und unten weiß lackiert. In der Mitte dazwischen verlief horizontal ein taubenblauer Streifen, der ebenso breit war wie das einzige Fenster.
Als ich ihn zum ersten Mal sah, glaubte ich, meine Mutter habe ihm seinen Namen wegen des Streifens gegeben. Aber ich hatte mich geirrte. Im Innern des Wohnwagens waren die Wände, die kleinen Schränke über den Schlafpolstern, der winzige Herd, ja sogar die Arbeitsplatten und die Komposttoilette allesamt babyblau. Sogar das verschlissene Linoleum auf dem Fußboden wies ein blau-weißes Schachbrettmuster auf.
Alles hatte so großartig angefangen. Nachdem ich Rusty und Blue aus dem Gefängnis des Lagerhauses befreit hatte, stellte ich fest, dass der Wohnwagen vollständig ausgestattet war. Decken, Konservendosen und zig Liter Wasser im hinteren Tank, der nur von außen geöffnet werden konnte. Ein voller Wassertank für das winzige Bad mit Dusche.
Die Ausstattung deutete darauf hin, dass Mom alles genau geplant und keine Mühen gescheut hatte, um den Wohnwagen für mich vorzubereiten, aber ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sie das ganz allein hinbekommen hatte.
Plötzlich fing der Asphalt an zu vibrieren, die Ankündigung eines herannahenden Fahrzeugs. Ich stand auf und spähte in beide Richtungen auf den schwarzen Highway.
Nichts.
Und doch zerriss ein Motorengeräusch die Stille, dröhnte immer lauter, ohne dass ich den dazugehörenden Wagen sehen konnte.
Als ich den Pick-up endlich entdeckte, war es zu spät.
6. KAPITEL
SAWYER
Das Geräusch quietschender Bremsen erfüllte die Nachtluft. Der Geruch nach brennendem Gummi stieg mir in die Nase. Metall rieb auf Metall, als der Geländewagen, ein älteres Modell, über die Fahrbahn schleuderte und die Mittellinie überquerte, ehe er schließlich seitwärts weiterrutschte und ungefähr einen Meter von mir entfernt zum Stillstand kam.
»Verdammt noch mal, was …?«, knurrte die Stimme eines Mannes, der offenbar genauso verwirrt war wie ich selbst.