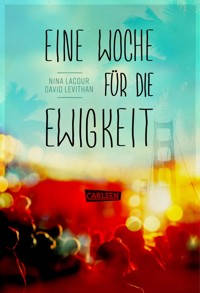18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman über Vergeben und Heilen – und eine mitreißende Liebesgeschichte Als Sara, Barkeeperin im teuren Szenelokal Yerba Buena, Emilie kennenlernt, die für das Restaurant die Blumen arrangiert, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch ihre Lebensgeschichten könnten kaum unterschiedlicher sein: Sara ist mit siebzehn aus dem White-Trash-Drogensumpf ihrer Kleinstadt nach Los Angeles geflohen. Dass sie ihren zehnjährigen Bruder zurücklassen musste, wirft sie sich heute noch vor. Emilie ist die Tochter einer gutbürgerlichen kreolischen Familie, hat aber immer darunter gelitten, dass sich die gesamte Aufmerksamkeit der Eltern auf Emilies drogenabhängige Schwester Colette richtet. Doch gerade als Sara und Emilie glauben, miteinander ein neues Zuhause gefunden zu haben, holt ihre Vergangenheit sie ein. »Wilde Minze ist zärtlich und innig, eine umwerfende, sinnliche Erkundung der kostbarsten Momente des Lebens. Ein Lesegenuss!« Charlotte McConaghy
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wilde Minze
Die Autorin
NINA LACOUR lebt mit ihrer Familie in der Bay Area nahe San Francisco, wo sie auch aufgewachsen ist. Ihre Jugendbücher sind in den USA Bestseller und wurden vielfach ausgezeichnet. Nina LaCour arbeitete als Buchhändlerin und Englischlehrerin und unterrichtet heute an verschiedenen Universitäten. Wilde Minze ist ihr erster Roman für Erwachsene.YASEMIN DINÇER studierte Literaturübersetzen in Düsseldorf. Sie hat unter anderem Werke von Shirley Hazzard, Chanel Miller und Andrew Michael Hurley aus dem Englischen übertragen und ist mehrfache Stipendiatin des Deutschen Übersetzerfonds. Sie lebt und arbeitet in Berlin.
Das Buch
EIN ROMAN ÜBER VERLUST UND HEILUNG – UND EINE BITTERSÜßE LIEBESGESCHICHTEAls Sara, Barkeeperin im teuren Szenelokal Yerba Buena, die Floristin Emilie kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch ihre Lebensgeschichten könnten kaum unterschiedlicher sein: Sara ist mit siebzehn aus dem White-Trash-Drogensumpf ihrer Kleinstadt nach Los Angeles geflohen. Dass sie ihren zehnjährigen Bruder zurücklassen musste, wirft sie sich heute noch vor. Emilie ist die Tochter einer gutbürgerlichen kreolischen Familie, hat aber immer darunter gelitten, dass sich die gesamte Aufmerksamkeit der Eltern auf ihre drogenabhängige Schwester richtet. Gerade als Sara und Emilie glauben, miteinander ein neues Zuhause gefunden zu haben, holt ihre Vergangenheit sie ein.»WILDE MINZE IST ZÄRTLICH UND INNIG, EIN LESEGENUSS!«CHARLOTTE MCCONAGHY
Nina LaCour
Wilde Minze
Roman
Aus dem Amerikanischen von Yasemin Dinçer
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Yerba Buena bei Flatiron Books, New York.
© 2022 by Nina LaCour© der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Nach einer Vorlage von Joanne O’Neill / Flatiron Books Umschlagmotive: beata07 / Shutterstock; Asya_mix / © GreenTana / Getty Images Autorinnenfoto: © Kristyn StrobleE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-3039-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Ein Nachmittag im Frühling
Paradies
Der Blumenladen & die Einzimmerwohnung
Venice
Der Canyon & die Garagenwohnung
Der Wald & das Bett
Long Beach
Ein Gewitter & der Fluss
Yerba Buena
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Ein Nachmittag im Frühling
Widmung
Für meine Frau Kristyn, die einen Raum betrat und mir den Atem verschlug.Sieh nur, was für ein Leben wir uns erschaffen haben.Und für meinen Vater Jacques, der mir so großzügig erlaubt, die Details seiner Jugend in Los Angeles für meine Geschichten zu verwenden.Ein Nachmittag im Frühling
Sie fuhren gemeinsam den Hügel hinauf. Draußen zogen verschwommen Bäume und Himmel vorbei, die Bremsen ächzten, die Luft zwischen ihnen war elektrisch aufgeladen. Bei jeder Kurve wurde eine nackte Schulter an die andere gedrückt, bis der Bus langsamer wurde und schließlich anhielt.
Die Türen falteten sich auseinander, und die beiden traten auf die Straße hinaus. Der Armstrong Drive endete hier in einer Sackgasse – ein Parkplatz, eine Rangerstation, der Eingang in den Wald. Sara öffnete den Reißverschluss ihres Rucksacks, zog eine Thermoskanne heraus, schraubte den Deckel auf und nahm einen Schluck. Als Annie danach griff, berührten sich ihre Finger, und Sara sah zu, wie Annie die Lippen gegen den Metallrand presste und trank.
Es beeindruckte Sara jedes Mal – wie die Luft sich veränderte, sobald sie den Wald betrat. Kühl, feucht, nach frischer Erde duftend, selbst an hellen Tagen wie diesem dunkler und gedämpfter. »Sollen wir uns eine Karte besorgen?«, fragte Annie, aber Sara schüttelte den Kopf. Sie kannte den Wald gut, verlief sich nicht und fand immer wieder zurück.
Sie ergriff Annies Hand und führte sie an der Station vorbei. Sie passierten eine Reisegruppe mit nach oben gerichteten Gesichtern. Sich klein vorzukommen fühlte sich gut an. Deshalb hatte ihre Mutter sie hierher mitgenommen, als sie ein kleines Kind war, und deshalb kam Sara auch weiter, nachdem ihre Mutter tot war.
Sie nahmen Saras Lieblingspfad – den steilsten und ruhigsten – und wanderten, bis sie außer Atem waren, auf Augenhöhe mit den Zweigen der uralten Mammutbäume und dem Himmel so nah, wie man nur kommen konnte.
»Da drüben?«, fragte Annie.
Sara folgte ihrem Blick zu einem Hain abseits des Pfads. Sie nickte, und ihr Herz schlug schneller. So vorsichtig wie möglich liefen sie über den Waldboden auf einen Kreis junger Mammutbäume zu, in deren Mitte ein hohler Stamm stand. Dort öffneten sie ihre Rucksäcke, zogen eine Decke und zwei Pullover heraus und breiteten sie über den Kiefernnadeln aus.
Der Wald war still. Alle anderen Menschen waren weit weg.
»Darf ich dich jetzt küssen?«, fragte Sara.
»Noch nicht«, sagte Annie. Sie zog ihr T-Shirt über den Kopf. Sie öffnete ihren BH.
»Jetzt?«
Annie schüttelte den Kopf. »Du bist dran.« Also zog auch Sara ihr Shirt aus, und dann küsste Annie sie stürmisch, ehe Sara erneut fragen konnte.
Die Erleichterung, nach Stunden des Wartens.
Die Aufregung: zwei Vierzehnjährige, heimlich verliebt.
Sara sank auf die Decke, Annie über ihr. Sie küssten die Kurven von Hälsen und Schlüsselbeinen. Bedeckten Brüste mit ihren Handflächen. Lächelten, erröteten, küssten sich noch inniger.
Nach einer Weile ruhten sie nebeneinander aus, Annies Kopf in Saras Halsbeuge.
»Schau mal«, flüsterte Annie, und Sara sah eine knallgelbe Bananenschnecke von einem Farn kriechen. Sie bewegte sich auf Sara zu, die vor ihrer seltsamen, kalten Glätte zurückschreckte und sich das Lachen verkneifen musste. Die Schnecke kroch über ihren blassen Bauch und dann weiter auf Annies. Sie brauchte eine Ewigkeit. Sie waren drei Wesen im Wald. Die Mädchen hielten ganz still. Die Schnecke hinterließ eine glitzernde Schleimspur auf ihrer Haut.
Darauf folgte eine Woge der Trauer: die winzigen Diamanten auf einem Krankenhaushemd. Der flamingofarbene Nagellack, den Sara mit sorgfältigen Strichen auf die Nägel ihrer Mutter aufgetragen hatte. Gelb angelaufene Augen, aufgesprungene weiße Lippen. Die besorgten Gesichter der Krankenschwestern, die Wutanfälle von Saras kleinem Bruder und wie ihr Vater bei seinen Besuchen mit hinter dem Rücken verschränkten Händen in einer Ecke gestanden hatte. Während jener Wochen im Krankenhaus hatte Sara das Gefühl, über einem Abgrund zu schweben. Und dann war ihre Mutter fort, und sie stürzte hinein.
»Hey«, murmelte Annie, und Sara kehrte mit klopfendem Herzen zurück in den Mammutbaumhain. »Woran denkst du?«
»An nichts Bestimmtes.«
Eine Brise ließ die Zweige über ihnen rascheln.
»Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß«, forderte Annie sie auf. »Über dich.«
Ihre Stimme war nah an Saras Ohr, ihr weicher Körper gegen Saras Haut gepresst. Was könnte Sara offenbaren, um sie zufriedenzustellen? Nichts aus den letzten beiden Jahren, und auch nichts aus den Monaten davor. Nichts aus der Schule, denn auch wenn es sich manchmal anfühlte, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt, saßen sie schon im selben Klassenraum, seit sie klein waren. Sie musste noch weiter zurückgehen … und dann wusste sie es.
»In meiner Familie spielten wir immer ein Spiel zusammen. Ein Zeichenspiel. Wir saßen gemeinsam um den Tisch, und eine oder einer von uns fing an, meistens mein Dad. Er zeichnete eine Straße oder einen Zug oder einen Berg. Und dann fügte die nächste Person etwas hinzu. Menschen oder Autos oder den Himmel. Wer auch immer als Letztes kam, vervollständigte das Bild, bis dahin war das ganze Blatt voll. Ich habe das so geliebt. Gespannt zu warten, was die anderen zeichnen würden, mir etwas zu überlegen, um sie zu überraschen. Manchmal spielten wir stundenlang.«
Sie hoffte, es würde genügen, und spürte, wie Annie sie näher zu sich heranzog.
Mittlerweile stand die Sonne tief am Himmel, und sie mussten zurückkehren – Annie zu ihrem Zwillingsbruder und ihren Eltern, Sara zu ihrem kleinen Bruder, um dafür zu sorgen, dass er etwas zu essen bekam. Wahrscheinlich stieg er gerade auf sein Fahrrad und fuhr von seinem Freund nach Hause. Vielleicht würde ihr Vater an diesem Abend da sein. Vielleicht auch nicht. In jedem Fall musste Sara den Bus zurück in die Stadt erwischen, ehe die Sonne über den baufälligen Hütten, den rustikalen Ferienhäusern und dem breiten, schlammigen Fluss unterging. Über der Appaloosa Bar und dem Wishes & Secrets Hair Salon und der weißen Kirche von Lilys Vater.
Aber zuerst noch ein paar Minuten hier, dachte sie.
Noch ein Kuss.
Noch ein Vogel hoch über ihnen.
Noch eine kühle Brise auf ihrer Haut.
Wie einfach es war, den ganzen Rest zu vergessen, während sie so klein und geschützt im Wald waren.
Am anderen Ende Kaliforniens drückte Emilie eine neue Grünpflanze in die Erde des Gartens ihrer katholischen Schule. Die Blätter kamen ihr bekannt vor. Sie blickte sich um, und tatsächlich – da waren noch mehr davon, über die Stützmauer ragend.
»Dieselbe Pflanze, oder?«, fragte sie, und Mrs. Santos nickte.
»Wenn man in einem Garten eine freie Stelle sieht, sollte man sich umschauen, was bereits dort wächst. Höchstwahrscheinlich kann man sich ein bisschen davon nehmen.«
Die Schule hatte sich vor ein paar Stunden geleert. Nun waren nur noch sie drei übrig – Emilie, ihr Freund Pablo und Pablos Mutter –, die sich um das kleine Beet kümmerten, das die Schule von der Straße abtrennte. Mrs. Santos hatte angeboten, es sowohl schön als auch nützlich zu gestalten. Ein paar Blumen, hauptsächlich Kräuter.
»Wie heißt sie?«, wollte Emilie wissen. Sie hatte die Namen der Pflanzen gelernt, aber diese im Schatten wachsende hatte sie irgendwie übersehen.
»Yerba buena.«
»Lustig«, sagte Emilie. »So heißt das Lieblingsrestaurant meiner Eltern. Weißt du noch, Pablo? Dieses Lokal auf dem Sunset, in dem wir zusammen waren?«
»Das schicke?«
»Ja.«
Pablo warf das Unkraut, das er gerupft hatte, in einen Eimer und stellte sich neben sie vor die Pflanze. Er zupfte einen Stiel ab und ließ ihn vor Emilies Gesicht baumeln. »Hier ist ein Zweig Minze. Gib mir all dein Geld.«
Sie lachten, sogar Mrs. Santos.
»Es ist also eine Art wilde Minze?«, fragte Emilie und rieb ein Blatt zwischen den Fingern.
»Ja, sie eignet sich gut für Tee«, erwiderte Mrs. Santos. »Das gilt für die meisten dieser Pflanzen. Ein Teegarten macht nicht viel Aufwand. Kräutertee, genauer gesagt. Kleine Pflanzen. Anspruchslos. Ich sammle ein paar für dich. Schau mal, was dir schmeckt.«
Eisenkraut. Pfefferminze. Kamille. Salbei. Yerba buena.
»Das ist ja ein ganzer Strauß«, bemerkte Emilie, als Mrs. Santos ihr die Kräuter reichte.
»Benutze sie frisch. Probiere heute Abend ein paar davon, während du deine Hausaufgaben machst.«
Sie packten ihre Sachen zusammen und brachen zu Fuß zu ihren Häusern auf, die auf gegenüberliegenden Straßenseiten sechs Blocks von der Schule entfernt lagen. »Wie geht es Colette?«, fragte Mrs. Santos.
»Ganz gut. Sie bringt mir Gitarrespielen bei. Fühlen Sie mal meine Finger.«
Mrs. Santos berührte ihre Schwielen. »Du hast geübt.«
»Fühl mal«, forderte Emilie auch Pablo auf, während sie vor einem Fußgängerübergang warteten.
»Boah.«
Die Ampel schaltete auf Grün, sie überquerten die Straße, und Emilie dachte daran, wie Colette ihre Finger in die richtige Position brachte und ihr erklärte, wann sie die Akkorde wechseln sollte. Wie sie beide auf Colettes Bett Lieder übten. Noch öfter hatte Emilie in den vergangenen Wochen jedoch allein in ihrem Zimmer geübt, während ihre Schwester allein in ihrem blieb. Ihr fiel die Szene an einem der letzten Abende ein, als Colette sie angeschrien und ihre Zimmertür zugeknallt hatte.
Sie waren fast bei ihren Häusern angekommen. »Erzähl mir hinterher, wie dir der Tee geschmeckt hat«, sagte Mrs. Santos. »Einfach heißes Wasser und ein paar Blätter. Und Honig, wenn du magst.«
Emilie winkte, als sie die Stufen zu ihrer Haustür hinaufstieg. »Bis morgen.«
»Komm nachher vorbei und gib mir die Algebra-Lösungen«, rief Pablo ihr nach, wofür Mrs. Santos ihn scherzhaft ausschimpfte, während Emilie ihre Haustür unverschlossen vorfand und hineinging.
Im Haus war niemand zu sehen, also schnitt sie sich ein paar Scheiben Käse ab, um sie mit einem Apfel zu essen, und nahm ihren Teller mit nach draußen auf die Veranda. Nur wenige Monate zuvor hatten ihr Vater Bas und seine zwei Cousins die alte Veranda auseinandergenommen und Emilie und Colette eingeladen, ihnen beim Bau einer neuen zu helfen.
»Familientradition«, hatte Bas gesagt. »Wir haben unseren Vätern dabei geholfen, Häuser und Veranden und alle möglichen Sachen zu bauen.«
»Und damals in New Orleans«, fügte Rudy hinzu, der älteste der Cousins, der als einziger dort geboren worden war, ehe die Familien nach Los Angeles umzogen, »haben unsere Väter ihren Vätern geholfen.«
Colette verdrehte die Augen. Sie hatte gerade erst die Highschool abgeschlossen, allerdings nur knapp bestanden, und die Zeugnisse ihres zweiten Halbjahrs sahen so düster aus, dass das College, auf das sie hatte gehen wollen, seine Zusage zurückgenommen hatte. »Meine Freundinnen warten am Strand auf mich«, sagte sie. Auf Emilie wirkte es jedoch aufregend. Die Holzstapel, die Cousins, die sie nur selten sahen, obwohl sie in benachbarten Städten lebten.
»Komm schon, Schwester«, sagte sie. »Das wird lustig.«
Colette lehnte sich gegen das Haus. Mit ihren zusätzlichen drei Jahren und fünf Zentimetern kam sie Emilie beinahe überirdisch vor. Ihr Haar war länger als Emilies, ihre Jeansshorts waren kürzer, und sie legte den Kopf schief und ließ alle warten. Dann zuckte sie mit den Achseln und sagte: »Wieso nicht?«
Colette half für etwa eine Stunde, ehe sie behauptete, sie müsse nun gehen. Aber Emilie verbrachte den ganzen Tag draußen bei den Männern, lauschte ihren Geschichten, lächelte über ihre Witze, auch wenn sie sie nicht verstand, und hämmerte Nägel ein, wo sie es ihr sagten. Sie zeigten ihr, wie man einen Elektroschleifer verwendete, und sie zog Maske und Schutzbrille über, um das Geländer zu bearbeiten, bis es glatt war.
Nun lehnte sie sich dagegen und blickte über ein kahles Gartenstück, auf dem ein Rosenbusch verkümmert und nie ersetzt worden war. Vielleicht könnte sie einen Lavendelstrauch hierherverpflanzen. Oder sogar ihren eigenen Teegarten anlegen. Hinter der Schiebetür nahm sie eine Bewegung wahr – irgendjemand musste zu Hause sein. Ihre Eltern hatten keine regelmäßigen Arbeitszeiten. Bas war Bauunternehmer, Lauren Anwältin in der Unterhaltungsbranche. Sie kamen und gingen und ließen ihre Töchter dasselbe tun.
Tee, dachte Emilie. Kein Lavendel. Sie würde Mrs. Santos bitten, ihr beim Anpflanzen zu helfen. Und dann hörte sie innen das Stampfen von Stiefeln auf der Treppe und Bas’ Hilfeschrei.
»Ruf 911 an. Es ist deine Schwester.«
Sie schnappte sich das Telefon und wählte, folgte ihm nach oben, während es klingelte und die Telefonistin sie bat, ihren Notfall anzugeben, aber Bas blockierte die Badezimmertür.
»Sieh nicht hin, Schatz. Sag ihnen, sie sollen sofort einen Krankenwagen schicken. Sag, es war eine Überdosis, und sie sollen auf der Stelle kommen. Sieh nicht hin, Em, warte an der Tür auf sie.«
Also ging Emilie wieder nach unten, und der Krankenwagen kam leise, ohne Sirenen, die Straße herauf und parkte vor ihrem Haus. Zwei Sanitäter eilten hinein, und sie zeigte auf die Treppe, und dann war auch Lauren zu Hause, und es gab nichts zu tun für Emilie, während die Sanitäter ihre Schwester, bewusstlos, aber am Leben, aus der Tür hinaus und hinten in den Krankenwagen hineintrugen. Bas kletterte ihnen hinterher.
Lauren schnappte sich den Autoschlüssel.
»Ich folge ihnen zum Krankenhaus«, erklärte sie Emilie.
»Ich komme mit.«
»Nein, nein, du bleibst.« Lauren umfasste Emilies Gesicht mit den Händen. »Meine zuverlässige Tochter, mein gutes Mädchen. Bleib einfach hier, während wir fort sind.«
Emilie sah aus dem Fenster zu, wie der Krankenwagen davonrollte, ihre Mutter hinterher, sie alle irgendwie unbemerkt vom Rest der Welt. Ein paar Minuten später gingen auf der anderen Straßenseite im Haus der Familie Santos die Lichter an. Sie hätte hinübergehen, ihnen alles erzählen und an ihrem Tisch zu Abend essen können. Aber sie tat es nicht. Sie blieb allein im Haus, während der Abend voranschritt. Sie starrte auf ihre Hausaufgaben und vergaß zu essen. Die Kräuter aus dem Schulgarten verwelkten auf der Küchenarbeitsfläche. Sie schlüpfte unter die Bettdecke und hielt ihren Körper so still sie konnte. Sie würde einfach hierbleiben, bis es vorbei war.
Paradies
Zwei Jahre später wachte Sara davon auf, dass ihre Schlafzimmertür geöffnet wurde.
»Das Telefon hat nicht aufgehört zu klingeln«, sagte Spencer im Türrahmen, das Haar auf einer Seite verfilzt, die Augen müde. »Es ist Annies Bruder.«
Sara griff nach dem Telefon und presste es gegen ihr Ohr. »Dave?«
»Ist Annie bei dir?«
»Nein.« Sie sah, dass es halb zwei Uhr morgens war, und ihr Herz schlug schneller. Spencer setzte sich neben sie und presste seine Wange an ihre, um mitzuhören.
»Bist du dir sicher, dass sie nicht bei dir ist?«, fragte Dave.
»Natürlich bin ich mir sicher«, antwortete Sara.
»Wann hast du sie das letzte Mal gesehen?«
»Nach der Schule. Als ich mich von euch beiden verabschiedet habe. Danach bin ich zur Arbeit gegangen und von da aus nach Hause.«
»Meine Eltern brauchen das Telefon. Ich leg auf. Ich ruf dich an, wenn wir irgendetwas herausfinden.«
Sara nickte, nicht imstande, etwas zu sagen, und drückte das Telefon an sich, bis Spencer es ihr abnahm und neben das Bett legte.
»Moment mal«, sagte er. »Sollte er nicht herauskriegen können, wo sie ist? Also, wenn er die Augen schließt und sich konzentriert?«
»Wovon redest du?«, wollte Sara wissen.
»Ich dachte, Zwillinge könnten das«, stellte Spencer fest.
»Oh.« Sara nahm seine kleinere Hand in ihre. »Ich glaube, so funktioniert das nicht.«
Am Morgen machte Sara wie immer Rühreier für Spencer, auch wenn ihr selbst zu schlecht war, um etwas zu essen.
Sie holte die Teller ihrer Mutter aus dem Schrank, die mittlerweile an den Rändern angeschlagen waren und deren Blumenmuster verblasste. Nach einer Weile war Sara aus ihrer Trauer herausgeklettert, aber nun war Annie verschwunden, und sie spürte sie wieder näher rücken. Die schreckliche Schwerelosigkeit, die Tiefe darunter.
Spencer ließ sich in die Frühstücksecke gleiten. Als sie seinen Teller hinübertrug, sah sie ein leeres Blatt Papier und einen Bleistift auf dem Tisch. Ihr Zeichenspiel, mittlerweile nur noch für zwei.
»Du fängst an«, sagte Sara, also begann Spencer zu zeichnen.
Sie setzte sich ihm gegenüber, das Licht fiel durch die karierten Vorhänge, die Pfanne kühlte in der vergilbten Spüle ab, die Familienzeichnung von vor Jahren hing neben dem Fenster an der Wand.
Spencer zeichnete einen bewölkten Himmel und verwischte die Bleistiftstriche mit den Fingern. Als er fertig war, reichte er ihr das Blatt. Sie zeichnete Baumkronen. »Wir müssen los«, sagte sie. »Können wir den Rest später hinzufügen?«
»Okay«, erwiderte er und befestigte es mit einem Magneten am Kühlschrank. »Oder vielleicht macht es Dad.«
»Vielleicht«, sagte sie.
Auf der Vordertreppe zogen sie ihre Schuhe an, bevor sie in unterschiedliche Richtungen zu ihrer jeweiligen Schule aufbrachen.
Sara hatte ihren Rucksack nur leicht gepackt, für den Fall, dass sie direkt wieder aufbrechen musste. Als sie gegenüber des Schulcampus aus dem Bus stieg, hoffte sie, Annie davor zu sehen – ihr lockiges braunes Haar und ihre Jeansjacke, ihre Böse-Mädchen-Haltung, die durch ihr niedliches Gesicht zunichtegemacht wurde. Du hast mir Angst eingejagt, würde Sara rufen, Annie würde ihr den Arm um die Taille schlingen, und sie würden versuchen, wie reine Freundinnen zu erscheinen. Sara stellte sich vor, wie sie an Annies Gürtelschlaufe zog. Verschwinde nie wieder, würde sie sagen. Versprich es mir.
Ich verspreche es, würde Annie antworten.
Aber sie sah nur Dave und Lily mit Crystal und Jimmy zusammengedrängt vor dem Eingang stehen. Annie war nicht dabei.
»Was sollen wir tun?«, fragte Crystal.
»Abhauen«, antwortete Dave. »Uns aufteilen und nach ihr suchen. Was für ein Blödsinn, dass meine Eltern mich hierhergebracht haben.«
»Ich sehe in der Stadt nach«, erwiderte Crystal. »Aber irgendwie hab ich Schiss. Sollten wir nicht zu zweit losgehen?«
Jimmy nickte. »Ich begleite dich.«
»Ihr zwei könnt gemeinsam suchen«, sagte Sara zu Dave und Lily. »Ich komme auch allein klar.«
»Sicher?«, wollte Lily wissen, und Sara sagte Ja.
»Ich bin mit dem Auto da. Wir können nach Monte Rio fahren«, sagte Lily zu Dave, und dieser stimmte zu.
Sara spürte die Leichtigkeit ihres Rucksacks und eine heftige und verzweifelte Hoffnung.
»Ich muss um vier bei der Arbeit sein. Wenn irgendjemand sie findet, ruft beim Motel an, okay?« Ihre Freund*innen nickten. »Ich gehe in den Wald.«
Sie fuhr allein mit dem Bus den Armstrong Drive hinauf und eilte an der Rangerstation vorbei zum Wanderweg. Sie vertraute dem Wald. All den Nachmittagen, die sie dort verbracht hatten. Und dennoch. Sie machte sich auf den Augenblick gefasst, in dem sie Annie finden würde, verletzt oder ohnmächtig, blutend oder gebrochen. Oder noch Schlimmeres. Es war neblig und kalt. Sie rief Annies Namen, doch die einzige Antwort war Schweigen. Sie stieg höher und höher und ging vom Weg ab, fand ihren Hain. Niemand war da. Sie lief wieder hinunter zum Hauptweg, nahm andere Pfade.
Sara würde sie finden – da war sie sich sicher. Sie suchte über sechs Stunden lang, und um sich zu beruhigen, stellte sie sich vor, wie Annie im Schneidersitz gegen das weiche Holz eines Baumstamms gelehnt auftauchte und bei ihrem Anblick lächelte. Sie stellte sich ihren Kuss vor, den Singsang von Annies Stimme, wenn sie Sara fragte, was denn los sei. Annie würde da sein, vollkommen heil, und die Welt wäre wieder in Ordnung, und sie würde nicht noch eine weitere geliebte Person verlieren.
Dann zeigte ihre Armbanduhr drei Uhr an. Sie würde den Wald nun verlassen müssen, um es rechtzeitig zur Arbeit zu schaffen. Also sagte sie sich, dass das Telefon klingeln würde, sobald sie das Büro des Vista Motels erreicht hätte. Am anderen Ende der Leitung wäre Dave, und er würde ihr mitteilen, sie hätten sie gefunden. Sie trat aus dem Schatten des Waldes und wartete in der Sonne auf den Bus, der sie nach Monte Rio bringen würde.
Das Vista Motel lag in der nächsten Stadt und war nicht besser oder schlechter als alle anderen. Von seinem Büro ging ein Lagerraum ab. Alle Gebäude – zwanzig Einzelzimmer und drei Suiten mit Miniküche – waren einstöckig. Die Gäste konnten direkt bis zu ihren Zimmertüren vorfahren. Und hinter den Zimmern lag ein privater Rasen mit Zugang zum Fluss für die Motelgäste. Dort saßen sie in Liegestühlen unter weißen Sonnenschirmen und nippten an ihren mitgebrachten Getränken, und wenn das Wetter warm genug war, liefen sie die Treppe hinunter zum Steinstrand und schwammen.
»Hat irgendjemand für mich angerufen?«, fragte Sara Maureen beim Hereinkommen.
Maureen saß über ein Kreuzworträtsel gebeugt und schüttelte den Kopf, ohne aufzublicken.
»Bist du dir sicher?«
»Bin seit acht Uhr früh hier. ›Sittich‹«, sagte sie und füllte die Kästchen aus. Dann griff sie nach einem Klemmbrett und reichte es Sara. Da die Hauptreisezeit vorüber war, waren nur sechs Zimmer belegt.
»Ich warte auf einen Anruf. Es ist wichtig. Wenn er kommt, während ich sauber mache, holst du mich dann?«
Maureen nickte.
Im Lagerraum zog Sara ein Paar Latexhandschuhe über. Sie fand den Mülleimer zum Rollen, der kein kaputtes Rad hatte. Schnappte sich einen Eimer mit Glasreiniger, Schwämmen, Putzmittel und Mülltüten und balancierte obendrauf noch eine Küchenrolle. Sie schob alles aus der Hintertür und in Zimmer 5. Laken und Bettdecke wurden abgezogen. Sie leerte den Mülleimer aus dem Badezimmer und den neben dem Bett. Sie nahm leere Bierflaschen von der Kommode und hob Zeitungsseiten vom Fußboden auf. Annie hatte stets vorgeschlagen, sich eines Tages in ein Zimmer zu schleichen und es nur für ein paar Stunden zu benutzen. »Klingt das nicht gut?«, hatte sie Sara ins Ohr geflüstert. »Eine verschlossene Tür? Ein Bett?«
»Glaub mir«, hatte Sara geantwortet. »An diesen Betten ist wirklich nichts verlockend.«
»Wieso nicht?«
»Die sind eklig.«
»Das sind doch bloß Menschen«, hatte Annie entgegnet. »Bloß Körper. Was ist so schlimm daran?«
Also hatte Sara erst vor ein paar Wochen, am Nachmittag von Annies sechzehntem Geburtstag, Zimmer 12 – eins der hübscheren mit Blick auf den Rasen – so gründlich sauber gemacht, wie sie konnte. Sie kaufte in der Drogerie sechs Kerzen und zog vorsichtig die Bilder von Jesus und der Jungfrau Maria ab, ehe sie sie aufstellte: eine auf jedem Nachttisch, drei auf der Kommode, eine auf dem Fernsehtisch. Sie brachte ihren Radiorekorder von zu Hause mit, dazu Alicia Keys’ letztes Album, da Annie jedes Mal mit dem Kopf nickte und sich wiegte, wenn »No One« lief.
An jenem Abend traf sie sich ein paar Blocks weiter mit Annie auf ein Eis, und als sie fertig waren, sagte Sara: »Ich habe etwas auf der Arbeit vergessen. Begleitest du mich?«
Sobald sie von der Straße weg und außer Sichtweite waren, ergriff Sara ihre Hand. »Bist du bereit für dein Geschenk?«, fragte sie.
Annie lief rot an.
Maureen hatte ihr bereits den Zimmerschlüssel gegeben, also führte Sara Annie direkt auf die Tür zu und ließ sie hinein. Sie zündete die Kerzen an. Sie schaltete die Musik an. Sie öffnete den Minikühlschrank, wo eine halbe Flasche Rosé auf sie wartete, die ein Paar an jenem Morgen in seiner Suite zurückgelassen hatte, und teilte den Wein auf die beiden Plastik-Stielgläser auf, die das Motel den Gästen zur Verfügung stellte. Dann drehte sie sich um, sah, wie Annie sie mit glänzenden Augen beobachtete, und war überwältigt. Auf solche Weise angeschaut zu werden. Von diesem wunderschönen Mädchen geliebt zu werden. Sie hätte die Fassung verlieren können, hätte Annie nicht genau in diesem Augenblick einen Schritt nach vorn gemacht, die Hände in Saras Haar vergraben und sie geküsst.
Der Abend war perfekt. Nun, fast. Es gab jenen Moment, in dem Sara Annie in der Ellenbeuge küssen wollte und das winzige Mal dort entdeckte. Ihr wurde kurz schwindelig, und sie fühlte sich den Tränen nah, bis sie sich sagte, es wäre nichts. Nicht wie bei ihrem Vater oder seinen Freunden, und schon gar nicht wie bei ihrer Mutter. Vielleicht war es ein Kratzer. Es hatte nichts zu bedeuten.
Wo war sie? Sie fuhr mit dem Staubsauger durchs Zimmer. Dave musste mittlerweile etwas gehört haben. Sie würde den Müll wegbringen und dann bei Maureen vorbeischauen. Vielleicht war der Anruf gekommen, als diese gerade mit einem Gast beschäftigt gewesen war. Oder womöglich hatte Maureen sie nicht ernst genommen, als sie sagte, es sei wichtig. Sie ging um die Ecke zum Müllcontainer und fuhr vor Schreck zusammen. Dort stand ein Junge, nur wenige Jahre älter als sie, knietief im Müll.
Er erstarrte und beäugte sie argwöhnisch. Er hatte fettiges Haar, das ihm in die Augen fiel. Seine Kleidung war schäbig, aber da das gerade in Mode war, sagte es ihr nicht viel über ihn.
»Hey«, sagte er.
»Eklig«, sagte sie.
Er entspannte sich und grinste. Sie sah, dass von seinem rechten Vorderzahn eine Ecke abgebrochen war. »Diese Zeitschriften hier sind noch vollkommen in Ordnung«, erklärte er und zeigte ihr, was er gefunden hatte.
Sie verdrehte die Augen und leerte ihren Mülleimer. Er machte Anstalten, den neuen Abfall zu begutachten. »Nichts Gutes dabei«, sagte sie und rollte den Eimer zurück auf die Hausecke zu.
»Hey, warte mal«, rief er. Sie drehte sich ungeduldig um, während er sich aus dem Müllcontainer hievte. »Ich habe mich gefragt … wäre es vielleicht möglich, dass ich in einem der Zimmer, die du noch nicht sauber gemacht hast, duschen gehe? Ich mach auch ganz schnell.«
Zuerst wollte sie Nein sagen, aber dann sah sie die Hoffnung in seinem Gesicht, und sie befeuerte ihre eigene. Sie würde ihn die Dusche benutzen lassen. Sie würde vor der Tür warten. Und während sie diese gute Tat vollbrachte, während sie einem Menschen in Not half, würde Dave anrufen, um ihr zu sagen, dass sie sie gefunden hätten.
Aber obwohl sie es tat und der Junge sich hinterher mit nassem Haar und sauberem Gesicht bei ihr bedankte, rief Dave nicht an. Und als sie nach einer Stunde noch einmal nachhakte, hatte er nach wie vor nicht angerufen. Als die Laken im Trockner waren und sie erneut ins Büro kam, lief Maureen um den Empfangstresen herum.
»Süße«, sagte sie. »Ich kenne dich. Du würdest nicht sagen, etwas wäre wichtig, wenn es das nicht wäre. Sollte irgendjemand für dich anrufen, bin ich aus dieser Tür raus und brülle deinen Namen, noch bevor die Person fertig Hallo gesagt hat. Verstanden?«
»Okay«, sagte Sara.
»Möchtest du darüber reden?«
»Nein«, antwortete sie. »Aber danke.«
Sie konnte es nicht in Worte fassen. Noch nicht. Sie wollte Maureen so behalten, wie sie war – ihr schwarz gefärbtes Haar und ihre tief ausgeschnittenen Oberteile, stets professionell und freundlich, die Art von Chefin, die ihr erst vor zwei Wochen den Schlüssel zu Zimmer 12 gegeben hatte, ohne Fragen zu stellen. Sie wollte nicht hören, was Maureen dachte, oder zusehen, wie ihr Gesichtsausdruck besorgt wurde. Sie wollte einfach nur, dass das Warten vorbei wäre. Sie wollte die Angst aus ihrem Körper bekommen.
Als sie also aus dem Fenster von Zimmer 20 erneut den Jungen sah, der diesmal schamlos auf einem der Liegestühle unter einem weißen Sonnenschirm saß und durch die Seiten einer Zeitschrift blätterte, sagte sie sich, sobald sie das letzte Bett gemacht hätte und sofern er dann noch nicht verschwunden wäre, würde sie hinausgehen und sich zu ihm setzen.
Als sie sich näherte, winkte er ihr zu.
»Was machst du da?«
Er zuckte mit den Achseln. »Das, was man hier machen soll, oder?«
»Schon, wenn man ein zahlender Gast ist.«
»Willst du mich rauswerfen?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Dann setz dich zu mir.«
Sie ließ sich auf den benachbarten Stuhl sinken, jedoch erst, nachdem sie ihn ein paar Zentimeter von seinem weggerückt hatte. Sie war blond und hübsch. Groß wie ihr Vater. Sie war daran gewöhnt, sich in Acht zu nehmen, damit Jungs und Männer nicht auf falsche Gedanken kamen. Aber irgendetwas an diesem Jungen sagte ihr, dass er in Ordnung war.
»Ist echt nett hier«, bemerkte er. »Ich kann nicht glauben, dass hier tatsächlich jemand lebt. Es ist wie ein Paradies.«
»Na ja.«
»Machst du Witze? Ich meine, sieh dich doch um.«
»Nein, ich weiß«, beschwichtigte sie. »Es ist wunderschön, ich weiß.« Sie verstand, weshalb die Leute herkamen und sich niederließen, wo sie beide gerade saßen. Der Fluss, die Mammutbäume – sie versetzten auch sie in Staunen. »Was machst du überhaupt hier?«, fragte sie.
»Bin auf dem Weg nach LA, aber ich brauche neue Zündkerzen.«
»Ein paar Blocks weiter ist eine Werkstatt.«
»Ja. Da meinten sie, sie könnten sie in einer Stunde auswechseln, aber ich bin gerade knapp bei Kasse. Hast du eine Ahnung, wo ich kurzfristig einen Job bekommen könnte? Es ist bloß ein Civic. Kostet nicht viel, ihn zu reparieren.«
Sara zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung.«
»Na ja, hier«, sagte er. Er schrieb etwas an den Rand einer Zeitschriftenseite, riss sie heraus und faltete sie zusammen. »Rufst du mich an, wenn du was hörst?«
»Okay.« Sie verdrehte die Augen und steckte den Zettel ein.
Sie wusste nicht, was sie empfinden sollte, als sie die Autos vor dem Haus sah. Ob ein weiteres Abendessen allein mit Spencer besser wäre oder ob die lauten Stimmen ihres Vaters und seiner Freunde ihre Angst übertönen mochten.
Aber obwohl sie im Wohnzimmer waren, als sie hereinkam, lag eine Stille über dem Haus. Im Fernsehen liefen auf niedriger Lautstärke die Lokalnachrichten.
Zwei Typen, Brüder, deren Namen sie ständig verwechselte, saßen vor dem Fenster und spielten Karten. Als sie das Zimmer betrat, hoben sie kurz den Blick, senkten ihn dann jedoch gleich wieder auf ihre Hände. Die beiden redeten nie mit ihr. Aber auf dem Sofa saß Eugene.
»Hey«, sagte er. »Hey, Sara. Komm, setz dich.«
Er klopfte auf das Polster neben sich, und Sara ließ sich darauf sinken, wobei sie merkte, wie müde ihr Körper vom Suchen und Saubermachen war. Sie beugte sich vor und stützte den Kopf auf den Händen ab.
»Ich krieg dich kaum noch zu Gesicht. Wirst erwachsen und hast keine Zeit mehr für mich, oder was?«
Sie kannte Eugene schon ihr ganzes Leben. Ihre Mutter und seine Frau waren beste Freundinnen gewesen, aber dann war ihre Mutter gestorben, und Eugenes Frau hatte ihn verlassen.
»Meine Freundin ist verschwunden«, sagte Sara, das Gesicht noch immer vergraben, die Augen noch immer geschlossen.
»Verschwunden«, erwiderte Eugene. »Hm.«
Erneut legte sich Schweigen über den Raum, irgendeine Anspannung, die jedoch nichts mit Sara zu tun hatte. Sie war zu erschöpft, um sich darüber Gedanken zu machen. »Wir haben überall gesucht.«
Sie spürte eine Gewichtsverlagerung auf dem Sofa. Als sie die Augen öffnete, war er immer noch da und hatte ein neues Bier in der Hand. »Na ja.« Er nahm einen Schluck. »Sie taucht schon wieder auf.« Ein weiterer Augenblick verstrich. »Du weißt, dass du jederzeit zu mir kommen kannst, wenn du irgendetwas brauchst, oder?«
Sie blickte zu ihm auf und nickte.
»Gut«, sagte er und tätschelte ihr den Rücken.
In diesem Augenblick leuchtete das Blaulicht eines Streifenwagens an der Wand auf.
»Dieser Scheiß-Larry«, bemerkte einer der Kartenspieler am Fenster. Sie lauschten, wie die Autotür zugeschlagen wurde und Larrys Schritte den Weg heraufkamen. Die Männer wurden angespannt, wie jedes Mal, wenn er vorbeischaute. Sie waren zusammen aufgewachsen, aber Larrys Uniform trennte sie voneinander.
Saras Dad öffnete die Tür, bat ihn jedoch nicht herein. »Was kann ich für dich tun?«
»Hey, Jack. Wir suchen nach einer Freundin deiner Tochter. Ich habe ein paar Fragen an sie.«
»An Sara?«
»Ist sie hier?«
Ihr Vater machte einen Schritt zur Seite, um Platz für sie im Türrahmen zu schaffen.
Sara beantwortete die Fragen des Polizisten – wann sie Annie zum letzten Mal gesehen habe, ob sie noch wisse, welche Kleidung Annie getragen habe. Sie erinnerte sich natürlich an alles, da sie noch immer nur Augen für Annie hatte, auch nach mehr als zwei Jahren zusammen. Wenn Larry sie nach ihrer Beziehung gefragt hätte, hätte sie ihm die Wahrheit gesagt. Sie wusste nicht genau, warum sie es geheim hielten. Ein paar Kids in der Schule hatten sich geoutet, und es war nicht furchtbar für sie. Aber Annie und sie hatten sich an die Heimlichkeit gewöhnt. Etwas Heiliges, nur zwischen ihnen beiden. Sie wollten es für sich behalten.
»Sind dir irgendwelche riskanten Aktivitäten bekannt, in die Annie involviert sein könnte?«
Annie im Kerzenschein, das Mal auf ihrem Arm. Vielleicht sollte sie es ihm sagen. Aber vielleicht war es auch nichts, Sara konnte es nicht sicher wissen. »Nein«, antwortete sie und hoffte, Larry würde ihr glauben.
»Irgendwelche Drogen?«
Es war nichts gewesen. Sara schüttelte den Kopf.
Larry wandte sich an Jack. »Weißt du aus irgendeinem Grund mehr?«
Der Gesichtsausdruck ihres Vaters war unbeteiligt. Sein Tonfall so ruhig wie immer. »Woher zum Teufel sollte ich denn was darüber wissen?«
»Ich will mich nur vergewissern.«
Larry brach auf, und ihr Vater, Eugene und die anderen Typen machten eine weitere Runde Bier auf. Sara schaute nach Spencer, der am anderen Ende des Flurs fest schlafend in seinem Bett lag. Sie schnappte sich den Ersatzschlüssel aus der Küchenschublade und blieb im Wohnzimmer stehen.
»Ich brauche mal kurz den Truck. Okay?«
Ihr Vater nickte knapp. »Pass auf da draußen«, sagte er.
Sie fuhr eine Meile durch die Dunkelheit, bis sie The Pink Elephant erreicht hatte. Sie waren zu jung, um eingelassen zu werden, trotzdem trafen sie sich an den meisten Abenden unter dem Neonlicht der Leuchtschrift. Sie würde dort auftauchen und warten, und ihre Freund*innen würden Neuigkeiten zu berichten haben, und alles wäre wieder gut.
Beim Näherkommen sah sie, dass Dave mit der Stirn auf den Knien am Bordstein saß. Lily hatte den Arm um ihn gelegt, während Jimmy ununterbrochen redete, wie immer, wenn er nervös war.
»Sie werden den Fluss absuchen«, sagte Dave, als sie die drei erreicht hatte.
Zuerst fielen ihr nur seine geschwollenen Augen auf, wie krank er aussah, wie stark ein Mensch in nur so wenigen Stunden verkümmern konnte. Und dann: sein Mund, der dieselbe Form hatte wie Annies und genauso weich war. Sara dachte, vielleicht könnte sie die Augen schließen und ihn küssen, und wenn sie die Augen wieder öffnete, hätte er sich in seine Schwester verwandelt.
Und dann fragte sie: »Was?«, und er wiederholte: »Sie werden den Fluss absuchen.«
Sie presste die Hände gegen die Augen, bis es zu schmerzhaft wurde. Dort saßen sie beisammen, ganz still, unter dem pinkfarbenen Neonlicht der Leuchtschrift. »Das verstehe ich nicht«, sagte sie.
»Es wirkt zu früh, oder?«, erwiderte Jimmy und steckte die Hände in die Hosentaschen. »So lange ist sie doch noch gar nicht verschwunden. Ich weiß nicht, wieso sie das so früh machen sollten. Ist wahrscheinlich ein Fehler, oder? Ich meine, warum gleich vom Schlimmsten ausgehen? Seid ihr sicher, dass die Krankenhäuser sich nicht geirrt haben?«
»Sie werden den Fluss absuchen«, wiederholte Sara.
Lily wischte sich die Augen und blickte Sara an. Sie nickte ernst.
Jimmy fing erneut an: »Es muss ein Irrtum sein. Wie können sich alle so sicher sein, dass sie nicht irgendwo im Krankenhaus liegt?«
»Weil wir uns verdammt noch mal sicher sind, okay, Jimmy?«, fuhr Dave ihn an. »Wir haben jedes einzelne Krankenhaus angerufen. Wir haben überall gesucht. Wir sind uns hundertprozentig sicher, verdammt.«
»Sorry«, erwiderte Jimmy. »Okay. Tut mir leid.«
Lily faltete die Hände und senkte den Kopf zum Gebet.
Nachdem Saras Mutter gestorben war, kehrten sie nach Hause zurück, nun zu dritt. Ein kleiner Junge, quasi noch ein Kleinkind, das sich schon beim geringsten Kummer kaum trösten ließ: geronnene Milch, die aus dem Glas plumpste, ein Loch in seiner Socke, ein verschwundenes Spielzeug. Ein Mann, der mit seinen Freunden scherzte und lachte, aber nachts in seinem Schlafzimmer so heftig heulte, dass er damit seine Kinder aufweckte. Ein zwölfjähriges Mädchen, ganz zart und zerrissen. Es tat weh, etwas zu essen, und es tat weh zu hungern. Jede wache Minute war voller Verzweiflung, aber von der Reglosigkeit wurden ihre Muskeln wund.
Dann kam Spencer eines Nachts zu ihr ins Zimmer und rutschte an ihren Körper. Sie war es gewohnt, ihm nah zu sein, ihm durchs Haar zu fahren, wenn er weinte, ihn auf die Stirn zu küssen. Aber nun war es anders. Er vergrub sein Gesicht zwischen ihren Schulterblättern. Sie spürte, wie sein Bauch sich an ihrem Rücken hob und senkte. Spürte das synchrone Klopfen ihrer Herzen.
Er braucht mich. Er braucht mich. Er braucht mich.
Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn.
Er holte sie zurück ins Leben.
Als sie vom Parkplatz des Pink Elephant zurückkehrte, waren die Freunde ihres Vaters fort, und sie ging in Spencers Zimmer und kletterte zu ihm ins Bett.
»Hey«, murmelte er.
»Darf ich hier schlafen?«, fragte sie. Den Fluss. Es ging ihr nicht aus dem Kopf.
Er nickte, und sie drehte sich um. Sie rutschte sich zurecht, bis sie seinen Bauch an ihrem Rücken spürte. Sie wartete auf seinen Atem. Sie wartete auf seinen Herzschlag. Sie hoffte, er würde noch immer die Macht haben, sie zu heilen. Aber ihre Furcht war etwas Wildes, Gefährliches. Sie erschütterte ihren Körper. Spencer bemerkte es nicht. Sobald er wieder eingeschlafen war, ging sie zurück in ihr Zimmer.
Krankenhaushemd mit Rautenmuster. Pinkfarbener Nagellack. Die Schnecke und die Mammutbäume. Wie es sich anfühlte, gehalten zu werden, und hinterher. Hoffnung, die ausgehöhlt wurde.
Die Panik wurde so mächtig, dass sie sich beinahe krümmen musste und nicht wusste, wie sie stillhalten sollte. Ihr Zimmer schien zu groß für sie, gefüllt mit zu viel Luft. Sie brauchte eine Begrenzung. Sie holte ein paar Kisten aus ihrem Schrank, um Platz zu schaffen, und trug ihr Bettzeug hinein. Dann schob sie die Tür zu und schrie in ihr Kissen. Sie legte sich in die Dunkelheit, Shirts und Kleider, die ihr zu klein geworden waren, über ihr baumelnd. Sie wollte dort bleiben, fühlte sich nun sicherer, aber es klopfte an ihre Schlafzimmertür.
Davor wartete ihr Vater. Er blickte an ihr vorbei ins Zimmer: auf ihr nacktes Bett und die Decken, die aus dem Schrank quollen.
»Du schläfst da drinnen?«, fragte er.
Die Furcht hatte sie schutzlos gemacht, und hier war ihr Vater, und sie wollte die Wahrheit sagen.
»Ich habe Angst«, sagte sie. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter. Er hatte sie lange nicht mehr angefasst. Sie spürte das Beben einer Erinnerung, etwas längst Vergrabenes – eine Zeit vor Spencer, vor dem Tod, als sie ein kleines Mädchen war, das mit seinen Eltern im hellen Sonnenschein am Ufer eines Flusses lachte.
Eine Zeit, bevor sie wusste, dass der Fluss einen Menschen ganz verschlingen konnte.
Sie sagte: »Morgen früh werden sie den Fluss absuchen.«
Als sie ihn erneut ansah, waren seine Wangen feucht und seine Augen geschlossen.
»Dad«, sagte sie. »Lass uns nach ihr suchen, ja? Lass uns losfahren und sie finden.«
Sie spürte die Wärme seiner Hand und wusste, dass er ihr helfen konnte. Aber dann drückte er ihre Schulter und ließ sie los. »Hör zu«, erwiderte er. »Mädchen in deinem Alter – die verschwinden nicht einfach. Sie ist fort, und das war’s.«
»Nicht Annie.«
Er saugte den Atem ein und richtete seinen Blick in den dunklen Flur. Sie wollte, dass er stattdessen sie anschaute. Hatte das Gefühl, sie könnte sich in Luft auflösen, während er nicht hinsah. Bleib bei mir, wollte sie bitten. Hilf mir, das hier zu überstehen.
»Ich lebe schon lange in dieser Stadt«, sagte er. »Ich habe selbst Freunde verloren. Man macht einfach weiter. Das wirst du noch lernen.«
Aber Annies Lippen, die ihre küssten. Annies Kopf in ihrer Halsbeuge.
»Wir sind mehr als nur befreundet«, erklärte sie, und sein Blick schnellte überrascht zurück zu ihr.
Sie versuchte es erneut. »Hilf mir, sie zu finden.«
Er drehte sich um und lief in den vorderen Teil des Hauses. Sie sagte sich, er suche bestimmt nach seinem Schlüsselbund. Oder setzte Kaffee auf, um sie auf der Fahrt wach zu halten. Er holte seine Schuhe und würde zurückkommen und sagen: Los geht’s. Sie wartete und stellte es sich vor – wie es sich anfühlen würde, nicht allein zu sein.
Sie ging auf die Toilette, kehrte in ihr Zimmer zurück und war davon überzeugt, ihn dort wartend und zum Aufbruch bereit anzutreffen. Aber er war nicht da. Er war auch nicht im Wohnzimmer.
Er war fort.
Sie ging in der Küche das Licht ausmachen und bemerkte etwas Vertrautes auf dem Tisch. Spencers verwischte Wolken, Saras Mammutbäume. Und nun auch ein Fluss, mit einem Mädchen – Annie –, das mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb. Sara schnappte nach Luft, ließ die Zeichnung fallen, wollte nicht hinsehen. Aber das Bild hatte sich ihr eingebrannt. Annies lockiges Haar, ihre Jeansjacke, all die sorgfältigen Striche ihres Vaters.
Sie kehrte in den Schrank zurück und schloss sich ein.
Früh am nächsten Morgen versammelten sie sich auf Annies Veranda – Sara, Dave, Crystal, Jimmy und Lily. Das Boot fuhr in Monte Rio los und arbeitete sich langsam voran. Niemand von ihnen hatte geschlafen. Es gab nichts zu sagen.
Sie hatten es schon zuvor miterlebt. Jeden Sommer strömten Tourist*innen herbei, die meisten von ihnen College-Kids mit Flößen und Schwimmreifen und zu viel Alkohol. Sie überfüllten ihre Straßen, hinterließen Müll an ihren Stränden, und alle paar Jahre ertrank eine*r von ihnen. Sara hatte bereits gesehen, wie Leichname an Haken aus dem schlammigen Wasser gezogen wurden, aber es war niemals der Leichnam einer Person gewesen, die sie kannte.
Lily saß neben Dave und hielt seine Hand. Crystal und Jimmy hockten zusammengekauert unter einer Decke. Sara stand hinter den anderen und biss sich die Nägel herunter, bis ihre Finger bluteten. Dann tauchte in der Ferne das Boot auf, warf den Haken aus und zog ihn wieder herauf. Dave und Annies Eltern waren auf dem Boot, und Sara wusste nicht, was schlimmer wäre – die Augen zusammenkneifen müssen, um etwas zu erkennen, oder viel zu nah dran sein.
Sie warteten darauf, dass das Boot an ihnen vorbeiführe, aber das tat es nicht. Mehrere Häuserlängen entfernt kam es zum Stehen, nah genug, um zu erkennen, dass die Personen an Bord sich auf einer Seite versammelten und über den Rand auf etwas hinunterblickten.
Der riesige Haken wurde hinabgelassen, und Dave stöhnte und begann, vor und zurück zu schaukeln. Lily sagte: »Schschsch, ist schon gut, ist schon gut.« Vom Boot drangen Schreie zu ihnen, und der Haken hob Annie aus dem Wasser.
Die Gesichter ihrer Freunde, rot, feucht und verquollen. Die Panik in Daves Augen, die Leere in Crystals. Wie sehr Jimmy und Lily sich bemühten, die anderen zu trösten, bis Jimmy an den Rand der Veranda eilte, um sich zu übergeben, und Lily hineinging und zu Hause anrufen wollte, aber ihre eigene Nummer vergaß. Sara blieb ganz still, während alles um sie herumschwirrte. Das Schluchzen, das über den Fluss getragen wurde. Die Krümmung von Annies baumelndem Körper, das Wasser, das aus ihrer Kleidung und ihrem Haar strömte.
Sie schmeckte Blut, bemerkte, dass sie schon wieder an ihren Fingern herumbiss, und schob sie in die Hosentasche.
Darin stieß sie auf einen zusammengefalteten Zettel. Sie zog ihn heraus und faltete ihn auseinander. Sah zum ersten Mal den Namen des Jungen: Grant.
Grant mit seinem reparaturbedürftigen Wagen. Der Wagen, der sie von hier wegbringen konnte. Weg von der Stimme von Lilys Vater, der mittlerweile hier war und betete. Weg von Daves Schnappen nach Luft, das ihr jedes Mal einen Stich ins Herz versetzte. Weg von dem Abgrund, der sie verschlucken würde, wie damals, als sie ihre Mutter verloren hatte.
Sie sah ihren Vater mit gesenktem Blick im dunklen Flur stehen.
Die Zeichnung, die er für sie hinterlassen hatte – zu grauenvoll, um sie zu begreifen.
Sie konnte nicht bleiben. Nicht hier, in dieser Stadt, die Menschen raubte.
Sie ging durch das Haus zur Tür.
Es war noch früh am Morgen. Sie nahm den Bus zum Motel. Sie entdeckte einen Honda Civic am Straßenrand, und als sie nah genug war, um hineinzublicken, atmete sie aus. Er war da, noch am Schlafen, die Beine eingezogen wie die einer Papierpuppe, der Mund geöffnet.
Sie klopfte ans Fenster. Er fuhr zusammen, sah sie, setzte sich auf.
»Habe gerade meinen Schönheitsschlaf gehalten.«
»Ich komme mit«, sagte sie. »Wir müssen noch heute los.«
Sie wartete mit ihrem Rucksack auf dem Gehweg, während Grant sich mit dem Mechaniker unterhielt. »Sie müssen erst noch eine andere Reparatur abschließen, daher wird es ein paar Stunden dauern«, sagte er, als er herauskam. Sie hatte keine paar Stunden Zeit, da sie das Bedürfnis verspürte, sofort loszufahren, aber sie hatte ihm Geld versprochen und würde es besorgen müssen. Zuerst hatte sie an Maureen gedacht. Sie wusste, dass ihre Chefin ihr das Geld geben würde, wenn sie es brauchte, aber sie wusste auch, dass Maureen versuchen würde, sie zum Bleiben zu überreden. Lily hatte immer ein wenig Bargeld von ihrer Arbeit in der Kirche, aber Sara konnte es nicht ertragen, ihre Freund*innen so schnell wiederzusehen, ihre tränenbefleckten Gesichter, die ihr eigenes gebrochenes Herz spiegelten. Sie dachte, womöglich würde sie sie nie wieder ansehen können.
Damit war die Entscheidung gefallen. Es blieb nur noch ein Mensch übrig.
Sie führte Grant die Main Street hinunter, ehe sie in eine schmalere Straße abbogen. Es war lange her, seit sie das letzte Mal zu Eugene gelaufen war. Sie hoffte, dass er es ernst gemeint hatte, als er behauptete, er würde ihr helfen.
Als Sara klein war, hatte ihre Familie dort die Wochenenden verbracht, ihre Eltern hatten auf Eugenes Terrasse mit Blick auf den Fluss Bier getrunken, und Sara hatte Spencer an der Hand die Holztreppe von Eugenes Haus hinunter zum Kiesstrand geführt. Schon vor Spencers Geburt lagen Sara und ihre Mutter manchmal auf Eugenes Steg und ließen sich die Haut von der Sonne wärmen.
All das kam ihr in den Sinn, als sie nun auf das Haus zuschritt, auch die Tabletts mit Snacks, Chips und Melonenscheiben, die Eugenes Ex-Frau ihnen hingestellt hatte, und sie fragte sich, wohin diese nach dem Tod von Saras Mutter verschwunden war, weshalb sie kein Teil ihres Lebens geblieben war. Sie hatten den Fluss beinahe erreicht, und Sara wollte nicht hinsehen. Sie war froh, dass sie ihn hinter den Bäumen kaum ausmachen konnte.
Die Tür schwang auf, und im Rahmen stand Eugene, allein, genau wie erhofft.
»Sara.« Er kniff die Augen zusammen.
»Ich brauche Hilfe«, sagte Sara.
»Komm rein«, erwiderte er. »Du auch, wer immer du bist.«
Sie traten ein, und Eugene schloss die Tür. Die Wände aus Rotholz, der Zottelteppich, die Glasschiebetüren zur Terrasse. Sara hatte gewusst, dass ihr all das vertraut sein würde, aber es war mehr als das. Sie konnte beinahe die Stimme ihrer Mutter hören. Es verschlug ihr fast den Atem.
»Also, erzähl. Was ist los?«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.