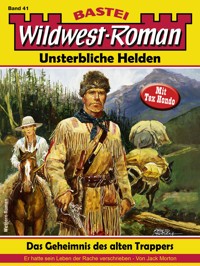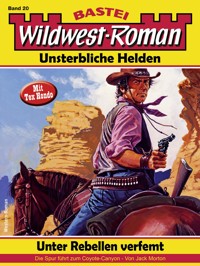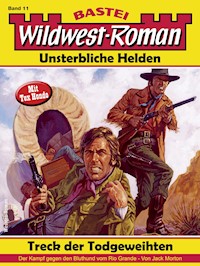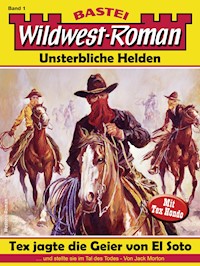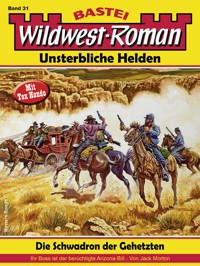
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden
- Sprache: Deutsch
Unter der Führung des berüchtigten Banditen Arizona-Bill Gannon zogen sie eine blutige Fährte durchs Land und verbreiteten Angst und Schrecken. Denn sie waren keine richtigen Soldaten, sondern eine wilde, unbändige und zügellose Horde von Geächteten. Unerbittlich wurden sie gejagt, aber sie waren wie ein Spuk. Urplötzlich tauchten sie aus dem Nichts auf, vollführten ihre grausamen Taten und verschwanden dann wieder in der Weite des Landes, als wären sie nie da gewesen. Trotz allem hatte sich Tex Hondo an ihre Fersen geheftet, um die Gauner vor ein ordentliches Gericht zu bringen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Schwadron der Gehetzten
Vorschau
Impressum
Die Schwadron der Gehetzten
Von Jack Morton
Sie standen sich in zehn Schritt Entfernung gegenüber: Henry Jones, der älteste Sohn des Mesteneros Paul Jones, und Stephen Tabor, der älteste Sohn des Großranchers Abraham Tabor.
»Du dreckiger Pferdezüchter!«, sagte Tabor gerade mit beißendem Spott in der Stimme. »Du hättest dich besser nicht mit mir angelegt. Jetzt kannst du dein letztes Gebet sprechen.«
Henry Jones nickte nur düster. Er war groß und schlank wie Tabor, wirkte aber in seiner abgerissenen Kleidung erbärmlich gegen den Sohn des reichen Ranchers, der einen Dreißig-Dollar-Stetson, ein blütenweißes Hemd und eine Nankinghose aus bestem Tuch trug. Der Revolverkolben, der aus einem tiefhängenden Holster ragte, besaß Griffschalen aus Elfenbein, das durch vier Kerben »verziert« war. Stephen Tabor war stolz darauf, dass er vier Männer getötet hatte, im fairen Duell.
Allerdings wusste jeder der Zuschauer auf der Mainstreet von Timber Crossing, dass der Mustangjäger kaum mehr Chancen hatte als ein Schneeball in der Llano Estacado um die Mittagsstunde.
Stephen Tabor galt als der schnellste Revolverschütze auf mehrere hundert Meilen im Umkreis, und seit einem halben Jahr war er richtig schießwütig.
Die meisten Männer gingen ihm aus dem Weg, weil er immer wieder versuchte, einen Streit anzufangen. Henry Jones war ihm nicht ausgewichen. Dazu war er zu stolz.
»Nun, hat es dir die Sprache verschlagen?«, höhnte Tabor. »Willst du nicht doch lieber die Beleidigungen zurücknehmen, die du mir vorhin an den Kopf geworfen hast?«
»Möchtest du, dass ich um mein Leben winsele, Stephen?«, fragte Jones ruhig zurück. »Nein, Amigo, hier geht es immerhin um die Ehre meiner Familie.«
Tabor lachte.
»Es geht um deinen kleinen Bruder Alamo, nicht um die ganze Familie. Mir wäre es viel lieber, wenn er jetzt vor mir stünde. Dann könnte ich es ihm für alle Zeiten austreiben, meiner Schwester noch einmal schöne Augen zu machen. Aber tröste dich, Henry, er wird dir bald in der Hölle Gesellschaft leisten. Ich werde es niemals zulassen, dass er noch einmal seine dreckigen Finger an meine schöne Schwester legt. Sie hat etwas Besseres verdient.«
»Du redest zu viel«, sagte Henry Jones gelassen.
Er war innerlich sehr ruhig und ausgeglichen, und das resultierte daraus, dass er sich nicht die geringste Chance gegen Tabor ausrechnete. Er hatte mit dem Leben abgeschlossen und wollte es wie ein Mann beenden.
Stephen Tabors Augen wurden schmal. Plötzlich knickte er in der Hüfte leicht ein, und die Rechte fiel auf den Kolben.
Henry Jones zog ebenfalls. Er war langsamer als Tabor, und dessen Kugel traf ihn in die Brust.
Der Mustangjäger schwankte, blieb aber auf den Beinen. Er hob die Waffe und feuerte auf Tabor. Der begriff zu spät, dass sein Gegner noch nicht endgültig erledigt war.
Jones schoss zweimal. Dann lag Stephen Tabor im Staub, und mit dem Blut rann auch das Leben unaufhaltsam aus seinem Körper.
Jones wankte auf ihn zu, den rauchenden Revolver in der Faust. Stumm sah er auf den Gegner hinab, dessen gebrochene Augen in den wolkenlosen Himmel starrten.
Pete Dawson, Revolver-Pete genannt, stürmte heran. Er war bei seinem Mädchen gewesen und hatte zu spät von dem Duell gehört. Er warf einen kurzen Blick auf den Toten und hob dann langsam den Kopf.
Mit einem seltsamen Blick sah er Jones an.
»Er wollte es so«, sagte der Mestenero schwer.
Die Kugel steckte in seiner Schulter. Es war ein Wunder, dass er immer noch stand.
Revolver-Pete sah ihn ungläubig an. »Ja, du hast gewonnen, Jones«, erwiderte er. »Aber du wirst nicht viel Freude daran haben. Wenn du kannst, dann reite tausend Meilen weit. Der alte Löwe wird nicht eher ruhen, bis er deinen Skalp hat.«
»Um meine Gesundheit brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Amigo«, sagte Henry Jones und wandte sich ab.
Pete Dawson zügelte sein schweißnasses Pferd auf dem großen Ranchhof. Er war kaum abgesessen, als der Rancher auf die Veranda trat.
Abraham Tabor war ein großer, breitschultriger Mann von knapp fünfzig Jahren. Ein mächtiger grauer Schnurrbart verdeckte seine Lippen.
»Du bist allein, Pete?«, fragte er. Er besaß eine tiefe, grollende Stimme, die selbst dann noch weithin zu hören war, wenn er leise sprach.
Revolver-Pete hatte sich eine schöne Rede zurechtgelegt. Aber nun vergaß er mit einem Schlag alles, was er sich vorgenommen hatte.
»Ihr Sohn ist tot, Boss«, sagte er nur.
Abraham Tabor stand da, als habe ihn der Blitz getroffen. Diese Nachricht war für ihn so unfassbar, dass er lange brauchte, bis er sie verdaut hatte.
Revolver-Pete fühlte sich verdammt unbehaglich. Er hatte mit einem Aufschrei von Seiten des Ranchers gerechnet, mit Flüchen und wilden Drohungen. Das alles wäre nicht so schlimm gewesen wie dieses Schweigen. Und nach einer Zeit, die Revolver-Pete wie eine Ewigkeit vorkam, fragte Tabor: »Wer hat das getan?«
»Henry Jones, Boss.«
»Warum?«
»Sie sollen sich gestritten haben. Wegen der Sache mit Alamo Jones und Ihrer Tochter. Stephen soll gesagt haben, Sarah wäre zu schade für einen dreckigen Mestenero.«
»Da hatte er auch vollkommen recht«, sagte der Rancher. »Und wo warst du, als es geschah, Pete Dawson?«
»Ich kam zu spät, Boss.«
»Wo du warst, habe ich gefragt?«
»Bei – bei meinem Mädchen.«
»Mit diesem verdammten Saloonflittchen hast du dich rumgetrieben!«, donnerte Tabor. »Du hast dir einen schönen Tag gemacht, während mein Junge erschossen wurde! Das wirst du mir büßen, Revolvermann.«
»Boss«, sagte Revolver-Pete mit leiser, warnender Stimme. »So dürfen Sie nicht mit mir sprechen. Stephen war alt genug, um sich selbst verteidigen zu können. Er brauchte keine Amme, die auf ihn aufpasste, und das hat er mir auch mehr als einmal gesagt. Jedes Mal, wenn ich mich in seiner Nähe blicken ließ, hat er mich weggeschickt.«
»Wie lautete mein Befehl?«
»Ich sollte ihn nicht aus den Augen lassen«, antwortete Pete wahrheitsgemäß.
Inzwischen hatten sich weitere Männer auf dem Ranchhof versammelt. Sie ahnten, was nun kommen würde, und bedauerten Revolver-Pete jetzt schon. Allerdings überwog bei den meisten die Schadenfreude. Revolver-Pete nahm schon seit Langem eine bevorzugte Stellung auf der Ranch ein. Er brauchte niemals hart zu arbeiten wie die anderen. Seine einzige Aufgabe war es immer gewesen, Stephen Tabor, den Lieblingssohn des Ranchers, auf seinen Ausflügen zu begleiten. Nun hatte er versagt. Er stand da und musste auf seine Strafe warten, die mit Sicherheit nicht niedrig sein würde.
Der Rancher ging ins Haus zurück. Pete und die Cowboys warteten schweigend. Als Tabor zurückkam, hatte er seinen Revolvergurt umgeschnallt und hielt den kurzen Stiel einer Bullpeitsche in der Linken.
Revolver-Pete wurde bleich. Seine Hand zuckte zum Kolben, aber er bekam die Waffe nur halb aus dem Holster.
Die lange geflochtene Lederschnur zischte durch die Luft und schlang sich um sein Handgelenk.
Pete schrie auf und ließ den Colt fallen.
»Ich sollte dich erschießen, du Versager!«, tobte der Rancher. »Ah, du hättest mich gern umgebracht, wie? Dafür werde ich dich zerbrechen, du Hund! Sattelt die Pferde, Männer! Wir reiten zur Stadt. Die Leute dort sollen sehen, wie man auf der Tabor-Ranch mit Deserteuren umgeht.«
Revolver-Pete wollte zu seinem Pferd, aber Tabor hielt ihn zurück.
»Du brauchst kein Pferd, Pete Dawson«, sagte er kalt. »Die fünfzehn Meilen bis Timber Crossing wirst du auch so schaffen. Oder sollte ich mich vielleicht irren?«
»Boss, das ...«
»Sag nie wieder Boss zu mir. Und versuch auch nicht, mich umzustimmen, Dawson. Du wirst nach Timber Crossing laufen. Und wenn du unterwegs schlappmachen solltest, werde ich dich mit der Bullpeitsche wieder munter machen.«
»Dad, das darfst du nicht!«
Sarah Tabor kam aus dem Haus, stellte sich neben ihn und sah ihn von der Seite an. Er schenkte ihr keinen einzigen Blick.
»Ich fälle hier die Entscheidungen«, sagte er hart. »Ich und niemand anders. Wo ist Louis?«
»Er sitzt in seinem Zimmer und liest. Soll ich ihn holen?«
»Louis!« Die Stimme des Ranchers grollte wie ein Donnerschlag über den Hof und war sicherlich eine halbe Meile weit zu hören. Im Haus klapperten ein paar Türen, und dann stand auch Louis Tabor, der jüngste der beiden Tabor-Söhne, auf der Veranda.
»Du hast mich gerufen, Vater?«
»Geh, sattle dein Pferd, Louis. Wir reiten zur Stadt.«
»Was ist passiert, Vater?«
»Euer Bruder wurde getötet. Von einem Bastard namens Henry Jones. Dafür werde ich ein Exempel statuieren. Die Jones-Sippe ist erledigt.«
»Vater, das kannst du nicht ...«
»Schweig!«, herrschte ihn der Alte an.
»Sattle jetzt dein Pferd! Wir reiten nach Timber Crossing.«
Da senkte Louis Tabor den Kopf und ging zu den Corrals hinüber. Er hatte es gelernt, sich den Befehlen seines Vaters zu beugen wie jeder auf dieser Ranch.
Sarah Tabor zog sich wieder ins Haus zurück. Auch sie sah ein, dass es zwecklos war, hier noch ein einziges Wort zu verlieren.
Ihre Gedanken waren bei Alamo Jones, den sie liebte.
Sie wusste, dass Alamo verloren war.
Und sie weinte noch, als der Reitertrupp längst in der Prärie verschwunden war.
Die Stadt Timber Crossing erlebte in der Abenddämmerung ein grausames Schauspiel.
Revolver-Pete schwankte über die Mainstreet. Er hatte blutige Striemen im schweißbedeckten, staubverkrusteten Gesicht. Er trug keinen Hut mehr. Das Hemd hing in Fetzen von seinem Körper hinab, und der nackte Rücken des bedauernswerten Mannes war von zahlreichen Peitschenhieben gezeichnet.
Die Frauen wandten sich schaudernd ab und riefen ihre Kinder in die Häuser. Mancher Mann ballte heimlich die Fäuste. Manch einer verspürte Zorn auf Tabor, aber die Angst vor diesem mächtigen Mann war stärker als alle anderen Gefühle.
Endlich war Pete an der Stelle angelangt, wo Stephen Tabor gefallen war. Abraham Tabor ließ seine Reiter anhalten. Hoch richtete er sich im Sattel auf und ließ die Peitsche angewidert fallen.
Er deutete auf Pete, der reglos im Staub lag, und rief so laut, dass es jeder in der Stadt hören konnte: »Der bleibt liegen, bis ich einen anderen Befehl gebe. Wer ihm auf irgendeine Art und Weise hilft, macht ebenfalls Bekanntschaft mit meiner Peitsche. Wo ist Jones?«
Keine Antwort.
»Wo ist Jones?«, brüllte Tabor. »Bringt ihn mir her!«
Ringsum blieb es still.
Tabors Blick fiel auf Al Reynolds, den Besitzer des Wild Buffalo, des größten Saloons von Timber Crossing. »Reynolds, wo hält sich Jones versteckt?«
»Beim Doc, Mr. Tabor. Er liegt beim Doc!«
»Holt ihn her!«, befahl der Rancher.
Ein paar Männer nahmen ihre Pferde herum, ritten zum Haus des Docs und kamen bald darauf mit Henry Jones zurück. Er trug kein Hemd. Sein Oberkörper war mit einem Verband umwickelt. Er ging aufrecht vor den Cowboys her, obwohl ihm das schwerfiel.
Der Rancher blieb im Sattel und sah kalt auf den Mann, der seinen Sohn getötet hatte.
»Du weißt, was dich erwartet, Jones?« Henry Jones nickte.
»Ich kann es mir denken, Tabor. Sie werden nicht eher Ruhe geben, bis Sie mich auch tot sehen. Aber Sie werden es nicht wagen, mich vor den Augen dieser Stadt zu ermorden. Das Recht ...«
Abraham Tabor unterbrach ihn mit einem rauen Lachen.
»Das Recht, Jones? Du willst auf das Recht pochen? Mörder!«
»Jeder hat gesehen, dass es ein fairer Kampf war. Ihr Sohn hat mich herausgefordert. Sollte ich mich etwa abschlachten lassen? Sie können mich anklagen und vor Gericht stellen lassen, Tabor. Jeder gerechte Richter wird mich freisprechen.«
»Du bist im Irrtum, Jones. Die Stadt Timber Crossing liegt auf meinem Land! Ich bestimme, welches Recht hier gesprochen wird. Ich bin das Gesetz, Jones. So war es, und so wird es auch bleiben. Hiermit verurteile ich dich zum Tod durch Erhängen. Bringt ihn zur Eiche, Männer!«
Henry Jones senkte den Kopf. Er wusste, dass er verloren war. Alles, was Abraham Tabor gesagt hatte, stimmte leider nur allzu genau. Timber Crossing lag auf seinem Land, und sein Wort war Gesetz. Es gab keinen Marshal und keinen Sheriff hier, und niemand hatte bis heute daran gedacht, diesem Zustand ein Ende zu bereiten. Warum auch? Es ging den Leuten gut. Es ging ihnen besser als den meisten Menschen in den meisten anderen Städten. Abraham Tabor sorgte dafür, dass jeder sein geregeltes Auskommen hatte, der auf seiner Lohntüte stand. Und das waren alle Menschen in Timber Crossing.
Abraham Tabor hatte ihnen nach und nach durch gerissene Schachzüge ihr Eigentum abgegaunert. Ihm gehörten die beiden Saloons, der General Store, die Schmiede, die Schreinerei, das Fahrunternehmen und die Bank. Die allerdings hatte dem reichen Rancher von Anfang an gehört. Und er hatte großzügig Darlehen verteilt, hatte die bis dahin selbstständigen Männer nach und nach in seine Abhängigkeit gebracht und sich zum Schluss ihren Besitz überschreiben lassen.
So standen sie alle auf Tabors Lohnliste. Und alle fanden es gut.
Henry Jones wusste, dass niemand da war, der ihm helfen würde. Jeder war sich selbst der Nächste. Und man hatte Angst vor Tabor.
Henry Jones wurde unter die große Eiche geführt, die mitten auf der Plaza ihre mächtigen Äste nach allen Seiten reckte.
Niemand achtete auf den Reiter, der seit wenigen Minuten den Hinrichtungsvorbereitungen zusah. Man hatte ihn überhaupt noch nicht bemerkt.
Der Fremde saß auf einem großen, sehnigen Rotschimmel, den Hut etwas nach hinten gerückt, sodass strohblondes Haar zu sehen war. Der rote Hengst stand reglos, wie aus Stein gemeißelt.
Unter der Eiche nahmen die Vorbereitungen ihren Fortgang. Der rote Hengst schnaubte plötzlich nervös, als sich Revolver-Pete regte, der dicht vor seinen Hufen lag.
Der Fremde glitt aus dem Sattel und kniete neben Revolver-Pete nieder.
»Eine seltsame Stadt hier«, sagte der Fremde. »Wer hat Sie denn so zugerichtet? Etwa der arme Teufel, den sie gerade hängen wollen.«
»Nein«, ächzte Pete mit leisem Kopfschütteln. »Jones hat nichts damit zu tun. Er darf nicht hängen. Er ist unschuldig. Das hier ist Lynchmord ...«
Der blonde Fremde stand schnell auf und machte ein paar seltsame Zeichen zu einer bestimmten Stelle zwischen den Häusern hin.
Pete Dawson folgte dem Blick des Mannes, konnte dort aber beim besten Willen niemand entdecken, dem die Zeichen gegolten haben könnten.
Der Blonde schwang sich wieder auf seinen Rotschimmel und ritt an. Das mächtige Pferd drängte sich rücksichtslos durch die Reihen der Umstehenden.
Gerade legte einer von Tabors Männern Henry Jones die Schlinge um den Hals. Abraham Tabor sah mit steinernem Gesicht zu. Der Fremde hielt seinen Hengst neben dem Rancher und stieß ihm die Mündung der Winchester in die Seite.
»Lassen Sie sofort aufhören, Mister!«, sagte der Fremde freundlich, aber in seiner Stimme lag ein eisiger Unterton.
Ringsum wurde es still. Alle Augen richteten sich auf den Fremden, es waren ungläubige, spöttische oder auch verächtliche Blicke. War dieser Mann wahnsinnig? Wusste er nicht, dass er beim geringsten Befehl des Ranchers ein toter Mann war?
Langsam wandte Tabor den Kopf.
»Wer bist du, Fremder?«, grollte er mit seiner tiefen Stimme. »Steck die Winchester wieder in den Scabbard, und ich will die Sache vergessen. Du weißt offenbar nicht, wen du vor dir hast.«
Der andere lächelte eisig.
»Mein Name ist Tex Hondo«, sagte er. »Und Sie sind Richter Lynch persönlich, wie?«
»Ein Wort von Ihnen, Boss, und ich putze ihn aus dem Sattel!«, rief einer der Tabor-Cowboys.
»Dann geht dein Boss aber mit auf die Reise«, erwiderte der Fremde lässig.
Einer der Cowboys lachte.
»Der ist wahnsinnig!«, rief er.
Tex Hondo sah nur Tabor an und wartete auf dessen Entscheidung.
»Hondo«, sagte der Rancher schließlich, und nun war bedeutend mehr Höflichkeit in seiner Stimme. »Ihren Namen habe ich schon ein paar Mal gehört. Und es war nur Gutes, was man sich so erzählt über Sie. Wenn Sie also wirklich dieser Tex Hondo sind, den ich meine, dann geben Sie mir recht, nachdem ich Ihnen meine Geschichte erzählt habe.«
»Welchen Tex Hondo meinen Sie denn?«
»Den Feind aller Banditen und Mörder.« Der Rancher zeigte auf Henry Jones, bevor er fortfuhr: »Dieser Mann da hat meinen ältesten Sohn Stephen vor ein paar Stunden erschossen. Dafür soll er jetzt büßen.«
»Welcher Richter hat das Urteil gesprochen?«
»Ich vertrete hier das Gesetz«, sagte Tabor rau.
»Sie schwingen sich einfach zum Richter über Leben und Tod auf, Mr. Tabor? Nur weil diese Stadt zufällig auf Ihrem Land liegt? Das ist gegen jedes Gesetz.«
»Haben Sie schon mal von der alten Western Bill gehört, Hondo, dem ungeschriebenen Gesetz der freien Weide?«
Seit Tex Hondo nicht mehr unter Apachen lebte, hatte er von seinem Chief und Lehrmeister, dem ehemaligen Armeescout Calhoun, eine ganze Menge gehört. Aber von der Western Bill hatte er noch nie gehört.
»Die Western Bill wurde von den ersten Siedlern in diesem Land geschaffen«, erklärte Abraham Tabor. »Es heißt darin, dass jeder, der in feindlicher Absicht das Anwesen eines anderen Mannes betritt, den Tod verdient hat. Nach diesem Gesetz habe ich Henry Jones verurteilt.«
»Dieses Gesetz mag früher einmal gut gewesen sein«, sagte Tex. »Heute gibt es bessere, die mindestens ebenso wirkungsvoll sind wie Ihre alte Western Bill, Mr. Tabor. Lassen Sie also diesen Mann frei, und klagen Sie ihn beim nächsten Sheriff an, wenn Sie wirklich glauben, dass Henry Jones schuldig ist.«
»Hondo«, erwiderte der Rancher. »Sie sollen unten im Süden ein sehr angesehener Mann sein. Sicherlich haben Sie auch schon viel Gutes getan und manchen Banditen das Fürchten gelehrt. Aber ich bin kein Bandit, sondern ein ehrbarer und angesehener Mann. Ich brauche nur mit dem kleinen Finger zu schnippen, und Sie kehren nie wieder auf Ihre stolze Ranch in Arizona zurück. Was tun Sie überhaupt hier oben in den Rockies? Welcher Wind hat Sie hierher verschlagen?«
»Eine heiße Fährte«, sagte Tex. »Wir sind hinter der berüchtigten Schwadron von Arizona-Bill her. Ist Ihnen dieser Name ein Begriff?«
»Arizona-Bill hält sich in dieser Gegend auf?«, fragte Tabor erstaunt.
»Seine Fährte führte uns hierher«, sagte Tex. »Aber das alles dürfte Sie kaum interessieren, Mr. Tabor. Werden Sie nun den Gefangenen freigeben?«