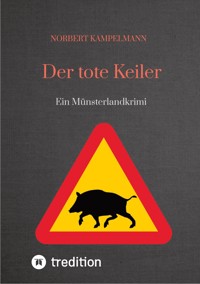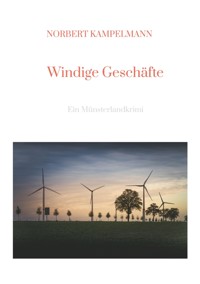
10,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Windrad auf eigenen Grund und Boden – das ist ein lukrativer Glückfall für die betroffenen Eigentümer! So freute sich auch Landwirt Hubert Große Hausmann riesig, als sein Acker zum Windvorranggebiet ausgewiesen wurde. Angebote von Investoren, die dort ihre Windkraftanlagen bauen wollen, ließen nicht lange auf sich warten. Roberto Corleone, ein italienischer Windkraft-Investor, machte ihm schließlich ein nicht ganz moralisches Angebot! Allerdings auf Kosten der Nachbarn, die bei dem Deal leer ausgingen! # Es kam, wie es kommen musste: Ein erbitterter Streit mit Nachbar Georg Kleine Grachtrup war die Folge! Als Corleone jedoch zu kriminellen Mitteln greift, um den Bau der Windräder voranzutreiben, wird es Hubert Große Hausmann zu viel und er bereut, sich mit Corleone eingelassen zu haben. In dieser vertrackten Situation helfen mal wieder unsere fünf Doppelkopffreunde mit genialen Ideen und Aktionen. Ob es schließlich gelingt, Corleone loszuwerden, wird in diesem Buch in ebenso spannender wie unterhaltsamer Weise dargestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Norbert Kampelmann
Windige Geschäfte
Ein Münsterlandkrimi
© 2023 Norbert Kampelmann
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback
978-3-384-02483-1
Hardcover
978-3-384-02484-8
E-Book
978-3-384-02485-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog – 10 Monate später…….
Anmerkung des Autors
Windige Geschäfte
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
Anmerkung des Autors
Windige Geschäfte
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
Kapitel 1
Beim ersten Mal zeigte selbst Pastor Krawinkel, der ansonsten introvertiert und in sich gekehrt durch das Leben ging, so etwas wie Emotionen. „Das gibt es doch nicht, so etwas ist in meinen 30 Jahren als Pfarrer von Sankt Georg noch nie passiert!“, murmelte er vor sich hin. Aber immerhin so laut und in einer für ihn ungewohnt hohen Tonlage, dass Paul Anders, der junge Diakon in seiner Gemeinde, besorgt zu ihm eilte.
Gemeinsam schauten sie wie gebannt in den Klingelbeutel, der wie immer um 8 Uhr in der Frühmesse am Donnerstag rundgereicht worden war. Darin befanden sich 3 Euro und 43 Cent in Münzen. Ein zwar leicht überdurchschnittliches Ergebnis für eine Kollekte am Donnerstagmorgen, also kein Grund für eine solch emotionale Reaktion des Pastors. Doch dann sah Paul Anders die Banknote, die Krawinkel in seiner rechten Hand hielt und gebannt fixierte. Ohne Zweifel: Ein 500-Euro-Schein!
„Der war im Klingelbeutel? Wer hat den denn da reingetan?“,fragte Anders.
„Das weiß nur unser Herrgott im Himmel“, entgegnete Krawinkel.
Denn keinem der beiden Geistlichen war etwas Ungewöhnliches aufgefallen.
Wie immer hatten sich nur wenige Gläubige zur Frühmesse eingefunden.
Neben der 94-jährigen Gertrud Schulte, die ganz in schwarz gekleidet auf ihrem Stammplatz in der zweiten Reihe im rechten Seitenschiff saß, war das Rentnerehepaar Gerlinde und Gustav Becker da, beide ebenfalls deutlich jenseits der 80. Die wenigen anderen Anwesenden saßen weiter hinten und waren weder Krawinkel noch Anders aufgefallen.
„Wofür war überhaupt die heutige Kollekte? Vielleicht wollte da ja einer damit eine spezielle Aktion unterstützen!“ ,spekulierte Anders. „Nein, das glaube ich nicht“, entgegnete der Pastor, „wie immer donnerstags sammeln wir für den Blumenschmuck in unserer Kirche.“
„Sie haben recht. Eine 500-Euro-Spende für Blumenschmuck – das wäre schon sehr unwahrscheinlich und mächtig übertrieben“, stimmte Anders zu. Obwohl: Die vorösterliche Zeit würde in ein paar Tagen beginnen. Und nach den tristen Wintermonaten würden farbenfrohe Primeln und Narzissen dem Altarraum sicherlich guttun. Diese ersten Frühlingsboten waren bekanntlich nicht billig. Vielleicht wollte da jemand mit einer großzügigen Spende endlich wieder Farbe in die Kirche holen.
Beide diskutierten noch eine ganze Weile ohne letztendlich zu einer einleuchtenden Erklärung für die Hintergründe der milden Gabe zu gelangen. Schließlich beschloss Krawinkel, den Geldschein bei nächster Gelegenheit zur Sparkasse zu bringen und die Summe dem Blumenschmuckkonto der Sankt-Georg-Gemeinde gutschreiben zu lassen. Schließlich war die Kollekte für diesen Zweck gedacht und man müsse sich ja an das halten, was man im Vorfeld gesagt habe.
Der mysteriöse Vorfall war schon fast in Vergessenheit geraten, als nach der Samstagabendmesse wiederum eine 500-Euro-Note im Klingelbeutel entdeckt wurde. Wohl an die 60 Mitglieder der Sankt-Georg-Gemeinde hatten den Gottesdienst besucht. Karl Schmidt, als Kirchenvorstandsmitglied an diesem Abend für den Kollektendienst zuständig, war nichts aufgefallen. Kein Wunder, denn der Geldschein war klein gefaltet und somit der Wert nicht erkennbar.
Auch der Zweck der Kollekte – die Unterstützung der Partnergemeinde Umbala im afrikanischen Kongo – war anders.
Direkt am darauffolgendem Montagmorgen machte sich Pfarrer Krawinkel auf den Weg zur heimischen Sparkasse an der Münsterstraße. Kirsten Uhle saß wie immer hinter dem mit Panzerglas geschützten Kassenschalter.
„Grüß Gott, Herr Pastor“, begrüßte sie ihn, wohl wissend, dass er diese Form der Anrede gern hörte, „was kann ich für Sie tun?“
„Wir hatten in den letzten Tagen außergewöhnlich ertragreiche Kollekten, die ich gern einzahlen möchte.“ Mit diesen Worten legte Krawinkel das gefüllte graue Leinensäckchen in die Mulde des Schalters.
Die Bankangestellte zog die Lade zu sich auf ihre Seite und öffnete das Säckchen. Die Münzen schüttete sie vorsichtig in die automatische Zählmaschine. Die wenigen Geldscheine hatte sie vorher mit ein paar routinierten Handgriffen herausgepickt.
„Wow, gleich zwei 500-Euro-Scheine. Waren die etwa im Klingelbeutel?“ fragte Frau Uhle.
„Ja, so etwas gab es noch nie! Ein Schein war am Donnerstag und einer am Samstag drin!“, antwortete Pfarrer Krawinkel.
Kirstin Uhle räusperte sich. „Schon ein wenig komisch! In den letzten 3 Wochen wurde kein einziger 500-Euro-Schein bei mir eingezahlt. Heute sind es bereits drei!“
„Wer hat Ihnen denn den dritten Schein gebracht?“
Uhle wägte kurz ab, ob sie gegen das Bankgeheimnis verstoßen würde, wenn sie die Information an den Pfarrer weitergeben würde. Aber nein, das war kein Geheimnis. Außerdem würde der Geistliche ganz sicher nicht damit hausieren gehen.
„Herr Prinz vom Sportgeschäft gegenüber hat vor einer halben Stunde den Schein hier abgegeben. Er wollte sich wohl vergewissern, ob die Note echt ist. Ein 12jähriger Junge hat damit kurz zuvor ein Skateboard für schlappe 180 Euro gekauft und bezahlt. Das Kind hat dem Verkäufer gesagt, dass es das Geld von seiner Oma zum Geburtstag bekommen habe.“
„Was Kinder heutzutage alles geschenkt bekommen! Als ich zwölf Jahre alt wurde habe ich ein paar Buntstifte und eine Tafel Schokolade bekommen. Und ich war überglücklich!“,bemerkte Pfarrer Krawinkel.
„Da sieht man mal, wie sich die Zeiten ändern.“ Uhle legte einen Beleg in die Lade und schob sie auf die Kundenseite. „Mit den beiden 500-Euro Scheinen sind es diesmal 1098,52 Euro, die Sie eingezahlt haben. Sie müssen den Betrag bitte hier kurz quittieren. Ich buche es wie immer auf das Konto der Kirchengemeinde.“
Nachdem Krawinkel die Formalitäten erledigt hatte, verließ er das Sparkassengebäude und machte sich auf den Weg zum Gemeindezentrum. Dort sah er von weitem Diakon Paul Anders, der sich gerade von Petra Zumbült, der 22-jährigen Gemeindehelferin, verabschiedete.
Krawinkel ahnte schon seit einiger Zeit, dass da etwas lief zwischen der attraktiven Gemeindeschwester und dem jungen Diakon, die beide im Gemeindezentrum wohnten – natürlich in getrennten Appartements. So wie die beiden sich ansahen und miteinander sprachen!
Krawinkel schaute weg und tat so, als wenn er die Beiden nicht gesehen hätte.
Krawinkel erinnerte sich gut an seine ersten Jahre im Kirchendienst. Auch damals spürte er noch heftig seine Hormone, und es fiel ihm nicht leicht, das Gelöbnis zum Zölibat einzuhalten.
Auch er hatte in dieser Zeit dagegen verstoßen. Es war in seinen Urlauben in Bayern passiert, die er ohne das Kollar als ganz normaler Zivilist in einem Gasthof verbrachte. Damals hatte er sich in Leonie, die Tochter des dortigen Dorfbäckers, verliebt. Zwei Jahre lang traf er sich immer wieder mit ihr, bis Leonie von sich aus die Beziehung beendete. Sie hatte wohl zwischenzeitlich die Dornenvögel gelesen und gespürt, dass sie mit ihrer Liebe gegen seinen Herrgott oder vielmehr die Kirchengebote nicht ankam.
Kurze Zeit später hatte Leonie einen Polizisten aus dem Nachbarort geheiratet.
Krawinkel war seitdem nie wieder nach Bayern gereist. Ab der Zeit verbrachte er seine Urlaube nur noch auf Texel oder im nahegelegenen Sauerland.
Mit einem tiefen Seufzer öffnete er die Tür zu seinem Büro und setzte sich an seinen Schreibtisch. Kurze Zeit später klopfte es an der Tür und Anders trat ein.
„Guten Morgen Herr Krawinkel. Haben Sie kurz Zeit, um über den Wochenplan zu sprechen?“
„Grüß Gott, Herr Anders. Na klar habe ich Zeit. Setzen Sie sich. Gibt es denn Probleme mit den Terminen?“
„Nein, eigentlich nicht. Bis auf morgen Abend. Ich weiß, ich habe eigentlich Bereitschaftsdienst. Aber da möchten die Angehörigen der Verstorbenen Martha Meier um 19 Uhr jetzt kurzfristig ein Rosenkranzbeten in der Kirche machen. Die Beerdigung ist ja am Donnerstag. Sie bitten darum, dass möglichst ein Geistlicher den Rosenkranz vorbetet. Und Sie wissen ja, ich habe dienstags Doppelkopfabend. Könnten Sie ausnahmsweise den Termin übernehmen?“, fragte Anders.
„Ja, natürlich, das mache ich gern. Ich habe die Martha schließlich gut gekannt. Sie war bis zu ihrer Demenzerkrankung vor 10 Jahren Mitglied in unserem Pfarrgemeinderat.“
„Das wusste ich gar nicht. Aber es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie einspringen. Sie wissen ja, wie ungern ich mit Verspätung zu meinen Doppelkopffreunden komme.“
„Natürlich. Ihr jungen Leute sollt auf euren Spaß nicht verzichten. Ist Zöpfchen eigentlich auch noch immer dabei?“, fragte Krawinkel.
„Na klar, er ist einer unserer eifrigsten Spieler. Und einer, der die ganze Runde mit seinen Anekdoten unterhalten kann. Aber das können Sie sich ja denken, Sie kennen ihn ja schon viel länger als ich!“
„Ja, ich habe mir schon von seinem Vater Paul die Haare schneiden lassen. Der Salon Auf der Landwehr ist eine Institution hier in Warendorf. Und den Franz, also Zöpfchen, habe ich sogar eigenhändig getauft. Richten Sie ihm herzliche Grüße aus. Ich werde in der nächsten Woche mal wieder in seinen Salon reinschauen.“
„Mache ich gern. Aber ich sehe gerade das leere Banksäckchen auf Ihrem Schreibtisch liegen. Waren Sie schon bei der Sparkasse? Die 500-Euro- Scheine waren doch echt, oder?“,fragte Diakon Anders.
„Ja, waren sie. Frau Uhle von der Sparkasse war genauso überrascht wie wir. Wochenlang habe sie keine 500-er mehr in der Hand gehabt. Und am heutigen Morgen gleich drei davon!“
Krawinkel berichtete kurz über die Banknote, die Herr Prinz von Intersport hatte überprüfen lassen.
„Na ja, uns soll es gleich sein. Wer der Kirche Geld zukommen lässt, tut Gutes. Und wir können das Geld wahrhaftig gut gebrauchen.“
Paul Anders verabschiedete sich von seinem Pfarrer und begab sich in sein eigenes Büro. Die Geschichte mit den 500-er-Banknoten ging ihm jedoch nicht so schnell aus dem Kopf.
Vielleicht sollte er seine Doppelkopffreunde einmal darauf ansprechen! Gemeinsam hatten sie schon andere mysteriöse Rätsel gelöst. Erst kürzlich hatten die Fünf dazu beigetragen, einen getürkten Wildunfall mit schlimmen Folgen zu enttarnen.
Kapitel 2
Hubert Große Hausmann wollte schon immer hoch hinaus. Schon damals als er noch der kleine Hubi war, kletterte er in jeder freien Minute auf die stattliche Eiche, die seit mehr als 100 Jahren an der Einfahrt zum elterlichen Bauernhof in der Sassenberger Bauernschaft Gröblingen stand.
Sein Großvater Bernhard hatte sie dereinst gepflanzt. Und auch davor war der Hof bereits seit mehreren Generationen im Besitz der Große Hausmanns. Sie waren seit jeher Schweinebauern – und zwar gut betuchte!
Hubert hatte den Betrieb vor knapp 10 Jahren von seinem Vater Heinrich übernommen. Drei Jahre nach Hofübergabe starb Heinrich im stolzen Alter von 82 Jahren. Huberts Mutter war schon 9 Jahre zuvor nach einer schweren Krebserkrankung von ihnen gegangen.
Als Hubert alleiniger Herr auf dem Hof war, blühte er regelrecht auf. Und er erinnerte sich an früher! Ja, er wollte in seinem Leben hoch hinaus.
Er begann, den Betrieb zu modernisieren und erheblich zu erweitern. Vier nagelneue moderne Ställe für jeweils knapp 1.500 Mastschweine hatte er in den letzten 5 Jahren gebaut. Die in die Jahre gekommenen alten Stallgebäude direkt am Hof hatte er kurzerhand abreißen lassen. Nur das immer schon herrschaftliche Wohnhaus der Große Hausmanns war erhalten und aufwendig renoviert worden, als Ingrid eingezogen war.
Hubert hatte seine jetzige Frau Ingrid vor gut fünf Jahren über eine Partnerschaftsbörse im Internet kennengelernt. Die schlanke, gutaussehende Blondine passte zwar rein äußerlich nicht gerade ideal zu dem untersetzten Hubert, dessen schütteres Haupthaar bereits leicht ergraut war und immer größere Geheimratsecken aufwies. Zudem war Hubert fünfzehn Jahre älter als Ingrid, als sie ihm ein halbes Jahr nach dem Kennenlernen vor dem Traualtar das Jawort gab.
Hubert war aber überglücklich und mächtig stolz auf seine hübsche Ehefrau, mit der er sich gern öffentlich zeigte und der er jeden Wunsch von den Lippen ablas.
Darum hatte er auch gern die alte historische Remise nahe dem stattlichen Wohnhaus zu einem edlen Pferdestall mit mehreren Boxen umgebaut. Seine junge Frau Ingrid liebte nämlich Pferde und war eine begeisterte Reiterin. Ein Fuchswallach und eine braune Stute hatten dort ihr Zuhause und wurden von Ingrid tagtäglich versorgt und geritten. Das Reitpony in der dritten Box gehörte Vanessa, Ingrids jetzt 10-jähriger Tochter, die sie aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe und auf Huberts Hof gebracht hatte.
Ingrid genoss es, im Mittelpunkt zu stehen und von Hubert verwöhnt, ja geradezu vergöttert zu werden. Auch wenn sich ihre eigene Zuneigung zu ihrem Ehemann in Grenzen hielt.
Die Ehe mit Hubert war für sie keine Liebesheirat gewesen, sondern eher eine Zweckgemeinschaft, die ihr und ihrer Tochter einen gewissen Luxus und Sicherheit brachte. Und die möglichst einen männlichen Stammhalter hervorbringen sollte, der einmal den Hof weiterzuführen konnte.
Dafür nahm Ingrid es auch in Kauf, das Bett mit einem Mann zu teilen, der in sexueller Hinsicht ihre Fantasien nicht erfüllte. Zwar fehlte es Hubert nicht an Potenz. Es war nur so, dass sich der Liebesakt in ihrem Schlafzimmer in immer gleichförmiger Art und Weise vollzog und in fataler Art und Weise daran erinnerte, was sich in Huberts neuen Stallungen abspielte.
Rund 150 Hektar Land gehörten zum Hof – eine ausreichende Fläche, um das Futter für die Schweine zum größten Teil selbst zu produzieren.
Der Betrieb war gesund und wurde von Hubert gemeinsam mit zwei angestellten landwirtschaftlichen Gehilfen bewirtschaftet. Natürlich merkte Hubert sehr bald, dass ihn der Lebensstil seiner geliebten Frau und die Kredite für die noch nicht abbezahlten neuen Ställe erheblich belasteten. Zumal die Schweinepreise in den letzten Monaten deutlich nach unten zeigten und seinen Gewinn erheblich schmälerten.
Deshalb hatte er sich auch riesig darüber gefreut, dass vor drei Jahren sein 6 Hektar großer Maisacker nördlich von Steinkamps Heide in der Erweiterungsfläche des bereits bestehenden Windvorranggebiets lag. Bislang hatte er nämlich keine Flächen in dem vor 15 Jahren ausgewiesenen Vorranggebiet. Eine willkommene Chance also, endlich neben der Landwirtschaft als Energiewirt neue Einnahmequellen zu erschließen.
Bereits wenige Tage nach dem Ratsbeschluss der Stadt Sassenberg zur Erweiterung des Windvorranggebiets hatten sich erste Interessenten bei Hubert gemeldet, die sich als Projektentwickler und potentielle Investoren anboten.
Drei, möglicherweise sogar bis zu fünf Windkraftanlagen – je nach Größe und Standort – konnten im neu ausgewiesenen Windvorranggebiet gebaut werden. Huberts Acker und auch die Felder seiner beiden Nachbarn Kleine Grachtrup und Schmelting lagen im neu ausgewiesenen Baugebiet.
Huberts Acker lag im Zentrum des Plangebiets.
Als erstes hatte sich Hubert seinerzeit im Internet schlau gemacht, welche aktuellen Pachteinnahmen zu erzielen waren. Die Verpächter, also in der Regel die Landwirte, würden durchschnittlich mit 10 bis 13 Prozent an den Stromerträgen eines Windrades beteiligt, so hatte Hubert im Netz erfahren. Für ein Windrad, das im Mittel pro Jahr rund sechs Millionen Kilowattstunden Strom produziere, ergeben sich so Pachteinnahmen von rund 30.000 bis 50.000 Euro. An windreichen Standorten seien sogar noch deutlich höhere Pachteinnahmen möglich. Und mit den immer weiter steigenden Energiepreisen ginge die Tendenz weiter nach oben, hatte Hubert gelesen.
Die Eurozeichen leuchteten damals sofort in seinen Augen. Zwei Windkraftanlagen, die jeweils 50.000 Euro in seine Hofkasse spülten - das waren für Hubert der ersehnte warme Geldregen in trockenen Zeiten und würden all seine finanziellen Sorgen beseitigen.
Die ersten Gespräche mit möglichen Investoren fanden vor ziemlich genau 3 Jahren statt und waren von Anfang an sehr vielversprechend verlaufen. Obwohl Sassenberg und das platte Land ringsum nicht gerade als TOP-Windgebiet galt.
Aber die neue Bundesregierung hatte ja bekanntlich den Ausbau der erneuerbaren Energien ganz oben auf ihre Agenda gesetzt. Nach dem Ausstieg aus der Kernenergie und dem absehbaren Aus für die Kohlekraftwerke drohte sonst ein Energiekollaps. Und Flächen für neue Windkraftanlagen waren knapp. Also gute Voraussetzungen, um schnell und erfolgreich Planungen umzusetzen.
Sehr schnell meldete sich seinerzeit Energie International, ein bundesweit tätiger Projektentwickler in der Windbranche. Hubert wurden gleich beim ersten Gespräch Pachteinnahmen von 30.000 bis 40.000 Euro pro Windrad avisiert. Und ja, zwei Anlagen seien auf seinem Acker zu realisieren. Man wolle aber auch mit seinen Nachbarn sprechen, um eine möglichst abgestimmte Planung für das gesamte Windvorranggebiet zu erarbeiten.
Das ließ sich doch gut an. Hubert war schon fast geneigt, das Angebot von Energie International anzunehmen, das ihm zwei Anlagen auf seinem Grund und Boden garantierte.
Doch dann meldete sich ein Investor aus Italien, der ihm versprach, ein Angebot machen zu wollen, das er nicht ablehnen könne.
Hubert dachte damals spontan an Marlon Brando und den Film „Der Pate“, als er diesen Spruch hörte. Zumal sich der Mann, mit dem er telefoniert hatte, als Roberto Corleone vorstellte.
Seine Firma, die Vento Italia, sei schon Marktführer in mehreren europäischen Ländern und wolle jetzt auch in Deutschland Fuß fassen, hatte Corleone gesagt.
„O.K., ich kann mir ja mal anhören, was die Italiener so anbieten“, hatte sich Hubert seinerzeit gedacht und Corleone zu sich nach Sassenberg eingeladen.
„Wenn Sie mir den Zuschlag geben, mache ich Sie zu einem reichen Mann“, hatte Corleone versprochen.
Er legte Hubert einen Plan vor, auf dem sein Acker in Steinkamps Heide mit drei Windkraftanlagen bestückt war. Die drei Windräder waren mit dem vorgeschriebenen Abstand zueinander, aber dadurch auch ziemlich nah an den Grenzen zu den Feldern seiner Nachbarn geplant.
„Gibt es bei diesem Plan nicht Ärger mit meinen beiden Nachbarn?“, hatte Hubert gefragt.
„Man kann es nicht jedem recht machen – wer zuerst kommt, malt zuerst. Oder anders gesagt: Sie müssen schnell Fakten schaffen und schneller sein als ihre Nachbarn. Dann profitierten sie am meisten!“,hatte Corleone gesagt, „denn wenn ihre beiden Nachbarn schneller sind, müssen Sie die Mindestabstände zu deren Anlagen beachten und sie können im schlechtesten Fall nur ein einziges Windrad auf ihrem Acker bauen. Außerdem können sie ja immer noch überlegen, ob Sie ihre Nachbarn an den Anlagen auf ihrem Grund und Boden beteiligen wollen!“
Und dann hatte Corleone sein Angebot vorgelegt. „Ich garantiere Ihnen eine jährliche Pacht von 50.000 Euro pro Windrad. Außerdem erhalten Sie beim Bau eines jeden Windrads eine – sagen wir „Provision“ – von jeweils 30.000 Euro bar auf die Hand. Steuerfrei, versteht sich!“
Hubert Große Hausmann hatte damals drei Tage Bedenkzeit für seine Entscheidung. Drei Tage, in denen er das Für und Wider abwog. Auf der einen Seite winkten jährliche Einnahmen von 150.000 Euro. Und das Schwarzgeld von insgesamt 90.000 Euro würde ihm und seiner anspruchsvollen Ehefrau so manchen Wunsch erfüllen, von dem er bis dahin noch nicht einmal zu träumen gewagt hatte.
Auf der anderen Seite würden seine Nachbarn Bernhard Schmelting und Adolf Kleine Grachtrup ganz sicher sauer darüber sein, wenn sie am Ende leer ausgehen würden und möglicherweise keine Anlage auf ihren jeweiligen Flächen bauen könnten. Aber das stand ja noch nicht endgültig fest, so zumindest hatte er Corleone verstanden. Und er könnte ja um des nachbarlichen Friedens Willen seinen beiden Nachbarn ein paar Euro von den Pachteinnahmen abgeben. Hubert fragte sich, wie sich Schmelting und Kleine Grachtrup entscheiden würde, wenn sie an Huberts Stelle wären?
Schmelting hatte nur einen kleinen Hof von gerade mal 10 Hektar, den er im Nebenerwerb betrieb. Im Hauptberuf war er LKW-Fahrer bei der Spedition Mußmann in Sassenberg und von daher fast immer unterwegs. Seine 100 Mastschweine wurden deshalb hauptsächlich von seiner Frau Hedwig versorgt, die sich auch um den kleinen Hühnerstall kümmerte. Und um Sonny und Benjamin, die beiden zotteligen Hochlandrinder, in die sich Bernhard und Hedwig sofort verliebt hatten, als sie die Tiere auf dem Warendorfer Fettmarkt gesehen und vom Fleck weg gekauft hatten.
Ob sich Schmelting überhaupt für ein Windrad interessierte? Hubert wusste es nicht, er hatte nie mit seinem Nachbarn darüber gesprochen. Und Schmelting hatte sich bei den Anhörungen im Vorfeld, in denen das geplante Windvorranggebiet vorgestellt worden war, nie sehen lassen.
Bei den Kleine Grachtrups sah das anders aus. Die waren Vollerwerbslandwirte und Veränderungen und Neuem gegenüber immer aufgeschlossen.
Der Senior, Adolf Kleine Grachtrup, war bereits 75 Jahre alt und genoss mit seiner Else den Ruhestand.
Seitdem er den Hof an seinen Sohn Georg übergeben hatte, arbeitete er nur noch sporadisch mit und wenn, dann nur wenige Stunden. Er hatte sich die kleine Scheune neben dem großen Wohnhaus zu einer kleinen aber schmucken Altenteilwohnung umgebaut und fuhr lieber mit seinem Pedelec spazieren. Er hatte es sich schließlich verdient, kürzer zu treten.
Sein Sohn Georg wohnte mit seiner Frau Gertrud und den drei Kindern seitdem im großen Familienbungalow. Die Kleine Grachtrups hatten sich vor ein paar Jahren von ihren Milchkühen getrennt und sich komplett auf Rinderzucht und Bullenmast spezialisiert.
Georg hatte in den letzten Jahren für seine Tiere riesige, hochmoderne neue Ställe gebaut. Die neuen Ställe waren zudem komplett mit PV-Kollektoren bestückt – die moderne Photovoltaikanlage versorgte nicht nur den eigenen Betrieb mit Strom, sondern brachte zusätzliche Einnahmen durch die Einspeisevergütungen. Georg stand den regenerativen Energien aufgeschlossen gegenüber und freute sich genauso wie auch sein Nachbar Große Hausmann sehr darüber, Flächen im neuen Windvorrangebiet zu besitzen.
In Sassenberg war Georg als „Bullen Schorsch“ stadtbekannt, denn er war nicht nur Schriftführer im landwirtschaftlichen Ortsverband, sondern engagierte sich unter anderem im Schützenverein und bei der Kolpingfamilie. Auch bei der Freien Wählergemeinschaft und im Kirchenchor war er aktives Mitglied.
Georg und Hubert kannten sich bereits seit der Kindheit, hatten aber nie engen Kontakt. Georg war immer der Sportlichere von ihnen gewesen und war auch bei den anderen Kindern beliebter als Hubert. Nur selten hatten die beiden miteinander gespielt. Und wenn überhaupt, dann waren auch andere Nachbarskinder dabei.
Gemeinsam hatten beide die Johannes-Grundschule im Sassenberger Brook besucht. Hubert war ein Jahr älter und deshalb ein Jahr früher eingeschult worden. Nach der Grundschule trennten sich ihre gemeinsamen Schulwege. Denn nach der Grundschule wechselte Hubert auf die Bischöfliche Realschule nach Warendorf, Georg auf die Hauptschule im Herxfeld und später auf die Handelsschule.
Hubert und Georg waren zwar beide Landwirte, hatten aber wegen der Verschiedenartigkeit ihrer Betriebe kaum etwas miteinander zu tun.
Aber Hubert wusste natürlich, dass Georg sehr gerne eine Windkraftanlage auf seinem Grund und Boden haben wollte. Zumal man als Eigentümer der Flächen ja bei einer Zusammenarbeit mit einem Investor mit dem Bau und dem Betrieb der Anlagen selbst nichts zu tun haben würden. Wenn man es genau betrachtete, brauchte man eigentlich nur die Hand aufzuhalten, um die Pacht zu kassieren.
Hubert dachte an die Worte von Corleone: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Warten sie nicht zu lange, sonst pickt sich ein anderer die Rosinen vom Kuchen!“
Und die wollte Hubert auf keinen Fall „Bullen-Schorsch“ überlassen.
Kurzum: Hubert nahm das Angebot von Vento Italia an und unterschrieb den Projetvertrag mit Corleone bei einem Notar.
Direkt nach der Vertragsunterzeichnung hatte Vento Italia beim Bauamt der Stadt Sassenberg den Bauantrag für die drei Windräder auf dem Grundstück von Hubert Große Hausmann eingereicht.
Natürlich hatte Georg Kleine Grachtrup sofort davon erfahren und war mit hochrotem Kopf und aufgebracht bei Bürgermeister Torsten Brinkmann vorstellig geworden.
Da Georg aber selbst in absehbarer Zeit keinen Investor vorweisen konnte, musste er zähneknirschend akzeptieren, dass der Antrag von Vento Italia angenommen und geprüft werden würde.
Nur wenige Wochen später wurde er dann dem Sassenberger Stadtrat vorgelegt.
Georg hatte natürlich versucht, in seiner Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Stimmung gegen Vento Italia zu machen. Das ausgerechnet ein in Deutschland noch unbekannter Investor hier in Sassenberg seine ersten Windkraftanlagen bauen, wollte sei doch ein großes Risiko. „Sind die italienischen Windräder überhaupt so sicher wie unsere?“ hatte er gefragt.
Corleone war eigens in die Ratssitzung zitiert worden, um Rede und Antwort zu stehen. Und er konnte damals die Bedenken der Sassenberger Ratsherren relativ schnell zerstreuen.
„Unsere Anlagen werden in Europa gebaut. Es sind die gleichen, die auch von unseren Konkurrenten errichtet werden und sich schon hundertfach bewährt haben. Vento Italia ist lediglich als Projektträger neu auf dem deutschen Markt. Und da wollen wir uns durch gute Preise und vor allem durch gute Anlagen, die guten grünen Strom produzieren, einen guten Namen machen,“ hatte er seinerzeit gesagt.
Corleone hatte Bilder gezeigt von riesigen Windparks in Südtirol, die seine Firma gebaut habe und die seit Jahren in Betrieb seien.
Zwar hatten Georg und seine Fraktion der Freien Wählergemeinschaft immer wieder argumentiert, dass eventuell weitere zusätzliche Anlagen nicht gebaut werden könnten, wenn man den jetzigen Planungen zustimmen würde.
„Du bist doch nur sauer darüber, dass die drei Anlagen auf Hausmanns Acker und nicht auf deinen eigenen Flächen gebaut werden sollen,“ hatte der Fraktionsvorsitzende der Grünen Georg vorgehalten. Und natürlich hatte er Recht damit.
Immerhin: Zweimal war die Abstimmung über den Bauantrag vertagt worden. Aber letztlich hatte der Sassenberger Rat den Plänen von Vento Italia zugestimmt und der Bauantrag wurde mit einem positivem Votum an die Kreisverwaltung weitergeleitet.
Aber das war natürlich nur die erste Hürde. Denn zuständige Genehmigungsbehörde war das Bauamt der Kreisverwaltung in Warendorf.
Corleone hatte geahnt, dass das Genehmigungsverfahren in Deutschland komplizierter und langwieriger sein würde als in Italien. Aber mit so viel Bürokratie hatte er nicht gerechnet. Die Architekten und Ingenieure seiner Firma hatten ihm die lange Liste der Antragsunterlagen gezeigt, die sie beim Kreis einzureichen hatten.
Neben dem eigentlichen Antrag und den detaillierten Anlagebeschreibungen und Plänen waren etliche weitere Unterlagen erforderlich. So waren zum Beispiel eine ganze Reihe von Gutachten zur Anlagensicherheit, zum Brandschutz und zum Arbeitsschutz erforderlich. Ganz zu schweigen von den Baugrunduntersuchungen und den Gutachten zum Artenschutz und denen zum Schallschutz, zum Schattenwurf oder auch zu etwaigen Turbulenzen.
Der komplette Bauantrag umfasste letztendlich acht volle Ordner.
Die durchzuarbeiten und zu bewerten dauerte fast 14 Monate, bis endlich der lang ersehnte Genehmigungsbescheid für die drei Windkraftanlagen aus dem Kreishaus kam.
Natürlich hatte Georg Kleine Grachtrup sofort eine Nachbarschaftsklage beim Verwaltungsgericht gegen die Baugenehmigung eingereicht. Die Klage hatte jedoch keine aufschiebende Wirkung, sodass Vento Italia die Vorbereitungen zum Bau fortsetzen konnte. Doch zu Georgs Leidwesen scheiterte die Klage.
Immer wieder hatte es während der Bauphase für das erste Windrad Verzögerungen gegeben. Zumeist waren dies hausgemachte Probleme. Mal gab es Lieferschwierigkeiten bei der Elektronik für das Steuermodul, mal fehlten Spezialgewindeteile für die Rotoraufhängung. Auch der Transport der Anlage, die auf der letzten Strecke per Schiff über den Dortmund-Ems-Kanal und per Schwerlasttransport erfolgte, dauerte fast 3 Monate länger als geplant. Schuld daran waren Bauarbeiten an einer Brücke über die Ems, die überquert werden musste.
Corleone war mittlerweile extrem genervt. So etwas kannte er aus Italien nicht!
Zu allem Überfluss war kurz vor der geplanten Inbetriebnahme der Anlage durch einen nächtlichen Sabotageakt das Kabel, das den Strom ins Netz bringen sollte, gekappt worden. Die Polizei wurde eingeschaltet – bislang hatten die Ermittlungen der Kripo jedoch noch zu keiner heißen Spur geführt.
Erst vor einem Monat – knapp 2 Jahre nach Erteilung der Baugenehmigung – war endlich das erste Windrad in Betrieb genommen worden. Es war eine mächtige Anlage mit einer Nabenhöhe von fast 130 Metern, die alles überragte, was bislang im Kreis Warendorf in diesem Segment gebaut worden war.
Und Corleone hatte Wort gehalten: Am Tag der Inbetriebnahme traf er sich mit Hubert an der Anlage und übergab ihm eine unauffällige Leinentasche. Der Inhalt: 30.000 Euro - 60 wunderschöne lilafarbene Banknoten mit einem Wert von jeweils 500 Euro!
Kapitel 3
„Ich wünsche dir viel Spaß. Aber vielleicht hast du ja noch Lust, nach dem Kartenabend bei mir reinzuschauen?“ Petra Zumbült legte ihren Arm um Pauls Hals und gab ihm einen Kuss.
„Na klar komme ich noch zu Dir. Draußen ist es ziemlich frisch, und ich werde mit dem Fahrrad zu Porten fahren. Da muss ich mich doch später erst einmal aufwärmen“, erwiderte Paul Anders und lächelte seine Freundin an.