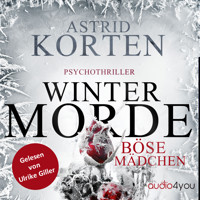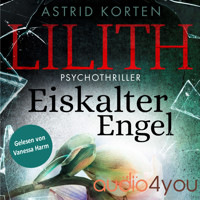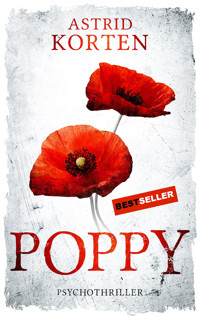4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
WUT - HASS - RACHE Was wir taten, war unvorstellbar. Verlegerin Alma, erdrückt von Beruf, Familie und dem Desinteresse ihres Mannes, sucht nach radikaler Veränderung. Sie will ihren Mann loswerden. Alma sucht nach Gleichgesinnten und findet sie in einem Chatroom. Vier Frauen, ein gemeinsamer Nenner: Wut. Doch dann geschieht ein heimtückischer Mord, der wie ein Albtraum auf Almas Brust lastet. Als sie begreift, dass sie die Hauptfigur in einem perfiden Rachespiel ist, ist es zu spät. Ein packender Psychothriller, in dem nichts so ist, wie es scheint, und der den Leser fassungslos zurücklässt. Erste Buchkritiken: "Als hätte Gillian Flynn (Gone Girl) die Desperate Housewives ersonnen, so liest sich der neue Thriller von Astrid Korten, der mit dem verzweifelten Entschluss einer betrogenen Ehefrau beginnt und in einen packenden Strudel aus Tod und Täuschung mündet." Wolfgang Brandner, Kulturreferent der Stadt Schladmig "Wenn man denkt, dass es gar nicht mehr böser geht, setzt Astrid Korten noch einen drauf! Chapeau! Wer Psychothriller mit Tiefgang, Wendungen und Überraschungen mag, wird "Wintermorde" lieben! Ein gut durchdachter und hervorragend erzählter Psychothriller!" Thrillertante Blog
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
WUT
Über das Buch
Gegenwart
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Trügerische Affäre
MONDTEUFEL
WO IST JAY?
Über die Autorin
Impressum
Impressum
Website: www.astrid-korten.com
Twitter: https://twitter.com/charbrontee
Google: Astrid Korten
Copyright 2017 Astrid Korten
Lektorat: Buchreif, Christine Hochberger
Bildnachweis: Shutterstock /PicFine
Covergestaltung ZERO Werbeagentur München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung der Autorin wiedergegeben werden.
WUT
„Wut gleicht einem vorübergehenden Wahnsinn, denn er ist,
ebenso wenig wie dieser, Herr über sich selbst.
Lucius Annaeus Seneca
Über das Buch
WUT * HASS * RACHE *
Was wir taten, war unvorstellbar.
Verlegerin Alma, erdrückt von Beruf, Familie und dem Desinteresse ihres Mannes, sucht nach radikaler Veränderung. Sie will ihren Mann loswerden. Alma sucht nach Gleichgesinnten und findet sie in einem Chatroom. Vier Frauen, ein gemeinsamer Nenner: Wut. Doch dann geschieht ein heimtückischer Mord, der wie ein Albtraum auf Almas Brust lastet. Als sie begreift, dass sie die Hauptfigur in einem perfiden Rachespiel ist, ist es zu spät.
Ein packender Psychothriller, in dem nichts so ist, wie es scheint, und der den Leser fassungslos zurücklässt.
Erste Buchkritiken:
Als hätte Gillian Flynn (Gone Girl) die Desperate Housewives ersonnen, so liest sich der neue Thriller von Astrid Korten, der mit dem verzweifelten Entschluss einer betrogenen Ehefrau beginnt und in einen packenden Strudel aus Tod und Täuschung mündet.
Wolfgang Brandner, Kulturreferent
Wenn man denkt, dass es gar nicht mehr böser geht, setzt Astrid Korten noch einen drauf! Chapeau! Wer Psychothriller mit Tiefgang, Wendungen und Überraschungen mag, wird "Wintermorde" lieben! Ein gut durchdachter und hervorragend erzählter Psychothriller!
Alexandra Hoffmann
Gegenwart
Tagebuch eines Häftlings
Ich bekomme keinen Besuch. Sie kommt nicht. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Offenbar glaubt sie mir immer noch nicht.
„Alle Täter behaupten, dass sie unschuldig sind“, hat sie gesagt, als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe. Ich rief, ich sei kein Verbrecher, und dass sie wüsste, dass ich so etwas nie tun würde. „Wenn du weiterhin oft genug wiederholst, dass du unschuldig bist, glaubst du es zum Schluss selbst“, hatte sie nur geantwortet.
Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, kommen mir Zweifel. Ich starre dann die Decke an und komme zu der Erkenntnis, etwas Schreckliches getan zu haben, ohne es selbst zu wissen. In einem Anfall von Wahn?
Ich habe das Gefühl, dass ich allmählich meinen Verstand verliere. Vielleicht leide ich an einer Psychose. Vielleicht werde ich aber eines Tages mit einem klaren Kopf aufwachen und feststellen, dass ich es mir eingebildet habe, in einer Zelle eingesperrt gewesen zu sein. Wenn das möglich ist, könnte es sein, dass ich während einer Psychose gewalttätig geworden bin. Jemand, der seinen Verstand verliert, ist zu allem fähig.
*
Ich kann nicht. Selbst auf dem Papier kann ich es nicht sagen.
Neuer Versuch.
Wenn das möglich ist, kann es sein, dass ich einen Mord begangen habe.
Jetzt aber.
Dann kann es sein, dass ich ein Mörder bin.
*
Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich getan habe und was nicht. Ich habe beschlossen, ihren Namen nicht mehr zu erwähnen.
Den Namen meiner Frau.
Gottverdammt.
Ich wünsche mir einen Brief von ihr.
Aber sie wird mir sicher bald die Scheidungspapiere zukommen lassen, mit dem Vermerk „Bitte nur unterschreiben.“
Wie lange muss ich mich denn noch in dieser verdammten Zelle zwischen diesem Pack einreihen? Gottvergessene Idioten, die ihren niedrigen IQ mit Krafttraining kompensieren, nackenlose Zuchtbullen, die brüllen, statt zu reden. Glauben, sie seien Alpha-Männchen, zumindest, wenn das Wort in ihrem Sprachschatz vorkommt. Wenn sie ihr Gehirn benutzt hätten, hätten sie nicht lebenslänglich bekommen. Dann hätten sie eine Ausbildung abgeschlossen, statt Drogen zu verkaufen, Frauen zu vergewaltigen oder bewaffnete Raubüberfälle zu begehen.
Ich bin hier noch keinem Wirtschaftskriminellen begegnet. In meinem Zellentrakt bin ich von harten Jungs umgeben, nicht von solchen, die der Steuerfahndung zum Opfer gefallen sind. Die sind in Trakt A untergebracht. Allerdings behaupten alle Inhaftierten ausnahmslos, sie wurden von Freund und Feind über den Tisch gezogen.
Wo sind meine Freunde?
Zum Glück sind meine Eltern tot, zumindest müssen sie nicht erleben, was gerade mit mir geschieht.
Ich bin nicht dumm, aber ich war nicht in der Lage, draußen zu bleiben. Es lag an den frustrierten Kripobeamten, die zu bequem waren, einen anderen Täter zu benennen.
Mir ist übel. Das Essen ist von mäßiger Qualität und ich habe bereits drei Kilo verloren, mein Liebling.
Ich brauche Hilfe. Ich muss meine Unschuld beweisen. Selbst mein Anwalt glaubt, dass ich lüge, ich sehe es ihm an. Seine Empfehlung lautet, mich schuldig zu bekennen, mein Bedauern zum Ausdruck zu bringen und auf Strafmilderung zu hoffen.
Nein! Das werde ich nicht tun.
Niemals!
Ich lege das Tagebuch des Häftlings beiseite und starre auf meine weiße Bürowand. Das Läuten des Telefons passt nicht zu dieser Situation. Ich schließe die Augen und warte, bis es aufhört. Als es im Raum wieder still ist, atme ich langsam und sehr bewusst aus. Es klingt wie ein flüchtiges Seufzen, vielleicht, weil mein Unterbewusstsein zu beschäftigt ist und mir merkwürdige und verstörende Szenen zeigt.
Stille.
Schweigen.
Ich werde Stillschweigen bewahren. Lange Zeit habe ich mich innerlich gegen diesen Kampf meines Lebens abgeschottet und die Ereignisse weit unten in den dunklen Tiefen meines Gedächtnisses vergraben. Das mag wohl daran liegen, dass ich fortan allen anderen etwas vormachen muss. Deshalb habe ich mich entschieden, meine Geschichte aufzuschreiben – und die des Häftlings, die mit meiner eigenen verknüpft ist. Mein Tagebuch ist der einzige Ort, an dem ich ehrlich sein kann. Ich brauche ein Ventil.
Ich nehme meinen Stift in die Hand und schreibe:
MÄNNER sind MÖRDER, Serientäter, und sie entkommen zu oft ihrer Strafe.
Hm … Diese Erkenntnis hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin: eine Serientäterin, eine Frau mit einem dunklen Geheimnis, mit einem erhöhten Puls, einem arrhythmischen Herzpochen, eine Frau, die ihre Augen irrlichtern lässt, hektisch und unsicher.
Mir ist bewusst, dass mein Zorn noch nicht verebbt ist – noch nicht richtig. Er liegt auf der Lauer, versteckt im Schatten, bereit, sich hinterrücks auf mich zu stürzen, wie eine Möwe, die im Sturzflug auf die See hinabstürzt. Ohne auch nur im Geringsten zu zögern, taucht sie kopfüber mit Höchstgeschwindigkeit ein, wenn sie ein Objekt ihrer Begierde unter der Wasseroberfläche ausmacht. Ihre heiseren Schreie – der möwische Gleichwert zu hinterhältiger Freude – verjagt ihre Beute nicht, die sie am Stück runterschlingt, ehe sie überhaupt weiß, wie ihr geschieht. So ähnlich erging es mir, als eine der Frauen möwengleich wieder aus dem Nichts auftauchte – ein Freitagmorgen im Februar, und diese Frau, die kalte Umarmung eines anderen Winters. Ich habe es gespürt – das Gefühl, dass jemand mich beobachtete, als ob mir eine Feder über die Haut im Nacken strich und mich zwischen den Schulterblättern frösteln ließ. Die Wolken teilten sich in dem Moment und der gleißende Schein der Wintersonne brach hervor und fiel auf den Schnee, wie ein Vorbote.
Der Schmerz, den sie mir zufügte, ist noch da – er ist nie weg gewesen, aber seine scharfen Kanten sind stumpf geworden. Ein Geheimnis zu hüten, ist schwieriger als ich geglaubt habe. Das Schweigen ist manchmal unerträglich. Schweigen übermannt mich mit Traurigkeit und lässt die Quelle der Melancholie sprudeln. Ich verstehe mittlerweile, warum Menschen betrügen und danach so töricht sind, den Betrug zu gestehen. Vielleicht ist das auf Dauer doch besser, als allein mit einem Geheimnis leben zu müssen.
Reue ist nicht das treffende Wort für das, was ich heute empfinde. Reue ist etwas für Feiglinge, die es nicht wagen, sich zu ihren Taten zu bekennen. Serienmörder verspüren tief in ihrem Inneren das Bedürfnis, gefasst zu werden. Sie suchen weniger Anerkennung als Aufmerksamkeit, das Rampenlicht, die Bühne – Schaut mich an, ich habe die Macht. Sie hinterlassen Spuren wie eine Unterschrift: Ich war hier. Die Tat selbst ist nicht genug, die Welt muss wissen, wie brillant sie sind. Serientäter sind intelligent und führen die Polizei an der Nase herum. Aber ihre Eitelkeit wird ihnen letztlich zum Verhängnis.
Ich muss mein Schweigen brechen, damit ich nicht wieder in die stählerne Falle der Vergangenheit tappe. Ein Tagebuch ist ein geeignetes Mittel für meine geheimen Wunden. Ich werde meine Geschichte aufschreiben, weil ich zu verstehen versuche, was vor einem Jahr geschehen ist. Mein Tagebuch wird niemand lesen, weder Greta, Marie und Sophie noch der Häftling, obwohl er ein Recht dazu hätte. Es gab eine Zeit – für alle – da waren wir glücklich. Ein Wort, das ich heute nicht mehr verwenden mag.
Marie, Sophie, Greta und ich.
Unser Lächeln war eine Kleinigkeit.
Was wir taten, war unvorstellbar.
Kapitel 1
Ein Jahr zuvor - Wie alles begann
Auszüge aus meinem Tagebuch.
Ich möchte ein schlechter Mensch werden.
Die Chance ist groß, dass ich, Alma Rösler, demnächst sterben werde. Besonders in der Nacht, sobald der Himmel mir auf den Kopf fällt und Gott gleich mit ihm, weil ich nur noch einen, höchstens zwei Tage unter den Wolken weile. Wenn ich wieder einmal schweißgebadet aufwache, kommt mir dieser Gedanke in den Sinn.
Seit meiner Geburt laufe ich Gefahr zu sterben. Also kann ich durchaus sagen, es hat sich kaum etwas verändert. Außer, dass mein Herz jetzt eine tickende Zeitbombe ist. Ich hatte einen Herzinfarkt, der meine Mitralklappe geschädigt hat. Morgen soll sie durch eine neue ersetzt werden.
Mein Arzt meinte, ich hätte Glück gehabt und sollte ihm vertrauen. Dr. Schäfer saß hinter einem weiß lackierten Tisch, als er mich über die Mitralklappe aufklärte, auf einem Stuhl mit einer hohen Lehne, die seinen Kopf mit dem gegelten, grau melierten Haar überragte. Ich habe mich damals gefragt, welchen Zweck dieser Stuhl wohl erfüllt. Die Lehne passt eher zu einem Gelehrten, der den ganzen Tag in starrer Haltung an einem wissenschaftlichen Durchbruch arbeitet. Solche Typen glauben, dass der Austausch einer Herzklappe einem Schnupfen gleichkommt. Schnupfen. Unheilbar. Endstadium. Die Viren platzen aus allen Nähten, brauchen Frischluft. Operation gleich Exitus. Hm ... Dr. Schäfer (= Schaf) kann also nicht viel tun. Er ist ja Arzt. Er kann nur die Klappe austauschen. Aber sein Stuhl soll vermutlich ausdrücken: Hier arbeitet eine Koryphäe. Ob es im Himmel auch Möbel gibt? Ich würde dann dort auf einem ähnlichen Möbelstück Platz nehmen, aber das wird gewiss von Gott belegt.
Dr. Schäfer trägt unter seinem weißen Kittel diese bestimmte Art von Pullovern, diese weichen, die Ehefrauen ihren Männern kaufen. Dadurch werde ich daran erinnert, dass er noch ein anderes Leben hat. In diesem anderen Leben segelt er an den Wochenenden mit einem alten Schulfreund – das hat er mir anvertraut. Ich gönne ihm seine Entspannung, aber nicht, wenn ich seine Patientin bin. Der Arzt, den ich mir erträume, hat kein Leben außerhalb der Krankenhausmauern, dies hier ist sein Leben. Wenn ich mir ausmale, dass er mich aufschneidet, während er seinem OP-Assistenten erzählt, dass er am Wochenende segeln war, bricht mir der Schweiß aus allen Poren. Warum hütet Dr. Schäfer keine Schafe? Darüber spricht man wenigstens nicht.
„Vertrauen“, wiederholte er leise, den Blick auf irgendetwas unten auf dem Boden gerichtet, was ich nicht sehen konnte. Ich lauschte damals seinen Worten, hörte die Diagnose und stand abrupt auf. Der Arzt auch. Ich glaubte, eine gewisse Erleichterung in seinem Gesicht zu sehen, schwer erkennbar, da sein selbstgerechter Ausdruck andere Emotionen plattwalzte. Männer wie er zeigen keine mimische Regung. Nicht nach dem Sex, nicht auf der Beerdigung der Mutter. Ich ging um seinen Schreibtisch herum, was er stirnrunzelnd zur Kenntnis nahm, sah ihm in die Augen. Sie nennen es Glück, wenn ich jeden Moment sterben kann? Ich glaube, es ist wohl eher Pech.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich wollte es sagen. Stattdessen dankte ich ihm. Nur wofür? Dass er mir zwei Minuten seiner kostbaren Zeit gewidmet hatte? Er reichte mir zum Abschied die Hand und ich befürchte, ich habe mich nochmals bei ihm bedankt.
Ich bin eine schlechte Nachricht
Ich bin mir bewusst, dass mein Herz jeden Moment seine Arbeit einstellen kann. Das Herz ist ein essenzielles Organ. Ohne Herz stirbt der Mensch. Sie werden mich aufschneiden, meine Rippen zersägen und mein Herz stilllegen. Dabei kann alles Mögliche schiefgehen. Vielleicht werde ich danach nicht mehr aufwachen. Jedes Jahr sterben eintausendsiebenhundert Patienten an einem Kunstfehler. Sie wurden krank eingeliefert und tot entlassen. Wenn ich meinem Mann die Fakten unter die Nase halte, findet er das morbid.
Der Tod kommt näher, so nah, dass er seinen Arm um meine Schulter legt. Dabei spüre ich sein Zittern. Und meinen Widerwillen. „Zu jung“, sagt das Leben. Doch der Tod widerspricht. „Alma, dies ist deine Chance. Dein Code lautet: Du bist eine Ausnahme.“
Selbst in dem Moment, in dem meine Mitralklappe undicht ist, zeige ich ein sozial wünschenswertes Benehmen. Ich belasse meine Hand auf dem Oberarm von Mister Tod, lächle freundlich. Ja, wir beide haben einen Deal: Ich sterbe, und du wirst leben. Machen wir.
Gute Vorsätze
Ich möchte ein schlechter Mensch werden. So, jetzt steht es hier. Schwarz auf weiß.
Nach meiner Operation habe ich verschiedene Optionen, falls ich noch lebe. Im Netz wimmelt es nur so von Schicksalsgefährten. Manche Herzpatienten trainieren für einen Marathon, obwohl sie vorher kaum einen Schritt zu Fuß gegangen sind. Andere fahren mit dem Fahrrad den Berg rauf und runter, möglichst in der Nähe einer Klinik. Manche gründen eine Stiftung. Fast alle möchten ein besserer Mensch werden. Das Ruder herumwerfen, nennen sie es. Fürs Erste verspüre ich nicht das geringste Bedürfnis nach Sport oder guten Taten.
Ich war schon immer ein wenig anmaßend und eingebildet und ich befürchte, dass der Zustand meines Herzens mich nicht davon heilen wird. Vielleicht bin ich eitel, aber ich versuche, Klischees zu vermeiden. Ich möchte kein besserer Mensch werden, nur weil mein Herz auf der Kippe steht und sich und mich womöglich aufgeben wird.
Wenn ich zurückblicke, was ich momentan ununterbrochen tue, habe ich mir mein ganzes Leben Gedanken darüber gemacht, was andere von mir halten. Die Anthropologie, die mein Verhalten der vergangenen Jahre zu erklären versucht, kommt zu dem Ergebnis, dass ich nur das getan habe, was andere von mir erwartet haben. Oder wovon ich glaubte, dass es von mir erwartet wurde. Ich begründete mein Verhalten, wusste fantastische Motivationen und Analysen aus dem Hut zu zaubern, aber letztlich war meine stärkste Triebfeder die Angst vor der sozialen Isolation. Es bedurfte einer defekten Mitralklappe für diese Erkenntnis.
Ich möchte eine Banane
Paul hat mir früher vorgeworfen, dass ich meine vermeintlich moralische Überlegenheit raushängen lasse. Meine Vernunft macht ihn verrückt und ich kann es ihm nicht mal verübeln. Folglich führe ich eine mentale Diskussion mit ihm, die ich schon längst hätte führen sollen. „Ich weiß, dass du es nicht leicht hast, aber das gibt dir nicht das Recht, mich wie einen Punchingball zu benutzen.“
Oder so ähnlich.
Ich möchte ein schlechter Mensch werden, und daran werde ich hart arbeiten. Der erste Schritt wäre, in Situationen, in denen alles Sinn ergibt, meine Missbilligung und meinen Unmut kundzutun. Wenn mir ein Pferd auf den Fuß tritt, krümme ich mich lieber vor Schmerz, als das edle Tier darauf hinzuweisen, dass es meine Zehe zerschmettert hat.
Der zweite Schritt bestünde darin, in Situationen, in denen es unpassend wäre, dennoch den Mund aufzumachen.
Es sind Situationen, mit denen Männer in der Regel keine Probleme haben. Sie glauben, alle Ansprüche wären ihnen bereits in die Wiege gelegt worden. Erfüllt sich das nicht, werden sie böse.
Affe möchte eine Banane.
Keine Banane im Haus.
Affe wird böse.
Der dritte Schritt bereitet mir schon jetzt eine ungeheuerliche Vorfreude auf das, was kommen wird. Diejenige zu sein, die wie ein Marktweib schreit. Diejenige zu sein, die sagt, dass es für dich heute keine Banane gibt. Den roten Knopf zu drücken, wann immer mir danach ist, ohne dass es mir etwas ausmacht, was andere davon halten.
Der Weißwurstmoment
Ich bin mir absolut der Tatsache bewusst, dass ich mich mit zweiundvierzig Jahren auf dem Höhepunkt meines Lebens befinde. Meine Unverwüstlichkeit hat meine zwanzigjährige Ehe mit Paul langsam erschöpft. Wie zwei Katzen schleichen wir beide in einem fremden Territorium umeinander, denn ich will dem endgültigen Verfall ein wenig entgegensteuern. Seit Jennys Geburt vor fünf Jahren gehen wir uns aus dem Weg. Wir sind zu sehr mit dem Mädchen beschäftigt, und deshalb kommt es uns vor, als bemühten wir uns auch um uns. Wir plaudern miteinander, oh ja, man höre und staune. Paul rumort in der Küche und ich sitze am Tisch, gebe gemurmelte Satzfetzen von mir und Bestätigungen in Form von Lautäußerungen wie Hm-hm, ja, aha.
Dann starrt Paul ins Leere, als hätte er meine Antwort nicht gehört. Er hat neuerdings diese Aussetzer, und sie häufen sich. Gerade noch hier bei mir, im nächsten Augenblick weit weg, als würde er auf einem Fluss aus Gedanken dahingleiten. Dann ist er wieder entspannt und unbekümmert. Ich verstehe, worum es hier geht, und schweige – wie immer. Paul erwähnte heute eine Versammlung, die bereits eine Woche zurücklag und zu der er hauptsächlich gegangen war, um sich zu ärgern. Dann erzählte er mir den Plot eines Kinofilms, den wir nicht zusammen gesehen haben. Ich habe nicht gefragt, wer ihn begleitet hat. Es gibt zu viele Karins, Chelseas oder Susannes. Schließlich sprach er von einem Kollegen mit einem todkranken Hund. Ich dachte an mein Herz und hatte Mitleid mit dem Hund.
Während Paul Kaffee kochte und erzählte, ging mir ein Spaziergang durch den Kopf. Ich meine einen richtigen Spaziergang, gänzlich ohne Ziel.
Wenn ich eine Gruppe mit Nordic-Walking-Stöcken an meinem Küchenfenster vorbeilaufen sehe, gehen mir die Bewohner der Dritten Welt durch den Kopf, die für eine Karaffe Wasser unzählige Kilometer pro Tag laufen. Versuch denen mal zu erklären, dass es Menschen gibt, die sich freiwillig mit Stöcken fortbewegen, vollkommen ohne Ziel.
Trotz meiner Aversion gegen wahlloses Walken ging ich heute vor die Tür. Ich hatte meinen freien Tag und die Decke fiel mir auf den Kopf. Ich musste etwas unternehmen und überlegte, was ich mir kaufen könnte, etwas, was ich brauchte, aber mir fiel nichts ein. Außerdem wollte ich nicht unbedingt in das nahe gelegene Einkaufscenter, wo mir Bekannte über den Weg laufen konnten. Ich entschied mich für eine andere Route und kam in eine Gegend, die ich nicht kannte: Ein kleiner Platz mit einem Café, einer traditionellen Bäckerei und einer Imbissbude. Plötzlich sah ich eine Person, die eine mir vertraute Jacke trug. Tatsächlich, sie gehörte Paul, der aus einem Wandautomaten eine dampfende Weißwurst zog und sie in kürzester Zeit verschlang, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzusehen. Ich kam mir vor, als hätte ich ihn in dem Moment erwischt, in dem er mit einer Hure ein Bordell verließ.
Mein Mann scheint sein Leben ohne mich zu führen. Das weiß ich natürlich, aber es bleibt eine abstrakte Vorstellung, wenn ich ihn dabei nicht in einer Imbissbude erwische. Bis heute wusste ich nicht, dass er Weißwurst mag. Ich habe auch keine Ahnung, was er um diese Uhrzeit in dieser Gegend macht.
Plötzlich geriet mein ganzes Leben ins Wanken. Im Grunde habe ich keine Ahnung, wer Paul überhaupt ist, dieser Mann, den ich meinen Ehemann nenne. Ich erkannte seine Jacke, nicht mehr. Wahrscheinlich wäre er genauso erstaunt darüber gewesen, mich hier zu sehen.
Paul weiß nicht, was sich in meinem Kopf abspielt, und ich kann von meinem Ehemann nicht erwarten, dass er mich und meine wortreiche Stille versteht. Er interpretiert und analysiert stattdessen scharfsinnig meine achtlosen Bemerkungen, versucht, mich auf eine Art und Weise zu beruhigen, die mich nicht beruhigt.
Ich habe vor geraumer Zeit damit aufgehört, ihm zu erzählen, was ich fühle. Er hat keine Ahnung, dass ich in der Nacht stundenlang wach liege und seinem Schnarchen lausche. Ich liste ihm dabei flüsternd auf, was während der Operation alles schiefgehen könnte. Dass ich Angst vor dem Eingriff habe und mich vor dem Sterben fürchte, erwähne ich nicht.
Wie er jetzt seine Weißwurst hinunterschlang, kam er mir wie eine Person vor, in die ich mich niemals hätte verlieben können. Seine Schultern waren nach vorn gebeugt, seine Jacke wirkte verwaschen und aus der Mode. Er machte den Eindruck eines niedergeschlagenen Mannes, der sich mit seinem Schicksal abgefunden hatte.
Vielleicht isst er wöchentlich eine Weißwurst. Vielleicht macht er das schon länger. Vielleicht habe ich mich auf die Frage fixiert, ob er mich noch liebt, weil ich nicht darüber nachdenken möchte, ob ich ihn noch liebe. Es macht mir zu schaffen, und ebenfalls die Tatsache, dass meine Vorstellung, wer ich bin und wie ich mich zu verhalten habe, sehr viel instabiler ist, als ich bisher vermutet habe.
Ich eilte über den Platz, wollte ihn doch nicht kompromittieren.
Fiktive Gespräche
In meinem Kopf unterhalte ich mich mit anderen Menschen, führe vollständige Konversationen mit ihnen. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob diese Gespräche nicht doch stattgefunden haben. Das habe ich doch schon einmal erzählt, schießt es mir immer häufiger durch den Kopf. Ich habe keine Ahnung, ob es anderen Menschen ähnlich ergeht.
Während meiner inneren Monologe bin ich lebendig und eloquent. Ich erzähle bis ins Detail, was mir auffällt und bin erstaunt, dass es amüsant ist, und ich lache laut auf.
Paul hat mir einst versprochen, dass er mich warnt, wenn ich meinen Verstand verliere. Aber ich denke nicht im Traum daran, ihn an sein Versprechen zu erinnern.
Freier Fall
Ich liege wieder in einem Zimmer, das Menschen in weißer Kleidung betreten. Weder dieses Zimmer noch die Aussicht aus dem Fenster kommen mir bekannt vor. Draußen wird es dunkel. Ich liege schon ziemlich lange dort und frage mich, ob der Körper unter dem Laken mir gehört.
In den vergangenen Stunden habe ich mich in Gedanken mit Paul unterhalten und nicht einmal gelacht. Man kann das als einen Versuch auffassen, auf das Pflegepersonal geistig gesund und fit zu wirken. Aber im Grunde gibt es nichts zu lachen.
Unsere Unterhaltung?
„Paul, wo bleibst du?“
„...“
„Antworte gefälligst. Wo bleibst du?“
In Erwartung
Die Besuchszeit ist vorüber. Paul ist nicht gekommen. Er hat auch nicht angerufen oder mir eine SMS geschickt. Morgen werde ich operiert. Ich gerate in Panik. Falsch! Ich bin in Panik. Ich rufe ihn an. Es läutet. Der Anrufbeantworter springt an. Seltsam. Paul schaltet niemals den Anrufbeantworter ein und ganz gewiss nicht heute, da ich jeden Moment sterben könnte. Er muss doch erreichbar sein.
Ich habe keine Lust, seine Mutter anzurufen, mache es dennoch. Sie hat keine Ahnung, wo Paul ist. Seine Freunde wissen auch nichts. Sie versuchen, mich zu beruhigen, aber ich entnehme ihren Stimmen, dass auch sie es komisch finden. Hatte er einen Autounfall und sein Wagen liegt irgendwo in einem Graben? Oder ist dies der Moment, in dem Paul mich offiziell verlässt?
Schmerzen
Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen.
Ich habe Schmerzen.
Mein Name ist Alma Schmerz.
Schafe grasen auf meiner Weide – meinem Körper, ich warte auf das endgültige Signal des Todes. Darauf, dass das Licht schwächer wird. Das ist nicht gut.
Die künstliche Klappe befindet sich in meinem Herzen, und ich muss den Rest meines Lebens Medikamente einnehmen. Ich höre die Klappe ticken. Laut Dr. Schäfer gewöhnt man sich an das Geräusch. Wenn ich die Kraft hätte, Paul einen schweren Gegenstand an den Kopf zu werfen, würde ich es tun. Dr. Schäfer hat mich gestern operiert, erst heute sitzt Paul an meinem Bett. Vielleicht war er gestern auch schon dort und ich habe es nicht mitbekommen. Ehemann gleich Feigling.
Er sitzt weinend auf dem Stuhl neben meinem Bett. Das einzig Sinnvolle, das er von sich gibt, ist: „Ich konnte es nicht.“
Seine wortkarge Erklärung hätte von mir stammen können.
Aber ich will jedes Detail hören.
„Du stellst mir aber seltsame Fragen. Haben sie dir Medikamente gegeben?“, will er auf mein beharrliches Erkunden hin wissen.
Haben sie nicht, du feige Sau.
Er hat sich um mich keine Sorgen gemacht und nicht im Krankenhaus angerufen, um sich nach mir zu erkundigen. Stattdessen ist er nach Dienstschluss nach Hause gefahren, hat den Anrufbeantworter eingeschaltet und sich in die Badewanne gelegt, bis seine Haut aufgeweicht und faltig war. Er hat mich für viele Stunden aus seiner Lebenswelt gerissen, wie man sich einen Splitter aus der Haut zieht.
Geruch
Meine Tochter hat mir zwei Bilder gemalt, die über meinem Bett hängen. Paul hat sie mit Datum und Namen versehen, als würde ich nicht wissen, dass sie von meiner Tochter stammen. Jenny mag keine kranke Mutter, rümpft ihre Nase beim Betreten des Krankenzimmers.
„Es stinkt hier nach Krankheit und Tod“, hat sie gesagt und dabei ihren Vater angelächelt. Dann haben sie beide das Krankenzimmer verlassen. Egal.
Ich nehme den Geruch der Desinfektionsmittel nicht mehr wahr. Ich rieche nicht, was ich nicht mag. Ich weigere mich, Bestandteil von schwächlichem, krankhaftem und widerlichem Chaos zu sein.
Die Folge
Ich stehe momentan auf dem geistigen Niveau einer Sechsjährigen. Ein Buch zu lesen, strengt mich an. Ich blättere lieber in Zeitschriften mit jeder Menge Bilder und wenig Text und erfahre so einiges über berühmte Persönlichkeiten ohne nennenswertes Talent. Ich fand es schon immer seltsam, dass Topmodels als Popstars angeschmachtet werden, nur weil sie schön sind. Jetzt habe ich es begriffen. Sie werden bewundert, weil sie mit ihrer strahlenden Haut, ihrem faltenfreien Lächeln und ihren cellulitefreien Beinen den Mythos von Unsterblichkeit aufrechterhalten. Wenn ich heute das Foto eines Models betrachte, bin ich nicht mehr eifersüchtig, sehe nur die gesunde Frau. Keine Makel, kein Fältchen, keine defekte Mitralklappe, die das Fest der Oberflächlichkeit stören. Ich liege hier und atme und blättere. Das sollte genügen. Nebenbei entledige ich mich einiger Illusionen. Wie meiner Wahnvorstellung, dass ich lebe, um zu altern.
Die erste Falte gefiel mir. Mit ihr war ich nicht mehr das leicht naive Mädchen, sondern eine erwachsene Frau. Dennoch habe ich immer auf die eine oder andere Weise an dem Erwachsenendasein gezweifelt. Ich habe das Kindsein abgelegt, aber niemals wirklich den Großen angehört. Jetzt – hier in diesem Zimmer, in diesem Bett – denke ich anders darüber. Die erste Falte war der Anfang, die Herzklappe die Folge.
Der Arzt wird in wenigen Minuten kommen. Er will überprüfen, ob ich noch immer krank bin. Sie ängstigen sich in dieser Klinik vor Hypochondern. Kostendämpfung.
Reprise (Belebung)
„Du warst nicht da.“
„...“
Die imaginären Unterhaltungen zwischen Paul und mir sind momentan recht kurz. Was soll ich ihm antworten? Es beschäftigt mich. Ich bin ein Weichei. Er – der Waschlappen – beschäftigt mich.
Ich bin sehr freundlich zu ihm und er ist erleichtert. Wir unterhalten uns – über unsere Tochter. Worüber auch sonst? Wir überlegen, was das Beste für Jenny ist. Ich behalte meine finsteren Gedanken für mich, äußere mich nur hin und wieder dahingehend, dass ich nie wieder gesund werde. Er widerspricht brav. Ich lehne mich auf und er spielt, in der Reprise, die Rolle des unterstützenden Ehemannes.
Eines Tages werde ich dieses Zimmer verlassen. Ich male mir aus, dass ein anderer Paul mich abholt, in Begleitung unserer Tochter. Ein Mann, der während meiner Abwesenheit in den Körper meines Ehemannes geschlüpft ist, einer, der während der kurzen Spanne meiner Abwesenheit ein anderer geworden ist. Das schuldet mir Paul, das Geschenk des Lebens, das ich in den Gefühlen wiederentdeckt habe, das eine Frau wie mich wieder menschlich macht und nicht nur Gefühle wie Liebe, sondern auch Gier, Lust, Begehren ... das mich das ganze Spektrum der wimmelnden, explosiven Gefühle wieder spüren lässt. Die Ungeduld, mit ihm zusammen zu sein, die mich den ganzen Tag quält, selbst für ein Gefühl wie Eifersucht wäre ich dankbar. Das mochte schmerzhaft sein, aber wenigstens war ich dann wieder im Reich der Lebenden. Wir fahren in meiner Vorstellung zu dritt nach Hause und feiern das Fest meiner Heimkehr.
Jeder wird sterben, die Frage ist nur, woran. Hatte ich das schon erwähnt, Paul? Ich werde in einer dunklen Nacht bei abnehmendem Mond vor deinem Bett stehen, dein kuscheliges Schlafkissen mit dem Porsche nehmen und es so lange auf dein Gesicht drücken, bis dein letzter Atemzug in einem zitternden Rasseln verklingt.
Ich könnte aber auch eine Anzeige aufgeben: Austausch erwünscht. Alter Paul gegen neuen! Dumm gegen klug. Trockenes Brötchen gegen Apfelkuchen mit Sahne.
Sei also auf der Hut!
Wasserdichtes Fass
Ich bin ein wasserdichtes Fass. Ich fühle mich nur gut, wenn mein Fass kein Loch hat, durch das die Realität hineinsickern kann. Auch habe ich keine Lust, meine armselige Geschichte ständig zu wiederholen. Meine Verwandten und meine Freunde kennen sie, das sollte genügen. Ihre mitfühlenden Gesichter mit dem sorgenvollen Runzeln auf der Stirn ertrage ich kaum noch. Selbst ihre Stimmen ändern sich, wenn sie sich nach meinem Befinden erkundigen. Sie sind so leise, als würden sie mich nach einer illegalen Aktion aushorchen. Ich antworte, es gehe mir gut, wechsele das Thema und bemühe mich, ihre Erleichterung zu ignorieren. Eine geglückte Herzoperation bedarf keines weiteren Kommentars. Ich möchte wieder an die Arbeit.
Ich habe mir vorgenommen, niemandem mehr von meiner neuen Herzklappe zu erzählen. Die Erinnerungen an die Zeit vor und nach der Operation fließen in mein wasserdichtes Fass. Deckel drauf. Fertig.
Fast zu Ende
Es scheint mir geradezu fantastisch, mich in die Gesellschaft von Menschen zu begeben, die nicht wissen, dass ich im Krankenhaus nur knapp dem Tod entkommen konnte. Dass ich fast tot war, ohne dass ich es wusste. Dass ich Todesangst hatte.
Ich blicke jetzt nach vorn, nicht zurück! Mein Herz arbeitet perfekt und mein Leben hat sich verändert. Ich trinke jetzt Espresso mit George Clooney, statt mit Gott Malkovich auf dem Koryphäenstuhl Händchen zu halten. Vor einigen Tagen hatte ich gerade die neue Espressomaschine eingeschaltet, als Paul in die Küche kam. Er blieb an der Tür stehen, die Hände in den Taschen, und blickte mich verlegen an. Ich kannte diesen Gesichtsausdruck – eine Frau war mal wieder im Spiel. Mit seinem zerzausten Haar und dem unsteten Blick, der durch die Küche huschte, war er wieder ein kleiner Junge, der bereit war sich zu entschuldigen, und der auf Vergebung hoffte.
„Ich habe nachgedacht“, begann ich, während ich zwei Tassen unter die Maschine stellte. „Wir sollten ein paar neue Grundregeln aufstellen, finde ich.“
„Grundregeln?“, fragte Paul verwirrt.
„Ja!“
Plötzlich wurde mir klar, dass er gar nicht verlegen wirkte, sondern verschlagen. Durchtrieben. Wut stieg in mir hoch wie Quecksilber in einem Thermometer.
„Ich brauche meinen Freiraum, Paul. Ich brauche Ungestörtheit, um Manuskripte zu lesen. Du kannst nicht einfach auf einen Plausch reinspaziert kommen, wenn du dich langweilst oder gerne Gesellschaft hättest.“
„Und wie sollte ich mich in Zukunft deiner Meinung nach verhalten, Alma?“
Mir fiel auf, dass Paul sich kaum beherrschen konnte, obwohl er sich bemühte, kühl und gelassen zu wirken, doch ich kannte ihn zu gut.
„Soll ich vorher anklopfen?“, fauchte er. „Mich auf einen Kaffee mit dir verabreden? Auf Zehenspitzen in meinem eigenen Haus herumschleichen?“
„Hör mal, ich verlange lediglich, dass du meinen Arbeitsbereich hier ebenso behandelst wie dein ... Allerheiligstes in der Stadt.“
„Reg dich nicht so auf, Alma.“
Die Espressomaschine spuckte und zischte. Ich drehte mich um und knallte die beiden Tassen auf den Tisch.
„Wieso habe ich keinen Schlüssel für unsere Stadtwohnung?“
„Was?“ Er blickte mich misstrauisch und verwirrt an.
„Du hast mir nie einen Schlüssel gegeben.“
„Wieso hättest du einen Schlüssel ...“
„Sabine hat einen.“
Paul starrte mich an. „Wieso tust du das? Wieso sagst du so was?“
„Übrigens, der Schuhputzkasten steht jetzt in der Garage auf deiner Werkbank. Mir fehlt nach der Herzoperation einfach die Spucke zum Polieren.“ Die brauche ich für dich!
Ich spürte, wie die Worte und die Kälte, die in ihnen mitschwang, wie eine einzige Giftwolke in die Luft freigesetzt wurden. Paul fiel vor Schreck die Kaffeetasse aus der Hand. Meine Augen scannten emotionslos den Verlauf des Kaffees – ein sanftes Braun auf Blütenweiß.
Es gelingt mir ausgezeichnet, ein schlechter Mensch zu werden.
Es ist wie ein eisiger Wind, der mir die Tränen in die Augen bläst und mich trotzdem lächeln lässt.
Es fühlt sich verdammt gut an.
Kapitel 2
Entkorkt
Greta, Marie und Sophie lernte ich in einem Chatroom für Frauen um die vierzig kennen und wir verstanden uns dort auf Anhieb. Ich habe Vertrauen immer für eine merkwürdige Sache gehalten – eine kuriose Sache –, die Bedeutung, die die Leute dem beimessen. Zum Beispiel, wie ungeheuer wichtig sie in einer Beziehung genommen wird. Ich vermute, dass wir Frauen ein großes Verlangen danach haben. Im Chatroom fassten wir von Anfang an Vertrauen. Unsere erste Begegnung im realen Leben könnte man dagegen ein wenig seltsam nennen.
Ich nippte bereits seit zwanzig Minuten an einem Glas Wein, als die drei kurz nacheinander das Café Lila betraten, mit einer Zeitung als Erkennungszeichen unter den Arm geklemmt. Ich ging nicht gern in ein überfülltes Café wie dieses, in dem das Stimmengewirr und die Geräusche von klirrendem Geschirr von den Wänden widerhallten und in dem es nicht immer gut roch, dafür aber Hochmut, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit anzutreffen waren. Ein Ort voller Menschen, voller Leben, voller Blech und Beton – und ohne Weißwurst. Für unseren Zweck war es perfekt: neutral, groß, anonym.
Es war sonderbar, so im Halbdunkel zu sitzen, mit dem Weinglas in der Hand und sie zu beobachten, während draußen der Feierabend langsam in die Gänge kam, Züge mit Pendlern den Bahnhof verließen, Menschen nach Hause hasteten und der Wind den Regen gegen die Fensterfront des Cafés peitschte. Ich hatte in der vergangenen Nacht kaum geschlafen und mein Körper schrie vor Müdigkeit, und doch sprudelte heute eine Art verrückte Energie durch mich hindurch – die Vorfreude auf dieses erste Treffen.
Greta, Sophie, Marie.
Blond, brünett, schwarz.
Ihr Äußeres entsprach nicht ganz meiner Vorstellung. Obwohl sie in meinem Alter waren, wirkten sie jünger als Mitte vierzig. Sie begrüßten sich freundlich, reichten sich die Hand und machten sich über die Zeitung lustig. Dann sahen sie sich um, zweifellos nach mir, aber ich ließ meine Zeitung auf der Theke liegen und wartete, um sie mir noch aus der Ferne anzusehen. Als sie ihre Getränke bestellten, hielt ich die Zeitung hoch, ging auf sie zu. „Ich bin Alma.“
Ein paar letzte Reste meiner nervösen Energie brodelten noch immer in mir. Ich wusste, ich sollte nach Hause fahren und versuchen, mich mit Paul zu arrangieren, vielleicht mich mit ihm zu versöhnen. Aber ich wusste nicht, wie ich diesen Frauen mein Verhalten erklären sollte, also blieb ich und fragte mich, ob sie sich auch von mir ein anderes Bild gemacht hatten.
„Ihr müsst mein verheerendes Aussehen entschuldigen. Der Regen.“
Verdammt. Warum entschuldigte ich mich? Als ich noch ein junges Mädchen war, wirkte der Regen immer so erfrischend. Er machte mir nichts aus. Die Regentropfen ließen mich in der Sonne funkeln. Heute ging ich ohne Regenschirm nicht mehr aus dem Haus und falls doch, dann kam ich mir wie ein triefender Aufnehmer vor.
Ich schlug vor, unser erstes Gespräch im ersten Stock zu führen, weil es dort ruhiger war.
Wir rückten an einem schmalen, blank polierten Holztisch eng zusammen und ich empfand unmittelbar jene gewisse Intimität, die sonst nur ein Computerbildschirm vor mir hervorrief, weil er Wärme und Licht ausstrahlt, mich aber nie ansieht und von dem ich keine Antwort erwarte. Ich spürte, dass die anderen ähnlich empfanden und sich bemühten, ihr Unbehagen nicht zu zeigen.
Den wahren Grund unserer Zusammenkunft rührten wir zunächst nicht an. Stattdessen führten wir eine lockere Unterhaltung über die mangelnden Parkplätze in Münchens Innenstadt und über den anhaltenden Regen. Wir grinsten wie Schimpansen oder schnurrten wie divenhafte Katzen, die jeden Moment zum Angriff übergehen konnten.
Sophie, die sich im Chatroom hinter dem illustren Namen SW – Superweib versteckte, winkte den Ober herbei und bestellte eine Flasche Weißwein. Sie besaß die natürliche Autorität einer Führungskraft. Eine große, schlanke Gestalt mit breiten Schultern, die sie ihrem morgendlichen Schwimmtraining verdankte. Man sah ihrer Figur nicht an, dass sie bereits zwei Kinder zur Welt gebracht hatte. Das kurz geschnittene brünette Haar betonte das ebenmäßige Gesicht; sie war eine der wenigen Frauen, bei denen eine Kurzhaarfrisur nicht geschlechtslos, sondern elegant wirkte. Wie kühl und ungerührt sie ist, dachte ich, majestätisch und würdevoll. Ich kannte kaum eine Frau, die auch nur halb so viel Klasse ausstrahlte wie Sophie. Ich wusste, dass sie Assistenzärztin in der Notaufnahme war und – dass sie einsam war. Mehr hatte sie im Chatroom nicht preisgegeben. Ihre perfekte Erscheinung brachte ihr vermutlich nur wenige Freundschaften mit ihresgleichen ein.
„Mach drei Flaschen draus“, sagte Marie und lächelte den Kellner an. „Wird heute gebraucht. Wir wollen eine Totenmesse abhalten und all das beerdigen, was uns zuwider ist.“
Wir lachten laut auf. Wenigstens gab es etwas, worüber wir lachen konnten. Die ersten Zeichen der realen Annäherung flammten auf. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug.
Marie war das absolute Gegenteil von Sophie. Sie hatte kein Feingefühl, keinen Stil und keinen Geschmack; sie gab sich auch keine Mühe, das vor uns zu verbergen. Ihr unförmiger Körper steckte in einem Anorak und einer Hose ohne Bügelfalte, eine Kombination, die die Bezeichnung Hosenanzug nicht verdiente, ihre Füße in bequemen Turnschuhen. Ihr dichtes, dunkles Haar hätte mithilfe eines Friseurs prächtig sein können. Wäre ich Marie auf der Straße begegnet, ich hätte sie für eine schlampige Hausfrau gehalten. Allerdings wusste ich, dass sie Anwältin in einer renommierten Sozietät war und sich auf Strafrecht spezialisiert hatte.
Als der Kellner den Tisch verlassen hatte, gab sie vollständige Sätze von sich, mit denen sie ihre Zuhörerinnen angeregt unterhielt. Sie war Publikum gewohnt. Ich wusste nicht, ob sie mir sonderlich sympathisch war. Es spielte keine Rolle, auch sie saß nur aus einem einzigen Grund an diesem Tisch. Wenig später brachte der Kellner drei Flaschen Wein und überließ uns unserem Schicksal.