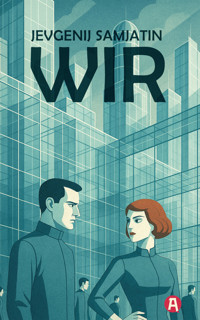
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aionas
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jewgenij Samjatin – Wir: Ein Meilenstein der Weltliteratur – kühl konstruiert, tief empfunden, heute erschreckend real Ein Staat ohne Geheimnisse. Häuser aus Glas, durch die jeder Blick dringt. Ein Tagesablauf, der bis auf die Minute geregelt ist. Gefühle gelten als gefährlich, Individualität als Krankheit. In dieser vollkommen rationalisierten Zukunft lebt D-503 – ein pflichtbewusster Konstrukteur des Raumschiffs »Integral«, das den Einzigen Staat in den Kosmos tragen soll. Er ist überzeugt von der Logik dieser Welt, von der Schönheit der Ordnung – bis er der rätselhaften I-330 begegnet. In ihr bricht etwas Unberechenbares in seine klar gezeichnete Existenz ein: Begehren, Zweifel, Unruhe. Eine innere Revolution beginnt – still, zögerlich, aber unumkehrbar. Wir, geschrieben 1920, ist der erste große dystopische Roman des 20. Jahrhunderts. Mit literarischer Präzision und visionärer Klarheit beschreibt Jewgenij Samjatin eine Gesellschaft, die den Menschen restlos in ein Kollektiv eingliedert – nicht aus Willkür, sondern aus Überzeugung. Das Individuum wird aufgelöst im Namen der Vernunft, die Freiheit geopfert auf dem Altar der Sicherheit. Der Roman war seiner Zeit so weit voraus, dass er in der Sowjetunion sofort verboten wurde – und doch legte er damit den Grundstein für alle großen Dystopien, die folgen sollten. George Orwell war tief beeindruckt und bekannte offen, dass "Wir" ihn maßgeblich zu "1984" inspirierte. Auch Huxleys "Schöne neue Welt", Atwoods "Der Report der Magd" oder moderne Werke wie Eggers’ "The Circle" tragen Spuren dieses unerhörten Textes. Doch "Wir" ist mehr als eine politische Allegorie. Es ist ein literarisches Kunstwerk – kühl und zugleich erschütternd intim. Samjatins Sprache oszilliert zwischen technischer Klarheit und innerer Unruhe, seine Bilder sind von beängstigender Helligkeit, seine Vision von beklemmender Weitsicht. In einer Zeit, in der digitale Kontrolle, freiwillige Transparenz und algorithmisch gelenkte Entscheidungen längst Realität sind, wirkt dieser Roman nicht wie eine Warnung vor der Zukunft – sondern wie eine Beschreibung unserer Gegenwart. Wir ist ein Roman, der nachhallt. Der Fragen stellt, die keine einfachen Antworten kennen. Was macht uns zu Menschen? Wie viel Ordnung verträgt die Freiheit? Und was geschieht, wenn wir vergessen, wie es ist, wirklich zu fühlen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jewgenij Samjatin
Wir
Ein dystopischer Roman
Eintrag Nr. 1
Heute las ich eine Notiz in der Staatszeitung — sachlich, feierlich, wie ein Aufruf aus einer anderen Welt. Ich schreibe sie hier wörtlich ab:
„In hundertzwanzig Tagen wird unser erstes Raketenflugzeug, der Integral, vollendet sein. Dann schlägt die große historische Stunde: Der Integral wird sich in den Weltraum erheben. Vor tausend Jahren unterwarfen eure heroischen Vorfahren diesen Planeten dem Einzigen Staat. Heute seid ihr an der Reihe. Euer Werk, der gläserne, elektrische, Feuer speiende Integral, wird die unendliche Gleichung des Alls integrieren. Eure Aufgabe ist es, jene fremden Wesen, die auf anderen Planeten noch im unzivilisierten Zustand der Freiheit leben, unter das segensreiche Joch der Vernunft zu beugen. Wenn sie nicht begreifen, dass wir ihnen ein fehlerfreies, mathematisch begründetes Glück bringen, dann ist es unsere Pflicht, sie zu ihrem Glück zu zwingen. Doch bevor wir zu Waffen greifen, versuchen wir es mit dem Wort. Im Namen des Wohltäters wird allen Nummern des Einzigen Staates mitgeteilt: Wer sich dazu berufen fühlt, ist verpflichtet, Traktate, Manifeste, Oden, Gedichte und andere Werke zu verfassen, die die Schönheit und Größe des Einzigen Staates preisen.
Diese Werke werden die erste Botschaft sein, die der Integral in den Kosmos trägt. Heil dem Einzigen Staat! Heil dem Wohltäter! Heil den Nummern!“
Meine Wangen brennen, während ich diese Zeilen niederschreibe. Ja, wir werden diese herrliche, allumfassende Gleichung lösen. Wir werden die wilde, krumme Linie begradigen, sie zur Tangente machen, zur Asymptote. Denn die Linie des Einzigen Staates ist die Gerade. Die große, göttliche Gerade — die weiseste aller Linien.
Ich bin D-503, Konstrukteur des Integral. Einer von vielen Mathematikern des Einzigen Staates. Meine Hand ist an Zahlen gewöhnt, nicht an Töne, nicht an Rhythmus. Ich schreibe, was ich sehe, was ich denke — nein, was WIR denken. Wir — das ist das einzig richtige Wort. Darum soll dieses Werk den Titel Wir tragen.
Vielleicht ist es nichts anderes als eine abgeleitete Größe unseres Lebens — dieses vollkommenen, mathemisch geordneten Lebens. Und wenn das so ist, muss es nicht zwangsläufig selbst zu einem Poem werden? Ja. Ich glaube, ich weiß es.
Ich schreibe und spüre ein Glühen in meinem Gesicht. Wahrscheinlich ist es dasselbe Gefühl, das eine Frau hat, wenn sie zum ersten Mal das Pochen eines neuen Herzens in sich spürt. Dieses Werk — das bin ich, und doch nicht ich allein. Ich muss es noch viele Monate mit meinem Blut nähren, bevor ich es unter Schmerzen gebären und dem Einzigen Staat überreichen kann. Aber ich bin bereit. So wie fast jeder von uns.
Eintrag Nr. 2
Frühling. Aus der wilden, fremden Weite hinter der Grünen Mauer treibt der Wind gelben Blütenstaub heran. Süßlich, beißend. Er legt sich auf die Lippen, macht sie trocken, zwingt einen, sie ständig mit der Zunge zu befeuchten. Jede Frau, der ich heute begegne, trägt diesen Geschmack auf den Lippen – die Männer auch. Es stört die Konzentration. Logisches Denken wird schwieriger.
Aber dieser Himmel! Tiefblau, ohne einen Makel. Wie konnten unsere Vorfahren sich von diesen unförmigen, träge dahinziehenden Dampfklumpen – Wolken! – begeistern lassen? Ein leerer, steriler Himmel ist vollkommen. Makellos. Und ich weiß, dass nicht nur ich so denke. Wir alle lieben diesen makellosen Himmel. Alles heute ist durchsichtig, klar, aus unzerbrechlichem Glas gegossen – wie die Mauer, wie unsere Gebäude. An solchen Tagen erkennt man in den einfachsten Dingen eine tiefe Ordnung, verborgene Gleichungen, eine stille Schönheit.
Heute früh, auf der Werft beim Integral, schweifte mein Blick über die Maschinen. Die Kugeln der Regulatoren drehten sich mit geschlossenen Augen, die Hebel blitzten und neigten sich wie Tänzer, die Balancierstange schwang stolz, der Meißel der Stemmmaschine arbeitete im Rhythmus einer stummen Musik. Es war ein Ballett – mechanisch, exakt, von Sonnenlicht übergossen.
Ich fragte mich: Warum ist das schön? Warum der Tanz? Weil er keine freie Bewegung ist. Weil er Gebundenheit verkörpert. Wahre Schönheit ist vollkommene Unterwerfung. Der Tanz ist die ideale Unfreiheit. Und wenn unsere Vorfahren in Ekstase tanzten – in Ritualen, bei Paraden –, dann nur, weil dieser Drang zur Unfreiheit ihnen bereits innewohnte. Wir leben das heute nur bewusster aus...
Ein metallisches Klacken unterbrach mich – die Klappe meines Numerators. Ich sah auf. O-90. Natürlich. In wenigen Sekunden war sie da, bereit zum Spaziergang.
Die liebe O. Zehn Zentimeter kleiner als die Mutternorm, rund wie ihr Name, ihre Lippen formten bei jedem Wort ein rosiges „O“. In ihren Handgelenken lagen diese tiefen Grübchen, wie bei einem Kind. Mein Kopf war noch bei der Formel, die ich gerade entdeckt hatte – sie verband uns, die Maschinen, den Tanz – und ich erzählte es ihr. „Wunderbar, nicht wahr?“ fragte ich. O strahlte: „Ja, wunderbar – der Frühling!“
Der Frühling... Sie meinte wirklich den Frühling! Ich schwieg.
Draußen auf dem Prospekt: Leben, Bewegung. Nach dem Mittagessen verbringen wir unsere persönliche Stunde oft mit einem Ausgleichsspaziergang. Aus allen Lautsprechern tönten die Klänge des Marsches vom Einzigen Staat. In perfekten Viererreihen marschierten die Nummern: Hunderte, Tausende in blaugrauen Uniformen, goldene Nummern auf der Brust. Wir vier waren nur eine Welle im gewaltigen Strom. Zu meiner Linken O-90 – meine O, hätte ein behaarter Vorfahr vielleicht gesagt –, rechts zwei unbekannte Nummern: eine weiblich, eine männlich.
Der Himmel lachte. Die goldenen Nummern blinkten wie kleine Sonnen. Überall glänzende Gesichter, kein einziger Schatten, alles strahlend, aus Licht gebaut. Die Musik war wie eine Treppe aus Erz, jeder Takt ein Schritt weiter nach oben, immer höher, hinauf in das schwindelnde Blau...
Und plötzlich sah ich alles neu: die geraden Straßen, das gläserne Pflaster, die durchsichtigen Wohnblöcke, die geometrische Ordnung der Marschblöcke. Es war, als hätte ich all das allein erschaffen, als stünde ich wie ein Turm über der Welt. Ich wagte kaum, die Ellbogen zu bewegen, aus Angst, die Mauern, Kuppeln und Maschinen könnten einstürzen...
Ein Sprung zurück in die Vergangenheit: ein Bild im Museum – eine Straße des 20. Jahrhunderts. Buntes Chaos: Menschen, Tiere, Räder, Plakate, Farben, Vögel. Und das hat wirklich existiert! Es wirkte so absurd, so unwahrscheinlich, dass ich laut loslachen musste. Gleich darauf – ein Echo. Jemand lachte rechts von mir. Ich sah hin: ein fremdes Gesicht, weiße, ungewöhnlich weiße Zähne.
„Verzeihen Sie“, sagte sie. „Aber Sie sahen eben aus wie ein Schöpfer am siebten Tag, überzeugt, dass Sie selbst mich erschaffen haben. Schmeichelhaft.“
Sie sprach mit ernstem Ton, fast mit Achtung – vielleicht wusste sie, wer ich bin. Doch ihre Augen, ihre Brauen – da war etwas. Ein X. Ich konnte sie nicht in Zahlen fassen. Das irritierte mich. Ich versuchte, mein Lachen zu erklären – logisch. Der Kontrast, die Kluft zwischen Damals und Jetzt...
„Warum unüberbrückbar?“ fragte sie. Ihre Zähne blitzten. „Auch damals gab es Trommeln, Paraden, Reihen von Menschen... Also?“
Die Worte – sie hatte exakt das gesagt, was ich vorhin niedergeschrieben hatte. Ich antwortete: „Wir haben dieselben Gedanken. Wir sind keine Einzelwesen mehr. Wir gleichen uns.“
„Sind Sie sicher?“ fragte sie. Ihre Brauen zogen sich spitz zur Nase – ein scharfes X. Ich sah sie an, dann O, dann wieder sie. Jetzt erst erkannte ich ihre Nummer: I-330. Schlank, drahtig, geschmeidig. Neben ihr O – rund, weich, kreisförmig. Und am Ende der Reihe ein Mann, gekrümmt wie ein S. Kein Gesicht glich dem anderen. Wir waren verschieden...
I-330 bemerkte meinen Blick, seufzte: „O weh!“ Es passte, aber da war wieder dieses Etwas in ihr... Ich antwortete scharf: „Kein O weh! Die Wissenschaft schreitet voran. In fünfzig, hundert Jahren...“
„Dann haben wir alle dieselben Nasen?“
„Ja! Weil Unterschiede Neid erzeugen. Wenn ich eine Knollennase habe und ein anderer...“
„Ihre Nase ist klassisch“, sagte sie. „Aber Ihre Hände... zeigen Sie mir Ihre Hände.“
Ich hasse es, wenn man meine Hände betrachtet. Sie sind behaart – ein pelziger Atavismus. Ich hielt sie ihr hin, sagte kühl: „Affenhände.“
Sie sah mich an, dann meine Hände, dann wieder mein Gesicht. „Interessanter Zusammenhang.“ Ihre Brauen zogen sich erneut zum X zusammen.
„Er ist auf mich eingetragen“, sagte O stolz mit ihren rosigen Lippen.
Ein überflüssiger Satz. Ganz die O. Ihre Zunge ist zu schnell für ihr Denken. Die Zunge darf nie schneller sein als der Verstand. Wie eine Frühzündung beim Motor – schädlich.
Vom Akkumulatorenturm schlug es fünf. Die Stunde war vorbei. I-330 ging mit dem S-förmigen Mann davon. Ein Gesicht, das mir bekannt vorkam. Ich wusste nicht, woher. Beim Abschied lächelte sie, rätselhaft.
„Kommen Sie morgen ins Auditorium 112“, sagte sie.
Ich zuckte die Achseln. „Wenn ich eine Order erhalte...“
„Sie werden eine bekommen“, sagte sie mit fester Stimme.
Diese Frau war wie ein unlösbarer Term, der plötzlich in einer Gleichung auftaucht. Irrational. Unheimlich. Ich war erleichtert, mit O allein weiterzugehen. Arm in Arm, bis zur vierten Kreuzung. Dann musste sie nach links, ich nach rechts.
„Ich würde so gern heute Abend zu dir kommen. Jetzt, in diesem Moment…“, sagte sie schüchtern.
Was hätte ich sagen sollen? Sie war erst gestern bei mir, und unser nächster Geschlechtstag war übermorgen. Wieder war ihre Zunge schneller gewesen als ihr Denken. Zum Abschied küsste ich sie dreimal auf ihre klaren, wolkenlosen, blauen Augen.
Eintrag Nr. 3
Ich habe meine gestrigen Aufzeichnungen noch einmal gelesen und festgestellt, dass ich mich vermutlich nicht klar genug ausgedrückt habe. Für uns Nummern ist das alles selbstverständlich. Aber wer weiß — vielleicht, unbekannter Leser, gehörst du zu jenen, denen der Integral diese Zeilen bringen wird, und hast das große Buch der Zivilisation nur bis zu der Stelle gelesen, an der unsere Vorfahren vor 900 Jahren stehen geblieben sind. Möglicherweise sagst du dir bei Begriffen wie Gesetzestafel, Persönliche Stunden, Mutternorm, Grüne Mauer oder Wohltäter: „Was soll das alles bedeuten?“
Mir erscheint es absurd und zugleich fast unmöglich, all das zu erklären. Es wäre, als hätte ein Schriftsteller des 20. Jahrhunderts in einem Roman plötzlich erklären müssen, was ein Rock, eine Wohnung, eine Ehefrau ist. Für zivilisierte Leser selbstverständlich, für Wilde fremd. Vielleicht hat man damals bei Übersetzungen für unzivilisierte Völker Anmerkungen zum Wort Rock gemacht. Denn der Wilde hätte sich wohl gefragt: „Wozu? Das ist doch nur Ballast.“
Ich vermute, du wirst ähnlich erstaunt sein, wenn ich dir sage, dass seit dem 200-jährigen Krieg keiner von uns das Land jenseits der Grünen Mauer betreten hat.
Aber denk einen Moment nach: Die gesamte Geschichte der Menschheit war ein Weg von der Rastlosigkeit zur Sesshaftigkeit. Je sesshafter, desto weiter entwickelt. Und wir — wir leben in der vollkommenen Form dieser Sesshaftigkeit. In jenen dunklen Zeiten, als es Nationen, Kriege, Märkte gab, irrten die Menschen ziellos über den Planeten. Warum? Wer braucht das heute noch?
Natürlich war die Umstellung nicht leicht. Als im 200-jährigen Krieg alle Straßen zerstört und von Gras überwuchert wurden, war es zunächst sicher unangenehm, in Städten zu leben, die durch weite grüne Ödnis voneinander getrennt waren. Aber was macht das schon? Auch als der Mensch seinen Affenschwanz verlor, konnte er anfangs wohl keine Fliegen mehr vertreiben und vermisste ihn sicher schmerzlich. Doch heute? Stell dir vor, du hättest einen Schwanz! Oder dass du ohne Kleidung, ohne Rock, auf der Straße stündest. Vielleicht trägst du noch einen.
Ich jedenfalls kann mir eine Welt ohne die Grüne Mauer nicht vorstellen. Kein Leben, das nicht von der Gesetzestafel geordnet ist.
Die Gesetzestafel... Von der Wand meines Zimmers strahlen ihre purpurnen Zahlen auf goldenem Grund zu mir herab – streng und gütig zugleich. Ich denke an das, was die Alten Ikonen nannten. Ich würde beten, wenn ich könnte. Ich würde Verse schreiben. Warum bin ich kein Dichter, um dich zu preisen, du Gesetzestafel, Herz und Puls des Einzigen Staates?
Schon als Kinder lernten wir eines der größten Werke der alten Literatur kennen: den Eisenbahnfahrplan. Vergleiche ihn mit unserer Gesetzestafel — der eine ist aus Graphit, der andere aus Diamant. Beide bestehen aus Kohlenstoff, aber wie unterschiedlich sind sie! Der Fahrplan bringt den Atem ins Stolpern. Die Gesetzestafel macht aus jedem von uns einen stählernen, sechsrädrigen Helden in einem großen Gedicht.
Jeden Morgen stehen wir, Millionen, zur selben Minute auf. Wir beginnen unsere Arbeit zur selben Zeit. Wir essen, spazieren, schlafen im Takt der Zahlen. Ein einziger, millionenhändiger Körper, gelenkt von der Gesetzestafel.
Ich will ehrlich sein: Ganz vollkommen ist auch unser Glück noch nicht. Zweimal am Tag — von 16 bis 17 Uhr und von 21 bis 22 Uhr — lösen wir uns auf in Einzelwesen. Persönliche Stunden. Dann sieht man Nummern hinter geschlossenen Gardinen, andere auf dem Prospekt, wieder andere am Schreibtisch. Auch ich gerade. Aber ich glaube — idealistisch, wenn man so will —, dass wir eines Tages auch diese zwei Stunden in die allgemeine Formel einfügen. Dann wird jede der 86.400 Sekunden eines Tages ihren festen Platz haben.
Ich habe viel über jene unvorstellbaren Zeiten gelesen, in denen Menschen in Freiheit lebten – ein Wort, das heute an Tierherden erinnert. Was ich nie begreifen konnte: Wie konnte ein Staat es zulassen, dass Menschen ohne festgelegte Tagesstruktur lebten? Keine Pflichtspaziergänge, keine geregelten Essenszeiten, Aufstehen und Zubettgehen nach Belieben. Historiker berichten sogar, dass Straßenlaternen die ganze Nacht brannten, dass Menschen nachts unterwegs waren, schlenderten, fuhren.
Unbegreiflich. Wie konnte man so blind sein? Man verbot das Töten eines Menschen, aber nicht das Töten von Millionen. Einen zu töten hieß, das Menschheitskapital um 50 Jahre zu verringern. Ein Verbrechen. Aber es um 50 Millionen Jahre zu verringern? Kein Gesetz. Ist das nicht absurd?
Heute kann jede zehnjährige Nummer dieses moralische Problem in einer halben Minute lösen. Doch damals — nicht einmal alle ihre Kants zusammen kamen darauf, eine Ethik auf Grundlage der Mathematik zu errichten. Keine Ethik der Subtraktion, Addition, Division, Multiplikation.
Und wie widersinnig, dass das Geschlechtsleben völlig unkontrolliert war! Die Menschen „liebten“ sich, wann sie wollten, wie sie wollten, zeugten Kinder wie Tiere — blind, planlos, gegen jede wissenschaftliche Vernunft. Gartenbau, Geflügel- und Fischzucht — das kannten sie. Aber Kinderzucht? Vater- und Mutternorm? Nichts davon.
Was ich hier schreibe, wirkt vielleicht wie ein schlechter Witz. Du denkst womöglich, ich mache mich über dich lustig, während ich mit todernster Miene Unsinn erzähle.
Aber ich bin nicht fähig, Witze zu machen. Jeder Witz ist eine unklare Funktion – also eine Lüge. Und zweitens: Die Wissenschaft des Einzigen Staates sagt, dass es so war. Und die Wissenschaft des Einzigen Staates irrt sich nicht.
Damals lebten die Menschen wie Tiere, in Herden, ohne Ordnung, ohne Logik. Was konnte man von ihnen erwarten? Selbst heute hören wir manchmal noch, aus der Tiefe, aus dem alten Abgrund, ein Echo des Wilden. Zum Glück sind es nur Reste, kleine Fehler in der Maschine. Und für solche Störungen haben wir den Wohltäter. Seine starke Hand, die wachsamen Augen der Beschützer – sie greifen ein.
Apropos: Die S-förmige Nummer von gestern — ich erinnere mich, ihn einmal aus dem Beschützeramt kommen gesehen zu haben. Jetzt verstehe ich, warum ich instinktiv Ehrfurcht empfand. Und warum mir unbehaglich wurde, als diese seltsame I-330...
Ich muss gestehen: I-330...
Es läutet. Schlafenszeit. 22:30 Uhr. Bis morgen.
Eintrag Nr. 4
Bis heute war mein Leben klar, geordnet, durchsichtig — wie ich es liebe. Klarheit: Mein Lieblingswort. Aber heute... heute ist etwas geschehen, das ich nicht verstehe.
Erstens: Ich habe tatsächlich die Order erhalten, mich in Auditorium 112 einzufinden — wie sie es angekündigt hatte. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag nur bei 3 zu 20.000 (1500 Auditorien bei zehn Millionen Nummern). Und drittens... Nein, ich will nicht vorgreifen. Der Reihe nach.
Das Auditorium war eine riesige Halbkugel aus Glas, sonnendurchflutet. Überall glatte, kugelrunde, rasiert glänzende Schädel. Ich suchte mit den Augen — nicht direkt, nur flüchtig — nach einem rosigen Halbmond über den blauen Uniformen, nach den Lippen von O. Aber sie war nicht da. Natürlich, sie kommt heute Abend zu mir. Es war nur natürlich, dass ich sie hier sehen wollte.
Ein Signalton. Wir erhoben uns, sangen die Hymne des Einzigen Staates. Dann begann auf dem Podium der goldene Phonolektor, seine Stimme aus dem funkelnden Lautsprecher:
„Verehrte Nummern! Kürzlich entdeckten unsere Archäologen ein Buch aus dem 20. Jahrhundert. Darin erzählt der Autor von einem Wilden, der ein Barometer beobachtete: Immer wenn es Regen anzeigte, regnete es auch. Also kratzte der Wilde das Quecksilber heraus, bis der Zeiger auf Regen stand — in der Hoffnung, so Regen hervorzurufen.“
Auf der Leinwand erschien ein Federgeschmückter, der mit einem Knochen das Quecksilber aus einem Barometer kratzte. Gelächter.
„Sie lachen. Aber war der europäische Mensch jener Zeit nicht noch lächerlicher als der Wilde? Auch er sehnte sich nach Regen — aber er war unfähig, das Barometer zu beeinflussen. Der Wilde aber zeigte Mut, Energie, eine Logik, wenn auch eine wilde. Er erkannte: Ursache und Wirkung sind verbunden. Und damit begann sein Weg...“
Ich will ehrlich sein. An dieser Stelle wurde ich innerlich stumm. Alles floss an mir vorbei, als wäre ich aus Gummi, wasserundurchlässig. Ich war da, aber nicht mehr verbunden. Ich verstand nicht, wieso ich überhaupt hier war. Unsinn – ich hatte ja die Order! Und dennoch fühlte sich alles leer an, bedeutungslos.
Erst als der Vortragende zum eigentlichen Thema kam, konnte ich mich mit Mühe wieder konzentrieren: Musik. Unsere Musik. Die mathematische Komposition. Die Ursache ist die Mathematik, die Wirkung die Musik. Er sprach vom neu erfundenen Musikometer. „Ein Knopfdruck genügt, und Sie komponieren drei Sonaten pro Stunde. Ihre Vorfahren dagegen mussten sich in einen krankhaften Zustand versetzen – ›Begeisterung‹ nannten sie das –, eine Art Epilepsie.“
Dann kündigte er ein Beispiel jener alten Epilepsie an: Musik von Skrjabin, 20. Jahrhundert. Der Vorhang öffnete sich. Ein schwarzes Ungetüm erschien — ein Instrument, genannt Flügel. Welch absurder Name. Er sollte Flügel verleihen?
Doch ich hörte nichts mehr von dem, was gesagt wurde. Denn sie trat auf die Bühne. I-330. Sie trug ein enges, schwarzes Kleid, das Schultern und Brüste freilegte, dazwischen ein warm zitternder Schatten. Ihre Zähne: blendend weiß, beinahe bissig. Sie lächelte. Es war ein Lächeln wie ein Schnitt.
Dann spielte sie. Die Töne wirr, exaltiert, ohne jeden Sinn für Ordnung. Musik aus jener Zeit – wild, irrational, unlogisch. Die meisten lachten. Und ich? Warum... auch ich?
Epilepsie. Ein Schmerz. Ein süßer, brennender Schmerz. Wie ein Biss, der sich tiefer und tiefer eingräbt. Und ich wollte, dass er tiefer ging. Dass ich ihn ganz spüre. Da ging die Sonne auf. Nicht unsere gleichmäßige, kristallklare Sonne – sondern eine andere. Eine wilde, brennende, zerstörerische Sonne. Ich löste mich auf, fiel in tausend Fetzen auseinander...
Links von mir kicherte jemand. Ich sah hin. An seiner Lippe hing ein winziges Speichelbläschen. Es platzte. Dieses Bläschen holte mich zurück. Ich war wieder ich. Und plötzlich war alles lächerlich. Ich lachte mit. Und alles wurde leicht, absurd einfach. Was war geschehen? Nichts. Nur ein historischer Rückblick. Und wie wohltuend klang dann unsere Musik: die kristallinen chromatischen Skalen, ineinander gleitende Reihen, Taylor- und MacLaurin-Akkorde, die schwerfälligen Ganztonsprünge der Pythagoreischen Hosen, die melancholischen Wellen verklingender Schwingungen...
Das war Größe. Das war Ordnung. Und wie dürftig dagegen die willkürliche Fantasterei der alten Musik.
Wie immer verließen wir in Viererreihen das Auditorium. Eine mir vertraute S-förmige Gestalt glitt an mir vorbei, ich grüßte respektvoll.
In einer Stunde würde O kommen. Ich war angenehm aufgewühlt. Zu Hause ging ich direkt zur Hausverwaltung, zeigte mein rosa Billett, bekam die Erlaubnis, die Vorhänge zu schließen. Nur an Geschlechtstagen ist das erlaubt. Ansonsten leben wir offen, durchsichtig, im Licht. Es schützt vor Verheimlichung und erleichtert den Beschützern ihre Arbeit. Und doch – wie konnten unsere Vorfahren in jenen geschlossenen Höhlen leben, in dieser Burg-Mentalität: „Mein Haus ist meine Festung!“ Welch ein Irrweg.
Um 22 Uhr zog ich die Vorhänge zu. Da trat O ein. Etwas außer Atem, reichte sie mir ihr rosa Mündchen und ihr rosa Billett. Ich riss den Talon ab. Erst um 22:15 lösten sich unsere Lippen.
Später zeigte ich ihr meine Aufzeichnungen, sprach von der Schönheit des Quadrats, des Würfels, der Geraden. Ich drückte mich präzise, gewählt aus. Sie schwieg lange, dann fielen Tränen aus ihren blauen Augen. Eine davon traf Seite 7 meines Manuskripts. Die Tinte verlief. Ich muss die Seite neu schreiben.
„Lieber D, wenn Sie nur... wenn...“
„Was — wenn?“
Wieder dieselbe alte Bitte. Sie will ein Kind. Oder... ist es etwas anderes? Wegen jener anderen? Nein. Das wäre zu verrückt. Zu unlogisch.
Eintrag Nr. 5
Wieder einmal drücke ich mich ungenau aus. Ich schreibe, als wäre mein Leser ein guter alter Freund — sagen wir, R-13, der Dichter mit den wulstigen Lippen, den jeder kennt. Doch Sie, Leser, leben auf dem Mond, der Venus, dem Mars oder Merkur. Wer weiß, wer Sie sind.
Also, stellen Sie sich ein Quadrat vor — ein lebendiges, vollkommenes Quadrat, das von seinem Leben berichtet. Es würde nicht auf die Gleichheit seiner vier Seiten hinweisen. Wozu auch? Das ist für es selbstverständlich, es nimmt es gar nicht mehr wahr. Und genau so geht es mir.
Nehmen wir zum Beispiel das rosa Billett und alles, was daran hängt — für mich ist das so selbstverständlich wie die vier Seiten des Quadrats. Aber für Sie? Vielleicht wirkt es wie ein komplexes mathematisches Rätsel, wie ein Newtonsches Binom in einer fremden Sprache.
Hören Sie zu. Ein alter Philosoph sagte einst: „Liebe und Hunger regieren die Welt.“ Daraus folgt: Wer die Welt beherrschen will, muss Liebe und Hunger bezwingen.
Unsere Vorfahren haben einen hohen Preis für den Sieg über den Hunger gezahlt — den 200-jährigen Krieg. Es war ein Krieg zwischen Stadt und Land. Wahrscheinlich hielten die rückständigen Landbewohner aus religiöser Sturheit an ihrem Brot fest. (Das Wort „Brot“ benutzen wir heute nur noch metaphorisch; seine chemische Zusammensetzung ist längst unbekannt.)
Aber 35 Jahre vor der Gründung des Einzigen Staates wurde die Naphtha-Nahrung erfunden. Damals waren nur noch 0,2 Prozent der Weltbevölkerung am Leben. Doch das, was blieb, war rein, geläutert, frei vom Schmutz der Vergangenheit. Die Erde war bereit für den Einzigen Staat — ein Paradies für die Überlebenden.
Glück ist ein Bruch: Zähler ist das Glück, Nenner der Neid. Was hätten all die Opfer des 200-jährigen Krieges bedeutet, wenn es heute noch Neid gäbe? Und doch: Es gibt ihn noch. Wegen „Knollennasen“ und „klassischen Nasen“, wegen I-330 und O-90. Einige werden begehrt, andere übersehen. Das darf nicht sein.
Nachdem der Staat den Hunger besiegt hatte, wandte er sich dem zweiten Herrscher der Welt zu: der Liebe. Auch dieser Feind wurde organisiert, gezähmt.





























