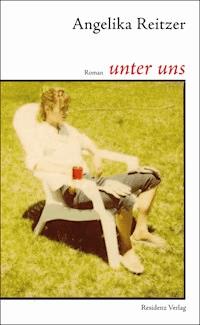Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, zwei Familien aus zwei sehr verschiedenen Welten werden uns hier mit großer Sensibilität und Menschenkenntnis nahegebracht. Mariannes Leben ist vererbt. Sie übernimmt den Betrieb ihrer Großmutter, eine Baumschule, noch bevor diese stirbt und Marianne mit all dem zurücklässt, was hier, in dem großen Haus in der österreichischen Provinz, verwurzelt ist: eine weit verzweigte Familie, ihre Geschichten, ihre Vergangenheit, das, was kommt. Der Radius von Mariannes Leben ist klein, es besteht aus viel Alltag und viel Arbeit, und selbst die bestürzendsten Ereignisse geschehen mit der Selbstverständlichkeit, mit der die Jahreszeiten wechseln. Siri, die Freundin aus dem Land, das einmal die DDR war, fängt dagegen immer wieder neu an. Sie ist mit ihren Eltern in den Westen geflüchtet, Monate bevor die Mauer gefallen und die Welt auf einmal in allen Himmelsrichtungen unüberschaubar groß geworden ist. Aber wo ist darin ihr Platz, ein Anknüpfungspunkt für ihr Leben? Unsentimental im Ton, mit leuchtender Klarheit im Blick für die Details, poetisch und suggestiv in ihrer sprachlichen Präzision erzählt Angelika Reitzer diese Geschichte von zwei Frauen, deren Freundschaft zufällig scheint. Und doch erkennen sie einander in ihren Sehnsüchten, berühren sich in dem, was ihnen fehlt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wir Erben
Ich danke S. F. für ihre Geschichte.Ihr, meinen Freunden und meiner Familie ist dieserRoman gewidmet.
Außerdem danke ich dem Bundesministerium fürUnterricht, Kunst und Kultur sowie der Stadt Wienfür die Unterstützung der Arbeit an Wir Erben.
© 2014 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenDruck: CPI Moravia Books, PohoreliceISBN 978-3-99027-051-6
ANGELIKA REITZER
Wir Erben
ROMAN
Inhalt
Teil I
1. Wände
2. Wände II
3. Mütter
4. Musik, nachts
5. Am Meer
6. Oben
7. Eine Skizze vom Meer
8. Laub (Manche Blätter färben sich rot)
9. Laub (Manche Blätter färben sich gelb)
Teil II
10. Seen
11. Gewebe (Prince of Persia)
12. It doesn’t exist
13. Störfelder
14. Systeme
15. Dickicht
Teil I
1. Wände
Mitten im Meer eine kleine Insel, von hohen Wellen umbrandet. Er und sie sind in dem Haus, das die Insel ausfüllt und in dem eine Matratze liegt, die so groß ist wie das Haus. Wellen schlagen gegen die Hausmauern, Felsen ragen aus dem Wasser, in die unverputzten Ziegelwände hinein. Vor der Abfahrt mussten sie genau angeben, was sie essen werden, Mahlzeit für Mahlzeit, und die genauen Mengen. Ihr gesamter Lebensmittelvorrat, der zum Teil aus fertigen Speisen bestand, war in zwei Kartons verpackt, für die Nacht und den darauffolgenden Tag. Die Mengen deuteten auf länger hin. Zwei Kartons, als gehörten sie nicht zusammen, als wären sie zwei zufällig miteinander Reisende. An Essen erinnert sich Marianne nicht, aber an die hohen Wellen, die gegen die Wände schlagen. Fest und sehr hart. Nur beim Verteidigungshaushalt heißt es plötzlich, das sei ein souveränes Recht des Staates. Das ist doch … Aber was hat das mit Krankenschwestern zu tun? Marianne fällt noch einmal in den Schlaf zurück und weiß, dass sie von der Hitze nur träumt. Sie liegt zwischen Decken und Polstern und unter Daunen, ihr Zimmer ist nicht geheizt. Was sie als Kind hasste, muss jetzt sein. Schlafwarm ist sie, aber der Schweiß rinnt nicht wie im Traum in Bächen an ihr hinunter. Sie greift sich zwischen die Brüste.
Es ist dunkel, Marianne erkennt die grünen Ziffern des Radioweckers, der in ihren Traum hineinrauscht, sodass er sich scheppernd davonmacht und entschwindet. Sie hört von einem iranischen CIA-Agenten, dass es sich um eine Hinrichtung handelt, bekommt sie nicht mit. Sie träumt meistens von – Aber wieso Rauschen? Und wer war der Mann in ihrem Bett auf dieser Insel? Marianne hört das Ticken ihrer Armbanduhr, die am Nachttisch liegt. Wie lange es her ist, dass sie einen sexuellen Traum hatte. Erst als sie diese Worte denkt, erinnert sie sich tatsächlich an das Geträumte. Das Rauschen aus dem Radio hat sich in ihrem Kopf festgesetzt, die Bewegung, die eine gemeinsame Bewegung ist, ein Stoßen vielleicht, könnte in eine Welle, die eine harte Welle ist, übergegangen sein. Ein Schlag eigentlich. Wie lange ist es her, dass sie mit Eric geschlafen hat? Sie zieht die Decke bis unters Kinn. Die dumpfen Schläge der Wellen, das betäubte Echo davon in ihrem Kopf. Wenn sie am Lautstärkeregler des Radioweckers dreht, kann sie das Rauschen zurückdrehen, aber es verschwindet nicht. Sie drückt den Knopf am Radio, sie schaltet die Nachttischlampe ein. Kurz knistert die Glühbirne, das Ticken der Uhr vergisst sie.
Draußen ist es dunkel, im Haus ist es still.
Bevor sie sich anzieht, sitzt sie ein paar Minuten auf dem Hocker im Badezimmer. Neben dem Wäschekorb liegt verschlungen eine Strumpfhose auf dem Fliesenboden, die ihre Mutter vergessen haben wird. Zwischen Mariannes Handtüchern hängt eines, knallgelb, das sie zur Schmutzwäsche gibt, auch die Strumpfhose lässt sie in den Wäschekorb fallen. Marianne geht ins andere Zimmer und stellt die Heizung ab. Die Bettwäsche liegt auf dem Fußboden, auf dem Sekretär stapeln sich Bücher, die in die Regale auf der Galerie gehören. Mariannes kleiner Fernsehapparat steht auf dem Nachtkästchen. Viel zu nahe, denkt sie, und dass das schädlich ist für die Augen. Sobald ihre Mutter Johanna das Elternhaus betritt, wird sie zum Kind, um das sich alle zu kümmern haben. Sie ist unersättlich, Marianne ist froh, dass sie abgereist ist. Sie ist froh und erleichtert, dass alle abgefahren sind. Wie meistens weiß sie nicht mehr, was sie vorhin im Radio gehört hat. Nach den Nachrichten Musik, ja, aber welche? Zuerst will sie Obstbäume veredeln, dann wird sie mit Lukas ins Einkaufszentrum fahren, um ihm Hosen und eine Winterjacke zu kaufen. Seine ist schäbig. Ihr Sohn wirkt so erwachsen, seit er studiert. Spätestens morgen ist auch er wieder weg.
Das Jahr ist vorüber.
Marianne genießt die Stille, die nicht in ein, zwei Stunden wieder vorbei ist, sondern den ganzen Tag anhalten wird. Wie immer, wenn sie alleine ist, geht Marianne die Treppe hinunter, ohne das große Licht anzumachen. Nur an einem der Bücherkästen auf der Galerie brennt Licht. In der Küche macht sie Handgriffe, die nur für sie bestimmt sind, die nicht in Dienstleistungen übergehen. Man hört den feinen Strahl des Wassers, dann das Glucksen der Kaffeemaschine.
Die Großmutter schläft noch. Zu Weihnachten hat sie ihre Töchter und die Enkelkinder in kleinen Gruppen wie in privater Audienz empfangen. Sie hat kaum ein Wort gesprochen, fotografieren ließ sie sich nicht. Als Marianne aus dem Haus tritt, ist es draußen heller als drinnen. Es ist nicht so kalt, wie es um die Jahreszeit sein sollte. Sie holt die Zeitungen aus dem Zeitungsfach in der Einfahrt, es sind die von vorgestern und heute. Sie schließt die schwere Haustür leise, geht vorsichtig zurück in die Küche. Eine Tasse Kaffee steht auf dem großen Esstisch, die Zuckerdose, ein Tetrapack Milch. Marianne schiebt den Stehkalender zur Seite. Auf solchen Kalendern hat die Großmutter immer alles notiert, Liefertermine, Telefonnummern, Bestellungen. Irgendwann hat Lukas darin Schulskikurse oder Elternsprechtage eingetragen. Jetzt steht da nichts. Mitte Januar wird Marek wiederkommen, und dann sind auch die Betriebsferien zu Ende, ist Mario wieder da und bald die ganze Mannschaft.
Ein schwaches Licht fällt auf die Zeitung in Mariannes Hand. Endlich keine Jahresrückblicke mehr und keine Rankings. Für Vorsätze, denkt Marianne, sind andere zuständig. Sie liest einen Artikel über eine Amerikanerin, die sich an alles erinnern kann, seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr. Wie sie, wenn sie sich langweilt, in ihrem geistigen Tagebuch blättert, das alle Ereignisse in der Erinnerung gleichwertig führt. Katastrophen spielen darin dieselbe Rolle wie Launen, Alltag, einzelne Mahlzeiten oder Mode. Und immer ist dabei die Mutter anwesend. In den vergangenen Jahren hatte Marianne die Selbstverständlichkeit, mit der die Großmutter das Weihnachtsfest und andere Familienfeiern in ihrem Haus inszenierte, ungefragt übernommen. Wenn sie sich an jeden Streit, an jede Auseinandersetzung in der Familie erinnern könnte, würde sie wohl schon lange niemanden mehr einladen. Wenn sich alle daran erinnern könnten, was sie je zueinander gesagt haben, dann wäre doch längst alles explodiert. Aber das war wahrscheinlich in allen Familien so.
Marianne richtet das Frühstück für die Großmutter: zwei Semmeln und eine Kanne Kräutertee. Der Tee muss ganz dünn sein, wird aber kräftig gezuckert. Die Großmutter hat immer Appetit aufs Leben gehabt und sich nicht abspeisen lassen. Die zwei Semmeln kann sie längst nicht mehr aufessen, es ist eine Erinnerung an eine Frau, die es nicht mehr gibt. Marianne stellt das Tablett auf die Kommode im Vorzimmer und verlässt das Haus.
Es ist immer noch fast dunkel. Im Gewächshaus macht sie Licht, sie schaltet das Radio ein und nimmt sich die erste Schachtel mit den Zweigen. Die Reiser zum Veredeln kommen mit der Post, Marianne sucht von den alten Obstbäumen, deren Sortennamen längst vergessen sind, die passenden Unterlagen dazu. Es gibt ein Mutterbeet mit Wurzelteilen, das vor zwölf Jahren gepflanzt wurde. Jedes Jahr werden sie heruntergeschnitten, mit Sägemehl und Erde angehäufelt, das fördert die Wurzelbildung. Im Dezember wird nur der gewachsene Teil mit den kleinen Wurzeln gerodet, die Mutterpflanze bleibt stehen. Im Frühjahr werden die Reihen abgeblasen, damit Licht dazukommt, dann kann sie wieder ausschlagen. Bis zu dreißig Jahre alt kann eine solche Mutterpflanze werden. Durch die Veredelung können Äpfel-, Birnen-, Zwetschken- und Kirschensorten auf Jahre erhalten werden. Außerdem bestimmt die Unterlage die Wuchsstärke, die Größe der Frucht und manchmal auch die Lagerfähigkeit. Marianne mag diese Arbeit, die viel Geschick erfordert. Sie schneidet die Edelreiser auf die entsprechende Länge, putzt die Unterlage mit einem Tuch sauber, dann macht sie mit einem Messer an der Veredelungsunterlage einen diagonalen Schnitt. Sie presst den Reiser und sein Gegenstück aufeinander, bindet sie mit Veredelungsgummi zusammen. Rebwachs auftragen und topfen, das geht so dahin. Ein paar hundert werden im Frühjahr ausgepflanzt. Langsam kommt das Licht, es ist nicht sehr kräftig, aber kräftiger als in den Wochen zuvor.
Als Marianne drei Stunden später ins Haus zurückkommt, steht Lukas’ Rucksack bereits im Stiegenhaus. Er will jetzt schon fahren, aber seine Mutter kann ihn überreden, bis zum Mittagessen zu bleiben. Einkaufen will er nicht. Er braucht keine neue Hose, er will keine neue Winterjacke, hätte stattdessen gerne einen von Mariannes Armeepullovern, die sie trägt, wenn sie draußen oder mit dem Lieferwagen unterwegs ist. Das Tablett steht wieder in der Küche. Lukas hat mit seiner Urgroßmutter gefrühstückt, eine große Schale Milchkaffee und die beiden Semmeln. Er hat die Urgroßmutter gefüttert, sie hat nicht protestiert, aber nach dem dritten Bissen wollte sie nicht mehr. Sie isst nur noch ganz wenig, ein Spatz ist sie wieder geworden. Nein, nicht wieder, seine Urgroßmutter ist nie ein Spatz gewesen, eher eine Krähe oder eine Drossel. Sie hat immer hart gearbeitet, sie hat viel geredet, und sie hatte immer einen kräftigen Appetit. Nachdem sie aufgehört hatte, im Betrieb mitzuarbeiten, wurde sie fett, bekam etwas Monströses in diesen Jahren. Nun ist ihr Leib geschrumpft, sie ist klein geworden. Von den Wangen hängt sehr weiche Haut. Wenn sie sich selbst anzieht, was seit einem halben Jahr nur mehr selten vorkommt, wählt sie Sachen, die sie vielleicht vor dreißig Jahren getragen hat, und auch davon ist das meiste zu groß. Aber sie sieht nicht verloren darin aus. An diesem Vormittag ist es, als könnte sie sich gar nicht mehr erinnern, wer bis gestern noch im Haus war. (Ihre Töchter Johanna, Margret und Gertraud; Gertrauds Tochter Alina mit dem neuen oder alten Freund; Margret mit ihrer ältesten Tochter Katharina und den Mädchen, die die alte Frau ignorierte, während sie, wie um Margret zu kränken, immer nur nach den Buben fragte, den Söhnen von Margrets zweiter Tochter Pia; und Isa natürlich, aber mit Isa hat die Großmutter wahrscheinlich seit Jahren kein Wort mehr gewechselt.) Sie hat den Überblick verloren, das war die Entschuldigung, die sie aus ihrem Alter gewann. Sie war aber auch davor sehr selektiv mit ihrer Zuneigung umgegangen.
Kurz vor eins gehen Marianne und Lukas essen, danach bringt sie ihn zum Zug. Sie fährt die längere Strecke zum größeren Bahnhof nach Neustadt, dann muss er nicht umsteigen. Ein, zwei Tage wird er in Wien bleiben, dann fährt er nach Hamburg, wegen eines Mädchens. »Ich habe mich von der Urli verabschiedet«, sagt Lukas, nachdem er seinen Rucksack von der Rückbank genommen hat. Marianne runzelt die Stirn, wundert sich, verabschiedet, natürlich, was denn sonst. Sie versteht erst, als sie ihn im Bahnhofsgebäude verschwinden sieht. Es ist Jahre her, dass er seine Urgroßmutter Urli genannt hat, das war sein Kinderwort, wie alle anderen nennt er sie seit langem bei ihrem Vornamen, Jutta. Marianne würde Lukas jetzt gerne noch einmal in den Arm nehmen.
Sie parkt das Auto in der Tiefgarage und treibt sich zwei Stunden im Einkaufszentrum herum, ohne etwas zu finden. Unterwäsche, hätte sie gedacht, dann kauft sie zwei Paar Jeans für ihren Sohn. Im Supermarkt nimmt sie wieder normale Mengen, zu zweit brauchen sie nicht so viel. Marianne fährt zum Postamt, verpackt die Hosen gleich im Schalterraum, legt ein paar Zeilen dazu und gibt das Paket auf. Am Heimweg schaut sie in der Blumenhandlung vorbei und kauft Brot in der Bäckerei. Inzwischen ist es wieder dunkel geworden.
Als Marianne aufsperren will, denkt sie an die Verkäuferinnen aus der Blumenhandlung, die Grüße ausgerichtet haben, und ruft noch in der Tür: »Grüße von Melanie und der anderen!« Da spürt sie die Stille. Das ganze Haus ist ruhig, es ist leiser und größer als sonst. Es ist ein großes Haus, und natürlich ist es stiller, seit Lukas in Wien studiert. Jetzt ist es riesig und ganz still. Sie kann kein Wort mehr sagen, sie kann nicht nach Jutta rufen, muss daran denken, dass sie das nie leiden konnte: Zur Tür herein und schreit, als wär sie auf der Börse. Sie hört auch kein Husten oder einen Sessel, der zur Seite gerückt wird. Kein Radio, keinen Fernseher. Das Haus ist es, das sich so ruhig verhält. Da schaltet sich der Anrufbeantworter ein, Marianne sieht das Blinken, das anzeigt, dass er eine Nachricht aufnimmt. Aber das Telefon hat nicht geläutet, sie hätte es gehört, als sie die Tür geöffnet hat. Es ist doch ganz still gewesen. Sie hört ihre Stimme, die ihren Namen sagt und, dass niemand erreichbar ist im Moment. Geht zum Telefon und nimmt den Hörer in die Hand. Niemand meldet sich. Auch Marianne sagt nichts. Als sie den Hörer wieder in seine Halterung steckt, piepst das Gerät, und das Intervall, in dem es rot blinkt, verändert sich. Jutta liegt auf ihrem Bett, sie trägt einen Pullover über dem Nachthemd und Hausschuhe, ihre linke Hand hängt über den Bettrand. Vielleicht hat sie gerade die Nachttischlampe ausgeschaltet.
Vorher.
Ab jetzt gibt es ein Vorher und Nachher, Marianne weiß es auf der Stelle. Jutta hat nie Hausschuhe im Bett getragen, nur Menschen in Filmen machten das. Wie oft hat sie sich beim Fernsehen darüber gewundert, immer ein wenig verächtlich gesagt: »Diese Amerikaner! Legen sich mit Schuhen aufs Bett.« Marianne rechnet damit, dass das Kostüm, in dem Jutta begraben werden will, auf dem Sofa liegt, aber da ist nur eine Wolldecke und das Bezirksblatt von vor zwei Wochen mit einem Weihnachtsbaum auf dem Titelblatt. Sie weiß es ja: das blaue mit der Stickerei. »Es wird mir zu groß sein, obwohl ich doch immer so schlank war. Aber du kannst es am Rücken mit Stecknadeln fixieren, wie bei einer Modepuppe.« Marianne greift nach der Hand der Großmutter und bettet sie in ihren Schoß, spürt die feine Haut über den Knochen. Als sie sich neben die alte Frau legt, die jetzt ganz klein ist, ist ihr, als sollte sie einen Gedanken fassen. Ja, ich bringe dich, wohin immer du willst. Als sie sich neben die alte Frau legt, ist ihr, als würde ihr die Tote Platz machen. Ein paar Gedanken, Jutta, ein paar Ideen, nein, eine, eine einzige. Sie spürt keine Verzweiflung, was sie spürt, ist die kleine Figur der Frau neben sich. Der dunkelgrüne Pullover hat eine Laufmasche, daran klammert sich Marianne jetzt: Heißt das offene Laufmasche, oder ist die Masche, wenn sie läuft, sowieso schon offen? Sie greift nach einem Faden. Es fühlt sich an, als würden Tränen aus ihr herausfließen. Das ist ihre Jutta, »Oma, du«. Marianne hält den kurzen Faden in der Hand und weiß, wenn sie daran zieht, löst sich der Körper der Großmutter auf, dann ist Jutta weg. Wäre das nicht ein perfekter Abgang? Weinen, denkt Marianne bei dem Wort Abgang, aber alles ist trocken. Kein Wasser weit und breit, in das der Wollfaden sinkt, ins weite Nass eines Styx, aus dem nur mehr der Haarschopf der Großmutter herausschaut. Sie ist mit einem Mal ganz lebendig, wie sie sich da bewegt unter Wasser, und wer zieht an diesem Haarschopf? Marianne kann das nicht, Marianne darf das nicht, die Großmutter hätte es niemals erlaubt. Weinen hätte sie erlaubt, die Hände falten hätte sie geduldet (auch wenn sie es nicht gebilligt hätte, so hätte sie sich dennoch damit abgefunden). Sitten. Aber obwohl es zur Großmutter gehört, fällt Marianne das nicht ein. Nur comme il faut, dabei kann Marianne kein Französisch. Sie spricht es aus, aber die Großmutter nickt nicht. Immer wieder sagt Marianne diesen Satz, der sie seltsam berührt, schmerzt, tröstet: »Comme il faut.« Jutta stimmt nicht zu, winkt nicht einmal ab. Von dem wenigen dünnen Haar, das die Großmutter wie immer, Tag und Nacht, eng am Schädel nach hinten gekämmt hat und das zu einem sehr kleinen Knoten zusammengebunden ist, stehen ein paar Strähnen weg. Schon lange sind die Haare nicht mehr wirklich grau, weiß waren sie nie, die meisten Strähnen sind gelblich.
Marianne gräbt in ihren Hosentaschen nach Geld für den Obolus und zieht eine Fünf-Cent-Münze und einen Euro aus ihrer Gesäßtasche. Sie will sich an die letzten Worte Juttas erinnern und an ihre eigenen. Sie will sich entschuldigen, dass sie ihren Beitrag nicht geleistet hat. Wie lange Jutta hier schon liegt? Die Kälte, die von diesem Gedanken ausgeht, lässt Marianne sich noch enger an die Großmutter schmiegen. »Comme il faut.« Jetzt hat sie es schon wieder gesagt. Vielleicht, weil ihr eingefallen ist, dass sie die kleinere Münze unter die Zunge der Großmutter hätte legen sollen, aber das wagt sie nicht. »Ich weiß, Jutta, ich weiß, ich bin zu spät gekommen.« Sie streichelt das weiche Gesicht der Großmutter. Die Haut an den Wangen fühlt sich an, als würde sie nachgeben, aber sie hört nicht auf, die Großmutter zu streicheln, vermeidet dabei, deren Haare zu berühren. Als könnte sie in dieses Gesicht hineingreifen, durch die Haut hindurch. Kein Widerstand mehr, keiner. Die Großmutter ist es selbst gewesen, die sich am Haarschopf genommen und hinübergetragen hat. Das sieht ihr ähnlich, alles macht sie selber, sie verlässt sich nicht auf ihre Nachkommen und auf die Götter schon gar nicht. Marianne streicht jetzt ihrer Großmutter das Haar noch glatter, drückt es an den kleinen Kopf. Sofort ist Mariannes Handfläche feucht oder eher schmierig. Sie steht auf und nimmt den kleinen schwarzen Kamm von der Kommode, um die tote Frau zu kämmen. Sie schämt sich ihres Ekels, Juttas Haare sind wie mit einer Fettschicht überzogen. Wann hat sie der Großmutter das letzte Mal die Haare gewaschen? In diesem Jahr bestimmt noch nicht, vielleicht war das vor Weihnachten, bevor die anderen eingetroffen sind. Es ist auch einige Tage her, dass sie sie auf ihrem Leibstuhl mit dem Waschlappen abgerieben hat. So sehr sie die Großmutter auch liebte, so sehr ekelt es sie vor den wenigen gelben Haaren. Im Kamm bleiben fingernagelgroße Schuppenblättchen hängen, die Marianne am Nachthemd der Großmutter abstreift.
Was dachte sie, als sie den Haarschopf endlich erwischt hat? So forsch sie noch konnte, wird sie zugegriffen haben, sich im letzten Augenblick nicht schonend, nun schon gar nicht mehr. Dachte sie an etwas, das nicht aufhören würde? Was für ein Moment kann das gewesen sein, ein Wimpernschlag oder eine Ewigkeit? Die Großmutter hatte für die meisten Gelegenheiten Formeln parat, sie hat sich ihr Leben zusammengeredet. Die Krankheit war eine Last, die man zu tragen hatte, das Leben etwas, das einmal zu Ende ist. »Niemand holt einen ab«, sagte sie vor ein paar Tagen. Und: »Wenn man unzufrieden ist mit seinem Leben, dann ist man zu alt.« Sie hat nie mit sich selbst geredet. Marianne hat sie nie flüstern oder vor sich hin murmeln gehört, das hätte etwas mit Schwäche zu tun gehabt, mit fehlender Selbstkontrolle.
Dass ein Organismus mit einem Mal nicht mehr ist, kann sich Marianne nicht vorstellen. Die Wurzeln eines Menschen liegen schließlich ganz innen oder außerhalb des Körpers. Juttas Hände sind nicht gefaltet. Gott sei Dank, denkt Marianne und muss laut auflachen. »Gott sei Dank! Das warst du wohl auch selber.« Sie lacht über die Hände der Toten, die tun, was Jutta will, die ihr immer noch gehorchen, diese fleißigen Hände, die ins Volle gegriffen haben, ein ganzes Leben. Hände, die den Schmutz nicht gescheut haben und nicht, ihre Kinder zu ohrfeigen, wenn sie sich um sie sorgte. Jutta hat ihre Hände immer aufgehalten, um den anderen zu geben. Sie verteilte Beeren, die sie noch gepflückt hatte, obwohl ihre Augen schon schlecht waren, an alle, die ihr über den Weg gelaufen sind. Eine Flasche Schnaps für den Arbeiter, den die Frau verlassen oder betrogen hat oder die ihm weggestorben ist, während er bei Jutta das Geld für den Hausbau verdiente. Wenn Marianne und Lukas verschwitzt nachhause kamen, weil sie so wild gespielt hatten, weil zuerst die Mutter, dann der Sohn den Weg von der Bushaltestelle gerannt war, als wäre jemand hinter ihnen her, hielt sie schon das Wasserglas für sie bereit. Wenn Marianne betrunken nachhause kam, schüttete ihr die Großmutter das Wasser ins Gesicht. Ohrfeigen gab es da keine mehr.
Es ist eine andere Stille jetzt, während es ganz dunkel geworden ist, auch im Zimmer. Als sich Marianne am Teppich vor dem Sofa wiederfindet, den Kamm in der einen, die Münzen in der anderen Hand, sieht sie nicht einmal mehr bis zum Boden, es ist stockfinster. Bettbank, Juttas Wort für das Sofa klingt jetzt wie der Abschluss einer Epoche. Ein letztes Mal hört Marianne die Großmutter aufseufzen, dann schließt sie die Augen, und die Münzen rollen über den Holzboden unters Bett.
Den Arzt, der den Tod der Großmutter feststellte, kannte sie nicht. Jutta, Marianne und Lukas fuhren, wenn sie zum Arzt mussten, in den Nachbarort zu einer Schulfreundin Mariannes aus der Volksschule, die noch nicht aus dem Weihnachtsurlaub zurück war, als Marianne sie anrief. Den Totenschein musste dann noch ein weiterer Arzt ausstellen, den Marianne auch noch nie gesehen hatte. Es war der zuständige Sprengelarzt, und Marianne hatte für einen Moment das Gefühl, es sei der Mann aus ihrem Traum von letzter Nacht. Er hatte rötliches Haar, ganz kleine Locken. Sie schätzte ihn nur ein wenig älter als Lukas, aber so jung konnte er nicht mehr sein. Vielleicht ließ ihn seine vermeintliche Hilflosigkeit jünger wirken. Die Männer von der Bestattung waren alle gutaussehend. Wie sie die Tote ankleideten, in den Sarg betteten, dabei immer wieder einen Satz an Marianne richteten, nahm ihr die Angst. Sie stöberte in Juttas Dokumenten nach Geburtsurkunde, Taufschein, Meldezettel. Geboren 1927. In Linz, das hatte Marianne nicht gewusst. Wo waren Juttas Eltern Titta, geborene Kasselau, und ihr Vater, der Unternehmer Harald Musil, all die Jahrzehnte gewesen? Jutta hatte nie den Eindruck gemacht, als hätte auch sie Eltern gehabt. Wo haben diese Musils gelebt? In Afrika? Die Großmutter hieß laut Taufschein Jolanda Titta, aber im Meldezettel von 1958 oder 1959, der fast ganz ausgebleicht war, stand Jutta Lex. Ihre Eltern waren noch im 19. Jahrhundert zur Welt gekommen, sie hatte nie von ihnen gesprochen. Jetzt hatte Marianne ein Gefühl, als würden die greisen und vielleicht sehr vornehmen Urgroßeltern irgendwo auf eine Verständigung warten, und sie wusste nicht, wohin sie sich wenden sollte. Mehrmals promenierten sie in lachhaften Tropenanzügen durch Mariannes Träume. Erst in der Nacht, nachdem der Sarg im Krematorium nach unten gelassen und Jutta verbrannt worden war, verblassten diese Traumbilder.
Am schlimmsten, denkt Marianne immer und immer wieder, am schlimmsten ist doch, dass jetzt wieder alle zurückkommen müssen. Sie würde sich vor Jutta für diesen Gedanken schämen, weil er beweist, dass sie der Situation nicht gewachsen ist. Sie würde gerne noch ein paar Stunden allein sein, in dem Haus, das ihr jetzt ganz allein gehört, in dem sie nun ganz allein ist. Frau Schwaiger steht auf einmal in der Küche und will etwas für sie kochen. »Einen Tee wenigstens. Marianne, trink einen Tee.« Am Vormittag hat die Nachbarin, die sich seit dreißig Jahren um den Haushalt kümmert, alle Betten frisch überzogen. »Jaja, so ist das. Jetzt kommen alle Mädchen wieder nachhause!«
Sie räumen den Christbaum im Wintergarten ab, und Frau Schwaiger wickelt Kugeln und Sterne in das weiche, zerfledderte Papier. Marianne sitzt bei ihr, stellt ihr die Kartons hin und hört der Nachbarin zu. Wie Jutta, die im nächsten Jahr 85 geworden wäre, nach dem Tod ihres Mannes den Betrieb übernommen, großgemacht und dabei noch die Kinder aufgezogen habe. Dass man ihr die Liebe zu den Blumen nicht auf den ersten Blick angesehen habe, aber ihren Geschäftssinn sehr wohl. Wie sie, Frau Schwaiger, Jutta immer dafür bewundert habe, auch wenn diese streng war mit ihren Leuten, mit ihrer Familie. So habe sie doch alles immer geschafft, was sie sich vorgenommen habe. Alles. Frau Schwaiger würde Marianne gerne an ihren Busen drücken, aber sie weiß, dass sie das nicht darf (und tut es, kurz bevor sie nachhause geht, doch). Marianne wehrt sie ab: »Ich brauch noch ein bisschen Zeit.« – »Soll ich die Mädchen anrufen?« Erst als der Baum aus dem Haus geschafft ist, Frau Schwaiger das Licht in der Küche und im Wintergarten ausgeschaltet hat und mit einer großen Tasche über den Hof davongeht, ruft Marianne ihre Mutter an. Die Mädchen.
Sie telefoniert mit Margret, Isa, Gertraud, in dieser Reihenfolge. Lukas spricht sie auf die Mailbox: »Du hast dich ja verabschiedet. Es reicht, wenn du zur Bestattung kommst.« Er wird gegen Mitternacht zurückrufen und am nächsten Tag als Erster wieder zuhause eintreffen. Johanna kommt, und auch Isa steht auf einmal in der Tür, und Frau Schwaiger, die alles weiß, hat Suppe und Paprikahuhn und einen großen Topf mit Reis zubereitet, den Tisch in der Küche für sechs gedeckt und im Wintergarten die Heizung eingeschaltet. Die Betten sind überzogen, und in den Zimmern ist es warm. Jemand hat den Anrufbeantworter ausgeschaltet (vielleicht war es Marianne selber). Er blinkt nicht mehr.
Johanna bezog wieder das Zimmer im ersten Stock und teilte sich mit Marianne ein Bad. Drüben, im Doppelzimmer neben dem Wohnzimmer, wohnten Gertraud und ihre Tochter Alina, deren Freund nicht mitgekommen war. Auch Gertrauds Mann war nicht dabei, er war auf einem Kongress in den USA, Keynotespeaker, wie Gertraud auf Nachfragen sagte, »er kann nicht weg«. Ganz oben schliefen Margret und Katharina in getrennten Zimmern. Margret würde ihres mit Isa teilen müssen, die noch einmal nachhause gefahren war, um zu arbeiten. Sie konnte sich nicht so viel Urlaub leisten, wahrscheinlich war sie gar nicht angestellt. Katharina brachte einen Mann mit, den die anderen noch nie gesehen hatten und von dem Johanna und Gertraud behaupteten, sie hätten auch noch nie von ihm gehört. Ihre Töchter hatte sie bei deren Vater untergebracht, von dem sie schon eine Weile getrennt war. Dass sie nicht zu Juttas Begräbnis kamen, fanden die meisten ebenso unangemessen wie die Tatsache, dass sie ihr neuer Freund begleitete. Pias Mann Peter, der Vater ihres zweiten Sohnes, kam direkt zum Begräbnis und brachte beide Buben mit, die bei Lukas im Zimmer untergebracht wurden, wie immer.
Im Haus war wieder Lärm und Getriebe, aber nicht nur, weil weniger getrunken wurde, war alles anders als zu Weihnachten. Am Abend vor der Bestattung saßen sie in Juttas Zimmer, zu dem die Stube in den letzten Jahren geworden war, und redeten über Menschen, die kommen sollten, aber nicht auffindbar waren. Viele von Juttas Freunden und Bekannten waren bereits gestorben, es gab ein paar Geschäftsfreunde und Kollegen, die sich aus dem Arbeitsleben zurückgezogen hatten und deren Telefonnummern nicht mehr gültig waren. Einige Partezettel kamen wieder zurück. Das Gerede ihrer Mutter empfand Marianne als besonders anstrengend. Alle waren um Schonung bemüht, redeten leiser als sonst und mit Rücksicht auf sie. Isa, Lukas und Frau Schwaiger hätten Marianne gereicht, aber sie wollte nicht unfair sein oder ungastlich. Frau Schwaiger mischte sich nicht in Angelegenheiten der Familie, sagte kaum etwas, wenn alle versammelt waren. Johanna und Gertraud, die immer über ihre Mutter geschimpft hatten, erzählten freundliche Geschichten über Jutta. Da konnte auch Margret mitreden, die ansonsten nicht so viel sagte. Ein böses Wort war ihr auch früher kaum jemals über die Lippen gekommen. Gertraud hatte sich noch am besten mit ihrer Mutter verstanden, wenngleich Jutta wenig von ihrem Leben gewusst haben dürfte. Jutta war auf die Karriere ihrer Tochter stolz gewesen, und wenn sie zusammen waren, waren sie wie eingeschworen, dafür waren Details nicht nötig. Alle wollten freundlich sein, sie wollten gedenken. Manchmal lachten sie, machten sich etwa über Juttas Liebhaber Paul lustig, den sie alle gemocht und für den sie Mitleid empfunden hatten. Johanna setzte zu einer kleinen Rede an: »Jetzt kann ich es ja zugeben«, hatte sie wirklich Tränen in den Augen? »Sie war eine imposante Frau, und sie hat ihr Leben gemeistert, was wirklich keine Selbstverständlichkeit war. Und obwohl sie kaum etwas lieber gehabt hätte, hat sie niemanden von uns genötigt, den Betrieb zu übernehmen. Sicher, es war ein Glücksfall für alle, entschuldige Marianne, so was wie ein Glücksfall, dass du damals aus der Schule geflogen bist, und deine Schwangerschaft und der Weg zurück nachhause, und jetzt bist du schon so lange an ihrer Seite.« Lukas tippte sich an die Stirn, Johanna lächelte ihm zu. »Wahrscheinlich warst du die Einzige, die sie wirklich akzeptiert hat, auch wenn das für uns manchmal nicht ganz leicht war.«
Marianne wollte etwas erwidern, aber auf einmal bekam sie Magenkrämpfe, sie konnte nicht sitzen bleiben. Sie ging aus der Stube hinaus, durch das Vorhaus und vor die Tür. »So große Angst, alles zu verlieren?« War das Gertraud gewesen? Marianne bildete sich diesen Satz bestimmt nur ein. Wie wäre Gertraud auf einen solchen Gedanken gekommen? Niemand wollte heute über Erbangelegenheiten sprechen, und Gertraud war doch die Letzte, die neidisch sein würde. Marianne stand ohne Jacke im Freien und hätte gerne ein bisschen gefroren. So schnell, wie er gekommen war, hatte der Krampf wieder nachgelassen. Wenn es schneien würde, wenn es klirrend kalt wäre, so kalt, das die Haut spannte und die Hände in den Hosentaschen zitterten, wäre es besser. Der Himmel war bewölkt, kein einziger Stern war zu sehen. Lukas kam ihr nach: »Geht’s wieder? Was hast du?« Marianne lehnte an der Steinbrüstung, die Hand ihres Sohnes lag auf ihrer Schulter, es hatte etwas Väterliches. Dann schwang er sich auf die Brüstung, rollte die Hemdsärmel nach unten und holte Tabak heraus. Der karierte Stoff seines Hemdes und wie er da saß und sich eine Zigarette drehte, ließ ihn rustikal wirken. »Das ist so ungesund, Sohn!« Lukas hielt ihr die Zigarette hin, Marianne nahm sie entgegen, er gab ihr Feuer. Während sie rauchte (hustete, sich bittere Tabakfäden von den Lippen zog), drehte er noch eine Zigarette, aber bevor er sie sich anzündete, hielt Marianne ihm ihre hin. »Wirst du weinen, Lukas?«
Ein paar Tage später, da sind alle anderen wieder abgereist, wird er zu seiner Mutter sagen, dass seine Tränen ihr gegolten haben, weil sie so einsam schien, wie eine ganz und gar Verlassene. »Aber Jutta ist doch alt geworden«, und Marianne ergänzt in Gedanken: Du meinst, ich bin doch alt genug, um allein zu leben. »Jetzt bist du ganz allein in dem riesigen Haus.« – »Und da fragt ihr euch, ob mir das gut tut, oder wie?« – »Ihr? Ein Wir gibt es dabei nicht. Ich mach mir nur meine Gedanken. Ich meine, du bist auch schon lange allein. Dabei bist du doch noch so jung.« Und nach einer Pause: »Stell dir vor, einer aus meiner WG, der hat eine Affäre mit einer Frau, die ist doppelt so alt wie er.« – »Willst du mich jetzt mit deinen Mitschülern verkuppeln, oder was?« Lukas ist gekränkt oder amüsiert, das ist bei ihm nicht immer sofort zu erkennen. Er hat Eric vergessen. Oder hält er das nicht für eine richtige Beziehung? Lukas steht auf und räumt den Tisch ab, Marianne ist auf einmal ganz ausgelassen. »Bring sie doch mit, deine Freunde, dass ich mir einen aussuchen kann.« Jetzt lachen beide. Lukas setzt sich noch einmal auf die Bank zu seiner Mutter, und da bekommt Marianne wieder einen Magenkrampf, zum dritten Mal seit Juttas Tod.
Auf dem Vorplatz des Krematoriums standen die Trauergäste herum und unterhielten sich, die meisten hatten Schirme aufgespannt, Schneeflocken fielen vom Himmel. Walter hatte Marianne aus dem Auto geholfen, er sah traurig aus und sehr alt. Die Geste tröstete Marianne und tat so gut, dass sie keine Wut mehr auf ihren Vater empfinden wollte, nie mehr. Auch Marianne fühlte sich alt und traurig. Wie unfassbar das war, wenn es mit einem selbst zu tun hatte: Menschen, die sich versammelten, um sich von einer Toten zu verabschieden. Wie ungreifbar und belanglos jetzt die Beziehung Mariannes zu ihrer Mutter war, auch zu den Tanten, zu all diesen Menschen, die doch den Alltag mit ihr teilten. Bei den anderen sah es selbstverständlich aus: In unmittelbarer Nähe zu ihnen hatten sich bereits die Gäste der nächsten Bestattung versammelt. Als wäre irgendetwas einfacher, wenn sie sich als Unbekannte unter diese Gruppe mischen könnte. Die Dämmerung hatte eingesetzt, und Marianne wusste später nicht mehr, ob sich wirklich Wolken vor eine nicht sichtbare Sonne geschoben hatten, während sie die Trauerrede hielt. Sie hatte vom Sommer erzählt, den Jutta aus Marokko mitgebracht hatte und der auch nach dem Tod von Robert, Juttas Ehemann, dem Vater ihrer Kinder, anhielt. Auf einmal war es dunkler geworden in dem runden Saal. Von den finsteren Wäldern, die die Großmutter geliebt hatte, obwohl sie einen Großteil davon verkaufte. Wie daraus Rosenstöcke wurden, Rhododendron, Ligustern und Obstbäume und Eigentumswohnungen und Ausbildungen für die Töchter und Enkelkinder. Wie Jutta sich immer um alle gesorgt hatte, auch wenn sie nicht die typische Mutter und Großmutter gewesen war. Wie sie immer alle versorgt hatte.
Niemand verlor beim Hinausgehen ein Wort zu dem Gesagten, auch Lukas nicht, und Marianne erschrak, als sie bemerkte, dass sie den Zettel mit den Notizen nicht aus ihrer Jackentasche genommen hatte. Kondoliert wurde auf dem Treppenaufgang. An die hundert Mal wurde Marianne, Lukas, Johanna, Margret und Gertraud die Hand geschüttelt, wurden ein paar Worte gewechselt, und gleich darauf hätte keiner von ihnen sagen können, wer ihnen gerade ins Gesicht geschaut hatte. Danach fuhren sie in einem langen Konvoi nach Gumpenthal, Marianne hatte zum Totentrunk eingeladen. Leichenschmaus, Totentrunk, was für grausige Wörter. Zehrung, sagte Johanna, das war möglich. Sie hatten sich geeinigt, dass es ganz traditionell sein sollte: Wein und Brot mit Salz und Kümmel.
Die meisten blieben im Hof stehen, ganz voll war der Platz vor dem Haus, wo Biertische aufgestellt waren, mit Tee und Kaffee in großen Thermoskannen, Tassen und Gläsern in Plastiksteigen, Körben und Schüsseln mit Schwarzbrot und Keksen. »Weihnachtskekse mitten im Jänner!« (Isa) Den Wein rührte kaum jemand an, sowohl der Rote als auch der Weiße waren zu kalt. Unter einem der Tische standen zwei volle Bierkisten, am nächsten Tag fehlte eine Flasche.
Marianne stand inmitten ihrer Familie, sie wusste nicht, wohin mit ihrer Wut. Wie selbstverständlich sich Jutta mit diesem Tod abgefunden hatte, wie zart die Haut der Toten gewesen war. Sie dachte, dass ihre Großmutter an ihrem Sterbetag nichts mehr zum Essen bekommen hatte, weil sie, Marianne, ihr nichts gegeben hatte. Wen hätte sie denn fragen können? Lukas war bei ihr gewesen am Vormittag, dann war sie mit ihm bei Gerhard und Manuela im Gasthaus. Frau Schwaiger war zwar im Haus gewesen, um die Wäsche zu machen, aber galt das? Manuela und Gerhard standen ein paar Meter neben Marianne und unterhielten sich mit Johanna. Frau Schwaiger sorgte sich um alle und redete zwischendurch mit ihrem Mann, der seit seiner Pensionierung noch dicker geworden war. Alle redeten, als würden sie flüstern, um die alte Frau nicht aufzuwecken, hier, unter ihrem Fenster, wo Marek jetzt lehnte, als würde er sich gleich mit ihr unterhalten, wenn sie den Kopf herausstreckte. Jutta hatte ihn oft ungerecht behandelt, von oben herab, aber nur mit ihr hatte er über seine Familie geredet, über seinen Bruder, mit dem er nach Österreich geflüchtet war und der dabei fast ertrunken wäre. Marianne hatte den Marek aus ihrer Kindheit als alten Mann in Erinnerung, dabei war er damals Mitte, Ende zwanzig gewesen. Kurz vor ihrer Geburt war er ins Lex-Haus gekommen. Johanna und Walter wussten kaum etwas aus dieser Zeit, die waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, für einen tschechischen Hilfsarbeiter interessierten sie sich damals wohl am wenigsten. Marek stand nicht mehr am Fenster der Großmutter, er war wieder verschwunden. Wahrscheinlich, dachte Marianne, saß er in seiner Küche bei einem Bier und trank auf die Tote. Mit wem hätte sie reden können? Manuela konnte sie nicht fragen. Oder doch? Hatte sie ihr erzählt, warum sie ihrer Großmutter nichts zum Essen gegeben hatte? Dem Menschen, der sie aufgezogen hatte, ohne den aus ihr nichts geworden wäre, außer eine hysterische, dann gleichgültige Alkoholikerin vielleicht, die es ganz normal fand, dass ihre Freundinnen mit abgehalfterten Junkies in kleinen Wohnungen hausten und damit Geld verdienten, dass sie mit dreckigen Nadeln dahergelaufenen Säufern scheußliche Tätowierungen stachen. Was war denn gewesen an dem Tag? Sie hatte die ganze Zeit nur an Lukas gedacht. Neue Anziehsachen für Lukas, eine neue Hose, einen neuen Pullover wollte sie ihm kaufen und eine Jacke, damit er anständig herumlief. So alt war sie jetzt schon: anständig angezogen sollte ihr Sohn sein. Aber die sterbende Großmutter, an die hatte sie nicht gedacht. Die Großmutter war vielleicht verhungert, ausgetrocknet. Niemand hatte das untersucht. Hatte Frau Schwaiger noch einmal für sie gekocht, oder bildete Marianne sich das nur ein?
Fast der ganze Ort war da. Immer wieder bildeten sich kleinere Grüppchen, klar erkennbar, obwohl alle nah beieinander standen. Die Frauen, die als Tagelöhnerinnen bei Marianne arbeiteten, waren da, und die Angestellten. Gerhard und Manuela hatten ihr Gasthaus zugemacht, Manuela schaute immer wieder, ob Frau Schwaiger Hilfe brauchte, Gerhard redete lange mit dem Bürgermeister und der Gemeindesekretärin. Lukas war der Mittelpunkt unter den Jüngeren, und Freunde von ihm waren gekommen, junge, ernste Männer, die sich korrekt verhielten. Die meisten verabschiedeten sich bald, kalt war es jetzt wieder, und manche behielten ihre Handschuhe an, als sie Marianne, ihrer Mutter und ihren Tanten die Hände drückten. Der Mann von Frau Schwaiger ging wortlos davon, Gertraud oder Margret würden sich irgendwann im Laufe des Abends darüber aufregen, wenn Frau Schwaiger nicht mehr da war. Wenn sie gekonnt hätten, hätten sie die beiden längst geschieden; sie hassten diesen Mann. Er war übergewichtig und hatte keine Manieren, er hielt sich für etwas Besseres, obwohl er Busfahrer war und ihrer Meinung nach ungebildeter als seine Frau. Sie wussten natürlich alle, dass er kein gutes Haar an keiner von ihnen lassen würde, wenn er einmal den Mund aufmachte, was man sich aber nicht vorstellen konnte.
Im Esszimmer und im Wintergarten war gut geheizt. Es gab warmes Buffet, und jetzt fanden alle, die noch da waren, Platz zum Sitzen. Nur Marianne stand wieder auf. Sie sah sich durchs Zimmer gehen. Michaela, Hannos Frau, war unruhig, es war ihr deutlich anzusehen. Vielleicht hatte sie vorhin so heftig mit Hanno, Lukas’ Vater, diskutiert, weil sie nicht wusste, ob es sich nun gehörte, dass sie blieben. »Die Urgroßmutter meines Sohnes –« Als Marianne das hörte, sagte sie nur: »Natürlich bleibt ihr noch. Oder müsst ihr die Kleine abholen?« – »Nein, nein«, Michaela versuchte Marianne freundlich anzuschauen, »das ist nicht nötig. Wir bleiben noch kurz«, sagte Michaela und meinte es wohl genau so. Hanno unterhielt sich, seitdem sie nach drinnen gewechselt waren, mit Mariannes Vater, in der Hand hatte er die ganze Zeit einen vollgeladenen Teller, von dem er kaum aß. Nachdem Marianne an ihnen vorbei war, drehte er sich wieder zu Walter und ließ seine Frau stehen.
Frau Schwaiger war am Vortag mit einer jungen Frau gekommen, um sie Marianne vorzustellen. Sie sollte in Zukunft im Haushalt mitarbeiten. (Hatte Frau Schwaiger gesagt: »Das ist Ilsa, sie kommt aus Deutschland«?) Sie war vorsichtig und zurückhaltend, es wirkte, als hätte sie ihre Gesten und Bewegungen auf den Anlass eingestellt. »Sie brauchen sich nicht zu verstellen«, entfuhr es Marianne, als sie in der Küchentür beinahe mit ihr zusammenstieß. Am liebsten hätte sie sie zur Seite geschoben. Marianne hielt sich den Bauch, die junge Frau stellte das Tablett ab und bot ihr ein Glas Wasser an. Wasser rauschte in Mariannes Ohren, die ganze Zeit. Sie sagte: »Hab ich Sie jetzt angekeift?« Die junge Frau lachte, nein, sie lächelte, ihr Gesicht strahlte. Sie hatte einen sehr großen Mund, sie hielt noch immer das Glas in der Hand. (Hatte Frau Schwaiger gesagt: »Das ist Lisa, eine Deutsche«?) Wie alt war sie, was machte denn eine Deutsche hier in diesem Kaff? Au-pair-Mädchen gab es auch schon länger keine mehr in der Gegend, Marianne hätte davon gehört. Warum strahlte sie so? Das Rauschen in ihrem Kopf wurde ein bisschen leiser, es hörte nicht auf, aber es schwappte jetzt nicht mehr hinter Mariannes Blick. Sie nahm das Glas. (»Darf ich dir Ilka vorstellen, sie ist gebürtige Ungarin, aber in Deutschland aufgewachsen.« Und Frau Schwaiger hatte auch gesagt: »Schade, dass sie Jutta nicht mehr kennenlernen konnte.«)
Später gerieten Johanna und Gertraud in Streit, weil die eine der anderen vorwarf, sich nicht um das Begräbnis gekümmert zu haben. Jede fand, die andere wäre dafür zuständig gewesen, zumindest ein wenig Unterstützung hätte Marianne brauchen können. Marianne saß neben Alina und Peter, und obwohl sie sich mit den beiden unterhielt, konnte sie gut mitanhören, wie sich ihre Mutter und ihre Tante gegenseitig an den Kopf warfen, was ihnen an der Bestattung nicht gepasst hatte. Wie verständlich, dass sie, Marianne, mit allem überfordert gewesen sei, wie unangemessen die kurze Trauerfeier und wie unpassend, dass Marianne niemanden von den Vereinen, die Jutta ihr Leben lang unterstützt habe, zu Wort kommen habe lassen. Sie hätte doch den Bürgermeister etwas sagen lassen müssen. Peter schaute Marianne an, als wartete er auf ein Zeichen, als ginge es um Angreifen und Parieren, und sicher, Peter, ihre Hand auf seiner Hand, würde sie verteidigen. Aber was tat das zur Sache? »Wo sind denn die ganzen Kränze?«, fragte Johanna. »Die Kränze und die Buketts und die Blumen kommen auf den Kompost. Nur der Sarg und die Leiche werden verbrannt. Ach. Bei der Einäscherung ist das nicht anders möglich.« Marianne sagte das mehr zu sich selber als zu den anderen, aber Alina stand auf und ging zu ihrer Mutter Gertraud und redete auf sie ein, flüsternd jetzt. Johanna schnellte auf, sie schlug sich auf die Stirn: »Was ist nur mit uns?« Ihre Hand lag auf Gertrauds Schulter. »Es sollte doch auch, im Übrigen, von Blumen Abstand genommen werden. Stand ja in der Parte, nicht?« Peter betonte jedes Wort, redete langsam, ließ sich Zeit. Marianne schaute auf, in seinen offenen, freundlichen Blick. »Ja«, sagte sie und dachte: Aber diesen Satz nehmen sie mir ja auch übel. Vielleicht hatten sie auch irgendwo aufgeschnappt, dass Marianne niemand anderem das Geschäft mit den Blumen gönne, aber das war doch nicht ernst zu nehmen. Kränze, Buketts, alles dagewesen, genug von allem. Früher war Johanna die Letzte gewesen, die sich um Gerede gekümmert hatte. So waren sie doch alle aufgewachsen: dass nur das Eigene zählte. Der Ton wurde wieder versöhnlich. Gertraud entschuldigte sich bei Marianne, falls diese sie missverstanden haben sollte. Jede von ihnen habe doch besonderes Mitgefühl mit ihr als Juttas engster Angehöriger, und sie schäme sich, ihr nichts abgenommen zu haben. Es sei nur der Gedanke, dass ihre Mutter verbrannt worden sei, unerträglich. Jutta hatte einmal gesagt, sie sei so froh, dass sie nur Töchter habe, denn Schwiegertöchter seien die Pest, wenn es um das Erbe gehe. Woher sie das hatte, wusste Marianne nicht.
Die Maler strichen die Vorzimmer im Erdgeschoß, im ersten und zweiten Stock, Esszimmer und Küche sollten folgen, aber das konnte dauern. Zuerst schlugen sie die Farben und Reste des Anstrichs der letzten dreißig oder vierzig Jahre von den Wänden, bis auf die Mauern drangen sie vor. Nachdem das letzte Auto am Tag nach der Bestattung aus dem Hof gefahren war und Marianne mit Lukas beim Frühstück saß, kamen sie mit ihrem Lieferwagen. Geräuschlos fast. Lukas, dessen großer Rucksack wieder einmal im Vorhaus lümmelte, fragte seine Mutter, ob sie jemanden erwarte. Dann: »Brauchst du mich noch?« Ein bisschen weniger ungeduldig: »Ich kann auch noch ein paar Tage bleiben, wenn –« Marianne schob ihn zur Tür hinaus und begrüßte die Maler. Lukas blieb in der Hofeinfahrt noch einmal stehen, da ging sie zu ihm und erleichterte ihm das Gewissen: »Ich brauche meine Ruhe.« Und als er sie weiter ungläubig anschaute: »Gibt’s einen besseren Zeitpunkt für neue Farben?« Wie jedes Mal, wenn Lukas das Haus verließ, fehlte er ihr im ersten Moment, nachdem sie ihn aus den Augen verlor, am allermeisten.
Später ging Marianne aus dem Haus. Sie würde wiederkommen, wenn die Männer Mittagspause machten und im Haus Ruhe herrschte. Hinter ihr fiel das Gartentor zu. Ich werde alles aufschreiben. Sie ging die Straße hinunter und in die Buchhandlung, wo sie ein dickes Notizbuch kaufte, außerdem blaue Fineliner. Die Großmutter hatte ein Hausbuch geführt, mit einer alten Füllfeder hatte sie ihre Notizen gemacht. Später und bis zuletzt hatte Jutta nur mehr mit Bleistift geschrieben. Kurze Bleistiftstummel, die sie in eine Halterung steckte, und wenn Marianne böse war, ärgerte sie Jutta damit, dass das Geschriebene ohnehin verlöschen, verschwinden würde. Aber die Großmutter sagte: »Das lebt durch die Leser, dafür bist du verantwortlich.« Drei Generationen, hatte sie behauptet, hätten ihre Notizen hinterlassen, zum Leben und zum Betrieb, Privates sei bei manchen stärker gewesen, so die Großmutter damals. Dass man ein Quartierbuch führen musste, das hatte Marianne in der Schule gelernt. Sieben Jahre aufbewahren. Lage und Nummer, Reihenzahl, Sorte, Menge, Qualität. Und alle Kulturmaßnahmen, Qualitätskontrollen. Das reichte doch!
Die Hausbücher lagerten in einer Holzkiste im oberen Wohnzimmer, das wusste Marianne, aber sie hatte sich immer von ihnen ferngehalten. Als wäre von den letzten hundert Jahren eine Bedrohung für sie ausgegangen. Marianne war gerade erst wieder hier eingezogen, sie war, aber das wusste sie damals nicht, von ihrem eigenen Leben vollständig überfordert gewesen. Wie hätte sie einen größeren Ausschnitt überblicken können, ihre Gedanken gingen über den Tag nicht hinaus. »Wenn ich etwas notiere«, so Marianne mit ihren pampigen zwanzig Jahren, »dann benutze ich die elektrische Schreibmaschine, da, schau her.« Ihre Schreibmaschine war lange auf dem Schreibtisch gestanden, später in der Stube, irgendwann war sie im Schrank mit der alten Buchhaltung gelandet. Unter einer Plastikhaube und unter viel Papier wird sie vergraben sein, Marianne hatte sie nie mehr benutzt. Jetzt dachte sie daran, gleich wieder umzukehren, um die Kiste zu inspizieren, aber der Gedanke an die Maler hielt sie zurück. Wann hatte sie die Großmutter zum letzten Mal am Küchentisch oder an dem Sekretär in der Stube sitzen sehen, einen Bleistift in der Hand? Lange hatten sie nicht über die Hausbücher gesprochen, aber wann hatte die Großmutter damit aufgehört, sie zu führen? Wenn Jutta von den Büchern zu ihr aufschaute, sah sie immer Vorwurf und Warnung und Bitten in ihrem Blick, und Marianne war jung. Sie war Anfang zwanzig und hatte dieses wilde Leben, das ihres war, ihres ganz allein. Ihre Haare standen in alle Richtungen, die Bluse aus den Jeans gerutscht, oder sie trug etwas Durchsichtiges, Knappes. Sie war von der Schule geflogen, das ja, aber sie hatte nichts falsch gemacht. Sie war so ein Kindskopf gewesen, und verliebt war sie gewesen, und überzeugt, dass sie die schönsten Blumen des ganzen Landes züchten würde, sie ganz allein. Die Großmutter war es, die ihr immer wieder mit Geld ausgeholfen hatte, die sie zu sich zitiert hatte, um ihr den Kopf zu waschen. »Du führst dich auf wie ein junger Hund, dabei hast du Hüften wie ein kleines Mädchen, genier dich!« Und als Marianne während der Schwangerschaft keinen einzigen Tropfen Alkohol trank und erkannte, was für ein besoffenes Kind der werdende Vater war und dass sie ihn nicht mehr ertrug, da war Jutta gut zu ihr und kümmerte sich um die schwangere Enkeltochter.
Marianne gab lange Zeit ihrer Großmutter die Schuld, dass niemand bei ihnen blieb. Sie selbst hatte nichts falsch gemacht. Nie.
Jutta konnte einem wahnsinnig auf die Nerven gehen. Wie stur sie war! Wie gründlich sie das Leben geliebt hatte, Marianne hätte es gerne verstanden.
2. Wände II
Wie es hier aussehen könnte, wenn alles gut wäre.
Das Lex-Haus liegt in einer ruhigen Seitenstraße. Es ist das einzige Haus in der Straße, die ein breiter Weg ist, und man kann vor allem an dieser Anfahrt erkennen, dass es früher so etwas wie ein Anwesen war.
Das Haus war der Mittelpunkt des Ortes, darin war das Gemeindeamt untergebracht, weil es sehr viel früher das Haus des Bürgermeisters war. Drei Häuser zählten damals zu Gumpenthal sowie eine kleine Kirche und ein Feuerwehrhaus; seit einigen Jahren gibt es eine neue Siedlung, und heute ist Gumpenthal-Ort nur mehr ein Ortsteil von Gumpenthal, das Zentrum liegt gut vier Kilometer nördlich in Gumpenthal-Markt. Der Postbus fährt nur während des Schuljahres. Gegenüber vom Lex-Haus steht die große Linde, der Platz wird von manchen der alte Platz genannt: eine Wiese mit Bank und Baum, eine Sandkiste, die mit der Wiese verwachsen ist, Eisengestelle, auf denen Kleinkinder schaukeln könnten, eher die Imitation eines Spielplatzes, den ich nie in Benutzung erlebt habe. Ein verrostetes Bild von früher.
Es gibt zwei Gasthäuser. Eine Trinkerstube, die nur noch dazu da ist, den Wirt mit Bier und Schnaps zu versorgen und den einen oder anderen Bauarbeiter oder Handwerker, der sich hineinverirrt, was selten vorkommt. Wünsch, der alte Wirt, wohnt im Hinterzimmer, er ist mit meiner Mutter oder einer ihrer Schwestern in die Schule gegangen, man würde es nicht vermuten, so abgemagert und zerfurcht sieht er aus. Seine Frau bringt ihm einmal in der Woche warmes Essen, das scheint ihm auszureichen. Die Kinder sind in die Stadt gezogen und angeblich erfolgreich, man sieht sie hier nicht mehr. Das Haus verfällt von oben, das Dach ist an vielen Stellen eingesunken, und im ersten Stock fehlt lange schon das Glas in den Fenstern, die Fensterrahmen stehen wie bizarre Holzskelette vom Haus ab. Wünsch hat immer eine Zigarette im Mund, die nicht einmal brennen muss. Die weißen Bartstoppeln stehen dreckig in seinem Gesicht herum, er hat ein paar Haare am Schädel, bei ihm wächst nichts mehr, ein verdorrter Mensch mit unendlichem Durst.
Das zweite Wirtshaus hat nur mehr vier Tage in der Woche offen. Manuela, die schöne, zierliche Wirtin hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Burn-out, und erst da haben wir von den vielen Fehlgeburten erfahren. Ich habe sie immer bewundert, im Geheimen, weil sie so freundlich ist und so zurückhaltend und weil sie immer weiß, was die Gäste wollen. Aus der Keusche haben sie und ihr Mann ein Haubenlokal gemacht. Aber dann, naja, dann ging alles nicht mehr, das war eine schwere Zeit für die beiden, sie haben nicht aufgegeben. Manuela war monatelang außer Gefecht gesetzt, sie war auf Kur, dann fuhr ihre Schwester mit dem Auto in einen fahrenden Zug und sie besuchte ihren Schwager. Seit diesem Besuch arbeitet sie wieder im Wirtshaus mit. Es ist immer noch unser Wirtshaus, weil wir da zu Mittag essen, wenn Frau Schwaiger nicht kochen kann, aber vor allem, weil ich mit Lukas viele Abende dort verbracht habe, weil Lukas nach der Schule dort unterkam, wenn wir nicht zuhause waren und weil Manuela und ihr Mann Gerhard meine Freunde sind. Es ist fast immer voll, man muss reservieren, es gibt einen Tisch direkt neben der Bar, niemand sagt Stammtisch, aber da sitzen wir. Lukas war als Kind meistens bei Gerhard in der Küche, das war der Platz, den er liebte, und er geht weiterhin vor oder nach dem Essen zu ihm. Weil sie noch ein bisschen was wollen vom Leben, und nicht nur überleben, sagen Manuela und Gerhard, haben sie nur noch an vier Tagen geöffnet.
Wir alle gingen in die einklassige Volksschule, die ist heute geschlossen, weil zu wenige Kinder in Gumpenthal leben. Ins Gymnasium und in die Hauptschule sind wir damals schon eine knappe Stunde unterwegs gewesen.
Ein Bauernhof, dessen Felder gut zehn Jahre brachlagen, wird heute als Biohof geführt, Synergien gibt es noch nicht viele, aber frische Eier, das ist gut. Der Hof liegt außerhalb, und die neuen Betreiber sind Zugezogene.
Den Greißler, der viele Jahre eine Adeg-Filiale, dann ein Nah & Frisch war, führt jetzt, nachdem die alte Besitzerin gestorben ist und niemand übernehmen wollte, Joschi, mit dem ich in der Schule war, als Gemischtwarenhandlung und Papierfachgeschäft, und ich glaube, neuerdings kann man sogar Briefe bei ihm aufgeben. Joschi. In den achtziger Jahren ist er nach Wien gegangen und hat immer die wildesten Geschichten erzählt, wenn er einmal da war und wir uns die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Dann hat er eine Buchhändlerlehre gemacht, eine eigene Buchhandlung hat er auch gehabt, das hat nicht so lange gehalten. Bücher bekommt man bei ihm jetzt auch, aber wenn man ihm sagt, wie schön es ist, dass Gumpenthal wieder eine Buchhandlung hat, dann fällt er zuerst in sich zusammen und rastet dann eventuell ziemlich aus: »Das ist keine Buchhandlung, das ist ein Buchständer«. Lange haben wir nichts von ihm gehört, eine Weltreise soll er gemacht haben, und jetzt ist er wieder da und mag es nicht so gern, wenn man ihn Buchhändler nennt. Dabei hat er immer gute Vorschläge, was man lesen könnte. Der Joschi ist alt geworden, älter als ich, denke ich manchmal, aber das denke ich über viele Leute. Vielleicht hat es auch etwas mit seinem Status als Zurückgekehrter zu tun, mit seiner Enttäuschung, es woanders nicht geschafft zu haben, aber wirklich unglücklich wirkt er nicht. Die eigene Unzufriedenheit, die macht einen alt, ist das so?
In der Hauptstraße stehen die älteren Häuser, zirka die Hälfte davon ist noch bewohnt. Seit einigen Monaten wird in der ehemaligen Bäckerei am Freitagnachmittag und Samstagvormittag neben Brot auch Obst und Gemüse vom Biobauernhof angeboten. Dass die Häuser nicht alle bewohnt sind, sieht man erst aus der Nähe, viele Rollläden gehen nie nach oben, aber das ist auch bei den bewohnten Häusern nicht anders. Der Nussbaum am Ende der Hauptstraße stirbt langsam vor sich hin, ich kann mich nicht daran erinnern, wann er zuletzt Früchte getragen hat. Der kleine Platz mit dem Nussbaum wurde immer Hauptplatz genannt, wegen der Kapelle und des Feuerwehrhauses, und weil es tatsächlich der einzige Platz in Gumpenthal war. Die drei Parkbänke wurden vor kurzem erneuert.
Nach dem Ortskern (von Osten kommend) liegt die Siedlung, eine Reihe von einem Dutzend Häusern und ein Mehrfamilienhaus, das man Pensionistenheim nennen könnte. In Gumpenthal leben heute zwischen siebzig und achtzig Menschen, durchschnittliches Alter wahrscheinlich jenseits der fünfzig. Die drei Familien und die alleinerziehende Mutter (Joschis Cousine) bringen ihre Kinder in den Kindergarten nach Markt, keine Ahnung, wie lange der offen hat, vielleicht auch nachmittags. Früher waren die Frauen zuhause, heute sieht man tagsüber kaum jemanden auf der Straße. Einmal in der Woche fährt der Wagen mit dem Tiefgefrorenen durch den Ort, außerdem beliefert auch ein Bäcker einzelne Haushalte auf Bestellung. Das Taxiunternehmen berechnet für die Anfahrt aus Gumpenthal-Markt keinen Zuschlag, aus Neustadt schon (Tarif vergessen, ich fahre nie). Früher gab es einen Praktischen Arzt, aber nachdem Dr. Thaussig in Pension gegangen war, wurde seine Ordination aufgelassen. Heute benutzen ein Orthopäde und eine Physiotherapeutin die Praxisräume. Ich habe Jutta nach dem Sturz einige Male zur Physiotherapie gebracht. Sie hat das Turnen, wie sie es genannt hat, sehr gerne gemacht, aber nicht mehr als die verschriebenen Einheiten absolviert. Wenig hatte sich verändert, die Wände waren wieder ganz weiß und im Vorzimmer fehlten die alten Kalender und Katzen- und Blumenbilder. Das Ölgemälde sah nach Hobbymalerei aus. Die Therapeutin ist erst seit ein paar Jahren in Gumpenthal, sie lebt mit ihrem Mann in einem der Siedlungshäuser.
Wenn jemand zum ersten Mal den Weg in meine Baumschule findet, staunt er über Stille und Beschaulichkeit, so nahe an einer viel befahrenen Transitstrecke.
Ich setzte mich auf die Bank neben der Bäckerei. Geschlossen. Ich wusste nicht, welcher Wochentag war, und als ich auf die Uhr schauen wollte (die ich nicht am Arm trug), bemerkte ich, dass ich mir nicht sicher war, ob es Vormittag oder Nachmittag war. Ich hatte mit Lukas gefrühstückt, aber dann? Die Maler sind am Montag gekommen. Juttas Einäscherung war am Donnerstag oder Freitag, und die Maler kamen gleich am nächsten Tag. Hatte das Wochenende nicht stattgefunden? Was für ein Gedanke. Jutta hätte es nicht gefallen, aber ich finde die Idee für einen Augenblick reizvoll.
Kann mich nicht mehr an unseren letzten Streit erinnern.
Kann mich nicht erinnern.
Alles hat geblüht an ihrem letzten Geburtstag.
Beim Frühstück gestern oder war es vorgestern, war es am Sonntag? Ich sitze mitten am helllichten Tag auf einer Bank im Ort und frage mich, wie spät es ist. Keine Arbeit, keine Uhr. Der Sonntag wird stattgefunden haben. Beim Frühstück gestern haben drei Sätze mit Juttas Asche begonnen, daran werde ich mich immer erinnern.
Juttas Asche.
Es bringt Unglück, Blumen aus dem eigenen Garten aufs eigene Grab zu legen. Dabei ist das größere Unglück wohl, ein eigenes Grab zu haben.
Im Frühling die winterfeste Kamelie verpflanzen.
Es ist nichts wert, immer wieder etwas Neues anzufangen, ohne zu wissen, was aus dem Alten geworden ist. Jedenfalls kam es mir so vor, als hätte sie das gesagt, mir hinterher, als ich das Haus verließ. Nicht so genau hingehört, denn in Gedanken war ich bei Marek, der mir telefonisch angekündigt hatte, dass er eine Woche später kommen würde, weil seine Mutter krank sei und die Tochter seines Bruders ein Kind erwarte. Wie ich mich geärgert habe. Sätze, die mit Es ist nichts wert anfingen und aus ihrem Mund kamen, ärgerten mich eigentlich, aber in den Wochen vor ihrem Tod war kein Ärger mehr da. Ich wusste nicht, wie alt Mareks Mutter war, ich hatte ihn nicht gefragt, was für eine Krankheit. In Wahrheit glaubte ich ihm nicht. So eine schamlose Ausrede, das war mein erster Gedanke, und dann noch eine Geburt, darunter tat er es nicht, sterbende Mutter, neue Generation. Dass Marek noch eine Mutter hatte! Wo er doch selber ein alter Mann war, uralt. Marek hatte seine Familie fast zwanzig Jahre nicht gesehen, in den letzten Jahren dann regelmäßig. Jutta demonstrierte Desinteresse, wahrscheinlich war sie eifersüchtig, aber das konnte sie nicht zugeben. Vielleicht war es eher ein Staunen darüber, dass ein Leben zu Ende ging. Ich lass mich nur noch einmal hier hinaustragen, so viel ist gewiss. Hatte ich nicht damit gerechnet, als sie vor rund sechs Jahren in die Stube gezogen war? So ist das. Die einen zieht’s hinauf, die anderen unter die Erde.
Im Haus trugen die Maler die alten Muster auf, übermalten den Bleistiftstrich in Augenhöhe mit cremegelber Farbe. Die Farbe und das Muster hatten sich bewährt. Die Großmutter hätte die Maler nicht aus den Augen gelassen, sie hätte Frau Schwaiger beauftragt, ein ordentliches Mittagessen zu machen. Jetzt gab es Kaffee in Thermoskannen und Wasser, schon lange wurde nicht mehr gekocht für die Arbeiter. Die Firma, die das letzte Mal ausgemalt hatte, gab’s nicht mehr. Es dauerte ein halbes Jahr, bis Marianne jemanden gefunden hatte, der noch alte Rollen hatte. Wenn es nach Jutta gegangen wäre, hätten die Maler ihre Arbeit vor Weihnachten abgeschlossen, aber sie war schon zu schwach, ihren Willen durchzusetzen. Wie still es war. Und jetzt hatten sie doch nicht alle Muster. Von der Malerei im Esszimmer würden sie Schablonen herstellen. Auf einmal war es wichtig, dass es genau so gemacht wird, wie Jutta es gewollt hat.