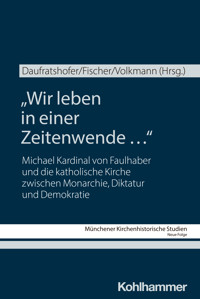
"Wir leben in einer Zeitenwende …" E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Michael Kardinal von Faulhaber führte als Erzbischof von München und Freising zwischen 1917 und 1952 akribisch Tagebuch. Die einzigartigen Aufzeichnungen erlauben tiefe Einblicke in seinen Alltag und seine unzähligen Gespräche in einer Zeit dramatischer Umbrüche: von der Monarchie über die Weimarer Republik und die NS-Diktatur bis hin zur Besatzungsherrschaft und den Anfängen der Bonner Republik. Wie ließen sich die rasanten politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen mit der Vorstellung einer ewigen göttlichen Ordnung in Einklang bringen? Wie reagierten Faulhaber, die katholische Kirche und der Vatikan auf Krieg und Frieden, auf Demokratie und totalitäre Ideologien und sich wandelnde Geschlechterrollen? Die Beiträge des Sammelbandes werten die Tagebücher im Blick auf diese Fragestellungen aus und beleuchten die bis heute kontrovers diskutierten Ambivalenzen, Brüche und Kontinuitäten in Faulhabers Denken und Handeln. Seine über 10.000 Tagebucheinträge hat Faulhaber in der heute nicht mehr geläufigen Gabelsberger-Kurzschrift verfasst. Ein interdisziplinäres Projektteam transkribierte die Quelle in zwölfjähriger Arbeit und machte sie vollständig in einer digitalen Edition (www.faulhaber-edition.de) öffentlich zugänglich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Münchener Kirchenhistorische Studien. Neue Folge
Herausgegeben von:
Franz Xaver Bischof und Klaus Unterburger
Band 14
Matthias Daufratshofer / Moritz Fischer / Peer Oliver Volkmann (Hrsg.)
»Wir leben in einer Zeitenwende …«
Michael Kardinal von Faulhaber und die katholische Kirche zwischen Monarchie, Diktatur und Demokratie
Verlag W. Kohlhammer
Wir danken dem Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Universität Münster, dem Institut für Zeitgeschichte München–Berlin und dem Erzbistum München und Freising, sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Unterstützung und Förderung dieser Publikation.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN: 978-3-17-045993-9
E-Book-Formate:
PDF: ISBN 978-3-17-045994-6
epub: ISBN 978-3-17-045995-3
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Cover
Einführung: Zeitenwende?
Grußwort zur Eröffnung der Tagung
1 »Sie spricht von ›Entwicklung‹, genau wie die Protestanten.«
2 »Ich spreche wie zu einem Bruder«
2.1 Pacelli und Faulhaber in München
2.2 Zum Forschungs- und Quellenstand
2.3 Die Pacelli- und die Faulhaber-Online-Editionen
2.4 Faulhaber und Pacelli im Spiegel der Online-Editionen
2.5 Die Translation Faulhabers auf den Erzbischofsstuhl von München und Freising 1917
2.6 Pacellis »Flucht« in die Schweiz während der Revolution in Bayern und die Rolle Faulhabers
2.7 Fazit
2.7.1 Plädoyer für digitale Editionen
2.7.2 Plädoyer für Faulhaber-Forschung in den Vatikanischen Archiven Pius’ XII.
3 Ein Bischof wie andere?
3.1 Vier ordnungsstiftende Deutungsschemata
3.2 Erstes Deutungsschema: Entchristlichung
3.3 Zweites Deutungsschema: Dualismus
3.4 Drittes Deutungsschema: Opferrolle
3.5 Viertes Deutungsschema: Opposition
3.6 Fazit
I Katholische Kirche und Demokratie
4 Ordnung, Hierarchie – Demokratie?
4.1 Einleitung: Ein umstrittener Kardinal
4.2 Die Geburt des Ordnungsdenkens: Faulhaber als Kind des Kaiserreichs
4.3 Gegen die neue (Un-)Ordnung: Faulhaber, die Revolution und die Republik
4.4 Kein Bruch. Faulhaber und der Nationalsozialismus
4.5 Nachkriegsordnungen: Faulhaber und die Bundesrepublik
5 Kardinal Faulhaber und die CSU
5.1 Ungesicherte Wahrheiten
5.2 Zum Stand der Forschung
5.3 »Lassen Sie meinen Namen aus dem Spiel«. Faulhaber und die Gründung der CSU
5.4 Stabilisator in den Führungs- und Flügelkämpfen der CSU
5.5 Repräsentanz und Kommunikation
5.6 Das Kreuz mit der Demokratie
6 Kommentar: Kein Vernunftrepublikaner
6.1 Ordnung und Gemeinschaft. Katholische Staatslehre und Leitbilder im politischen Katholizismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
6.2 Faulhaber im Spektrum des politischen Katholizismus der Weimarer Republik
6.3 Lernprozesse nach 1945?
II Neuordnung des Gewissens?
7 Leben in einer »Zeitenwende«?
7.1 »Blutig ernste Tage« oder Augusterlebnis? Faulhaber zu Kriegsbeginn 1914
7.2 Sabbatismus oder Martialismus? Faulhabers Kriegsverständnis
7.3 Anlass zum Umdenken? Faulhaber und die päpstlichen Friedensbemühungen
7.4 Kriegsmüde – kriegsüberdrüssig? Faulhaber während Kriegsende und Revolution
7.5 Friedensjahre als Zeitenwende? Faulhaber in der Weimarer Republik
7.6 Neuer Krieg, neue Moral? Faulhaber während des Zweiten Weltkriegs
7.7 Beharren oder Reflexion? Faulhaber in der Nachkriegszeit
7.8 Fazit
8 Cardinals Michael Faulhaber and Aloisius Muench, the Holy See’s Secretariat of State, Surviving Jews, and War Criminals, 1945–1959
8.1 Introduction
8.2 New Sources
8.3 Gifts, Conversation, and Friendship
8.4 Lost Sheep
8.5 “Let Greater Leniency Prevail Here”
8.6 Faulhaber, Muench, Pope Pius XII and the “Guilt Question”
8.7 Jewish Displaced Persons
8.8 The Holy See’s Secretariat of State, Antisemitism, and War Criminals
8.9 “Mercy”? Or Lingering Antisemitism?
8.10 “Jewish-Americans”
8.11 “A Spirit of Vindictiveness”
8.12 American Occupation Authorities Push Back
8.13 The Strategy of the Holy See
8.14 The Persistence of the Clemency Campaign During the 1950s
8.15 Conclusion
9 »Ich habe mit meinen Lagern genug«
9.1 Die Internierung und die Lager im Blickfeld Faulhabers
9.2 Die Zusammenbruchsgesellschaft unter Besatzungsherrschaft
9.3 Seelsorge und Fürsorge
9.4 Grundsätzliche Kritik an der Internierung
9.5 Unterstützung für Individuen und Gruppen
9.6 Fazit
10 Vergeben und vergessen?
10.1 Der Vatikan, Faulhaber und die Nürnberger Prozesse
10.2 Kardinal Faulhaber und Hans Frank
10.3 Katholische Opposition gegen die alliierte »Siegerjustiz«
10.4 »Vergeben und vergessen«
10.5 Kirchliche Fluchthilfe für NS-Täter
10.6 Zusammenfassung
11 Kommentar: Faulhaber, die Weltkriege und der Umgang mit Kriegsverbrechern
III Christliche Weltanschauung im Wandel
12 Münchener Katholiken im Kampf der Weltanschauungen
12.1 Der katholische Autoritätsbegriff
12.2 Das Gespräch Hitlers mit Faulhaber auf dem Obersalzberg 1936
12.3 Robert Linhardt und Emil Muhler – Zwei Priester der Erzdiözese München und Freising
12.4 Die zwei moralischen Prinzipien Robert Linhardts
12.5 Zwei Schriften Emil Muhlers: 1932 und 1947
12.6 Fazit
13 Kardinal Faulhaber in der tschechischen Publizistik der Zwischenkriegszeit im Zeichen von Antibolschewismus und Unionismus
13.1 Faulhaber auf Tschechisch. Vielfach erwähnt, zitiert und übersetzt
13.2 Kampf gegen Bolschewismus im Zeichen des Unionismus. Protestaktion des Apoštolát svatého Cyrila a Metoděje
13.3 Faulhaber als Prediger gegen den Bolschewismus
13.4 Als Unionismus gedeuteter Uniatismus im Kampf gegen die Diktaturen
13.5 Zusammenfassung
14 Kommentar: Antibolschewismus und christliche Gesellschaftsordnung
IV Geschlechterordnungen
15 Faulhaber und die Frauen
15.1 Zunehmende weibliche Berufstätigkeit als Herausforderung katholischer Ordnungsvorstellungen
15.2 Elisabeth von Schmidt-Pauli: die Schriftstellerin und Intellektuelle
15.3 Marie Fitz: die Lehrerin
15.4 Zita Zehner: die Politikerin
15.5 Frauenbilder eines Kardinals
16 »Neue Frau« oder »Katholische Frau«
16.1 Das sich wandelnde Frauenbild der 1920er Jahre in den Akten des Bischöflichen Ordinariats Regensburg
16.2 Die Regensburger Diözesansynode 1927/28
16.3 Die Diözesansynoden des Bistums Passau (1929) sowie des Erzbistums München und Freising (1930)
16.4 Fazit
17 Kommentar: Michael von Faulhaber und die Ordnung der Geschlechter
18 Nachwort
Abkürzungen
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Stichwortverzeichnis
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Register
Einführung: Zeitenwende?
Michael Kardinal von Faulhaber und die katholische Kirche zwischen Monarchie, Diktatur und Demokratie
Matthias Daufratshofer / Moritz Fischer / Peer Oliver Volkmann
Wir schreiben das Jahr 1932. Dreizehn Jahre waren seit dem Ende des Ersten Weltkriegs vergangen, der Millionen von Menschen das Leben gekostet hatte. Illusionen des Jahres 1914, einen schnellen Krieg nach alten Mustern führen zu können, waren schnell der blutigen neuen Realität gewichen. Zu denjenigen, die den Waffengang von Anfang an unterstützt hatten, gehörte auch Michael von Faulhaber (1869–1952), damals Bischof in Speyer. Die Wucht und Brutalität des Krieges ließen den Geistlichen indes nicht unberührt, weshalb er im Winter 1932 das Wort ergriff, um rückblickend den Krieg und die Frage einer »neuen Kriegsmoral« zu reflektieren. Die Worte, die der nunmehrige Kardinal und Erzbischof von München und Freising fand, wirken auch im 21. Jahrhundert noch aktuell: »Wir leben in einer Zeitenwende, und wie in anderen Fragen wird sich auch in der Frage ›Krieg oder Frieden‹ eine Wandlung der Geister vollziehen.«[1] Wie die Jahre, Monate und Tage seit dem Februar 2022 zeigen, fällt die Ausrufung einer »Zeitenwende« meist leichter denn deren praktische Umsetzung. Das zeigte sich bei Faulhaber spätestens mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, der bei ihm selbst zu keinem Geisteswandel führte.[2]
Faulhabers Ausführungen über die »Zeitenwende« führen mitten hinein in das Thema dieses Bandes, der den Umgang des Kirchenmanns sowie der katholischen Kirche insgesamt mit Wandlungsprozessen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Thema hat. Die Schrecken des Ersten Weltkriegs forderten schließlich die ewige Ordnung in Form der Lehre des gerechten Kriegs fundamental heraus und verursachten zwar ein Umdenken, führten aber nur selten zu einem Umsteuern. Der Krieg war dabei nur ein Thema unter vielen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit dem Faulhaber und die katholische Kirche konfrontiert wurden. Das zeigt allein ein kurzer biografischer Abriss des Erzbischofs, dessen Leben von zahlreichen politischen und sozialen Umbrüchen gekennzeichnet war: Noch vor Gründung des Kaiserreichs im Jahr 1869 geboren, erlebte Faulhaber als stellvertretender bayerischer Feldpropst das Ende des Ersten Weltkriegs und als Erzbischof in München die Revolution in Bayern hautnah. Dort war er unmittelbarer Zeitzeuge der Weimarer Republik, der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs sowie der Nachkriegszeit und der ersten Jahre der Bundesrepublik Deutschland.
Die Kernfrage aller in diesem Sammelband veröffentlichten Aufsätze lautet, wie Faulhaber und die katholische Kirche mit diesen zeitgeschichtlichen Zäsuren umgingen. Wie positionierten sich der Erzbischof und seine Kirche mit ihren Vorstellungen einer ewigen, unveränderlichen Ordnung zu den Wandlungsprozessen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts? In welchem Verhältnis standen Kontinuität und Wandel? Veränderten sich Faulhabers Ordnungsvorstellungen im Wandel der Zeit – etwa im Hinblick auf Fragen von Krieg und Frieden, der Stellung zur Demokratie, der Herausforderung durch den Kommunismus, dem Verhältnis zum Nationalsozialismus und dessen Verbrechen oder der Stellung von Frauen in Gesellschaft und Kirche? Unterschied sich der Kardinal dabei von seinen deutschen Amtsbrüdern oder war er ein Bischof wie jeder andere?
Die hier präsentierten Ergebnisse gehen auf einen Workshop in der Katholischen Akademie in Bayern zurück, der am 10. und 11. Oktober 2022 vom Team des DFG-Langfristvorhabens »Kritische Online-Edition der Tagebücher Michael Kardinal von Faulhabers (1911–1952)« organisiert wurde.[3] Das seit 2014 von der DFG geförderte Editionsprojekt wird gemeinsam vom Institut für Zeitgeschichte München–Berlin und dem Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster verantwortet und versammelt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Geschichtswissenschaft, Theologie und Informatik. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die Besuchstagebücher Faulhabers, die dieser von 1911 bis 1952 nahezu täglich führte. Er verkehrte in dieser Zeitspanne mit über 17.000 Personen. Die Tagebücher waren 2010 nach dem Tod von Faulhabers letztem Sekretär Johannes Waxenberger (1915–2010) in das eng mit dem Projekt kooperierende Erzbischöfliche Archiv München gelangt, wo sie seit 2012 der Forschung zur Verfügung stehen. Ergänzt wird diese Quelle durch hunderte sogenannte Beiblätter, die der Erzbischof zahlreichen Tagebucheinträgen beifügte, um etwa persönliche Reflexionen festzuhalten.
Die Tagebücher stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Edition vor zwei große Herausforderungen: Zum einen verfasste Faulhaber diese größtenteils in der Gabelsberger-Kurzschrift – eine Art der Stenografie, die um die Jahrhundertwende weit verbreitet war, heute aber nur noch wenige Experten beherrschen. Alle Editorinnen und Editoren mussten daher diese alte Kulturtechnik erlernen, um den Text in Langschrift transkribieren und damit der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Zum anderen ist der Umfang des Quellenkorpus mit allein 4.095 beschriebenen Tagebuchseiten, die auf 32 Bände verteilt sind, enorm, weshalb früh der Entschluss feststand, keine gedruckte oder hybride Edition zu erstellen, sondern rein digital zu arbeiten. Seit 2015 finden sich auf der Homepage des Projekts die ersten transkribierten Tagebuchjahrgänge samt zugehörigen Beiblättern in einer Leseversion, einer reinen Transkriptionsfassung sowie als Digitalisat. Erschlossen werden die Einträge dabei durch eine umfangreiche Suchfunktion sowie Kurzbiografien. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des vorliegenden Bandes im April 2025 sind die Jahrgänge 1911 bis 1926 sowie 1930 bis 1949 veröffentlicht. Abgeschlossen werden soll das auf zwölf Jahre angelegte Langfristvorhaben am 31. Dezember 2025.[4]
Die Tagebücher Faulhabers geben einen einmaligen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt der nach Meinung vieler Zeitgenossen »überragendste[n] Bischofsgestalt ihrer Zeit«.[5] Es sind insbesondere drei übergreifende Themenfelder, zu denen die Edition neue Erkenntnisse verspricht und die auch in diesem Sammelband im Vordergrund stehen: Erstens das Verhältnis von Religion und Politik, Kirche und Staat sowie Katholizismus und politischen Ideologien in der Moderne; zweitens insbesondere das Verhältnis der Kirche zum Nationalsozialismus; drittens zusammenfassend die Theologie- und Konfessionsgeschichte sowie ihre Strukturen und Netzwerke.
All diese Themen beschäftigen die Geschichtsschreibung zur katholischen Kirche seit Jahrzehnten. Insbesondere das Verhältnis zu Diktatur und Demokratie kanalisiert in regelmäßigen Abständen in emotionalen Diskussionen über Kirchenfürsten wie Faulhaber, die in den letzten Jahren zunehmend im Rahmen von Straßenumbenennungsdebatten geführt werden.[6] In Würzburg wurde 2024 der dortige Kardinal-Faulhaber-Platz nach langen Debatten und der Einrichtung einer Expertenkommission in Theaterplatz umbenannt. Die Gründe für die Entscheidung des Stadtrats waren in erster Linie die Haltung des Erzbischofs zur Weimarer Republik und zum Nationalsozialismus.[7] Die gleiche Kontroverse beschäftigt auch München wegen der dortigen Kardinal-Faulhaber-Straße seit vielen Jahren.[8] Dort stehen sich die Positionen ebenso unversöhnlich gegenüber: Während der »Bund für Geistesfreiheit München« Faulhaber einen »Kriegstreiber, Demokratiefeind und Hitler-Verehrer« nennt und infolgedessen die Umbenennung der Kardinal-Faulhaber-Straße fordert,[9] bezeichnete der Journalist Christian Feldmann den Münchener Erzbischof Anfang 2019 in der Münchner Kirchenzeitung als einen »Widerständler mit kleinen Fehlern«[10]. Im November 2024 berichtete die Süddeutsche Zeitung, dass ein im Auftrag der Stadt arbeitendes »Expertengremium« zum Ergebnis kam, die Umbenennung der Straße dem Stadtrat zu empfehlen.[11] Nicht nur Faulhabers »zweifelhafte Rolle im Nationalsozialismus«, sondern nun auch sein Agieren bei den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche werden ihm zur Last gelegt.[12]
Der 2022 vom Editionsteam veranstalte Workshop hatte daher auch zum Ziel, die seit längerem stark polarisierte öffentliche Debatte zu versachlichen. Hervortreten sollten dabei die Ambivalenzen, Ambiguitäten und Widersprüche Faulhabers, die sich auch in den Tagebüchern offenbaren, und die nun erstmals seit Beginn des Projekts anhand der neuen Quellen systematisch diskutiert werden sollten. Der Ausgangspunkt der Überlegungen für den Workshop war dabei eine gemeinsame Beobachtung der Editorinnen und Editoren, denen immer wieder die enorme Bedeutung des Begriffs »Ordnung« in Faulhabers Gedankenwelt ins Auge fiel. Faulhabers Glaube an eine ewige, von unveränderlichen göttlichen Wahrheiten dominierte Ordnung stand dabei – zumindest vordergründig – in einer inneren Spannung zu seinem bischöflichen Wahlspruch »Vox temporis vox Dei« (»Die Stimme der Zeit – die Stimme Gottes«). In diesem kommt die Ambivalenz und Gleichzeitigkeit von Wandel und Kontinuität frappierend zum Ausdruck, stellte sich dabei doch die Frage, welche Gültigkeiten ewige Wahrheiten in Zeiten des Umbruchs haben konnten. Gerade die neuscholastischen Theologen wurden nicht müde, den durch das päpstliche Lehramt garantierten Ewigkeitsanspruch der Kirche zu betonen und jeglichen Entwicklungsgedanken zu verurteilen.[13]
Genau diese Spannung zwischen an sich unveränderlichen katholischen Ordnungsvorstellungen und dem faktischen Wandel der Welt wurden im Workshop und werden im vorliegenden Band bearbeitet. Ziel ist es dabei nicht nur, neue biografische Zugänge zu Faulhabers Leben und Wirken zu erschließen, sondern diesen auch in den breiteren zeit- und kirchengeschichtlichen Kontext einzubetten und damit umgekehrt neue Einsichten in die Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erhalten. Ausgangspunkt ist dabei im Folgenden jeweils die Position Faulhabers, wie er sie in seinen Predigten, Schriften, Briefen und insbesondere seinen Tagebüchern und den dazugehörigen Beiblättern formuliert hat. In einem zweiten Schritt wird Faulhabers Haltung mit anderen katholischen Konzepten verglichen und so in einen größeren kirchlichen Kontext gestellt. Vier Themenfelder stehen im Fokus, die zugleich die Gliederung für diesen Sammelband bilden: Erstens wird nach dem Verhältnis Faulhabers und der katholischen Kirche zur Demokratie anhand der für den Katholizismus zentralen Denkkategorien Ordnung und Hierarchie gefragt. Zweitens geht es unter der Leitfrage »Neuordnung des Gewissens?« um den Umgang der katholischen Kirche mit Schuld und Sühne nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie einer möglichen Veränderung ihres Verhaltens. Drittens werden unter dem Schlagwort »Christliche Weltanschauung im Wandel« Positionierungsversuche des Katholizismus in der Auseinandersetzung mit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts – insbesondere Nationalsozialismus und Kommunismus – untersucht, um das theologische Fundament der Ordnungsvorstellungen offenzulegen. Und viertens werden Geschlechterordnungen im Katholizismus in den Blick genommen sowie nach Geschlechterverhältnissen im Spannungsfeld von Amtskirche und Milieu und dem Einfluss von Frauennetzwerken gefragt. Jedes einzelnes Kapitel wird dabei durch einen Kommentar abgerundet, der den Blick noch einmal weitet und nach größeren thematischen Zusammenhängen fragt.
Mehrere Beiträge sind diesen vier Themenbereichen rahmend voran- und nachgestellt. Den Beginn macht Hubert Wolf, der ausgehend vom berühmten Disput zwischen Kardinal Faulhaber und Konrad Adenauer (1876–1967) auf dem Münchener Katholikentag 1922 die Positionen innerhalb der katholischen Kirche zu Vorstellungen von ewiger Ordnung und Entwicklung darlegt. Im Anschluss daran fragt Matthias Daufratshofer basierend auf den beiden Online-Editionen der Tagebücher Faulhabers und der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917–1929) nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden der beiden Editionen. Er fokussiert die Frage nach dem Verhältnis und der Interaktion der beiden Kirchenmänner während ihrer gemeinsamen Münchener Zeit, von denen einer später als Pius XII. auf dem Papstthron sitzen sollte und wie kaum ein anderer Papst des 20. Jahrhunderts als Verteidiger der ewigen göttlichen Wahrheiten gilt. Eine systematische Perspektive nimmt schließlich Olaf Blaschke ein und fragt, wie stark sich Faulhaber und sein Ordnungsdenken von seinen damaligen Amtsbrüdern unterschieden.
Die Beiträge zeigen dabei, von welchen Beharrungskräften die katholische Kirche geprägt war, die deren Umgang mit Wandlungsprozessen und Zäsuren so schwierig machte. Der theoretische Anspruch, Hüter einer ewigen Ordnung zu sein, erwies sich im Angesicht des »Zeitalters der Extreme« (Eric J. Hobsbawm) praktisch nur schwer umsetzbar und führte zu Anpassungsprozessen, die im Rückblick wenig konsequent und selektiv erscheinen. Das hing vor allem damit zusammen, dass der theologische Zugriff auf das Weltgeschehen eng mit politischen Ansichten und Emotionen verschränkt war. Ein unpolitischer Bischof, als der sich Faulhaber verstand, war er gerade nicht. Das zeigt sich im ersten Kapitel, das sich Faulhabers vieldiskutiertem Verhältnis zur Demokratie widmet. Zunächst rücken Moritz Fischer und Peer Oliver Volkmann das Ordnungsdenken Faulhabers zwischen Kaiserreich und früher Bundesrepublik in das Zentrum ihrer Untersuchung. Der Begriff »Ordnung« war – so die beiden Autoren – der Fixstern in Faulhabers Ideenwelt, durch den sich dessen Haltung zur Demokratie aufschlüsseln lässt. Sie fragen darin nach dem Ursprung von Faulhabers Ordnungskonzept sowie dessen Vereinbarkeit mit den verschiedenen politischen Ideologien und Systemen der Zeit. Dabei wird deutlich, wie stark Faulhabers Ordnungsdenken den Prinzipien der modernen und pluralistischen Parteiendemokratie entgegenstand und wie wenig er sich im Laufe seines Lebens in diesem Hinblick wandelte. Anschließend stellt Thomas Schlemmer die in der Literatur häufig anzutreffende, empirisch aber nur schwach abgesicherte These vom kaum zu überschätzenden Einfluss Faulhabers und der bayerischen katholischen Kirche auf die Gründung und Entwicklung der CSU auf den Prüfstand. Hierzu beleuchtet er die spannungsreiche Gründungs- und Frühphase der christlich-sozialen Partei, wobei er Faulhaber als Vorsitzenden der Freisinger Bischofskonferenz in den Fokus rückt. Anders als noch in den Weimarer Jahren, in denen der Erzbischof eine strikte konfessionelle Trennung auf parteipolitscher Ebene verfochten hatte, unterstützte der Oberhirte von München und Freising nach dem Ende der NS-Diktatur nun die Gründung und den Fortbestand einer interkonfessionellen Partei auf Basis des Christentums beim demokratischen Neuanfang in Bayern. Hier offenbart sich also tatsächlich ein Wandel, der allerdings nicht als innerliche Annäherung an die pluralistische Demokratie verstanden werden darf. Schlemmer zeigt vielmehr, wie Faulhaber vor allem als Referenzpunkt in der innerparteilichen Diskussion fungierte und die neuen Mechanismen der Nachkriegsdemokratie nutzte, um seine eigenen Ziele zur Stabilisierung der christlich-konservativen Ordnung durchzusetzen. Elke Seefried ordnet Faulhaber in ihrem Kommentar schließlich im breiteren Kontext des politischen Katholizismus der Weimarer Republik ein und zeigt, wie stark sich Faulhaber dem Rechtskatholizismus annäherte und damit an der Zerstörung der Republik Anteil hatte. Sie verweist dabei auch auf die emotionale Distanz Faulhabers zur Republik, die sich auf dem Münchener Katholikentag 1922 plastisch zeigte. Zum »Vernunftrepublikaner« fehlte Faulhaber – folgt man Seefried – daher auch die Fähigkeit, eigene Gefühle auszublenden und, nach Konrad Adenauer, »in Ruhe« und mit kühlem Kopf die Verhältnisse zu beurteilen.
Das zweite Themenfeld des Sammelbandes eröffnet Tilman Deckers mit einem Beitrag über das Verhältnis Faulhabers zum Krieg. Von Linken nach Kriegsniederlage und Revolution jahrelang als »Kriegshetzer« beschimpft, verunglimpften ihn völkische Kreise und Nationalsozialisten seit Ende der 1920er Jahre als »Friedensfanatiker«. Waren diese Zuschreibungen dem jeweiligen politischen Milieu geschuldet oder hatte sich in Faulhabers Sicht auf den Krieg tatsächlich ein grundlegender Wandel vollzogen? Nuanciert löst Deckers diesen Komplex auf, wobei er, was bisher vernachlässigt wurde, ausführlich auf Faulhabers Haltung zum Zweiten Weltkrieg eingeht – der Lackmustest! Dabei stellt der Autor heraus, dass sich Faulhabers Einstellung zum Krieg – trotz dessen radikalen Wandels – nie grundlegend änderte, was er sowohl mit der Theologie als auch mit den politischen Überzeugungen des Kardinals erklärt. Suzanne Brown-Fleming, Andrew H. Beattie und Gerald J. Steinacher widmen sich daraufhin dem Umgang Kardinal Faulhabers und der katholischen Kirche mit der NS-Vergangenheit, der Internierung von NS-Belasteten durch die Alliierten sowie mit Kriegsverbrechern. Suzanne Brown-Fleming zeigt dabei ausgehend von der Beziehung Faulhabers zum Apostolischen Visitator Aloysius Muench (1889–1962), wie wenig sich – trotz Weltkrieg und Holocaust – das Weltbild der beiden Kirchenmänner nach 1945 geändert hat und wie wirkmächtig antijüdische Ressentiments weiterhin in ihrem Denken und Handeln waren. Sie verbindet dabei – anhand neu zugänglicher Dokumente aus den Vatikanischen Archiven und der Faulhaber-Edition – die lokale Ebene der Erzdiözese München und Freising über die diplomatischen Vermittler des Vatikan mit dem Heiligen Stuhl, wodurch ein breites Panorama entsteht. Brown-Fleming illustriert dabei, wie wenig sich Geistliche wie Faulhaber und Muench für die (nichtkatholischen und nichtdeutschen) Opfer interessierten, wie sehr sie aber umgekehrt der Umgang der Alliierten mit NS-Belasteten und Kriegsverbrechern umtrieb. Andrew H. Beattie kann an diese Feststellung nahtlos anknüpfen, indem er Faulhabers Umgang mit der außergerichtlichen Internierung von Nationalsozialisten von 1945 bis 1948 analysiert. Den Einsatz des Kardinals für NS-Belastete und gegen die Internierungs- und Entnazifizierungsmaßnahmen führt Beattie in seinem Beitrag auf dessen Hoffnungen auf eine Rechristianisierung der deutschen Gesellschaft zurück, die durch eine Solidarisierung mit den Internierten erfolgen sollte. Ein solcher Effekt blieb freilich aus – der Versuch, Wandlungsprozesse aufzuhalten oder zu verlangsamen, scheiterte. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Gerald J. Steinacher in seinem Aufsatz zum Umgang Faulhabers und des Vatikan mit NS-Kriegsverbrechern. Anhand zahlreicher neuer Quellen aus den Vatikanischen Archiven kann er dabei nicht nur minutiös nachzeichnen, wie die Interventionen der katholischen Kirche für NS-Täter wie Hans Frank (1900–1946) abliefen, sondern auch, welche Motive die dafür verantwortlichen Geistlichen antrieben. Die Erinnerung an die Opfer und die Bestrafung der Täter wurden dabei nach Steinacher schnell vergessen und auch von der Kirche als Hürde für die Nachkriegsgesellschaft gesehen, die sich dem Feind des Kommunismus stellen müsse. In seinem Kommentar fragt Mark Edward Ruff im Anschluss daran, weshalb sich die Grundüberzeugungen von Faulhaber und anderen katholisch-konservativen Klerikern – trotz allen Katastrophen seit 1914 – nie grundlegend änderten. Neben in der Forschung bereits ausführlich diskutierten Erklärungen für dieses Verhalten verweist Ruff – wie auch Elke Seefried – in Antwort darauf einerseits auf die Bedeutung von Emotionen und deren Verschränkung mit politischen Ideologien, die zukünftig noch stärker in den Blick genommen werden müssten. Andererseits nimmt Ruff unter Verweis auf die beiden Trump-Regierungen seit 2015 die »konservativen Kapitulationen vor rechtsradikalen Bewegungen« in den Blick, die man seit dem 20. Jahrhundert immer wieder beobachten könne – auch bei Faulhaber. Gerade auf diesem Feld hat es – folgt man Ruff – keinen Wandel gegeben.
Im dritten Themenfeld zur »Christlichen Weltordnung im Wandel« zeichnet Philipp Gahn auf der Mikroebene des katholischen München den Wandel des katholischen Autoritätsverständnisses nach, das in der Schöpfungsordnung und im Naturrecht grundgelegt ist. Während Kardinal Faulhaber grundsätzlich eine traditionelle Haltung zur staatlichen Autorität einnahm, der man gemäß den Aussagen des Römerbriefes zu Gehorsam verpflichtet sei, bemühte er sich während der nationalsozialistischen Herrschaft um einem »modus vivendi«, wie auch seine Unterredung mit Hitler auf dem Obersalzberg 1936 eindrücklich zeigt. Faulhaber versuchte die jeweiligen Kompetenzbereiche einerseits der weltlichen und andererseits der kirchlichen Autorität abzustecken, wobei ihm viel daran lag, den Dialog mit dem Regime nicht abreißen zu lassen. Diese traditionelle Haltung zur staatlichen Autorität konfrontiert Gahn mit den Ansätzen des Freisinger Moraltheologen Robert Linhardt (1895–1981), der sich zugunsten des NS-Regimes radikalisierte, und des Münchener Stadtpfarrers Emil Muhler (1892–1963), der die Legalität der Machtübernahme des NS-Regimes hinterfragte. Der mikrohistorische Blick Gahns ermöglicht dabei einen Einblick in Wandlungsprozesse auf lokaler Ebene, die den Anstoß zu einem übergeordneten Wandel von christlichen Ordnungsvorstellungen gaben. Eine Konstante blieb im Katholizismus hingegen weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus der Antikommunismus. Faulhaber als selbsternannten Kämpfer gegen den »Bolschewismus« widmet sich Anne Hultsch aus einer osteuropäischen Perspektive. Sie beleuchtet die überraschend intensive Rezeption von Veröffentlichungen und Predigten Kardinal Faulhabers in der tschechischen Publizistik der Zwischenkriegszeit. Im Zentrum steht dabei seine Predigt gegen den »Bolschewismus« von 1930, die in der Tschechoslowakei als moralischer Aufruf und im Rahmen einer breiteren religiösen Protestbewegung rezipiert wurde. Inmitten von Stalins Kirchenverfolgung in der Sowjetunion 1929/30 wurden Faulhaber und sein radikaler Antikommunismus dort als Rettungsanker wahrgenommen. Klaus Unterburger bündelt in seinem Kommentar geschickt die beiden Beiträge. Faulhabers Autoritätsverständnis und sein Antibolschewismus seien dem Autor zufolge nichts anderes als zwei Seiten einer einzigen Medaille gewesen – schließlich sei der »Bolschewismus« für den Münchener Kardinal die Pervertierung der natürlichen Ordnung und damit der Untergrabung jeder Autorität gewesen.
Das vierte und letzte Themenfeld dieses Bandes beginnt mit einem Beitrag von Franziska Nicolay-Fischbach, der sich mit dem Frauenbild Faulhabers und mit dessen ganz praktischen Umgang mit Frauen beschäftigt. Sie konstatiert dabei anhand von Schriften und Predigten ein starres Ordnungsdenken, demzufolge Frauen in erster Linie zur Mutterschaft und zur Arbeit im Haushalt geboren waren. Im Umgang des Kardinals mit Frauen, den sie anhand von vier Gesprächspartnerinnen des Kardinals untersucht, sieht Nicolay-Fischbach hingegen eine durchaus flexible Haltung, die von der reinen Lehre abweichen konnte, und der sie sogar einen emanzipativen Charakter zubilligt. Daran anknüpfend kann Susanne Wanninger in ihrer Untersuchung von Diözesansynoden in Regensburg, Passau und München während der Weimarer Republik zeigen, wie schwer es der Geistlichkeit fiel, sich mit im Wandel befindenden Geschlechterrollen, Lebensentwürfen und einer damit einhergehenden, als »sittenlos« empfundenen Lebensführung umzugehen. Auch und gerade im ländlichen, altbayerischen Raum sah sich die Kirche mit diesen neuen »Problemen« konfrontiert, für die sie indes aber keine neuen Lösungen fand und nach Wanninger aufgrund der unverrückbaren katholischen Lehre auch nicht hätte finden können. Martina Steber greift in ihrem Kommentar diese beiden Beiträge auf und verdeutlicht, wie wichtig es ist, nicht nur nach der Bedeutung von Frauen im Denken und Handeln Faulhabers zu fragen, sondern viel stärker die Grundkategorie »Geschlecht« in künftige Untersuchungen miteinzubeziehen und damit Männlichkeit und Weiblichkeit gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Im Nachdenken über Geschlecht kristallisiere nämlich Faulhabers Ordnungsbegriff. Sie macht dabei auch deutlich, wie stark der Kardinal und die katholische Kirche mit ihrem Nachdenken über Geschlecht im Mainstream der Weimarer Republik verankert waren und ordnet deren Vorstellungen in einen breiteren Kontext ein. Steber kann dadurch klar zeigen, dass kirchliche Initiativen – ob nun in München, Regensburg oder Passau – keineswegs emanzipativen Ideen folgten, sondern der »Stabilisierung der tradierten Ordnung« in einer sich im Wandel befindenden Gesellschaft dienen sollten.
Andreas Wirsching fasst in seinem Nachwort schließlich die Ergebnisse der Beiträge konzise zusammen. Für Wirsching steht fest, dass für Faulhaber »das Gehäuse der Amtskirche, die seine Welt war, unübersteigbar« gewesen sei. Weil der Kardinal »[u]nverbrüchlich am Universalitätsanspruch des Katholizismus« festgehalten habe, sei er den »Zeitläufen« gegenüber nur aus seiner exklusiven katholischen Binnensicht begegnet. Das seien »die Bedingungen sowohl für seine Größe wie für seine Grenzen« gewesen. Zugleich verweist Wirsching auf die erheblichen Herausforderungen, die mit einer noch zu schreibenden Biografie des Münchener Erzbischofs verbunden sind. Die Herausgeber dieses Bandes hoffen dennoch, dass die darin versammelten Aufsätze nicht nur zur weiteren Beschäftigung mit dem Kardinal anregen, sondern Impulsgeber für eine Faulhaber-Biografie sind.
Danken möchten wir zu guter Letzt all jenen Menschen, die zum Gelingen des Faulhaber-Workshops, der wie viele andere Veranstaltungen des Editionsprojekts an der Katholischen Akademie Bayern stattfinden konnte, und des vorliegenden Sammelbandes beigetragen haben. Wir freuen uns sehr, dass aus den profunden Vorträgen und den lebendigen Diskussionen ein solch facettenreiches Buch entstanden ist. Ein großer Dank gebührt dem Münchener Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, der unserer Tagung nicht nur ein Grußwort beisteuerte, sondern die Faulhaber-Edition von Anfang an finanziell unterstützt hat und ihren Fortschritt mit großem Interesse verfolgt. Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München–Berlin, und Hubert Wolf, Direktor des Seminars für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Universität Münster, gilt als weitsichtiges und motivierendes Leitungsduo des Faulhaber-Projekts ein besonders herzlicher Dank. Ohne die enge Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Archiv München und Freising als Kooperationspartner hätte die digitale Edition der dort aufbewahrten Faulhaber-Tagebücher nie realisiert werden können. Für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken wir uns namentlich bei Johannes Merz, Guido Treffler und Peter Pfister. Besonders möchten wir alle ehemaligen und aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die vielen engagierten Studentischen und Wissenschaftlichen Hilfskräfte des Editionsprojekts dankend hervorheben, ohne deren jahrelange akribische (Transkriptions-)Arbeit diese herausragende Quelle niemals der Öffentlichkeit hätte zugänglich gemacht werden können. Ebenso danken wir allen Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats für ihre fachliche Expertise. Ein besonderer Dank gilt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ohne deren Förderung weder die Edition noch der vorliegende Band hätte realisiert werden können. Für die Aufnahme in die Reihe »Münchener Kirchenhistorische Studien« danken wir Franz Xaver Bischof und Klaus Unterburger als Reihenherausgeber. Für die sehr angenehme Betreuung der Publikation und auch für ihre Geduld danken wir herzlich Andrea Häuser vom Kohlhammer-Verlag. Ebenso herzlich danken wir Günther Opitz vom Institut für Zeitgeschichte in München für seine tatkräftige Unterstützung bei der Drucklegung und den beiden Aachener Hilfskräften Rasmus Wormstädt und Belinda Harth für ihre sehr sorgfältige Schlussredaktion des Manuskripts.
Münster, Aachen und München im April 2025
Matthias Daufratshofer, Moritz Fischer und Peer Oliver Volkmann
Grußwort zur Eröffnung der Tagung
Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising
Sehr geehrte Herren Professoren Wirsching und Wolf,
sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
ich möchte zunächst an ein Ereignis erinnern, das sich vor sechzig Jahren und knapp einem Monat in diesem Haus zugetragen hat: Am 17. September 1962, kurz bevor das neu erbaute Kardinal-Wendel-Haus offiziell eingeweiht wurde, tagten hier die konstituierenden Sitzungen des Wissenschaftlichen Vorstands und des Kuratoriums der »Kommission für Zeitgeschichte bei der Katholischen Akademie in Bayern«. Damit war die längere Gründungsgeschichte dieser Institution abgeschlossen, die seither eine zentrale Rolle bei der Erforschung des deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert spielt, wenn auch seit 1967 nicht mehr von München, sondern von Bonn aus.
Im Rahmen ihrer Publikationen sind auch nicht weniger als drei umfangreiche Bände mit ausgewählten »Akten Kardinal Michael von Faulhabers« erschienen – 1975, 1978 und 2002. Damals musste der Herausgeber des dritten Bandes, Professor Heinz Hürten, noch die »Geheimhaltung wichtiger oder für wichtig gehaltener Quellen« beklagen. Gemeint waren die sagenumwobenen Tagebücher des Kardinals. Das hat sich seitdem gründlich geändert. Das große Projekt der kritischen Edition der Tagebücher Kardinal Faulhabers steht mittlerweile kurz vor der letzten Phase einer insgesamt 12-jährigen Laufzeit. Und es wirft immer wieder neue Fragen auf. Manchmal sind es punktuelle Fragen, wann der Kardinal was getan und mit wem er worüber gesprochen hat. Darüber hinaus stellen sich aber auch größere Fragen nach der Haltung Faulhabers und seinem Agieren angesichts der Entwicklungen während seiner langen und bewegten Amtszeit. Ich freue mich, dass mit diesem Workshop erneut solche übergreifenden Themen wissenschaftlich erörtert und einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Denn für mich ist auch wichtig: Die Tagebücher sind nur ein – wenn auch bedeutender – Baustein, um das Wirken von Kardinal Faulhaber zu erforschen.
Es geht in vielfältigen Aspekten um das Verhältnis zwischen Kirche und Gesellschaft. Die Ergebnisse kann und will ich nicht vorwegnehmen. Ich freue mich vielmehr, wenn wir alle weiter dazulernen werden. Dass gerade diese Themen mich als ehemaligen Professor für Christliche Gesellschaftslehre besonders interessieren, werden Sie verstehen. In meiner Dissertation war das eine zentrale Fragestellung. Wenn auch unter grundlegend veränderten Umständen steht die Kirche ja heute wie in der Zeit von Kardinal Faulhaber immer wieder vor der Frage, wie sie sich zu Politik und Gesellschaft, zu den drängenden Fragen der Zeit positioniert und was das für sie selbst bedeutet. Man braucht nur einige Stichworte aus den Beiträgen der Tagung herauszugreifen, um ihre Aktualität zu erkennen: Umgang mit Schuld und Sühne, das Verhältnis zur Demokratie, die Frage nach Autorität und die Rolle der Frauen.
Ich habe das Zustandekommen des Tagebuch-Projekts von Anfang an befürwortet und unterstützt. Denn es war und ist mir ein Anliegen, mit den Tagebüchern Kardinal Faulhabers eine zentrale historische Quelle der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und so das Denken und Handeln dieses bedeutenden Erzbischofs besser kennen und verstehen zu lernen. Ich erinnere mich noch an den Pressetermin kurz vor Projektstart (vor fast genau neun Jahren, am 15. Oktober 2013), bei dem ich unter anderem gesagt habe: »Ich bin mir bewusst, dass bessere Kenntnis und besseres Verstehen nicht automatisch bedeutet, dass alle Handlungen Kardinal Faulhabers aus heutiger Sicht Zustimmung finden werden. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es notwendig ist, sich der ganzen Geschichte der Kirche zu stellen. Nichts, was in den Archivalien zutage treten könnte, kann der Kirche mehr schaden als der Verdacht, wir würden etwas verschweigen oder vertuschen wollen. Die historische Forschung ist also kein Gegner der Kirche, sondern ein unverzichtbarer Helfer beim Bemühen um die Wahrheit.«
Das gilt natürlich nicht nur für die Amtszeit von Kardinal Faulhaber! Das gilt auch für Themen, die in den letzten Jahren neu oder verstärkt ins Blickfeld gekommen sind und der historischen Erforschung bedürfen. Ich nenne den (sexuellen wie geistlichen) Missbrauch und das Schicksal von Heimkindern. Auch hier geht es zunächst darum, die archivischen »Hausaufgaben« zu machen, also Quellen zu sichern, für die Nutzung aufzubereiten und sie der historischen Forschung zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne hat eben (am 1. Oktober) ein Projekt des Archivs des Erzbistums begonnen, die Überlieferung der sehr vielfältigen kirchlichen Kinder- und Jugendfürsorgeeinrichtungen zu erfassen.
Um zu Kardinal Faulhaber zurückzukehren: Es ist mir ein Anliegen, dass nicht nur seine Tagebücher vorbildlich ediert der Forschung weltweit online zur Verfügung stehen. Es gibt daneben ja noch die umfangreiche Aktenüberlieferung des Kardinals, nicht weniger als 130 laufende Meter in den Archivregalen. Diesen gewaltigen Dokumentenbestand hat mein Vorgänger Erzbischof Friedrich Kardinal Wetter schon im Jahr 2002 vollständig für die Forschung geöffnet. Er wurde im selben Jahr auch (in Kooperation mit dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv und dem Stadtarchiv München) in einer großen Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Natürlich sind auch diese Akten längst digitalisiert. Da sich darin aber in großem Umfang Material befindet, dessen Nutzung noch urheber- und persönlichkeitsrechtlichen Beschränkungen unterliegt, können die Digitalisate nicht einfach online gestellt werden. Deshalb muss man bisher zur Nutzung immer noch in den Lesesaal des Archivs kommen. Das wollen wir so bald wie möglich ändern und für Wissenschaftler:innen einen abgesicherten digitalen Zugang von überall her schaffen. Als erster Schritt zumindest zu einer besseren Erschließung der Faulhaber-Akten steht seit heute ein deutlich detaillierteres Findbuch online; darin ist unter anderem die Arbeit des Projekt-Mitarbeiters Julius Kiendl eingeflossen, die insbesondere den stenographischen Materialien galt.
Und »mein« Erzbischöfliches Archiv arbeitet daran, für die Überlieferung aus der Amtszeit von Erzbischof Joseph Kardinal Wendel (1952–1960) und anschließend von Julius Kardinal Döpfner (1961–1976) dieselben Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen wie für die Akten von Kardinal Faulhaber. Es gibt also noch viel zu tun und zu forschen!
Was das Faulhaber-Tagebuch-Projekt betrifft, werde ich auch die Abschlussphase mit Interesse verfolgen und nach Kräften unterstützen. Bei allem Respekt für die Tagungen, die im Projektverlauf immer wieder in der Katholischen Akademie stattgefunden haben, wird man sagen müssen, dass der Ertrag auch mit Projektende noch nicht ausgeschöpft sein wird. Die Forschung wird auch hier weitergehen müssen. Und wenn ich mir etwas wünschen darf, ist es, dass dabei nicht allein die politischen Aspekte seines Wirkens im Mittelpunkt stehen, sondern dass auch die eher innerkirchliche Seite seines Wirkens und sein Selbstverständnis als Bischof und Seelsorger verstärkt in den Blick genommen werden.
Zunächst aber wünsche ich diesem Workshop einen guten Verlauf!
1»Sie spricht von ›Entwicklung‹, genau wie die Protestanten.«
Kardinal Faulhaber in den Umbrüchen seiner Zeit
Hubert Wolf
Katholikentag in München, August 1922. Am Ende stand ein Eklat. Voller Wut beschimpfte der Münchener Erzbischof Michael Kardinal von Faulhaber den Katholikentagspräsidenten und Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer (1876–1967) nach dessen Schlussrede: »Wenn Sie als Vertreter der deutschen Katholiken hier so reden, dann bedauere ich die deutschen Katholiken.« Adenauer entgegnete spöttisch: »Wenn diese Ihre Leute die deutschen Katholiken sind, dann bedaure ich den Heiligen Vater.«[14] Was war geschehen?
Eigentlich sollte dieser Katholikentag ganz unpolitisch und sehr versöhnlich werden. Doch dann machte Faulhaber gleich in seiner ersten Predigt deutlich, was er von der neuen Weimarer Republik und ihrer Verfassung hielt: Gar nichts. »Brüder, werdet stark im Herrn! Legt die Rüstung Gottes an am Tage der Bosheit!«,[15] zitierte er den Epheserbrief. Vor hunderttausend Menschen auf dem Münchener Königsplatz holte er zu einem Rundumschlag gegen die neue politische Ordnung aus: »Wehe dem Staate, der seine Rechtsordnung und Gesetzgebung nicht auf den Boden der Zehn Gebote Gottes stellt, der eine Verfassung schafft ohne den Namen Gottes, der die Rechte der Eltern in seinem Schulgesetz nicht anerkennt, der die Theaterseuche und die Kinoseuche nicht fernhält von seinem Volke, der durch neue Gesetze die Ehescheidung immer noch mehr erleichtert und die uneheliche Mutterschaft in Schutz nimmt.«[16]
Der Kardinal räumte zwar ein, dass der Umsturz der alten Ordnung dazu geführt habe, dass es jetzt ein paar Katholiken mehr in hohen Staatsämtern gebe. Doch er widersprach allen, die eine Brücke zwischen den katholischen Ordnungsvorstellungen und dem modernen Verfassungsstaat schlagen wollten. »Kompromisse sind unvermeidlich«, aber über ihnen
»stehen wie die ewigen Sterne die Grundsätze, und es kann eine Grenze kommen, wo es heißt: Bis hierher und nicht weiter! Die Revolution war Meineid und Hochverrat und bleibt in der Geschichte erheblich belastet und mit dem Kainsmal gezeichnet […] Ein sittlicher Charakter wertet nicht nach den Erfolgen, eine Untat darf der Erfolge wegen nicht heilig gesprochen werden.«[17]
Umfassender konnte Faulhaber die aus seiner Sicht modernistische Politik der Zentrumspartei, ihre Mitarbeit an der gottlosen Weimarer Reichsverfassung und das Zusammengehen mit den vom Papst als Häretiker verdammten Sozialisten und Liberalen in der sogenannten Weimarer Koalition kaum verurteilen. In Bayern hatte sich schon 1918 die verfassungskritische Bayerische Volkspartei vom Zentrum abgespalten. Und Reichskanzler Joseph Wirth (1879–1956), der dem linken Zentrumsflügel angehörte, nahm am Katholikentag erst gar nicht teil, weil er ein Attentat von rechten Katholiken befürchtete.
Faulhaber hielt während des Katholikentags in München insgesamt 23 Reden und Ansprachen und dominierte das Laientreffen mit seiner Ablehnung der Weimarer Reichsverfassung so ungeniert wie kaum ein gastgebender Bischof zuvor. Die geschilderten Vorgänge aus dem Umfeld des Katholikentags vor gut hundert Jahren führen mitten hinein in das Thema der Tagung »Katholizismus im Umbruch? Michael Kardinal von Faulhaber und die katholische ›Ordnung‹ in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts«. Im Mittelpunkt der dort gehaltenen und in diesem Band versammelten Beiträge steht der Wandel katholischer Ordnungsvorstellungen. Nach den zitierten Aussagen Faulhabers scheint das ein Widerspruch in sich zu sein: Eine Veränderung politischer, gesellschaftlicher und vor allem theologischer katholischer Konzeptionen, die auf dem Naturrecht und letztlich auf dem unwandelbaren göttlichen Recht beruhen, war für den Kardinal im Grunde ausgeschlossen.
Aber Faulhaber repräsentierte 1922 keineswegs die ganze Kirche: Adenauer und seine Mitstreiter standen für einen anderen Katholizismus, für den Geschichtlichkeit und Wandel von Kirche und kirchlichen Ordnungsvorstellungen durchaus möglich, und manchmal sogar geboten waren. Die Weimarer Verfassung sahen sie als legitim an, weil Katholiken von ihrem Glauben her eben nicht auf eine bestimmte Staatsform, nämlich die Monarchie, festgelegt seien, weshalb sie in dem aus der Revolution hervorgegangenen demokratischen Verfassungsstaat und der neuen gesellschaftlichen Ordnung durchaus mitarbeiten konnten, ja sogar von ihrem Gewissen her dazu verpflichtet waren.
Der Münsteraner Moraltheologe Joseph Mausbach (1861–1931), der an der Ausarbeitung der Weimarer Verfassung entscheidend beteiligt war und die Kirchenartikel, die der katholischen Kirche in Deutschland erstmals umfassende Autonomie gewährten, mitformuliert hatte, verteidigte die Verfassung daher entschieden gegen Faulhabers Vorwürfe: Gott habe die Entstehung und die Rechtsform der Einzelstaaten der »geschichtlichen Entwicklung und der freien Entschließung der Völker anheimgegeben«.[18] Auch habe das Lehramt der Kirche immer verschiedene Staatsformen zugelassen und eben nicht, wie Faulhaber behaupte, allein die Monarchie. Revolutionen als solche seien zwar nicht erlaubt, aber Papst Leo XIII. (1810–1903, reg. ab 1878) höchstpersönlich habe 1892, aus Gründen des Gemeinwohls und der öffentlichen Ruhe, die Katholiken Frankreichs aufgefordert, sich »mit voller Loyalität«[19] der aus Revolutionen entstandenen Republik anzuschließen. Man kann es Gott also auch Recht machen in einem modernen pluralistischen Verfassungsstaat.
In diesem Sinne plädierte auch Konrad Adenauer für ein Ja zu Weimar und seiner Verfassung und für die produktive politische Zusammenarbeit der Katholiken mit den Protestanten – in der Sprache Roms »den Häretikern« – aber auch mit erklärten Gegnern des Christentums wie Sozialisten und Liberalen. Nur dadurch könne man Vorurteile abbauen und Schlimmeres für die Kirche verhindern: Die Alternative zur Weimarer Reichsverfassung wäre eben nicht die Monarchie, sondern die kommunistische Räterepublik gewesen. Deshalb brachte er den moraltheologischen Grundsatz der Epikie in Anwendung, der den »Umständen« bei der Anwendung christlicher Normen eine entscheidende Rolle zusprach.[20] In seinem Schlusswort widersprach Adenauer dem Kardinal schließlich direkt: »Es sind hie und da Äußerungen gefallen, die man sich aus Verhältnissen örtlicher Natur erklären kann, hinter denen aber die Gesamtheit der deutschen Katholiken nicht steht.« Und weiter: »Es verrät Mangel an historischem Blick, die heutige Verfassung verantwortlich zu machen für die heutigen Zustände.« Er hoffe, dass Mausbachs »kristallklarer Vortrag« reinigend gewirkt habe. Wenn der Sturm Äste und Bäume breche, dann seien diese sowieso alt und morsch. Nötig sei jetzt die »kühle und klare Erkenntnis der Dinge und Möglichkeiten.«[21]
Die Stimmung im Saal war eisig, der sonst übliche Applaus blieb aus. Während der Rede rief der Gründer der Bayerischen Volkspartei Georg Heim (1865–1938): »Schmeißt den Kerl doch einfach raus!« Faulhaber wollte den Saal demonstrativ verlassen, fand jedoch seinen Hut nicht – Augenzeugen zufolge hatte ihn jemand bewusst versteckt. Das gab Adenauer die Chance, schnell zum Schluss zu kommen und den Erzbischof um den Schlusssegen zu bitten, den dieser nicht verweigern konnte und wutschnaubend erteilen musste.
Nicht nur aufgrund der engen persönlichen Beziehung Eugenio Pacellis (1876–1958) zu Michael von Faulhaber wäre zu erwarten gewesen, dass der Apostolische Nuntius in Deutschland den Heiligen Stuhl über diesen heftigen Dissens innerhalb des deutschen Katholizismus über die Weimarer Reichsverfassung umgehend und ausführlich informierte und dabei eine Position bezog, die eindeutig der von Faulhaber vertretenen lehramtlichen Staatsrechtslehre folgte. Dieser favorisierte nach wie vor eindeutig das monarchische Konzept, obwohl er seit Leo XIII. zur Not auch andere Staatsformen akzeptierte, sofern sie irgendwie transzendental begründet wurden.[22] Das war aber bei der Weimarer Reichsverfassung dezidiert nicht der Fall. Hier galten vielmehr die Grundsätze: Volkssouveränität statt Verantwortung vor Gott – es somit Menschen recht machen, statt Gott recht machen. Pacelli hatte die Reden Faulhabers und Adenauers selbst gehört, einen Bericht des Nuntius nach Rom über den Münchener Katholikentag sucht man jedoch vergebens.[23] Überraschenderweise teilte der Nuntius die Position Faulhabers in dieser wichtigen ordnungspolitischen Frage nicht, so dass hier eine dritte katholische Position vorlag, die pragmatisch zwischen der Theorie einer Ordnung und ihrer praktischen Anwendung unterschied.
Aber auch ohne einen ausführlichen Bericht Pacellis war der Vatikan über die Rede Faulhabers informiert. Die vatikanische Tageszeitung »Osservatore Romano« hatte nämlich die Auftaktrede Faulhabers in italienischer Übersetzung auf ihrer Titelseite abgedruckt.[24] Die kritischen Äußerungen Adenauers zum Schluss des Katholikentages überging man jedoch.[25]
Papst Pius XI. (1857–1939, reg. ab 1922) las offensichtlich seinen »Osservatore Romano« genau, denn am 11. September 1922 ließ er den Substituten im Staatssekretariat, Giuseppe Pizzardo (1877–1970), an Pacelli schreiben, damit dieser Faulhaber »Seine Zufriedenheit und Seine väterliche Genugtuung für die ausgezeichnete Rede« mitteilen möge. »Seine Heiligkeit hat sie in Gänze gelesen und hat nicht nur die rednerische Schönheit, sondern besonders die Weisheit, den Eifer, die Umsichtigkeit und auch die Kraft bewundert, mit der Seine Eminenz die sehr schwerwiegenden Themen behandelt hat.«[26] Damit stellte sich der Papst ausdrücklich auf die Seite Faulhabers und seiner grundsätzlichen Ablehnung der neuen politischen und gesellschaftlichen Ordnung in Deutschland.
Pacelli hielt sich seinen römischen Vorgesetzten gegenüber aber weiter bedeckt und führte lediglich den Auftrag von Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri (1852–1934) aus, indem er Faulhaber nach dem genauen Wortlaut der »unvergessliche[n] Rede Euerer Eminenz auf dem hiesigen Katholikentag«[27] fragte und nach Erhalt den Text kommentarlos nach Rom übersandte. Er schwenkte aber überraschenderweise nicht auf den Kurs Faulhabers, Pius’ XI. und der katholischen Staatsrechtslehre ein.
Und das verlangte von einem Nuntius ein gehöriges Maß an Standing.[28] Pacelli war in dieser Frage kein »Falke« wie Faulhaber, natürlich auch kein »Liberaler« wie Adenauer und Mausbach, sondern ein gemäßigter Pragmatiker. Die Mitarbeit des Zentrums an der Weimarer Reichsverfassung nannte er sogar ausdrücklich eine »reife Entscheidung«, die angesichts der Gefahren, die Deutschland drohten, absolut notwendig gewesen sei.[29] Bereits in einem Schreiben vom 15. März 1919 an Gasparri hatte Pacelli verdeutlicht, wie er gedachte, die Spannung zwischen den normativen lehramtlichen Vorgaben aus Rom im Hinblick auf katholische Ordnungsvorstellungen und dem politisch Möglichen zu bearbeiten: Ein Großteil des Zentrums favorisiere das lehramtlich bevorzugte Konzept der Monarchie als idealer Staatsform. Aber eine genaue Analyse der Umstände zeige eindeutig, dass »eine Wiederherstellung der Monarchie« in Deutschland »absolut unmöglich« sei. Deshalb bleibe dem Zentrum nichts anderes übrig, als sich an der Regierung der Republik zu beteiligen, um das Feld nicht den Linken zu überlassen, die als notorische Kirchenfeinde bekannt seien.[30]
Im Oktober 1919 war Pacelli noch einmal auf das Problem der Weimarer Reichsverfassung zu sprechen gekommen. Diese war für ihn »eine Verfassung, die in der Theorie [in teoria] nicht gut ist, aber den deutschen Katholiken in der Praxis [in pratica] heute zumindest eine größere Freiheit als unter dem vergangenen Regime ermöglicht«.[31] Denn genau diese Autonomiegarantie für die Kirche war die entscheidende Grundlage für die Konkordatspolitik Pacellis, mit der er das römische Kirchenrecht des 1917 erlassenen »Codex Iuris Canonici« endlich auch in Deutschland umsetzen wollte.
All die Pragmatik Pacellis im Umgang mit der Weimarer Reichsverfassung und den Parteien, die diese Verfassung verabschiedet hatten, konnte aber nicht über das Grundproblem hinwegtäuschen: Die Verfassung und ihre Ordnungsvorstellung war aus der Sicht des kirchlichen Lehramts und seiner Staatsrechtstheorie nicht akzeptabel. Genau gesehen gab es sie gar nicht, weil sie auf der Volkssouveränität beruhte und keinen Gottesbezug hatte. »Das Deutsche Volk, einig in seinen Stämmen […] hat sich diese Verfassung gegeben,« heißt es in der Präambel. Von einer »Verantwortung vor Gott«, wie später in der Präambel des Bonner Grundgesetzes stehen sollte, war hier dezidiert nicht die Rede.
Vor dieses Problem sahen sich auch die deutschen Bischöfe gestellt. In einem Protestschreiben an Reichspräsident Friedrich Ebert (1871–1925) vom 27. Oktober 1919 hatten diese sich gegen die Bestimmungen der Weimarer Verfassung verwahrt, die »einen Eingriff in die unveräußerlichen Rechte der Kirche bedeuten«, die »durch Jesus Christus auf göttlicher Einsetzung beruht und deren Rechten keine weltliche Gesetzgebung Grenzen und Schranken zu setzen befugt ist«.[32] Ein besonderes Problem stellte der von allen katholischen Beamten und Abgeordneten verlangte Eid auf die Weimarer Verfassung dar. Wegen der genannten Eingriffe in die »unveräußerlichen Rechte der Kirche« und des fehlenden Gottesbezuges könnten diese – so schrieben die Bischöfe an Ebert – »den Verfassungseid nur insoweit schwören, als sie hierdurch zu nichts verpflichtet werden, was einem göttlichen oder kirchlichen Gesetze und damit ihrem Gewissen widerstreitet«.[33]
Genau diese Spannung zwischen an sich unwandelbaren katholischen Ordo-Konzepten und dem faktischen Wandel der Welt, die in diesem Rahmen nur angedeutet werden konnte, wird im vorliegenden Band in Themenfeldern bearbeitet, und zwar jeweils ausgehend von der Position Faulhabers, wie er sie in seinen Predigten, Publikationen und insbesondere Tagebüchern und den dazugehörigen Beiblättern formuliert hat. In einem zweiten Schritt wird dann Faulhabers Position mit anderen katholischen Konzepten verglichen und so in einen größeren kirchlichen Kontext gestellt. Vier Themenfelder stehen im Fokus, die zugleich die Gliederung für den vorliegenden Sammelband bilden: Erstens wird nach dem Verhältnis Faulhabers und der katholischen Kirche zur Demokratie anhand der für den Katholizismus zentralen Denkkategorien Ordnung und Hierarchie gefragt. Zweitens geht es unter der Leitfrage »Neuordnung des Gewissens?« um den Umgang der katholischen Kirche mit Schuld und Sühne nach dem Zweiten Weltkrieg sowie einer möglichen Veränderung ihres Verhaltens. Drittens werden unter dem Schlagwort »Christliche Weltanschauung im Wandel« Positionierungsversuche des Katholizismus in der Auseinandersetzung mit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, insbesondere Kommunismus und Nationalsozialismus untersucht, um das theologische Fundament der Ordnungsvorstellungen offenzulegen. Und viertens werden Geschlechterordnungen im Katholizismus in den Blick genommen sowie nach Geschlechterverhältnissen im Spannungsfeld von Amtskirche und Milieu und dem Einfluss von Frauennetzwerken gefragt.
Bei all diesen Themenfeldern prallen zwei im Grunde nicht versöhnbare Wissens- und Fachkulturen aufeinander. Tatsächlich vollzog sich während Faulhabers Lebens- und Amtszeit ohne Zweifel ein enormer gesellschaftlicher, politischer und auch theologischer Wandel. Zugleich inszenierte sich die katholische Kirche mitten in diesen Umbrüchen als Hort der Unveränderlichkeit und Institution von Ewigkeitswert: »Panta rhei«, alles fließt, alles ist einer stetigen Veränderung unterworfen, Natur und Kultur, Mensch und Welt, Reiche und Fürsten, philosophische Denksysteme und Glaubensüberzeugungen vergehen, aber die römisch-katholische Kirche bleibt ewig bestehen. Nach der gängigen neuscholastischen Ekklesiologie wurde die Kirche von Jesus Christus, dem Herrn selbst, so gegründet, wie sie heute noch ist. Ihre Lehre, Ämter und Institutionen seien – wie die ultramontane Dogmatik und Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts nicht müde wurde zu betonen – »ihrer Natur nach unveränderlich« und müssten daher auf immer und ewig genauso bleiben, wie der Herr selbst sie eingesetzt hat. Jede Änderung in Lehre und Verfassung wäre ein Sakrileg, eine Missachtung der göttlichen Gründungsurkunde der Kirche.[34] Durch dieses ekklesiologische Konzept wurde der Versuch unternommen, die katholische Kirche im wahrsten Sinne des Wortes zu entzeitlichen, sie also aus den innerweltlichen Entwicklungsprozessen herauszunehmen und auf ewig zu stellen. Eine Veränderung ihrer Grundprinzipien oder Reformen der Kirche selbst sollten dadurch von vorneherein für prinzipiell unmöglich erklärt werden, weil in der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche eben alles immer schon so war, wie es heute noch ist.[35]
Alle Priester und Professoren der katholischen Theologie mussten deshalb von 1910 bis 1967 im sogenannten Antimodernisteneid die Kirchenstiftung durch Jesus Christus mit deutlichen Worten beschwören:
»Ebenso glaube ich mit festem Glauben, dass die Kirche, die Hüterin und Lehrerin des geoffenbarten Wortes, durch den wahren und geschichtlichen Christus selbst, als er bei uns lebte, unmittelbar und direkt eingesetzt und dass sie auf Petrus, den Fürsten der apostolischen Hierarchie, und seine Nachfolger in Ewigkeit erbaut wurde.«[36]
Und »einfache« Gläubige besangen von den Zeiten des Kulturkampfs in den 1880er Jahren bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein voller Inbrunst die Ewigkeit und Unveränderlichkeit ihrer Kirche in den Stürmen der Moderne: »Ein Haus voll Glorie schauet, weit über alle Land’, aus ewʼgem Stein erbauet, von Gottes Meisterhand. Gott wir loben dich, Gott wir preisen dich. O lass im Hause dein, uns all geborgen sein!« Während draußen alles drunter und drüber geht, die teuflischen Mächte der Moderne die Menschen in den Abgrund ziehen, kann den Frommen in der festen, aus ewigem, unvergänglichem Material errichteten Kirchenburg nichts geschehen: »Wohl tobet um die Mauern, der Sturm in wilder Wut, das Haus wird’s überdauern, auf festem Grund es ruht.«[37]
Bei der Frage nach dem Wandel katholischer Ordnungsvorstellungen treffen auch zwei letztlich nicht kompatible Fachkulturen aufeinander, die historische und die dogmatische. Geschichte lebt vom Entwicklungsgedanken, Dogmatik dagegen von Ewigkeitswerten und unveränderlichen geoffenbarten göttlichen Wahrheiten.[38] Wie aber kann sich Ewiges entwickeln? Treffend hielt Faulhaber in einer Notiz über ein Gespräch vom 9. Januar 1922 mit Margarethe Adam (1885–1946), die für die Priesterweihe von Frauen eintrat, fest: »Sie spricht von ›Entwicklung‹, genau wie die Protestanten.«[39]
Die Ablehnung des Entwicklungsgedankens durch den Kardinal gilt in grundsätzlicherer Weise, wie die Aufzeichnungen über seine Begegnung mit Adolf Hitler (1889–1945) auf dem Obersalzberg am 4. November 1936 beispielhaft belegen:
»Herr Reichskanzler haben von ›dem ewigen Wandel‹ in der Kirche gesprochen. Die Dogmen der Kirche haben sich nicht gewandelt […] Sie sind als das Oberhaupt des Deutschen Reiches für uns die gottgesetzte Autorität, die rechtmässige Obrigkeit, der wir im Gewissen Ehrfurcht und Gehorsam schulden. […] Ich glaube, dass der Autoritätsgedanke in keiner Religionsgesellschaft so stark betont wird wie in der katholischen Kirche. Wenn freilich Ihre Behörden oder Gesetze gegen Dogma oder gegen das Sittengesetz, also gegen unser Gewissen verstossen, müssen wir das als die verantwortlichen Verkünder des Sittengesetzes aussprechen dürfen.«[40]
Mit Sittengesetz ist ein entscheidendes Stichwort für die Unveränderbarkeit katholischer Ordnungsvorstellungen gefallen, denn für Faulhaber ist Sittengesetz ein Synonym für Naturrecht und göttliches Recht und deren ewigen Geltungsanspruch.[41] In seinem Fastenhirtenbrief von 1934 ging er sogar so weit, die Lehre der Kirche als »Ausführungsbestimmungen«[42] des göttlichen Gesetzes und die von Gott eingesetzten Bischöfe als authentische Interpreten dieser ewigen Wahrheit zu bestimmen: »Sittlich ist, was dem Willen und den Geboten Gottes entspricht. Das wird auf die Dauer immer auch dem Wohle des Volkes dienen. Eine neue sittliche Ordnung aber, die mit den Geboten Gottes im Widerspruch stünde, würde Unordnung schaffen und dem Wohle des Volkes nicht dienen.«[43] Ewige Ordnung im Wandel der Zeit – ein wahrlich herausforderndes Thema, gerade im Hinblick auf Michael Kardinal von Faulhaber.





























